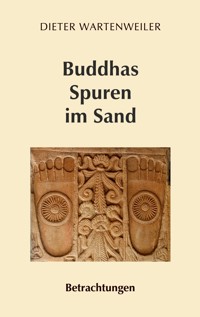Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein kleines Steinhaus wird für den neuen Bewohner Micha zum Ort der Einkehr. Über Fragen nach dem Wesen von Beziehungen, der Liebe und des Lebens tauscht er sich mit weisen Menschen aus, und durch seine grosse innere Präsenz wirkt er auf andere. Während sich ihm viele Ereignisse in neuer Sicht als traumhaft erweisen, überwindet sein offenes Herz alles Persönliche und reicht in die Unfassbarkeit des Lebens. Niemand kann es beschreiben, doch gerade darin liegt wahres Erkennen und Wissen. Eine tiefgründige Erzählung von eindringlicher Kraft
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 195
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dass ein kleines Steinhaus zum Mittelpunkt einer großen weiten Welt werden könnte, hätte ich mir nie gedacht. Der Grund dafür lag nicht in der weiten Landschaft, die es umgab, sondern vielmehr in den Menschen, die in dieser Gegend lebten. Zweimal war ich im Gästehaus eines ‚alten Weisen‘ namens Jeduschin einquartiert gewesen, der sich selber aber niemals als weise bezeichnet hätte. Er war ein unauffälliger Mann, dessen schon fortgeschrittenes Alter sich nur durch die grauen und teilweise weißen Haare verriet. Seine gütigen Augen strahlten eine große Kraft aus, was ihn menschlich nah und zugleich sehr vergeistigt wirken ließ. Dennoch konnte er im Kontakt mit Menschen durchaus direkt sein, aber er war nie verletzend. Stets ging es ihm um deren Wohl, wofür er sie aber herauszufordern verstand. Allem Konventionellen und insbesondere jedem oberflächlichen Gespräch war er dagegen abgeneigt, und er schwieg lieber, als sich in philosophischen Gedankengängen zu verlieren.
Jeduschin hatte mich nun sehr geprägt. Lange hatte ich eine innere Sehnsucht in mir getragen, die von einer ausgedehnten Suche begleitet war, und als ich diese schließlich wegen Erfolglosigkeit aufgegeben hatte, war ich ihm begegnet. Stets hatte ich geglaubt, etwas finden zu müssen, aber bei Jeduschin war mir klar geworden, dass es vielmehr darum ging, etwas zu verlieren – all das, was mich prägte, und was ich über mich und die Welt dachte. Nur ohne diesen geistigen Ballast war es möglich, zu sehen, dass es gar nichts zu suchen gab, da alles schon da war. Es verhielt sich damit wie mit dem Leben ganz allgemein: solange wir es gestalten wollen, ist nicht sichtbar, was es seinem Wesen nach ist. Das heißt wiederum nun nicht, dass jeder, der nichts tut, zu tiefer Erkenntnis gelangen würde. Es bedarf auch eines inneren Antriebs, der aber auf nichts Bestimmtes gerichtet ist, denn sobald man sich vorstellt, was zu gewinnen wäre, ist es nicht mehr das, worum es geht. Das Neue kann nur eine Überraschung sein, etwas ganz anderes als man meint, denn sonst wäre es nur eine Bestätigung des Gedachten und nicht etwas, das alle bisherigen Auffassungen sprengt. Dazu hatte mir Jeduschin verholfen.
Im Verlauf meiner Aufenthalte bei ihm war ich verschiedenen Menschen begegnet, die wie er von offenem Wesen waren. Dazu gehörte Esmeralda, welche mich bei meinem ersten Aufenthalt in einer forschen Art sehr herausforderte, und zu der ich später ein inniges Verhältnis entwickelte. Vor allem aber berührte mich Barbara, eine Frau meines Alters, die mit Mann und Kind auf einem Bauernhof in der weiteren Umgebung lebte. Bei unserer ersten Begegnung vor vielen Jahren hatten wir uns gleich sehr verbunden gefühlt, und ich hatte gespürt, dass auch sie zu den geistig offenen Menschen gehörte. Weil sie in der bäuerlichen Umgebung wenig Resonanz fand, war ihr Leben aber nicht einfach. Obwohl wir uns zwischenzeitlich viele Jahre nicht mehr gesehen hatten, war die Verbindung geblieben – das realisierten wir, als wir uns nach Jahren wieder trafen.
Mit Barbara hing nun auch das kleine Steinhaus zusammen, das mir zugefallen war. Es lag eine gute Wegstunde zu Fuß von ihrem Bauernhof entfernt und gehörte Andro, dem Bruder des verstorbenen Hausherrn. Durch Zufall war ich auf einem meiner Wege im Wald an diesem Haus vorbeigekommen, das mit seinen naturbelassenen Außenwänden nur aus der Nähe zu sehen war. Es hatte wohl einmal auf einer Waldlichtung gestanden, doch nun verdeckten es viele junge Bäume. Das kleine Steinhaus hatte eine unerwartete Wirkung auf mich, und obwohl ich noch nie da gewesen war, fühlte ich mich an diesem Ort sogleich beheimatet. Barbara hatte mir nie davon erzählt, aber als ich ihr von der Entdeckung des Hauses und meinen Eindrücken berichtete, erklärte sie mir, dass Andro lange in diesem Haus gewohnt hatte, und dass er es schließlich altershalber aufgeben musste und in den Bauernhof übersiedelt war. Weil mir das Haus so gefiel, brachte sie mich mit Andro zusammen.
Ursprünglich hatte ich die Idee gehabt, auch nach dem zweiten Besuch bei Jeduschin wieder in mein altes städtisches Leben mit all seinen Verpflichtungen zurückzukehren, aber dieser zweite Aufenthalt hatte mich so verändert, dass mir dies nicht mehr als wirkliche Lebensoption erschien. Und das kleine Steinhaus zeigte sich nun als Möglichkeit, in der Gegend zu bleiben und dort wohnhaft zu werden. Dieses Anliegen trug ich Andro vor, und er war durchaus davon angetan, das Haus nicht länger leerstehen zu lassen. So stellte er mir das Haus gerne gegen ein nicht sehr großes Entgelt als neue Wohnstätte zur Verfügung.
Natürlich musste das kleine Steinhaus vor meinem Einzug noch gereinigt werden, wenngleich es in einem baulich guten Zustand war. Da es über längere Zeit nicht mehr bewohnt gewesen war, hatte sich darin viel Staub angesammelt, doch die Wände waren sauber und gaben den Räumen mit ihrem hellen Putz einen wohnlich-leichten Charakter. Andro hatte bei seinem Umzug manche Möbel dagelassen, weshalb das Haus auch ohne größere Umstände gut bewohnbar war. Da ich anlässlich meiner bisherigen Aufenthalte in der Gegend schon manche Menschen kennen gelernt hatte, fanden sich einige, die mir gerne halfen, das Haus zu reinigen und es in einem guten Sinne bewohnbar zu machen. Aus einer Siedlung, die nicht weit unterhalb des kleinen Steinhauses lag, kamen Klara und Olga, die mich seinerzeit als Gast sehr freundlich in ihrem Haus aufgenommen hatten, und sie freuten sich sichtlich, dass ich in die Gegend zog. Sie brachten viel Putzmaterial mit, und vor allem auch zwei Neffen zur weiteren Hilfe. Es waren junge kräftige Männer, die sich Yesche und Jannik nannten. Klara stellte uns gegenseitig vor und nannte den Jungen meinen Namen Micha. Wir begrüßten uns herzlich, doch dass ich allein in einem kleinen Haus im Wald leben wollte, verwunderte die jungen Männer doch sehr. Das entsprach nicht ihrer Einschätzung eines erfüllten Lebens, und sie waren deshalb auch schon länger in der Stadt wohnhaft. So fragte mich Jannik auch gleich: „Warum willst du denn hier leben, in einem versteckten Waldhaus, wo du im besten Falle Rehe als Gesellen hast?“ Das war nun eine Thematik, die sich jungen Menschen nicht so einfach erklären ließ, aber ich versuchte es dennoch.
„Ach weißt du, ich war auch einmal so jung wie ihr jetzt, und da war ich ebenso voller unbändigen Lebens. Ich wusste dabei stets, was richtig war, aber später wusste ich es nicht mehr, und so suchte ich nach etwas, was ich als ‚wahr‘ hätte ansehen können. Anlässlich einer Wanderung stieß ich auf Jeduschin, den ihr vielleicht kennt, den alten Weisen bei der Kapelle. Und er hat mein Leben verändert.“ – „Und seither bist du nicht mehr voller unbändigen Lebens, wie du gesagt hast?“ fragte dann Yesche. – „Das wurde schon vorher anders, als ich meine Hörner abgestoßen hatte. Ich versuchte früher, auf andere Einfluss zu nehmen, und das ist nicht immer auf Gegenliebe gestoßen – gelinde gesagt.“ – „Sie haben dich niedergemacht?“ frage Jannik weiter. – „Nicht andere Menschen. Eher war es das Leben selbst mit all seinen Umständen und einigen Schicksalsschlägen. Als ich nicht mehr weiter wusste, ging ich auf die Suche.“ – „Was hast du denn gesucht?“, wollte Jannik wissen. Er schien mir als der ‚Lebenspraktischere‘ der beiden, und so war für ihn wohl jede Suche auf die Bewältigung äußerer Schwierigkeiten ausgerichtet. Darauf antwortete ich aber: „Es war wohl die Suche nach Frieden und einem erfüllten Leben.“ – „Das kann ich verstehen“, antwortete Jannik, „wenn du tun kannst, was dir behagt, wenn du genügend Geld verdienst und dich guter Beziehungen erfreust, dann ist das Leben erfüllt und du findest Frieden.“ So war es von mir her nun nicht gemeint, aber ich konnte seiner Einschätzung durchaus folgen. Und so antwortete ich: „Ich hatte all das, und doch war mein Leben nicht erfüllt. Es war eher angefüllt mit vielerlei Aktivitäten, und darin kann man sich auch leicht verlieren. Man fühlt sich dann möglicherweise ganz gut, und doch ist es im Tieferen nicht befriedigend. Mir schien es zeitweilig so, als würde ich auf einer Welle reiten. Das war sehr schön, aber jeder Wellenritt hört einmal auf, und manchmal weht kein Wind und es gibt keine Wellen.“ Jannik hörte mir etwas betreten zu, und er konnte wohl nicht ganz einordnen, wovon ich sprach. Da kam ihm Yesche zu Hilfe: „Ich glaube, Micha meint nicht die Wellen unten im Meer, die wir manchmal auch genießen, wenn wir bei Klara und Olga zu Besuch sind. Er meint wohl, dass wir uns nicht immer gut fühlen, auch wenn es ‚gut‘ läuft. Und vielleicht fand er in so einem Zustand zu Jeduschin.“ Jannik nickte, und ich wusste nicht, ob er nun verstand, oder ob ihm das Gespräch etwas unangenehm war, denn er war wohl eher ein Mensch der Tat.
So dachte ich, dass es nun an der Zeit wäre, mit den Reinigungsarbeiten zu beginnen, und ich dankte den beiden für ihre Bereitschaft, das Haus in einen guten Zustand zu versetzen. Sie machten sich auch gleich an die Arbeit. Jannik begann, den Fussboden in der Stube gründlich mit Wasser zu schrubben, und Yesche schaute in der Küche nach, was es hier zu tun gäbe. Olga verschwand derweil im oberen Stockwerk und machte sich mit der Fensterreinigung an die Arbeit, während sich Klara mit Besen und Lappen den Spinnweben widmete, welche von den fleißigen Tierchen in harter Arbeit an vielen Orten angebracht worden waren. Weil Yesche eher ratlos in der Küche stand, gesellte ich mich zu ihm und wir wuschen zusammen die Kästen und Regale aus. Yesche fragte dabei nochmals nach: „Und bei Jeduschin ist alles anders geworden?“ – „So war es“, antwortete ich, und ich fühlte, dass Yesche ein anderes Verständnis für die Situation hatte, als Jannik. So berichtete ich ihm auch etwas genauer: „Als ich Jeduschin das erste Mal getroffen hatte, beeindruckte er mich allein durch seine geistige Kraft, die in mir eine starke innere Bewegung ausgelöst hatte. Im Zuge der Begegnungen und Gespräche mit ihm gerieten schließlich alle meine Überzeugungen und meine bisherige Lebenshaltung ins Wanken, was mich zunächst sehr beunruhigte und mich später tiefgreifend veränderte. Solche Dinge geschehen aber eher, wenn man etwas älter ist, als ihr es jetzt seid. Zuerst muss man seine Lebenshaltung ja aufbauen, bevor man sie in ihrer Relativität erkennen kann. So entwickelt jeder Mensch seine Ansichten, doch mit der Zeit wird klar, dass diese weniger wichtig sind, als man zunächst glaubt. Kannst du das verstehen?“ Jannik bestätigte das, und es schein mir, als wüsste er mehr darüber als andere junge Menschen. – „Ja doch“, antwortete er, „und ich bin in meinen Lebensvorstellungen schon jetzt weniger sicher als andere. Und wie ging es weiter mit dir bei Jeduschin?“ – „Ich hatte manche innere Spannung, weil ich in zwei Welten gleichzeitig lebte – in einer äußeren und in einer inneren – und damit war ich nicht gut zurecht gekommen. Jeduschin hat mir aber gezeigt, dass diese ‚Welten‘ nicht voneinander verschieden sind, auch wenn sie so erscheinen.“ – „Ich habe eine Ahnung davon“, sagte Yesche dazu, während er an den Regalen weiterputzte. „Ich putze und fühle zugleich meine innere Befindlichkeit im Haus, und auch die Landschaft darum herum.“ – „Ja, so etwa ist es, und das Ganze ist unermesslich weit“, sagte ich dazu. „Es ist erstaunlich, dass du das in deinem Alter so wahrnehmen kannst.“ – „Ja“, antwortete Yesche, und er war zugleich etwas betrübt. „Viele können mich nicht verstehen. Auch Jannik nicht, und doch mag ich ihn sehr.“ Nach den Regalen und Kästen widmeten wir uns dem Schüttstein und dem Boden, denn beides rief auch nach Reinigung. „Irgendwie kann ich verstehen, dass du jetzt in diesem Haus leben möchtest“, sagte Yesche dann weiter zu mir, „auch wenn es für mich nicht das Richtige wäre.“ Dem konnte ich nur zustimmen, denn jede Lebenszeit hat ihre Formen, und junge Menschen brauchen den Austausch mehr als ältere.
Wir arbeiteten alle den ganzen Tag für die Hausreinigung, und abends erglänzte das Haus in wunderbarer Sauberkeit. Die Stimmung unter uns allen war gut, und gelegentlich sangen die Frauen zur Freude von uns. Alle verströmten eine gute Lebensenergie, und so fühlte ich mich in diesem Haus mit den anderen sehr gut aufgehoben, wenngleich ich später allein dort leben würde. Zum Abschluss saßen wir in der Küche zusammen, und wir genossen die belegten Brote und den Kuchen, die ich am Vortag bei Jeduschin vorbereitet hatte. Gerne wollte ich die hilfreichen Menschen bei späterer Gelegenheit etwas würdiger einladen, und doch fehlte an diesem Tag nichts. Alle waren zufrieden, und abends zogen sie wohlgelaunt, wenn auch müde von dannen. Die Jungen verabschiedete ich herzlich, und die Frauen nahm ich die Arme – dankbar für alles.
Wieder übernachtete ich in Jeduschins Gästehaus, und am nächsten Tag lieh er mir seinen Wagen mit dem zweirädrigen Traktor aus, der sein einziges Fahrzeug war. Damit fuhr ich ins nahe gelegene Dorf, das ich schon mehrmals besucht hatte, und kaufte Lebensmittel und Wäsche ein, um bald ganz ins Haus einziehen zu können. Ob ich irgendwann Gegenstände aus meinem früheren Stadtleben dazu nehmen würde, wusste ich noch nicht. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich kein Bedürfnis danach, aber es war nicht ausgeschlossen, dies später einmal zu tun. Nachdem ich das Notwendige beschafft und den kleinen Traktor mit dem Wagen wieder zu Jeduschin zurückgebracht hatte, verabschiedete ich mich innig von ihm. Er hatte in mir viel bewirkt, und mein Leben veränderte sich jetzt folgerichtig. Nun würde ein radikal inneres Leben seinen Anfang nehmen.
Zurück im Steinhaus öffnete ich an diesem warmen Abend die Fenster, und der laue Wind erfüllte die Räume. So war ich nun einfach da, ohne etwas zu beabsichtigen. Angekommen im Haus, und angekommen in der großen Weite und Leere, die sich auftat. Noch fühlte es sich erfüllt an – wunderbar diese Atmosphäre, und befreiend das reine Dasein, ohne irgendwelche Verpflichtungen erfüllen zu müssen. Es war ein schöner Zustand, und ich genoss ihn sehr, auch wenn ich wusste, dass er nicht von Dauer sein konnte. Hier würden mich neue Herausforderungen erwarten, und es wären nicht dieselben, denen ich bei Jeduschin begegnet war. Und auch dort war es nicht einfach gewesen. Nun aber genoss ich es einfach, hier zu sein. Den Balkontisch stellte ich auf die Veranda, und ich braute mir meinen ersten Kaffee. So saß ich draußen, wie ich es mir die ersten Male beim Haus vorgestellt und auch gewünscht hatte. Das war wunderbar, und ich fühlte, dass ich hier ganz ankommen könnte, im Haus und im Leben. Müde von aller Arbeit und dem Umzug bereitete ich daraufhin mein erstes Nachtlager vor, indem ich die neue Bettwäsche auflegte und das Kissen für einen ersten, hoffentlich guten Schlaf im Hause bezog und aufschüttelte.
In den folgenden Wochen lebte ich mich im Haus und in meiner neuen Situation ein. Sie war nicht unähnlich derjenigen Jeduschins, und es war eine größere Herausforderung als ich dachte. Meine Sachen von früher hatte ich bisher nicht geholt, denn ich wollte mich nicht mit Dingen belasten, die ihre Bedeutung verloren hatten. Zugleich bestand dadurch noch ein Faden zu meinem alten Leben, der mir eine Möglichkeit der Rückkehr gab. Faktisch war ich nun aber hier und hatte auszuhalten, was geschah. Und das war nicht wenig.
Wie ich hier nun allein lebte, war alles auf einen Nullpunkt zurückgedreht. Meine frühere Arbeit, die Beziehungen und meine alte Wohnsituation waren weit weg. Nichts von alledem hatte Bedeutung, und es trat ein Zustand von Leere ein, wie ich ihn bisher nicht kannte. Allein in abgeschiedener Umgebung war dies wohl unvermeidlich. Selbst das Haus, die Möbel und der umgebende Wald wurden von meinem Eindruck der Leere erfasst. Ich fühlte mich fast, als wäre ich auf dem Mond – als wäre meine Bindung an die Welt gekappt. Das äußere Leben erschien mir eher wie ein Spiel, das ich zwar in Ruhe betrachten konnte, woran ich aber nicht teilnahm. Es war mir, als sähe ich die Menschen um einen Tisch sitzen, worauf das Leben gespielt wurde, und als wären sie zugleich mehr als die Spieler, für die sie sich hielten. Und doch war es das normale Leben, das sich hier abspielte. Wenn darin gearbeitet wurde, so hatte dies aus der Distanz des Betrachters aber keine wirkliche Bedeutung, und auch die Beziehungen der Menschen untereinander hatten etwas Unwirkliches. Beziehungen konnten innerhalb dieses Spiels ja sehr wohl verlässlich sein, aber es gab sie eben nur dort. Wo die Bindung an die Welt verschwand, hatten sie nicht mehr den vorherigen Gehalt. Da war einfach der Betrachter, in dessen innerer Welt sich all das zeigte, was als gewöhnliches Leben erscheint. Und es zeigte sich auch, wie die Menschen sich stets mit etwas beschäftigten, nur um nicht zu spüren, dass sie sich mit ihrer Spielfigur identifizierten und nicht über den Tischrand hinaussahen. In diesem Spiel engagieren sich viele Menschen für ihre Ideale, andere ärgern sich über Situationen, die ihnen nicht passen, und auch das Polit-Theater gehört zu den Lebensinszenierungen. Solange sie sich mit ihren Aktivitäten identifizieren, fühlen sie sich in einer ‚realen Welt‘, aber ohne die Identifikation zeigt sich alles als Lebensspiel. In dieser Erfahrung war mir, als wäre etwas in mir gestorben – meine bisherige Lebensauffassung. Sich mit Dingen und Aufgaben zu beschäftigen schien mir geradezu leicht im Vergleich zu dieser Situation, wo es nichts zu tun gab und es auch nicht möglich war, etwas zu unternehmen, weil die Welt dazu fehlte. Auch hatte ich das Gefühl, nicht mehr am großen Weltgeschehen teilzuhaben.
Es gab nun aber eine andere Art von Dasein. Dieses war jedoch nicht wunderbar, wie ich es bei Jeduschin erlebt hatte, sondern ich empfand es einfach als ein Sein ohne Eigenschaften. Es war ein Dasein in einer großen Weite, womit sich auch ein Gefühl von Verlorenheit verband. Und aus diesem Zustand schien es kein Zurück zu geben. Ich würde in der großen Weite des Universums verbleiben, auch wenn die äußere Welt damit nicht verschwunden war. Sie hatte einfach an Bedeutung verloren; sie war gewissermaßen durchsichtig geworden. Sie war da, und zugleich war sie weit und groß und unermesslich. Es war ein Dasein ohne Identifikation mit gewissen Aspekten der Welt oder mit Vorstellungen und Selbstbildern. Und es gab keinen Weg mehr in eine Welt der Identifikationen. Sie hatten sich als Illusion erwiesen, und Illusionen lassen sich nicht wieder herstellen, wenn sie einmal durchschaut sind.
Wenngleich ich eine große Offenheit empfand, war mein Zustand zumindest in dieser Phase doch nicht erstrebenswert. Selbst wenn weise Menschen darauf hinweisen, dass wir viel mehr seien als die kleine Person, als die wir uns üblicherweise wahrnehmen, so sprechen doch die wenigsten davon, dass die Person ihre eigene Auflösung erleidet. Und auch nicht davon, dass die große Weite ohne Qualitäten ist. Darin mag es keine Sorge mehr geben, aber auch nicht mehr die Freude, die sich an den Ereignissen der Welt orientiert. Deshalb sprechen manche auch davon, dass es nach einer solchen Erfahrung notwendig sei, wieder in die gewöhnliche Welt zurückzukehren. Das mag zwar geschehen, aber bei einer tiefgreifenden Veränderung ist es nicht mehr die Person, die zurückkehrt. Nicht nur ist es nicht mehr die gleiche Person, die zurückkehrt, sondern überhaupt keine Person mehr. Und damit ist es auch keine wirkliche Rückkehr mehr. Vielmehr ist es ein Dasein in der Welt, worin alles relativiert und zugleich ausgeweitet ist. Und darin bewegt sich keine Person, sondern die Weite gestaltet sich in Erscheinungen, und all das wird gesehen. Es wird aber nicht von ‚jemandem‘ wahrgenommen, denn Welt und Sehen fallen in eins zusammen. So ließe sich im besten Fall sagen, dass nur ein Teil von einem selbst in die Welt zurückkehrt – respektive diese gar nie verlassen hat – während der andere in der neu erkannten großen Weite verbleibt. Damit die seit je bestehende Weite aller Welt und allen Menschseins erkannt werden kann, muss die allen Erscheinungen inneliegende Formlosigkeit allerdings erfahren werden. Und dabei geht es nicht um eine punktuelle Erfahrung von ‚Leere‘, die wieder abklingt, und die – wie manche sagen – ins eigene Leben integriert werden müsse. Vielmehr ist es eine Leere, die immer besteht. Sie macht das Wesen unserer Welt aus und bildet zugleich ihren Grund – den ‚Urgrund‘, wie ihn einige nennen. Dieser ist ‚leer‘ im Sinne einer formlosen, unfassbaren und unergründlichen Weite, und er muss ausgehalten werden. Das erschien mir nun schwerer als ich es vermutet hatte, bevor ich in meine eigene Klause gekommen war, und wohl hatte auch Jeduschin dies ausgehalten, als er nach dem Tod seines Meisters allein im Anwesen zurückgeblieben war.
Leere kann nicht beschrieben werden. In gewisser Weise ist aber erfahrbar, dass da ‚nichts ist‘, dass es nicht wirklich etwas anzustreben gibt, und dass darin auch keine Bindungen bestehen. Wenn sich im eigenen Innern damit manches auflöst, so ist das etwas ganz anderes, als wenn über die Leere philosophiert wird. In letzter Konsequenz ist gar keiner mehr da, der von sich sagen könnte, dass er etwas erfahren hätte. Da ist einfach nur noch reines Sein. So wurde ich beim ersten Aufenthalt im kleinen Steinhaus mit dem konfrontiert, was nichts ist. Auch Jeduschin hatte schon darüber gesprochen, und viele alte Meister berichteten davon. Sie sprachen aber anders darüber als gewisse Nachfolger, welche das ‚Lehren der Leere‘ als Berufung ansahen, ja sogar einen Beruf daraus machten. Berufung ist aber nur eine Fantasie, denn in der Leere wird nichts berufen und da ist auch niemand, der zu etwas berufen sein könnte.
Während ich meine Zeit in einem Zustand von Leere und Weite verbrachte, klopfte es eines Tages an die Haustür. Ich horchte verwundert auf und fühlte mich etwas in die äußere Welt zurückgeworfen. Als ich die Tür öffnete, stand da zu meinem Erstaunen Barbara. Wir hatten uns längere Zeit nicht mehr gesehen, weil ich im Bauernhof nichts einzukaufen hatte und es auch sonst keinen Anlass oder Zufall gab, der uns zusammengeführt hätte. Sie trug einen kleinen Rucksack mit sich, schaute mir keck in die Augen und sagte dann: „Ich wohne jetzt ein bisschen bei Dir und habe das Nötigste mitgebracht.“ Das verwunderte mich nun doch sehr, obwohl ich mich insgeheim auch über die Überraschung freute. Aber was sollte das ‚bei mir wohnen‘ bedeuten? Barbara präzisierte dann: „Andro hat mich geschickt. Er wollte, dass ich nach dem Haus sehe, ob alles in Ordnung sei, und auch nach dir, ob du dich wohlfühlst. Es war ihm ein Anliegen, dass es gut geht, und er hatte schon länger nicht mehr von dir gehört – weder direkt noch durch Berichte von anderen. So dachte er, die Initiative zu ergreifen, und da er nicht mehr selber den ganzen Weg hochgehen kann, hatte er mich angefragt, ob ich es tun würde.“
Noch immer war ich erstaunt, aber fürs Erste bat ich sie herein, und wir setzten uns in die Stube, die ich inzwischen auch etwas nach meinem persönlichen Stil eingerichtet hatte. Sie war einfach möbliert, mit einem hellen Sofa und zwei recht bequemen passenden Sesseln. An der Wand stand neu ein niedriges Gestell, das ich aus zwei breiten Holzbrettern und zwei kleinen Korpussen mit Schubladen zusammengezimmert hatte. Am Boden war ein ebenso heller Teppich ausgelegt, und auf den Sitzgelegenheiten lagen Kissen, welche die Farben der zwei Bilder aufnahmen, die ich an die breite Wand gegenüber den Fenstern gehängt hatte. Barbara war noch nie hier gewesen, seit ich eingezogen war, aber sie kannte das Haus aus ihren Kinder- und Jugendjahren, als Andro dort gelebt und sie ihn gelegentlich besucht hatte. „Bist du wirklich nur auf Andros Geheiß gekommen?“ fragte ich sie dann, „dafür hätte doch ein Tagesbesuch gereicht.“ Und ich setzte mich zu ihr hin, um sie doch sehr willkommen zu heißen – was immer die Gründe für ihr Kommen gewesen waren. „Vielleicht sprechen wir später einmal darüber“, bedeutete sie mir dann, „aber natürlich – ich wollte dich auch sehen.“