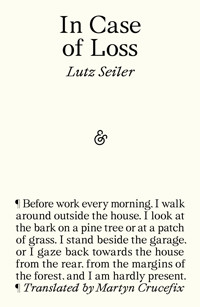10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Lutz Seilers preisgekrönte Erzählungen
Der Vater, der Angst hat, seine Tochter zu verlieren. Das Kind vor der Schule bei seinem ersten Kuss. Das Palaver des Stotterers, wenn er allein ist. Die Liebe zu einer Schachmeisterin, die plötzlich mehr als vorbei ist. Und immer geht es in diesen Geschichten auch um seltsame Apparaturen und ihr Geräusch: das bestialische Jaulen einer Handsirene, Nacht für Nacht, das leise Knistern eines Geigerzählers unter dem Pullover oder den Ton, den die Zeitwaage macht – eine kleine, unscheinbare Maschine, die in den Gang der Uhren und Schicksale lauscht.
All diese Erzählungen, für die Lutz Seiler mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis (für Turksib) und dem Deutschen Erzählerpreis ausgezeichnet wurde, beschreiben prägende Wendepunkte, das Groteske im Leben und unser häufig vergebliches Ringen um einen anderen Verlauf.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 329
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
»Einmal in der Woche bin ich bei Uhrmacher Walinski, um meine Armbanduhr auf die Zeitwaage zu legen. Seit ich entdeckt habe, tatsächlich ein Träumer zu sein (›ein verdammter Träumer‹, wie mein Vater es früher so oft sagte), bin ich vollkommen ruhig; ich bin ruhig und gelassen und tue nur noch, was ich will. Dinge, von denen ich weiß, daß sie gut für mich sind.«
Mit der Ruhe eines Seiltänzers bewegt sich dieser Träumer auch durch das Nachwende-Berlin. Unter den Dingen, die dabei in seinen Besitz geraten, ist eine einzigartige Uhr, in deren Ticken er die Geschichte hören kann, die ihm geschehen ist.
Neben der Zeitwaage geht es in Lutz Seilers preisgekrönten Geschichten um eine gespielte Erschießung, um einen Vater, der Angst hat seine Tochter zu verlieren, um das Palaver eines Stotterers, wenn er allein ist – und immer auch um seltsame Apparaturen und ihr Geräusch: das bestialische Jaulen einer Handsirene, Nacht für Nacht, das leise Knistern eines Geigerzählers unter dem Pullover oder den Ton, den die Zeitwaage macht – eine kleine, unscheinbare Maschine, die in den Gang der Uhren und Schicksale lauscht.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2015
Der vorliegende Text folgt der 1. Auflage der Ausgabe des suhrkamp taschenbuchs 4628
Suhrkamp Verlag Berlin
© Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 2009
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr.
Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
Satz: Satz-Offizin Hümmer GmbH, Waldbüttelbrunn
Umschlagabbildung: Hermann Michels und Regina Göllner
Der Kapuzenkuß
1 Hans und Margarete
Im Alter von neun Jahren hatte ich die Folgen meines ersten größeren Unfalls bestens überwunden, bis auf ein paar ruckartige Bewegungen gelegentlich und das Gefühl, mehr zu sehen und zu hören von der Welt als vorher. Die Narben auf meinem Kopf waren verheilt und die Haare nachgewachsen, aber noch im Dezember begleitete mich meine Mutter zur Schule, vorsichtshalber, wie sie sagte. Ohne das Tempo, mit dem wir ausschritten, zu verlangsamen, führte sie mich über den Ziegelweg, der leicht anstieg, durch einen schmalen, kümmerlichen Vorgarten bis an die Treppe zur Tür. Dann eilte sie selbst die drei Stufen voraus, drückte ungeduldig die Klinke herunter, obwohl sie wußte, daß das sinnlos war, und beschwor mich schließlich, auszuharren auf meinem Platz und dort solange zu warten. »Heute ist es sicher Frau Bakuski« oder »Heute morgen werdet ihr wohl Frau Janda haben« – irgend etwas veranlaßte meine Mutter zu diesen nervösen Prognosen, Janda oder Bakuski. Dabei wußte sie sowenig wie ich, wer an diesem Freitag aus der Tiefe des Gebäudes auftauchen würde, um die beiden Flügel der Haupttür zu entriegeln, nein, noch weniger als ich konnte sie etwas ahnen von den Schichtfolgen und Dienstplänen der zahlreichen Hortnerinnen, deren Aufgabe es war, uns vor und nach dem eigentlichen Unterricht, wenn nötig bis in den Abend hinein und unter dem erneuten Hereinbrechen der Dunkelheit, zu beaufsichtigen. In jedem Fall waren wir die ersten am Schulhaus, meine elegante Mutter mit ihrem weißen Knautschlackledermantel und dem hohen Dutt, einem Haarteil, das sie um ein bis zwei Köpfe größer machte, und ich mit Anorak und Pudelmütze.
Allein vor verschlossener Tür hatte ich mich schon oft gefragt, an welcher Stelle die Hortnerinnen selbst ins Innere der Schule gelangten. Ihre festungsähnliche Anlage war für mich nie ganz zu überblicken gewesen. Immer entzog sich ein Stück ihres Umrisses, mal war es ein unklarer Seitenflügel, von dem ich aus der bloßen Erinnerung nicht mehr hätte sagen können, an welcher Stelle er dem Haupthaus angewachsen war, dann fehlte mir wieder ein Bild vom Zusammenhang der verschiedenen Längs- und Querflure. Ich bewunderte jene Schüler, die schon nach kurzer Zeit über die Lage der Türen, die es nach allen Seiten hin gab, genauestens Bescheid wußten, und nicht selten beschlich mich der Verdacht, daß sich inzwischen alle um mich herum besser auskannten als ich. Schon oft hatte ich vorgehabt, mir bestimmte Treppen und Wege einzuprägen, doch sobald ich nur ein paar Schritte durch die überfüllten Flure getrottet war, wußte ich nichts mehr davon. Mit ihrem unsäglichen Hall verschlangen die Flure jeden gezielten Gedanken und verwandelten ihn in irgendeine Träumerei. Deshalb war es wichtig für mich, immer einen der guten, wissenden Schüler im Auge zu behalten. Ein Lehrer konnte erkranken, der sogenannte Vertretungsplan trat in Kraft, eine Hortnerin stürmte in den Raum und rief mit ihrer sich bereits überschlagenden Stimme »Zwonullsechs! Alles! Sofort! Zwonullsechs!« Im Eiltempo mußten wir dann unsere Sachen packen und »umziehen«, wie es hieß, womöglich auf eine andere Etage und alles noch innerhalb derselben Pause, deren letzte Minute meist gerade angebrochen war. Das löste in jedem Fall Hektik, manchmal fast eine Panik aus, in der die Klasse auseinanderriß – Zwonullsechs! Mir wurde schwarz vor Augen; ich hielt mich am Geländer, wobei ich doch ahnte, daß es nötig gewesen wäre, die Treppe gleich im Sprung zu nehmen. Bei jedem dieser Umzüge befürchtete ich, den Anschluß zu verlieren, endgültig abhanden zu kommen, verschollen in der Tiefe irgendeines Korridors, während in den Klassenzimmern der Unterricht längst wieder begonnen hatte und man sich hinter einer der vielen wie Rätsel verschlossenen Türen verwundert nach einem leeren Stuhl in der vorletzten Reihe umsah, einmal, zweimal, dann nicht mehr.
Meine Mutter umarmte mich. Obwohl ich doch wußte, was kam, hatte ich Mühe. Eine Weile stand ich fassungslos und lauschte (mit zurückgeschobener Mütze) dem Klopfgeräusch ihrer Absätze auf dem Pflaster, ein Geräusch, das ich auf meinen Narben spüren konnte, so klar und deutlich, als wäre mir dort infolge meines Unfalls ein zusätzliches Organ gewachsen … Unweigerlich wurde es leiser und leiser, plötzlich aber schien es nochmals näher zu kommen, was mich schon oft in falsche Hoffnungen gestürzt hatte. Am Ausgang der Straße änderten sich die Echoverhältnisse. Dort traf das Geräusch ihrer Schritte auf den ersten Wohnblock der Gebind, ein Neubaugebiet im Zentrum von L. mit sieben parallel angeordneten Blöcken und einigen anderen Blöcken, die sich im rechten Winkel zum Wald hin stuften, den Berg zur Charlottenburg hinauf, von der nicht mehr als ihr Name übriggeblieben war. So unklar sich der Schall bis dahin entwickelt haben konnte, abhängig von der Feuchte, der wechselnden Dichte der Luft, ihren kalten Strömungen, in denen sich auch die Reste des Nachtdunkels bewegten und mischten mit dem ersten Licht des Tages, so unerbittlich wurde jeder Laut an den hohen Mauern der Gebind aufgefangen und zurückgeworfen in die umliegenden Ortsteile. Die Schulstraße, auf der ich stand und, auf Zehenspitzen lauschend, den Schritten meiner Mutter nachhing, bildete einen dieser gepflasterten Kanäle, über die der Ort mit der Gebind und ihren Echos verbunden war.
Die einzigen, denen ich am Morgen begegnete, waren die beiden braunen Steinkinder über dem Eingang zur Schule. Eine Hortnerin hatte uns erzählt, bei den Kindern im Portal handele es sich um Hans und Margarethe, die früheren Hänsel und Gretel. Sie seien die Wappenkinder der Anstalt gewesen, für die man unsere Schule früher einmal gebaut habe, eine Schule mit Internat, in dem bevorzugt Waisen und Schwererziehbare aus ganz Thüringen Aufnahme gefunden hätten.
Im Portal befand sich ein großes ovales Fenster, an dessen Einfassung die beiden Steinkinder lehnten, links Margarethe, rechts Hans. Halb waren ihre Körper ins Gemäuer eingebunden. Hans hatte den linken Fuß auf einen Ball gesetzt und hielt ein Spielzeuggebäude in den Armen. Obwohl seine Hände die unteren Etagen des Gebäudes verdeckten, war schnell zu erkennen, daß es sich dabei um eine genaue Nachbildung unserer Schule handelte, die er mit einiger Anspannung betrachtete. Hans schien Großes vorzuhaben. Er hatte etwas Grobes, Grimmiges, was zu einer, wie ich annahm, anderen, lange vergangenen Zeit gehörte; sein Anblick bereitete mir Unbehagen.
Mit Margarethe war es anders. Sie hielt ein Buch in den Händen, über dessen Seiten sie knapp und unauffällig hinausschaute auf den Platz vor der Schultür. Um ihren Augen Tiefe zu geben, hatte man dort, wo ihre Pupillen liegen mußten, pfenniggroße Löcher eingestochen, aus denen sie mich unverwandt ansah. Starrte ich eine Weile zurück, bewegte sich etwas in ihrem Gesicht. Ihr Zopf war zu einer Schnecke gebunden, wie bei Frauen in alten Filmen. Anders als Hans stand sie barfuß im Portal. Sie trug ein knielanges Kleid, unter das man nicht sehen konnte, weil es mit Stein ausgefüllt war. Über ihrem linken Arm hing ein halbfertiger Schal, in die Armbeuge war ein Wollknäuel gepreßt, und wie ein Mikadospiel kreuzten sich zwischen den am Buchrücken verschränkten Händen einige Stricknadeln. Es schien, als wüßte Margarethe nicht, ob sie zuerst stricken oder lesen sollte, und deshalb schaute sie über ihr Buch hinaus auf den Vorplatz, ob es dort vielleicht jemanden gäbe, der bereit wäre, ihr bei dieser Entscheidung zu helfen. Ihre winzige Nase und ihre wie zu einem Kuß vorgewölbten Lippen erinnerten mich an Heike; Heike, die zweifellos noch schöner war als Margarethe und jedes andere Mädchen aus der Gebind.
Die Gebind – nie habe ich über dieses Wort nachgedacht, es war nur der Name unseres Viertels. Von den Einheimischen wurde sie die Atomsiedlung genannt. Alle Bewohner der Gebind stammten aus einem Dorf namens Culmitzsch, das man für den Uranbergbau geschleift hatte – ein Ort auf der Grenze zwischen Thüringen und Sachsen, wie mein Vater oft betonte, als wären wir auf dieser Linie besonderen Gefahren ausgesetzt gewesen.
2 Der Glöckner
An jedem Morgen nahm ich mir vor, meine Mutter nach der Uhrzeit zu fragen, vergaß es dann aber in letzter Sekunde, als hätte die Gravitation des riesigen Schulgebäudes meine Frage gelöscht. Nie wußte ich genau, wie früh wir eigentlich vor den Stufen zur Schultür anlangten und wieviel Zeit noch verblieb, bevor dernormale Tag beginnen würde. Auch das Läuten der Kirchturmuhr überwand selten die Gebind, oder es drang nur unvollständig, nur mit einzelnen, verzitternden Schlägen bis in die Talkerbe des Fuchsklamm – so hieß die Gegend, in der sich das Schulgelände, einige Häuser, Gärten und der Hof des letzten Bauern von L. drängten, obwohl dieser Name nirgendwo angeschrieben, auf keinem Schild und keiner Karte verzeichnet war. Die Leute sagten, auch sie wären im Fuchsklamm zur Schule gegangen, zu Zeiten, als an so etwas wie die Atomsiedlung noch nicht zu denken gewesen wäre … Ein feiner Schnee begann zu fallen und machte die Stufen zur Schultür unberührbar.
Ich hielt es nicht für angebracht, frühmorgens – fast war es ja noch Nacht, und der Tag dämmerte gerade herauf – der erste vor der Schule zu sein. Sicher hatte ich etwas vom Unbehagen meiner Mutter gespürt, die auf einen der zeitigen Schnellbusse nach Gera-Zwötzen angewiesen war, um zur vorgeschriebenen Stunde auf Arbeit zu erscheinen. Vor allem aber war es mir peinlich. Ein Schüler, der bereits vor der Zeit darauf wartete, in den Schulhort eingelassen zu werden, mußte in den Augen der Frühaufsicht einen bedauernswerten, irgendwie kläglichen Eindruck machen, woraus, soviel ahnte ich, nur Geringschätzung und Verachtung resultieren würden.
Es war nicht schwer, sich in der Nähe des Schulgebäudes zu verstecken. Ich brauchte nur einen Platz mit Aussicht auf das Schultor, wenigstens aber auf die Schulstraße. Obwohl ich schon wußte, daß es sich dabei nicht um einen wirklich brauchbaren Unterschlupf handelte, duckte ich mich zunächst in einen der wild wuchernden Büsche des Vorgartens. Mit dem Ranzen als Schild auf dem Rücken schob ich mich langsam rückwärts zwischen die Zweige und tauchte ein ins Geäst. Wie Daniel Boon roch ich am Holz und wischte mit der bloßen Hand ein wenig über den Boden. Im Laub unter der dünnen Schneeschicht lagen die Spuren meiner vergangenen einsamen Tagesanfänge, die ich wie fremde Spuren behandelte: frische, untrügliche Zeichen, daß ich auf diesem Planeten nicht vollkommen allein unterwegs war.
Durch die Büsche beobachtete ich das dumpf schimmernde Massiv des Schulgebäudes – aus einem der vergitterten Kellerschächte flackerte ein wenig Licht herauf, dort lag das Büro unseres neuen Hausmeisters. Stück für Stück grub ich mich bis an den Schacht heran und beugte meinen Kopf über das Gitter. Erkennen konnte ich nichts, aber ich spürte die Wärme im Gesicht und sog den betörenden Geruch der Verbrennung ein …
Der neue Hausmeister haßte Schüler, vor allem wegen ihres, wie er bei jeder Gelegenheit betonte, täglichen Zerstörungswerks an Stühlen und Bänken; aus heiterem Himmel tauchte er auf aus seinen Katakomben und forderte Ersatz für die Beschädigung von Volkseigentum. Mit seinen Wutausbrüchen hatte er ahnungslos vorübergehende Kinder oft bis ins Mark erschreckt und zu Tränen getrieben. Überhaupt schien es niemanden zu geben, der dem neuen Hausmeister hätte Paroli bieten können; ohne Frage war er der mächtigste Mann an unserer Schule. Meist trug er eine dünne, fast durchsichtige Kittelschürze aus braunem Dederon, in deren Brusttasche zwei schwere, silbern glänzende Vierfarb-Kugelschreiber steckten, die den Kittel auf eine Weise schräg nach unten zogen, daß sein ganzer Oberkörper auf den ersten Blick einen schief gewachsenen Eindruck machte; einige der größeren Kinder nannten ihn deshalb den Glöckner.
Vielleicht um seinen Haß auf diese Hottentotten, wie er uns in seinen Flüchen bezeichnete, besser zu verbergen, hatte der neue Hausmeister sich im Heizungskeller der Schule eine eigene, mit mehreren Schlössern und seltsamen Stahlhebeln verriegelte Werkstatt eingerichtet. An der Tür klebte ein Pappschild mit der Aufschrift »Büro«, darunter waren mit Bleistift »Sprechzeiten« notiert. Die alte Aufschrift oberhalb der Tür war überstrichen, schimmerte aber noch durch: »Luftschutzkeller«. Hatte man in der Schule oder auf dem Hof etwas verloren, den Turnbeutel, eine Mütze, einen Schlüsselbund, mußte man dort anklopfen und nachfragen. In einer Ecke des Raumes erhob sich ein ungeordneter, von Kohlenstaub und Asche ergrauter Haufen mit Fundsachen. Zu diesem Haufen vorgelassen zu werden galt allerdings als unmöglich. Öffnete der Glöckner sein Büro, war es sicher, daß man zunächst zurechtgewiesen wurde. Zuerst, weil man ihn, den Hausmeister, störte bei seiner Arbeit, dann, weil man wohl zu denen gehörte, die dauernd irgend etwas verloren und nicht wußten, was sie damit anrichteten (»Den Hottentotten heute fehlt jedes Gefühl für den Wert der Dinge!«), und schließlich, weil man keine vernünftige Beschreibung des verlorenen Gegenstandes vorzubringen vermochte: Womit doch einmal die Frage erlaubt sein müsse – so drückte sich der neue Hausmeister aus, und ohne weiteres war hörbar, daß ihm diese Überlegung einige Beherrschung abverlangte –, ob man bisher überhaupt irgend etwas gelernt hätte an der Schule, wozu man eigentlich hier sei, und ob man nicht besser gleich zu Hause bliebe, dann könne man wenigstens nichts mehr verlieren …
Zu meiner und zur Verzweiflung meiner Eltern kam mir in dieser Zeit ständig irgend etwas abhanden. Oft mußte ich an jenes Bibelwort denken, das dazu aufrief, etwas zu hüten wie den eigenen Augapfel. Meine Mutter hatte das Wort allzuhäufig gebraucht – jedesmal bekam ich Angst um meine Augen. Trotzdem: Es geschah, daß ich zweimal in der Woche den Turnbeutel verlor, und sowieso vergaß ich dauernd meine Brotbüchse unter der Bank, von Füllern und Heften ganz zu schweigen, all die Augäpfel-Sachen meiner Kindheit verlor ich am laufenden Band. In meiner Not war ich irgendwann dazu übergegangen, Beschreibungen der verlorenen Dinge anzufertigen, auf Zetteln, die ich aus einem Schulheft riß und eng zusammengefaltet in der Hand hielt, wo sie sich vollsogen mit meinem Angstschweiß, wenn ich vor dem Büro des Glöckners stand. Wie Gedichte trug ich meine auswendig gelernten Beschreibungen vor, was mich für ein paar Sekunden vor den Ausbrüchen seines Zorns schützte, ja, nach einer gewissen Zeit hatte ich das Gefühl, daß er meinen Vortrag anerkannte und ich unter denen, die ihn quälten mit ihrer Zerstreutheit, eine Art Musterschüler geworden war. Bald kam es vor, daß er mich hereinlotste in sein Büro und mich Aufstellung nehmen ließ vor dem Haufen mit Fundsachen, wo ich meine Beschreibung noch einmal vorzutragen hatte, wobei er mir kleine Anweisungen erteilte wie »Schön konzentrieren!« oder »Denke gut nach!«. Dabei hockte er auf einer Art Lehnstuhl, der aus den graumetallenen Einzelteilen verschiedener Schulbänke und Schulstühle zusammengesetzt und mit verschiedensten Fundstücken, verlorenen Jacken, Hosen und Schals, ausgepolstert war. Irgendwann erkannte ich eine von mir vor langer Zeit verlorene Pudelmütze, die der Hausmeister wie einen Strumpf über die Lehne seines Throns gezerrt und dafür an der Spitze durchstochen hatte. Meine Mutter hatte die Mütze selbst gestrickt, auf unzähligen Kindheitsfotos bin ich mit dieser Mütze zu sehen; vielleicht fühlte ich mich deshalb derart gekränkt, aber schließlich war ich der Schuldige, ich war der ständige Verlierer meiner Mützen, ich war es, der meiner Mutter diesen Kummer bereitete. Zu Hause erzählte ich nichts von meiner Entdeckung, und auch später brachte ich das nie übers Herz. Hinter dem Lehnstuhl des Hausmeisters lagen die stählernen Feuerklappen der Zentralheizung, daneben eine Werkbank mit einer Werklampe, der einzigen Lichtquelle im Raum. Undeutlich nahm ich eine Art Kochecke wahr, einen länglichen Aluminiumtopf, einen Tauchsieder, ein paar Büchsen. Die Wand über der Werkbank war fast vollständig mit Abbildungen halbnackter Frauen bedeckt. Nie habe ich gewagt, länger als eine, vielleicht zwei Sekunden dorthin zu schauen.
War meine Beschreibung zu Ende, gab es Nachfragen zu einzelnen Details, wobei ich nicht selten in die Irre ging. Während der Befragung umkreiste der Hausmeister den Fundsachenhaufen und vergrub seine Hände in der Dederonschürze, durch die jeder einzelne Knöchel seiner Faust zu sehen war. Überhaupt: In seinem Büro, das im Winter zugleich als Heizungskeller dienen mußte, war es heiß, so heiß, daß der Hausmeister oft nur eine kurze Hose und ein Turnhemd unter seinem Kittel zu tragen schien. Seine Latschen schlurften langhin über den Boden, die kalkweißen Unterschenkel, dicht behaart und äußerst bedrohlich … Ich schwitzte und versuchte, seine Ergänzungsfragen zu beantworten. Manches hatte ich einfach anders oder gar nicht in Erinnerung, und schließlich war es immer so, daß der Glöckner etwas fand, womit er triumphieren konnte: »Entweder du lügst, oder das ist nicht deine Trainingshose …«
Gemunkelt wurde, der Hausmeister träfe in seinem Keller auch Mädchen aus den höheren Klassen, aber bewiesen war das nicht. Während des Unterrichts, hieß es, stehle er heimlich Kleidungsstücke aus den Garderoben im Flur, um die Mädchen nach unten, in den Keller zu locken … Infolge meiner unfallbedingten Abwesenheit schien sein Interesse an mir, seinem Musterschüler, noch gewachsen zu sein. Seit ich an die Schule zurückgekehrt war und wieder damit begonnen hatte, Dinge zu verlieren, forderte der Glöckner mich auf, zusätzlich zur Beschreibung der frisch vermißten Sache Beschreibungen anderer, diesmal zwar nicht, aber doch schon öfter, schon zur Genüge verlorener Dinge vorzutragen, zur Übung, wie er sagte. Ich begriff die Schikane, wagte aber keinen Widerspruch, auch um meinen Sonderstatus oder das, was ich dafür hielt, nicht aufs Spiel zu setzen. Es kam vor, daß ich in dem stark erwärmten Keller, in dem es nach Kaffee, Kohle und den abgestandenen Gasen einer schlechten Verbrennung roch, vier oder fünf Beschreibungen hintereinander vortrug. Während ich redete, grimassierte der Glöckner unentwegt Zustimmung, Zweifel oder Ablehnung, obwohl ich doch nur wiederholte, was ich beinah unverändert schon einige Male zum Besten gegeben hatte. Manchmal schnellte er unvermittelt von seinem Thron aus Kinderstühlen empor, und wie eine Drohung ließ er die Ofenklappe zur Zentralheizung aufspringen, um eine Schaufel Kohle oder Koks in die Glut zu schleudern; dabei zischte er seine unverständliche Kritik vor sich hin, vielleicht hatte es auch gar nichts mit mir und meinem Vortrag zu tun und galt nur dem Feuer, der erdigen, minderwertigen Kohle … Trotzdem überkam mich dabei die Angst, und ich wünschte mir, daß meine Beschreibungen anhielten, sich endlos fortsetzen ließen, denn unterbrochen hatte der Hausmeister mich nie; solange ich verlorene Dinge beschrieb, war ich geschützt.
Natürlich war das alles zuviel für mich. Ich stockte oft, stotterte sogar, und schon während der zweiten oder dritten Beschreibung konnten die seltsam ruckartigen Bewegungen beginnen (das Vorzucken eines Arms zum Beispiel), die offensichtlich noch auf meinen Unfall zurückgingen und die ich nun, wie wir es bei Frau Kringler im Deutschunterricht gelernt hatten, als Mittel des Ausdrucks zu benutzen versuchte – wichtig war nur, daß der Glöckner nichts bemerkte von meiner Schwäche.
Wenn ich heute an diese Zeit denke, staune ich darüber, was alles normal war. Dann kann ich kaum glauben, daß ich selbst dieses Kind gewesen sein soll. Ich sehe irgendein Kind, das versucht, sich durchzuschlagen, und das trotz beständig drohender Schwierigkeiten einfach immer zu zerstreut ist, um seine sieben Sachen zusammenzuhalten. Ein erschreckend orientierungsloses Kind, das nebenbei eine Schule der Beschreibung absolviert – eine Schule im Keller, unterhalb der eigentlichen Schule. Ich glaube, noch heute könnte ich meinen Stoffturnbeutel in allen Einzelheiten beschreiben, mein Stoffturnbeutel von 1972 erscheint mir vertrauter als das Kind, das ich war.
3 Schälerelli
Es gab drei brauchbare Verstecke, die an jedem Morgen zur Auswahl standen: der Nußbaum, die Garage und der Schuppen des letzten Bauern von L. Von dort aus mischte ich mich dann unter die Ankommenden, unauffällig, ein Schüler wie jeder andere, abgesehen von meiner ledernen Kniebundhose, die meine Mutter Knickerbocker nannte. Dieses für unsere Gegend ungewöhnliche Kleidungsstück war ganz aus einem steifen, grauen Leder gemacht und wurde von Trägern gehalten, die vor der Brust ein starkes H und im Rücken ein dünnes X beschrieben. Oft betonte meine Mutter, wie praktisch meine Hose sei; wie unverwüstlich. Da ich mich mühte, als ein Kind zu gelten, das mit den Umständen seines Lebens einverstanden, froh und zufrieden war, quälte ich mich drei oder vier Jahre zwischen H und X.
Der Nußbaum befand sich im Vorgarten der Schule; er war nicht besonders groß. Wenn ich ihn benutzte, schwebte ich fast unmittelbar über den Köpfen der eintreffenden Schüler, manchmal schon steif vor Kälte und betäubt von meiner indianischen Einsamkeit. Seltsamerweise kam es nie vor, daß jemand den Kopf hob und ins Astwerk schaute. Es war nicht einfach, eine Position zwischen den Ästen zu finden, von der aus man sich geräuschlos fallen lassen konnte, um möglichst unauffällig in der Normalität des beginnenden Schultags zu landen. Ein einziges Mal hatte mich jemand fallen sehen. Es war Schwarzmüller gewesen, drei Jahre älter als ich – für einen verwegenen Moment hatte ich den Wunsch gespürt, zu ihm hinüberzugehen und ihm alles über mein morgendliches Geheimleben anzuvertrauen. Schwarzmüller, der selten kleinere Schüler schlug und selbst immer ein Geheimnis bei sich trug in Form bestimmter Fotografien. In den Hofpausen geschah es, daß er sie auch für uns einmal aus der Tasche zog, aber ohne sich dabei aufzuspielen, im Gegenteil, auch in der Gefahr war Schwarzmüller ruhig und sanft, und ohne Hast hielt er uns seine Bilder unter die Augen. Ich war jedesmal blind gewesen vor Aufregung und hatte nichts erkannt – nur Haare und Haut, Schwarz und Weiß, alles war ohne Sinn geblieben, ohne erkennbaren Zusammenhang.
Das zweite brauchbare Versteck war das unter der Garage, die ein Stück abseits, einige Meter weiter die Schulstraße hinauf lag. Gerade im Winter war es unter der Garage etwas besser als im Nußbaum. Um das bröckelnde Gefälle auszugleichen, stand sie an der Rückseite auf zwei grob gemauerten Pfeilern. Hatte ich die Garage gewählt, kniete ich dort unten wie ein Verschütteter zwischen abgefahrenen Reifen, halbleeren Blechflaschen für Elaskon und ein paar rostigen Kanistern, von denen ein betäubender Dunst ausging; ein Gemisch aus Benzin, Altöl und einem orangefarbenen Rostschutz, dessen Geruch ich erkannte, weil auch mein Vater ihn für den Unterboden seines Shiguli benutzte – »Reines Gift!«, wie er immer wieder anerkennend ausrief, wenn er damit zur sogenannten Winterfestmachung unter dem Wagen verschwand. Unter der Garage versuchte ich, möglichst wenig davon einzuatmen. Ich bekam Kopfschmerzen, und es konnte zwei oder drei Schulstunden dauern, bis sich der Schwindel legte. Ich schob meinen Schal über Mund und Nase, ich war ein Verschütteter im Goldrausch, auf dem Weg zu seiner Goldader, mitten in Alaska, und ich dachte an Heike: Sie würde mich finden, bewußtlos oder tot. Ihr Gesicht wäre auch dann noch so fein wie alles, was sie tat und was sie trug, edler als alles, was ich je tun konnte, aber jetzt müßte sie weinen. Ich sah ihren rotweiß gepunkteten Anorak mit dem Fellstreif rund um die Kapuze, eine Eskimokapuze, mit der sie sich über mich beugte, und darin sah ich ihr schwarzes Haar über der Stirn, ihre Wimpern, von Tränen verklebt, und ihre warmen, unberührbaren Wangen … Und ich sah ihren wunderbaren Mund, der etwas formte wie »ich dich auch« und »schon die ganz Zeit« … Auch Heikes Eltern waren edel, ganz aparte Leute, wie meine Mutter es einmal ausgedrückt hatte. Heikes Familie wohnte im Elstertal, zum Fluß hin, neben der Reußischen Klaviaturenfabrik, die jetzt Piano-Union hieß, weit von der Atomsiedlung und noch weiter von der Schule entfernt. Sicher spielte Heike selbst Klavier, vielleicht übte sie gerade jetzt noch ein wenig, bevor sie sich dann, zur genau richtigen Zeit, auf den Weg machen würde … Im Versteck unter der Garage plapperte und summte ich diese Dinge vor mich hin, denn tatsächlich hatte ich Angst, im Nebel der Ausdünstungen das Bewußtsein zu verlieren. Flüsternd stellte ich Heike zur Rede. Ich fluchte leise, etwas ätzte und gärte in mir, ich wurde fordernd, manchmal sogar wütend und böse – unter den Eingebungen des Rostschutzmittels verkündete ich Heike, daß unserer Hochzeit im Grunde nichts mehr im Wege stünde, aber sie müsse jetzt endlich besser auf sich achten, aufpassen, sie dürfe nicht weiterhin so schlechte Zensuren in Mathematik bekommen …
Entscheidend war, welchem Versteck ich mich gerade gewachsen fühlte. Wenn die mit dem Wort »Hausfriedensbruch« verbundenen Ängste überwogen, nahm ich den Nußbaum oder die Garage, aber an manchen Tagen und so auch an diesem Morgen fühlte ich mich beinah furchtlos; der beste Unterschlupf lag der Schule direkt gegenüber, auf dem Gelände des letzten Bauern von L., in einem seiner Schuppen am Berg. Den Kopf voran, zwängte ich mich durch eine Lücke zwischen Zaun und Torpfahl und überwand halb geduckt die krautige Böschung. Die Tür war nur angelehnt, augenblicklich umfing mich das Dunkel. Eine Weile stand ich reglos und lauschte. Dann tastete ich mich zu meinem Platz an der Schuppenwand. Lange wurde mir nicht klar, auf welche Weise ich den Frieden brach, so still und einverständig war ich mit meinem Platz im Schuppen. Einige Schüler behaupteten, der Bauer könne nicht richtig sprechen. Er hätte mit einem Vorschlaghammer nach ihnen geworfen und dabei unverständliche Flüche ausgestoßen. Seine Tochter, die nach der vierten Klasse unsere Schule verlassen hatte, schob täglich einen zweirädrigen Handkarren durch die aufgeweichte Brache rund um die Neubauten der Atomsiedlung. Auf der Stirnseite jedes Wohnblocks hatte man einen kleinen Platz für Müllkübel befestigt, die sie nach verfütterbaren Abfällen, verschimmelten Broten, Schälern oder Obst durchsuchte. Oft trug sie einen kurzen, karierten Wollrock, Strumpfhosen und Gummistiefel; es gab Gerüchte, die ihre O-Beine betrafen und unsere Phantasie aufs äußerste reizten. Ein paar Kinder fanden sich immer, die ihr nachliefen, ihren Karren umtraten und »Schälerelli« brüllten. Schälerelli! – aus der Echozentrale der Gebind wurde der hell tönende Ruf im ganzen Ort übertragen.
4 Oberer und Unterer
Der Milchwagen kam. Die Trichterlampe über der Außentreppe flammte auf, und für einen Moment schien es, als entstiege der neue Hausmeister dem Erdreich. Im Eiltempo wuchtete er einige der Milchkästen von der Ladefläche auf das Pflaster, jeder der Kästen antwortete mit einem kurzen, klirrenden Aufschrei. Dann schlug er mit der flachen Hand auf die Rückseite des Fahrerhauses, der kleine Lastwagen ruckte an, und noch ehe der Fahrer den Motor bis in den zweiten Gang getrieben hatte, war der Hausmeister wieder abgetaucht und die Lampe über seinem Ausstieg erloschen. Vorsichtig stampfte ich etwas gegen den Lehmboden.
Beim dritten oder vierten Aufschrei der Milchkästen war in der Dachwohnung des alten Hausmeisters das Licht angegangen. Eine Weile wuchs und schrumpfte sein Schatten, näherte sich dann mit einer fast hüpfenden Bewegung dem Fenster und verschloß es mit einem schnellen Griff durch die Übergardine. Seit Unzeiten, wie es hieß, lebten der Alte und sein Schatten in der Schule. Schon lange war der alte Hausmeister nicht mehr imstande, die Hausmeisterarbeit zu erledigen, aber die Wohnung hatte man ihm gelassen. Damals hätte man eben zu sehr darauf vertraut, daß es der Alte nicht mehr lange machen würde, wie mein Vater betonte, wenn unser Abendbrotgespräch die Situation in der Schule streifte. Selbst für uns wurde an beinah jedem Tag auf irgendeine Weise sichtbar, wie verbittert, ja, haßerfüllt der neue Hausmeister auf die scheinbar ewig fortdauernde Anwesenheit des alten reagierte. In der Schule hatte sich die Rede vom »unteren« und vom »oberen Hausmeister« eingebürgert, nicht selten wurde auch nur vom »Oberen« oder vom »Unteren« gesprochen.
Wollte der Obere seine Behausung einmal verlassen, mußte er über die Treppen und Etagen der Schule. Zu Gesicht bekamen wir ihn allerdings nie. Sicher, es gab Schüler, die vorgaben, ihm begegnet zu sein, auf dem Weg zur Latrine oder bei einem Botengang während des Unterrichts. Sie schilderten den Alten als schreckliche Erscheinung: nur Haut und Knochen, dazu ein riesiger, fast kahler Schädel. Ein wiederkehrendes Detail betraf sein Schuhwerk. In den Beschreibungen der Augenzeugen handelte es sich dabei um enganliegende Schaftstiefel mit einem kleinen, stählernen Huf an den Absätzen. In meiner Vorstellung bildeten diese stählernen Beschläge einen seltsamen Gegensatz zur Tatsache, daß dem Oberen, wie man sagte, das Gehen bereits schwerfiel, er das Gebäude kaum noch verließ und nur noch kurze Spaziergänge über die Flure der Schule machte. Manchmal, mitten im Unterricht, hörten wir sein metallisches Schlurfen und ein Klopfen. Es hieß, auf seinem Weg die Korridore entlang kontrolliere der Alte noch hier und dort etwas, den Sitz der Wasserhähne, die Stabilität einer Garderobe – er tat das mittels kleiner gezielter Schläge seines Stockes auf die jeweils zu prüfenden Dinge. Wenn das Klopfen an unserem Klassenzimmer vorbeizog, stellte ich mir vor, wie der Alte seinen großen Schädel schüttelte: Sein Urteil fiel negativ aus, zuungunsten des Unteren.
Noch einmal versuchte ich, mir etwas Wärme in die Füße zu stampfen. Der Lehmboden des Schuppens schien zu vibrieren. Rauchschwaden wälzten sich vom Schornstein der Schule herunter auf die Straße … Wenn man ihn nicht heimtückisch ermordet hätte, wäre Bruno Kühn, der Antifaschist und Namensgeber unserer Schule, heute so alt wie unser alter Hausmeister, hatte Frau Kringler, unsere Lehrerin, einmal gesagt. Einige Kinder hatten die Konstruktion mit dem Vergleich nicht verstanden, weshalb noch immer das Gerücht umging, hinter keinem anderen als unserem alten Hausmeister verberge sich der Namenspatron unserer Schule, jener Held im Widerstand, der in Wahrheit also doch nicht umgekommen, sondern nur untergetaucht war. Das erklärte augenblicklich die Stiefel und das Eisen daran und schließlich auch die Streifengänge des Alten – Ausdruck einer Wachsamkeit, die offensichtlich nie erlöschen durfte.
Eine Weile war der Schatten des Oberen in der Tiefe, vielleicht bei seinem Frühstück geblieben, jetzt tauchte er wieder auf. Er hüpfte, wackelte und schwenkte einen Arm – ich erschrak; ich glaubte, daß der Schatten jemandem in meiner unmittelbaren Nähe winkte, ja, direkt zu mir herüberwinkte, aber genau war das nicht zu erkennen und doch eigentlich unmöglich – ein unklares, vom Rauch in der Straße vernebeltes Hin- und Herwedeln war das, am Ende so, als winkten drei oder vier Arme gleichzeitig; dann aber folgte eine seltsame Verbiegung zur Seite. Der verbogene Schatten zog dabei mit einem Ruck an der Gardine, ohne sie jedoch mehr als einen Spaltbreit zu öffnen, und verschwand augenblicklich. Beinah hätte ich lachen müssen, aber die unsichtbare Gefahr, die irgendwo gleich hinter mir, zwischen Schälerellis stinkendem Karren und den Spießen eines Heuwenders lauerte, ermahnte mich.
Immer dichtere Schwaden rollten vom Dach der Schule auf die Straße, zerstreuten sich und flossen unter den Laternen wieder ineinander zu seltsam körperlichen, fettglänzenden Gebilden, die sich wie blind gegen die Häuser wälzten in dem Versuch, aus dem Fuchsklamm herauszufinden. Sie benutzten das Pflaster, um sich abzustoßen, und den langen Kanal der Schulstraße, um an Tempo zu gewinnen, aber erst im zweiten oder dritten Anlauf überstiegen diese Geistertiere die Spitzen der Dächer und kletterten über die dichtbewaldeten Bergkämme in den thüringischen Himmel, jenes nur langsam ausbleichende Gewölbe über den ersten Ausläufern der Mittelgebirge, deren weitblickende Kinder wir waren, wie es hieß im Lied eines ostthüringischen Dichters: »Wir sind die Kinder der Vorgebirge / mit Blick ins weite Hochgebirge …«, ein merkwürdiger Text, den wir übten im Musikunterricht und der von uns längst umgewandelt worden war in »Wir sind die Killer der Vorgebirge …« – was allerdings kaum hörbar wurde in unserem sich von Strophe zu Strophe zu einer Art Kampfgebrüll steigernden Gesang.
Mit kältestarren Fingern betastete ich meinen Kopf unter der Mütze; seit einiger Zeit schon hallte ein seltsam entstelltes, sich rhythmisch wiederholendes Geräusch durch die Luft, eine Art Jaulen, welches im üblichen, mir vertrauten Morgenecho der Atomsiedlung nicht enthalten war. Unter bestimmten Wind- und Luftverhältnissen war es möglich, ganze Gespräche, die dort von Block zu Block, von Fenster zu Fenster geführt wurden, beinah wörtlich mitzuverfolgen, was auch mit dem eigentümlich lauten Sprechen der ehemaligen Dörfler zu tun hatte, die ihre Stimme hoben, als gelte es noch immer, sich über Gärten und Felder hinweg verständlich zu machen.
5 Ayala
Der Wind hatte gedreht und drückte etwas Brandqualm bis in mein Versteck hinter der Bretterwand – es war der bekannte, verführerische Geruch; ich atmete tief und öffnete meinen Ranzen. Ich legte Hefte und Bücher zur Seite, löste langsam den ledernen Innenboden, der nur einseitig angenäht war, und vorsichtig fuhr ich mit den Fingerspitzen über das darunter versteckte Papier – es fühlte sich angenehm glatt an, fast ein wenig ölig. Wie alle sogenannten West-Sachen waren Fußballbilder auf dem Gelände der Schule verboten. Oben lagen die Bilder, die ich verdanneln wollte, wie die Sammler an unserer Schule das Tauschgeschäft nannten. Bestimmte Exemplare tauchten zu dieser Zeit unglaublich oft auf, darunter Rubén Hugo Ayala, der Argentinier mit den langen schwarzen Haaren, während er ausholt, von links eine Flanke zu schlagen (sein nach hinten wegwehendes Haar, als führe dem Spieler ein Sturm in sein schnauzbärtiges Gesicht); ich allein besaß drei Ayalas. Während ich wie abwesend, beinah bewußtlos die drei Ayalas durch meine Finger gleiten ließ und alle drei gleichermaßen wertvoll fand, flüsterte ich immer wieder die Bildunterschrift vor mich hin: »Rubén Hugo Ayala, Argentinien – Haiti (4 : 1)«.
Die Frage war, warum ich nicht nur die Ayalas, sondern meine ganze Sammlung in Gefahr brachte. Zu dieser Zeit gab es die kleine und die große Ranzenkontrolle. Die kleine innerhalb der eigenen Klasse, sie konnte vom Klassenleiter vorgenommen werden; zwei Schüler der Klasse, der jeweilige Milchdienst (verantwortlich für das morgendliche An- und Abliefern unseres Milchkastens), standen ihm dabei helfend zur Seite. Dann die große Ranzenkontrolle, für die eine ganze Klassenstufe in mehreren Reihen auf dem Appellplatz antrat, wobei jeder seinen Ranzen vorzeigte, auf Verlangen auch abzusetzen und auszuräumen hatte – diese Kontrolle war aber viel seltener und wurde vom Direktor selbst vorgenommen. Eine dritte Möglichkeit, ertappt zu werden: die stichprobenartige Tiefenkontrolle, der blitzartige Zugriff zum Beispiel einer Hofaufsicht, wenn sie während der Pause von hinten an einen Schüler herantrat, ihn mit einem scharf in den Nacken gezischelten »Du-kommst-jetzt-mit!« am Arm packte und abführte ins Lehrerzimmer. Im Lehrerzimmer befand sich die Kiste, wo im Verlauf der Woche die verbotenen Dinge gehortet wurden, bis schließlich, an jedem Freitagmorgen, ihre Abholung und Verbrennung durch den neuen Hausmeister erfolgte – diese Abläufe kannten wir längst, bis ins Detail. Einzelkontrollen konnten an jedem Ort, zu jeder Zeit und von jedem Lehrer vorgenommen werden, auch die beiden Hausmeister waren dazu berechtigt, sobald ein entsprechender Verdacht vorlag – verdächtig aber war jeder.
Bei jeder Ranzenkontrolle traten neue, ganz unglaubliche Mengen kostbarer, verbotener Dinge zutage, und wenn mich noch heute etwas wirklich erstaunt, dann, daß ihr Fluß in diesen Jahren niemals wirklich abriß, trotz der Verluste, der Bestrafungen, Verweise und »Mitteilungen an die Eltern«. Erst heute beginne ich zu begreifen, was sich hinter diesem Opfergang verbarg; ich verstehe, daß es mehr bedeutete, wenn wir neben der Unzahl feinglänzender Fußball- und Olympiabilder aus den Schokoladenpapieren von Sprengel, neben den knisternden Kaugummibildern mit Fix&Foxi, den Aufnähern, Aufklebern, zerknitterten Roman-Heften und geheiligten Disney-Comics bald auch unsere allergrößten Schätze, die Basecaps, T-Shirts und Matchboxes in die Schule schleppten, all die Dinge, für die das Wort Schund erfunden worden war, Schund&Schmutz, wie es noch öfter hieß und dabei in einem einzigen Atemzug gesprochen wurde. Etwas anderes, Größeres als die Faszination, die Schund auf uns ausübte, schien hier am Werk, und heute bin ich sicher, es war: unsere Pflicht und Schuldigkeit. Eine eigenartige und, genauer besehen, ungeheuerliche Pflichtschuldigkeit, die den vertrauten, von uns für unumstößlich erachteten Gesetzen unserer kindlichen Welt galt und darin schließlich auch, als ihrer letzten Instanz, dem Ofen des Unteren.
Denn nur so wird alles verständlich: Was wir uns im wiederholten Verstoß gegen die Hausordnung unserer Schule erwarben, erdannelten sozusagen, war eine echte Teilhabe, eine klar erkennbare Rolle im Regelkreis der Schule. Dieser Regelkreis von Kontrolle, Strafe und Verbrennung, der das Funktionieren unserer Schule im Inneren aufrechterhielt, benötigte Schund&Schmutz, den Stoff des Verbotenen, und von niemand anderem als uns konnte Schund&Schmutz regelmäßig geliefert werden … Was wir im Zuge der täglichen Ranzenkontrollen auf eine mutige Weise erstanden, war eine echte, klar benennbare Schuld, eine Schuld, die sinnvoll zu unserem Leben beitrug, weil sie uns Konturen verlieh im grau dahinströmenden Magma dieser Zeit und, indem wir sie uns zu eigen machten, beinahe freisprach von einer diffusen, ganz allgemeinen und offensichtlich angeborenen Schuldigkeit, die uns von Kindesbeinen an niederdrückte.
Auf diese Weise erzeugte der Ofen einen Sog. Immer umfänglichere Lieferungen verbotener Dinge wurden frisch herbeigeschafft und in die Schule getragen. Bestellungen bei Verwandten und Bekannten in Düsseldorf, Aachen, München, Karlsruhe und sonstwo wurden aufgegeben, neue Bittbriefe mußten mühsam formuliert, Bedürftigkeit geheuchelt werden, um Schund&Schmutz in Bewegung zu setzen, der uns dann auf dem Postweg oder über die Transitstrecken erreichte und beinah umgehend – als drohe, sobald dieser Zufluß einmal ins Stocken käme, das Gleichgewicht unserer Welt aus den Fugen zu geraten – dem Ofen des Unteren zugeführt wurde … Sicher: Für das Kind im kalten Versteck mit den Bildern in der Hand (ihre ölige Glätte wie eine Liebkosung zwischen den Fingerspitzen) war das alles undenkbar. Natürlich konnte ich nicht wirklich wollen, daß meine Ayalas in Flammen aufgingen, wie es – unweigerlich und im Grunde vorhersehbar – schon ein paar Tage später geschehen mußte.
6 Küssen
Die ersten Kinder trafen ein. Immer gab es solche, die sich sofort vor der verschlossenen Schultür drängten; es bedeutete ihnen etwas, als erste ins Schulhaus zu stürmen, dabei womöglich »Erster!« zu brüllen, um im Widerhall ihres Rufes den Sieg zu genießen. Über den wirklich ersten an der Schule würden sie allerdings nie etwas erfahren – ich versuchte, diesem Gedanken etwas Hohn beizumischen, stieß aber nur auf jene unklare Verlegenheit, die mich an jedem Morgen in eines meiner Verstecke trieb.
Inzwischen hüllten die Rauchschwaden mich beinahe vollkommen ein; ich genoß ihren süßlichen, fast schokoladigen Geruch, der – ein wirklich treffendes Wort gibt es bis heute nicht – seltsam künstlich, hochstaplerisch, ja, betörend unwahr wirkte und einen völlig meschugge machte, wie meine Mutter es ausdrückte, indem sie sich ihr Tuch oder den weißen Fellkragen ihres Knautschlackledermantels vor den Mund preßte. Ihr schienen diese Gase nichts als ungesund. Wie alle Erwachsenen außerhalb der Schule konnte sie nichts wissen vom Kreislauf des Verbotenen und unserer Aufgabe darin. Sie wußte nichts von diesem allerletzten Gruß, den Schund&Schmutz uns sandte, ein letzter Abglanz unserer Schätze, zugleich ein süßes Beharren, das an jedem Freitagmorgen in der Luft lag und von jedem von uns, der die Gelegenheit erhielt, begierig eingesogen wurde …
Seltsamerweise öffnete sich die Schultür nicht. Ich fragte mich, ob heute vielleicht alle etwas zu früh gekommen waren, als aus dem beginnenden Treiben eine bekannte Stimme tönte – es war Herzog, der vom Schulhof her brüllte: »Drei, drei, drei!«
»Gilt nicht, war nicht!« brüllte jemand zurück, den ich nicht sehen konnte.
»Doch, der war!« brüllte Herzog und: »Mach mal Andrea, die wehrt sich nicht!«