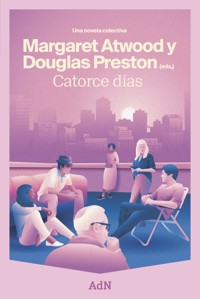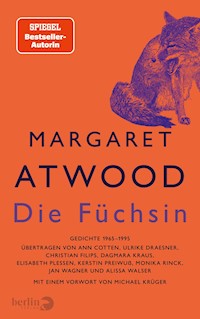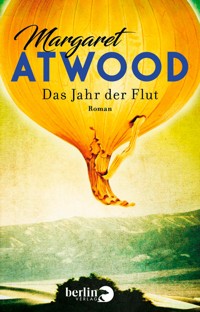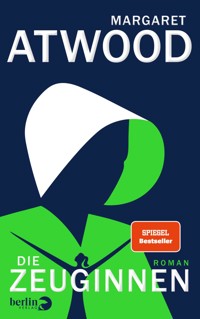
11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: eBook Berlin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Und so steige ich hinauf, in die Dunkelheit dort drinnen oder ins Licht.« - Als am Ende vom »Report der Magd« die Tür des Lieferwagens und damit auch die Tür von Desfreds »Report« zuschlug, blieb ihr Schicksal für uns Leser ungewiss. Was erwartete sie: Freiheit? Gefängnis? Der Tod? Das Warten hat ein Ende! Mit »Die Zeuginnen« nimmt Margaret Atwood den Faden der Erzählung fünfzehn Jahre später wieder auf, in Form dreier explosiver Zeugenaussagen von drei Erzählerinnen aus dem totalitären Schreckensstaat Gilead. »Liebe Leserinnen und Leser, die Inspiration zu diesem Buch war all das, was Sie mich zum Staat Gilead und seine Beschaffenheit gefragt haben. Naja, fast jedenfalls.Die andere Inspirationsquelle ist die Welt, in der wir leben.«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:www.piper.de
Deutsch von Monika Baark
Die Originalausgabe erschien 2019 unter dem Titel The TestamentsBei PenguinRandom House Toronto/New York/London© O. W. Toad Ltd 2019Für die deutschsprachige Ausgabe:© Berlin Verlag in der Piper Verlag GmbH 2019Die Illustrationen im Buch sind von Suzanne Dean (Füller) und Noma Bar (Mädchenprofile)
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Cover & Impressum
Zitate
I
Das Hologramm von Haus Ardua
1
II
Abschrift der Zeugenaussage 369A
2
3
4
5
III
Das Hologramm von Haus Ardua
6
IV
Abschrift von Zeugenaussage 369B
7
8
9
10
11
V
Das Hologramm von Haus Ardua
12
VI
Abschrift der Zeugenaussage 369A
13
14
15
16
17
18
19
VII
Das Hologramm von Haus Ardua
20
VIII
Abschrift von Zeugenaussage 369B
21
22
23
IX
Das Hologramm von Haus Ardua
24
X
Abschrift der Zeugenaussage 369A
25
26
27
28
XI
Das Hologramm von Haus Ardua
29
XII
Abschrift der Zeugenaussage 369B
30
31
32
33
XIII
Das Hologramm von Haus Ardua
34
XIV
Abschrift der Zeugenaussage 369A
35
36
37
38
39
40
XV
Das Hologramm von Haus Ardua
41
XVI
Abschrift der Zeugenaussage 369B
42
43
44
45
XVII
Das Hologramm von Haus Ardua
46
XVIII
Abschrift von Zeugenaussage 369A
47
48
49
50
51
XIX
Das Hologramm von Haus Ardua
52
XX
Abschrift von Zeugenaussage 369B
53
Abschrift von Zeugenaussage 369A
54
Abschrift von Zeugenaussage 369B
55
Abschrift von Zeugenaussage 369A
56
Abschrift von Zeugenaussage 369B
57
Abschrift von Zeugenaussage 369A
58
XXI
Das Hologramm von Haus Ardua
59
XXII
Abschrift von Zeugenaussage 369A
60
61
Abschrift von Zeugenaussage 369B
62
Abschrift von Zeugenaussage 369A
63
Abschrift von Zeugenaussage 369B
64
XXIII
Das Hologramm von Haus Ardua
65
XXIV
Abschrift von Zeugenaussage 369B
66
Abschrift von Zeugenaussage 369A
67
XXV
Das Hologramm von Haus Ardua
68
XXXVI
Abschrift von Zeugenaussage 369A
69
Abschrift von Zeugenaussage 369B
70
XXVII
Das Hologramm von Haus Ardua
71
Das Dreizehnte Symposion
Erinnerung
Danksagung
Quellenverzeichnis
Zitate
»Jede Frau soll dieselben Eigenheiten aufweisen, sonst gilt sie als Ungeheuer.«
George Eliot, Daniel Deronda
»Wenn wir einander ansehen, dann erkennen wir nicht nur ein verhasstes Gesicht, sondern wir schauen in einen Spiegel … Erkennen Sie sich denn nicht selbst?«
Obersturmbannführer Liss zu dem alten Bolschewiken Mostowskoi; Wassili Grossman,Leben und Schicksal
»Sie lernte allmählich, dass Freiheit schwer wog, dass sie eine Bürde, eine große und seltsame Last war, die der Seele zugemutet wird … Sie ist keine Gabe, die gegeben, sondern eine Wahl, die getroffen wird, und die Wahl fällt schwer.
Ursula K. Le Guin, Die Gräber von Atuan
I
Denkmal
Das Hologramm von Haus Ardua
1
Nur Tote dürfen Denkmäler haben, ich aber habe zu Lebzeiten eines bekommen. Schon jetzt bin ich versteinert.
Dieses Denkmal sei ein kleines Zeichen der Anerkennung für meine zahlreichen Verdienste, hieß es in der Würdigung, die von Tante Vidala vorgetragen wurde. Unsere Obrigkeit hatte sie dazu verpflichtet, was bei ihr nicht gerade auf Gegenliebe stieß. Ich dankte ihr mit aller aufzubietenden Bescheidenheit, dann zog ich an dem Seil und löste damit den Stoffvorhang, der mich verhüllte; sich bauschend sank er zu Boden, und da stand ich. Bei uns in Haus Ardua wird nicht gejubelt, aber hier und da wurde diskret applaudiert. Ich neigte den Kopf zu einem Nicken.
Mein Denkmal ist wie die meisten Denkmäler überlebensgroß, es zeigt mich als jüngere, schlankere Frau und besser in Form, als ich es seit Langem bin. Ich stehe kerzengerade da, meine steinernen Lippen sind zu einem festen, aber wohlwollenden Lächeln geformt. Meine Augen sind auf irgendeinen kosmischen Bezugspunkt gerichtet, was offenbar meinen Idealismus darstellen soll, mein tadelloses Pflichtbewusstsein, meine Entschlossenheit, allen Widrigkeiten zum Trotz voranzuschreiten. Nicht, dass am Himmel irgendetwas zu sehen wäre für mein Denkmal, dort, wo es aufgestellt wurde, inmitten von trübsinnigen Bäumen und Büschen neben dem Weg, der an Haus Ardua vorbeiführt. Wir Tanten sollen uns nichts einbilden, nicht mal die steinernen.
An der linken Hand halte ich ein Mädchen von acht oder neun Jahren, das vertrauensvoll zu mir hochschaut. Meine rechte Hand ruht auf dem Kopf einer Frau, die an meiner Seite hockt, das Haar bedeckt, den Blick gen Himmel, ein Ausdruck, der Duckmäusertum oder Dankbarkeit bedeuten könnte – es ist eine unserer Mägde –, und hinter mir steht eines meiner Perlenmädchen, wie im Aufbruch zu ihrer Missionsarbeit begriffen. An meinem Gürtel hängt mein Viehtreiber. Diese Waffe erinnert mich an meine Versäumnisse: Wäre ich resoluter gewesen, hätte ich ein solches Hilfsmittel gar nicht gebraucht. Meine Stimme allein hätte vollauf genügt.
Als Gruppendenkmal ist das Werk nicht sehr gelungen: total überfüllt. Besser gefunden hätte ich einen stärkeren Akzent auf meine Person. Aber zumindest sehe ich aus wie ein klar denkender Mensch. Es hätte durchaus anders sein können, da die betagte Bildhauerin – eine wahre Gläubige, inzwischen entschlafen – dazu neigte, ihre Sujets mit Glupschaugen auszustatten, um deren religiöse Inbrunst zu unterstreichen. Ihre Büste von Tante Helena sieht tollwütig aus, die von Tante Vidala nach Schilddrüsenüberfunktion, und ihre Tante Elizabeth wirkt, als würde sie gleich platzen.
Bei der Enthüllung war die Bildhauerin nervös. War ihre Darstellung schmeichelhaft genug? Würde ich sie gutheißen? Würde ich sie vor aller Augen gutheißen? Ich spielte mit dem Gedanken, beim Fallen des Stoffs die Stirn zu runzeln, aber ich besann mich eines Besseren: Es ist ja nicht so, als hätte ich kein Mitgefühl. »Sehr lebensecht«, sagte ich.
Das war vor neun Jahren. Seitdem ist mein Denkmal verwittert: Die Tauben haben mich dekoriert, Moos sprießt aus meinen feuchten Ritzen. Fromme Verehrerinnen legen mir regelmäßig Opfergaben zu Füßen: Eier für Fruchtbarkeit, Orangen, die die Fülle der Schwangerschaft andeuten sollen, Croissants, die auf den Mond anspielen. Die Backwaren ignoriere ich – meist hat es draufgeregnet –, doch die Orangen stecke ich ein. Orangen sind so erfrischend.
Dies schreibe ich in meinem Privatgemach in der Bibliothek von Haus Ardua – einer der wenigen verbliebenen Bibliotheken nach den eifrigen Bücherverbrennungen landauf, landab. Die verderbten und blutigen Fingerabdrücke der Vergangenheit müssen getilgt werden, um einen sauberen Ort zu schaffen für die sicherlich bald kommende Generation, die reinen Herzens ist. So die Theorie.
Aber unter diesen blutigen Fingerabdrücken sind welche, die von uns selbst stammen, und die lassen sich nicht so leicht beseitigen. Über die Jahre habe ich viele Leichen in den Keller gebracht, nun bin ich geneigt, sie wieder ans Tageslicht zu holen – und sei es nur zu deiner Erbauung, mein unbekannter Leser. Wenn du dies gerade liest, wird zumindest dieses Manuskript überlebt haben. Aber vielleicht fantasiere ich nur: Vielleicht werde ich nie einen Leser haben. Vielleicht rede ich in gleich mehrfacher Hinsicht nur mit der Wand.
Genug geschrieben für heute. Mir tut die Hand weh, mir tut der Rücken weh, und meine allabendliche heiße Milch wartet auf mich. Ich werde das Geschriebene in sein Versteck geben, fernab der Überwachungskameras – ich weiß, wo sie sind, da ich sie selbst installiert habe. Trotz solcher Vorkehrungen bin ich mir meines Risikos bewusst: Schreiben kann gefährlich sein. Welche Formen von Verrat und dann, welche Denunzierungen könnten mich erwarten? Es gibt einige in Haus Ardua, die diese Seiten liebend gern zwischen die Finger bekommen würden.
Wartet, rate ich ihnen schweigend: Es wird noch schlimmer kommen.
II
Kostbare Blume
Abschrift der Zeugenaussage 369A
2
Ich soll euch erzählen, wie es für mich war, im Innern von Gilead aufzuwachsen. Ihr sagt, es wäre hilfreich, und ich möchte euch ja gern helfen. Vermutlich rechnet ihr mit nichts als Gräueln, doch wahr ist, dass viele Kinder geliebt und verhätschelt wurden, in Gilead genau wie überall, und dass viele Erwachsene liebevoll, aber fehlbar waren, in Gilead genau wie überall.
Ich hoffe, ihr werdet zudem berücksichtigen, dass wir alle ein wenig nostalgisch werden, wenn wir an das Gute denken, das uns als Kind auf die eine oder andere Weise widerfahren ist, egal, wie absonderlich die Umstände dieser Kindheit Außenstehenden erscheinen mögen. Ich stimme euch zu, dass Gilead in Vergessenheit geraten sollte – zu viel davon war verkehrt, zu viel heuchlerisch, und es gab zu viel, das sicherlich unvereinbar mit dem Willen Gottes ist – aber ein wenig Raum müsst ihr mir gönnen, um das Gute zu betrauern, das uns verloren gehen wird.
An unserer Schule stand Rosa für Frühling und Sommer, Violett für Herbst und Winter, Weiß für besondere Tage: Sonntage und Feierlichkeiten. Bedeckte Arme, bedecktes Haar, die Röcke bis zum fünften Geburtstag knielang und danach höchstens eine Handbreit über dem Knöchel, denn die Begierden der Männer waren etwas Schreckliches, und diese Begierden mussten in Schach gehalten werden. Die Männeraugen, die immer hierhin schweiften und dorthin schweiften wie die Augen eines Tigers, diese Scheinwerferaugen mussten abgeschirmt werden von der betörenden und wahrhaft blendenden Macht, die wir waren – von unseren wohlgeformten oder dünnen oder dicken Beinen, von unseren anmutigen oder knubbligen oder wurstförmigen Armen, von unserer Pfirsichhaut oder unserem fleckigen Teint, von unseren glänzenden Locken oder unseren störrischen Mähnen oder unseren strohigen Zöpfen, es spielte keine Rolle. Wie wir auch aussehen mochten, ob wir wollten oder nicht, wir waren Fallstrick und Verlockung, wir waren die unschuldige und schuldlose Ursache dafür, dass wir allein durch unser Dasein die Männer trunken machen konnten vor Lust, bis sie ins Taumeln gerieten und in den Abgrund stürzten – in welchen Abgrund eigentlich?, fragten wir uns, war es wie eine Klippe? – und in Flammen aufgehen würden wie Schneebälle aus brennendem Schwefel, geschleudert von der zornigen Hand Gottes. Wir waren die Wächterinnen einer unschätzbaren Kostbarkeit, die tief in uns verborgen lag; wir waren kostbare Blumen, die in sicheren Gewächshäusern erblühen mussten, um nicht überfallen und entblättert und unseres Schatzes beraubt und zertrampelt zu werden von ausgehungerten Männern, die hinter jeder Ecke lauern könnten dort draußen in der scharfkantigen, sündenvollen Welt.
Solcherlei Dinge erzählte uns die schniefende Tante Vidala in der Schule, während wir Stickereien anfertigten für Taschentücher und Fußschemel und Bilder: Blumen in einer Vase, Früchte in einer Schale, das waren die bevorzugten Motive. Tante Estée, unsere Lieblingslehrerin, sagte immer, Tante Vidala übertreibe und es sei unvernünftig, uns in Angst und Schrecken zu versetzen, denn derart anerzogene Aversionen könnten sich negativ auf unser künftiges Eheleben auswirken.
»Es sind nicht alle Männer so, ihr Mädchen«, sagte sie mit beruhigender Stimme. »Die Besseren haben einen eher guten Charakter. Einige können sich durchaus beherrschen. Und wenn ihr erst mal verheiratet seid, werdet ihr sehen, es ist alles halb so wild und gar nicht so furchteinflößend.« Nicht, dass sie irgendeine Ahnung gehabt hätte, denn die Tanten waren nicht verheiratet; sie durften nicht heiraten. Das war der Grund, weshalb sie schreiben und Bücher lesen konnten.
»Wenn die Zeit gekommen ist, werden wir und eure Väter und Mütter eure Ehemänner weise wählen«, pflegte Tante Estée zu sagen. »Ihr braucht also keine Angst zu haben. Seid einfach schön fleißig und vertraut den Älteren, dass sie tun werden, was am besten ist, und alles wird gut. Ich werde dafür beten.«
Aber trotz Tante Estée mit ihren Grübchen und ihrem freundlichen Lächeln war es Tante Vidalas Version, die sich durchsetzte und in meinen Albträumen auftauchte: die eingeschlagenen Scheiben des Gewächshauses, das Zerreißen und Zerfetzen und das Trampeln der Hufe, und wie ich in Form von rosafarbenen, weißen und violetten Bruchstücken überall verstreut bin. Mir graute vor dem Gedanken, älter zu werden – alt genug zum Heiraten. Ich hatte kein Vertrauen in die weisen Entscheidungen der Tanten: Ich hatte Angst, am Ende mit einem brennenden Ziegenbock vermählt zu werden.
Die rosafarbenen, weißen und violetten Kleider waren Vorschrift für besondere Mädchen wie uns. Gewöhnliche Mädchen aus Ökonofamilien hatten immer das Gleiche an – diese hässlichen mehrfarbigen Streifen und grauen Umhänge, genau wie die Sachen ihre Mütter. Sie lernten nicht einmal sticken oder häkeln, nur Nähen und Seidenblumen basteln und derlei Pflichten. Sie kamen nicht so wie wir in die Schar der Auserwählten, um mit den allerbesten Männern verheiratet zu werden – den Söhnen Jakobs und den übrigen Kommandanten oder deren Söhnen –; wobei sie später noch auserwählt werden konnten, wenn sie älter waren, vorausgesetzt, sie waren hübsch genug.
Das sagte aber niemand. Man sollte sich nicht brüsten mit seinem guten Aussehen, das war unbescheiden, oder das gute Aussehen anderer zur Kenntnis nehmen. Aber wir Mädchen wussten Bescheid: Es war besser, hübsch zu sein als hässlich. Sogar die Tanten schenkten den Hübschen mehr Beachtung. War man aber schon in der Vorauswahl, spielte das Aussehen keine so große Rolle mehr.
Ich schielte nicht wie Huldah, ich hatte kein dauerhaft verkniffenes Gesicht wie Shunammite, ich hatte keine fast unsichtbaren Augenbrauen wie Becka, aber ich war noch unfertig. Ich hatte ein Teiggesicht wie die Kekse, die Zilla, meine Lieblings-Martha, mir zur Belohnung backte, mit den Rosinenaugen und den Kürbiskernzähnen. Aber trotz meiner nur durchschnittlichen Schönheit war ich sehr, sehr auserwählt. Doppelt auserwählt: Nicht nur war ich in der Vorauswahl zur Kommandantenfrau, erst mal war ich von Tabitha auserwählt worden, meiner Mutter.
So hat Tabitha es mir immer erzählt. »Ich ging im Wald spazieren«, sagte sie, »und kam an ein verwunschenes Schloss, und dort waren viele kleine Mädchen gefangen, und keines davon hatte eine Mutter, und sie waren verzaubert von den bösen Hexen. Ich hatte einen Zauberring und konnte damit das Schlosstor öffnen, aber ich konnte nur ein einziges kleines Mädchen retten. Also sah ich sie mir alle genau an, und dann fiel meine Wahl auf dich!«
»Und was wurde aus den anderen?«, fragte ich. »Den anderen kleinen Mädchen?«
»Die wurden von anderen Müttern gerettet«, sagte sie.
»Hatten die auch alle einen Zauberring?«
»Natürlich, mein Liebling. Nur mit einem Zauberring kann man eine Mutter sein.«
»Wo ist der Zauberring?«, fragte ich dann. »Wo ist er jetzt?«
»Na hier, an meinem Finger«, sagte sie und zeigte mir den Mittelfinger ihrer linken Hand. Das sei der Herzfinger, sagte sie. »Aber mein Ring konnte nur einen einzigen Wunsch erfüllen, und den habe ich für dich benutzt. Der Ring ist jetzt also nur noch ein ganz normaler Mutterring.«
Und dann durfte ich den Ring anprobieren, der aus Gold und mit drei Diamanten besetzt war: einem großen und je einem kleineren zu beiden Seiten. Er sah wirklich aus, als wäre er vielleicht mal ein Zauberring gewesen.
»Hast du mich hochgehoben und getragen?«, fragte ich jedes Mal. »Aus dem Wald rausgetragen?« Ich kannte die Geschichte auswendig, aber ich hörte sie gern immer wieder.
»Nein, mein Liebes, dazu warst du schon zu groß. Hätte ich dich getragen, hätte ich husten müssen, und dann hätten uns die Hexen gehört.« Das war einleuchtend: Sie hustete wirklich ziemlich viel. »Also nahm ich dich an der Hand, und wir haben uns aus dem Schloss geschlichen, damit uns die Hexen nicht hören – Pst, Pst, haben wir beide gemacht –, und sie hielt sich den Finger an die Lippen, und auch ich hielt mir begeistert den Finger an die Lippen und machte Pst. »Und dann mussten wir ganz schnell durch den Wald laufen, um den bösen Hexen zu entkommen, denn eine davon hatte uns aus der Tür gehen sehen. Wir sind gerannt, und dann haben wir uns in einem hohlen Baum versteckt. Es war sehr gefährlich!«
Ich hatte tatsächlich eine verschwommene Erinnerung daran, an jemandes Hand durch einen Wald zu laufen. Hatte ich mich in einem hohlen Baum versteckt? Mir schien, als hätte ich mich irgendwo versteckt. Also stimmte die Geschichte vielleicht.
»Und was ist dann passiert?«, fragte ich.
»Und dann habe ich dich in dieses schöne Haus gebracht. Bist du nicht glücklich hier? Wo dich alle so sehr lieb haben! Was für ein Glück für uns beide, dass ich dich auserwählt habe, nicht wahr?«
Dann schmiegte ich mich an sie, sie legte den Arm um mich, und ich lag mit dem Kopf an ihrem dünnen Körper, durch den ich ihre knochigen Rippen spüren konnte. Ich drückte mein Ohr an ihren Brustkorb und konnte ihr Herz hören, wie es in ihrem Innern vor sich hin hämmerte – immer schneller und schneller, schien mir, während sie auf eine Reaktion von mir wartete. Ich wusste, meine Antwort war wirksam: Ich konnte sie zum Lächeln bringen oder auch nicht.
Was konnte ich da anderes sagen als Ja und Ja? Ja, ich war glücklich. Ja, ich hatte Glück gehabt. Außerdem war es die Wahrheit.
3
Wie alt war ich damals? Vielleicht sechs oder sieben. Ich kann es nicht genau sagen, weil ich keine klaren Erinnerungen an die Zeit davor habe.
Ich liebte Tabitha sehr. Sie war extrem dünn, aber trotzdem schön, und sie spielte stundenlang mit mir. Wir hatten ein Puppenhaus, das unserem Haus ähnelte, mit Wohnzimmer und Esszimmer und einer großen Küche für die Marthas und einem Arbeitszimmer für den Vater mit Schreibtisch und Bücherregal, wobei die vielen kleinen Büchlein in den Regalen nur Attrappen waren. Ich fragte, warum die Seiten der Bücher weiß seien – ich ahnte, dass auf diesen Seiten sonst schwarze Zeichen waren –, und meine Mutter sagte, Bücher seien nur Dekoration, so wie Blumenvasen.
Was für Lügen sie mir auftischen musste! Um mich zu schützen! Aber sie konnte das. Sie war sehr erfinderisch.
Wir hatten im Obergeschoss des Puppenhauses schöne große Zimmer mit Vorhängen und Tapete und Bildern – hübsche Bilder von Früchten und Blumen –, und im Dachgeschoss waren kleinere Zimmer, und es gab fünf Badezimmer insgesamt, wobei eins davon einen Schminktisch hatte – woher kam dieses Wort? Was war das, »Schminke«? –, und einen Keller voller Vorräte.
Wir hatten für das Puppenhaus alle Puppen, die man brauchte: eine Mutterpuppe im blauen Kleid der Kommandantenfrauen, eine Mädchenpuppe mit drei Kleidern – rosa, weiß und violett, genau wie meine –, drei Marthapuppen in Mattgrün und mit Schürze, einen Wächter des Glaubens mit Kappe, der das Auto fuhr und den Rasen mähte, zwei Engel, die mit ihren Miniplastikgewehren am Tor standen, um jeden aufzuhalten, der eindringen und uns wehtun wollte, und eine Vaterpuppe in seiner steifen Kommandantenuniform. Er sagte wenig, lief aber viel auf und ab und saß am Ende des Esstischs, und die Marthas brachten ihm Sachen auf Tabletts, und danach ging er in sein Arbeitszimmer und schloss die Tür.
Insofern war die Kommandantenpuppe wie mein eigener Vater, Kommandant Kyle, der mich anlächelte und fragte, ob ich brav gewesen sei, um dann von der Bildfläche zu verschwinden. Der Unterschied war, dass ich sehen konnte, was die Kommandantenpuppe in ihrem Arbeitszimmer machte, nämlich mit dem CompuTalk und einem Stapel Unterlagen am Schreibtisch sitzen, aber bei meinem Vater im echten Leben hatte ich keine Ahnung: Es war verboten, sein Arbeitszimmer zu betreten.
Das, was mein Vater da drin machte, war angeblich etwas sehr Wichtiges – die wichtigen Dinge, die Männer eben machten, zu wichtig für Frauen, für die das nichts war, denn sie hatten ein kleineres Gehirn und waren unfähig zu großen Gedanken, behauptete Tante Vidala, bei der wir Religionsunterricht hatten. Es wäre so, als wollte man einer Katze das Häkeln beibringen, sagte Tante Estée, bei der wir Handarbeiten hatten, und darüber mussten wir immer lachen, denn so ein Quatsch! Katzen hatten ja nicht mal Finger!
Also hatten Männer so etwas wie Finger im Kopf, aber eben eine Art von Fingern, die Mädchen nicht hatten. Und das erkläre alles, sagte Tante Vidala, und jetzt keine Fragen mehr zu diesem Thema. Ihr Mund klappte zu und sperrte jedes zusätzliche Wort, das hätte gesagt werden können, ein. Ich wusste, dass es noch weitere Worte geben musste, denn selbst damals schien mir das mit der Katze irgendwie nicht richtig. Katzen wollten gar nicht häkeln. Und wir waren keine Katzen.
Verbotene Dinge sind anfällig für die Fantasie. Deswegen habe Eva den Apfel der Erkenntnis gegessen, sagte Tante Vidala: zu viel Fantasie. Es war also besser, manche Dinge nicht zu wissen. Sonst würden unsere Blütenblätter überallhin verstreut.
Im Puppenhauskarton befand sich auch eine Magdpuppe im roten Kleid mit rundem Bauch und weißer Haube, die ihr Gesicht bedeckte, aber meine Mutter sagte, wir bräuchten in unserem Haus keine Magd, wir hätten ja schon mich, und man solle nicht gierig sein und mehr wollen als ein kleines Mädchen. Also wickelten wir die Magd in Seidenpapier, und Tabitha sagte, ich könne sie irgendwann einmal einem anderen kleinen Mädchen schenken, das nicht so ein schönes Puppenhaus hatte und die Magdpuppe gebrauchen könnte.
Ich legte die Magd gern in den Karton zurück, denn die echten Mägde waren mir nicht geheuer. Auf unseren Schulausflügen kamen wir an ihnen vorbei, wenn wir in langer Zweierreihe unterwegs waren, an jedem Ende eine Tante. Wir besuchten dann eine Kirche oder einen der Parks, wo wir Kreisspiele spielten oder uns die Enten im Teich ansahen. Später würden wir in unseren weißen Kleidern und Schleiern zu Errettungen und Betvaganzas gehen dürfen, um zu sehen, wie Leute gehängt werden oder heiraten, aber dafür seien wir noch nicht erwachsen genug, sagte Tante Estée.
In einem der Parks standen Schaukeln; aber wegen unserer Röcke, die vom Wind hätten hochgeweht werden und Einblick hätten gewähren können, durften wir ans Schaukeln nicht einmal denken. Nur Jungen durften sich solche Freiheiten leisten, nur sie durften schaukeln und schweben und fliegen, nur sie durften sich in die Lüfte heben.
Ich habe bis heute nicht auf einer Schaukel gesessen. Es ist und bleibt einer meiner sehnlichsten Wünsche.
Wenn wir die Straße so entlangmarschierten, waren immer die Mägde unterwegs, paarweise mit ihren Einkaufskörben. Sie sahen uns nicht an, oder nicht genauer, nicht direkt, und ebenso wenig sollten wir sie ansehen, denn es sei unhöflich, sie anzustarren, sagte Tante Estée, so, wie es unhöflich war, einen Krüppel anzustarren oder sonst jemanden, der anders war. Wir durften auch keine Fragen stellen zu den Mägden.
»All das lernt ihr, wenn ihr alt genug seid«, sagte Tante Vidala immer. All das; die Mägde waren Teil davon. Irgendetwas Schlimmes also; irgendetwas Schädliches oder Schadhaftes, was möglicherweise ein und dasselbe war. Waren die Mägde früher so gewesen wie wir, weiß und rosa und violett? Hatten sie nicht aufgepasst, hatten sie eines ihrer aufreizenden Körperteile hervorlugen lassen?
Jetzt sah man eher wenig von ihnen. Man konnte nicht einmal ihre Gesichter erkennen, wegen dieser weißen Hauben. Alle sahen gleich aus.
Zu Hause in unserem Puppenhaus gab es eine Tantenpuppe, obwohl sie eigentlich nicht in ein Haus gehörte, sie gehörte in eine Schule oder aber nach Haus Ardua, wo die Tanten angeblich wohnten. Wenn ich allein mit dem Puppenhaus spielte, sperrte ich die Tantenpuppe in den Keller, was nicht sehr nett von mir war. Sie hämmerte und hämmerte gegen die Kellertür und rief »Lass mich raus«, aber die Mädchenpuppe und die Marthapuppe, die ihr geholfen hatte, beachteten sie gar nicht, und manchmal lachten sie.
Während ich dieses grausame Verhalten schildere, bin ich alles andere als zufrieden mit mir, auch wenn es nur gegen eine Puppe gerichtet war. Da ist eine gehässige Seite an mir, die ich leider nie ganz habe bezwingen können. Doch in so einem Bericht sollte man seine Fehler gewissenhaft zu Protokoll zu geben und auch alles andere. Sonst wird niemand verstehen, warum man bestimmte Entscheidungen getroffen hat.
Es war meine Mutter, Tabitha, die mir beibrachte, ehrlich zu mir selbst zu sein, was ein wenig erstaunlich klingt angesichts der Lügen, die sie mir erzählte. Der Gerechtigkeit halber muss ich sagen, dass sie wahrscheinlich immerhin zu sich selbst ehrlich war. Sie versuchte – glaube ich –, ein so guter Mensch wie möglich zu sein, unter den gegebenen Umständen.
Jeden Abend erzählte sie mir eine Geschichte, und dann brachte sie mich mit meinem Lieblingsplüschtier ins Bett – es war ein Wal, weil Gott den Wal zum Spielen im Meer geschaffen hatte, also konnte man einen Wal getrost zum Spielen benutzen –, und dann beteten wir.
Das Gebet war in Form eines Lieds, und wir sangen es gemeinsam.
Lieber Herrgott, gute Nacht,
Gib auf meine Seele acht;
Doch soll mein Leben schlafend enden,
so weiß ich sie in deinen Händen.
An meinem Bett vier Engel stehen
Sie wachen in der Dunkelheit,
Zwei beten und zwei sind bereit
Um meine Seele mitzunehmen.
Tabitha hatte eine sehr schöne Stimme, wie ein silberne Flöte. Noch heute meine ich sie manchmal abends beim Einschlafen singen zu hören.
Ein paar Dinge störten mich an diesem Lied. Erstens die Engel. Gemeint waren natürlich die Engel im weißen Nachthemd mit Flügeln, aber die stellte ich mir nicht vor. Ich stellte mir unsere Engel vor; Männer in schwarzen Uniformen mit aufgenähten Stoffflügeln und Gewehren. Vier Engel mit Gewehr, die um mein Bett stehen, während ich schlafe – kein schöner Gedanke, immerhin waren es Männer, was war also mit den Teilen meines Körpers, die unter meiner Bettdecke hervorschauen könnten? Meine Füße zum Beispiel. Würde das nicht ihre Lüsternheit schüren? So wäre es, wie sollte es anders sein. Die vier Engel waren also kein beruhigender Gedanke.
Außerdem war es nicht sehr aufmunternd, in einem Gebet davon zu reden, im Schlaf zu sterben. Ich hielt es zwar für unwahrscheinlich, aber wenn nun doch? Und was war meine Seele – dieses Ding, das von den Engeln mitgenommen würde? Tabitha erklärte mir, die Seele sei das Geistige, das nicht zusammen mit dem Körper stirbt, womit sie mich wohl aufheitern wollte.
Aber wie sah sie aus, meine Seele? Ich stellte sie mir wie ein Abbild meiner selbst vor, nur sehr viel kleiner. So klein wie die Mädchenpuppe aus meinem Puppenhaus. Sie war in mir drin, vielleicht war sie also dasselbe wie der kostbare Schatz, den wir laut Tante Vidala so sorgsam hüten mussten. Die Seele konnte einem auch abhandenkommen, sagte Tante Vidala und schnäuzte sich in ihr Taschentuch, und in dem Fall würde sie über die Klippe rollen und endlos in die Tiefe stürzen und Feuer fangen, genau wie die Ziegenböcke. Und das wollte ich um jeden Preis vermeiden.
4
Zu Beginn des nächsten Zeitabschnitts, den ich gleich schildern werde, muss ich anfangs acht gewesen sein oder auch neun. An die Ereignisse kann ich mich erinnern, aber nicht an mein genaues Alter. Es ist schwer, sich an exakte Daten zu erinnern, wenn man, so wie wir, keine Kalender hat. Aber ich werde weitererzählen, so gut ich kann.
Mein Name war damals Agnes Jemima. Agnes bedeutet Lamm, sagte Tabitha, meine Mutter. Sie sagte immer ein bestimmtes Gedicht auf:
Lämmlein, wer hat dich gemacht?
Wer hat dich auf die Welt gebracht?
Das Gedicht ging noch weiter, aber ich habe es vergessen.
Und Jemima – dieser Name stammt aus der Bibel. Jemima war ein ganz besonderes kleines Mädchen, denn Gott schickte ihrem Vater Hiob großes Unglück, um ihn zu prüfen, und das Schlimmste daran war, dass alle Kinder Hiobs getötet wurden. All seine Söhne, all seine Töchter, alle tot! Bei dieser Geschichte liefen mir jedes Mal kalte Schauer über den Rücken. Diese Botschaft muss für Hiob schrecklich gewesen sein.
Aber Hiob bestand die Prüfung, und Gott schenkte ihm neue Kinder – mehrere Söhne und auch drei Töchter –, also wurde er wieder froh. Und Jemima war eine dieser Töchter. »Gott schenkte sie Hiob, so, wie du mir von Gott geschenkt wurdest«, sagte meine Mutter.
»Hattest du denn Unglück? Bevor du mich auserwählt hast?«
»Ja, das hatte ich«, sagte sie lächelnd.
»Hast du die Prüfung bestanden?«
»Muss ich wohl«, sagte meine Mutter. »Sonst hätte ich mir nicht so eine wundervolle Tochter wie dich aussuchen dürfen.«
Diese Geschichte gefiel mir. Erst später dachte ich genauer darüber nach: Wie konnte sich Hiob von Gott einfach eine neue Ladung Kinder andrehen lassen und dann auch noch so tun müssen, als wären die toten völlig egal?
Wenn ich nicht gerade in der Schule oder bei meiner Mutter war – und ich war immer seltener bei meiner Mutter, denn immer öfter war sie oben und lag auf ihrem Bett und »ruhte sich aus«, wie die Marthas sagten –, hielt ich mich gern in der Küche auf und sah den Marthas beim Backen von Brot und Brötchen und Torten und Kuchen und beim Zubereiten von Suppen und Eintöpfen zu. Alle Marthas liefen unter dem Namen Martha, denn das waren sie ja schließlich, und sie trugen alle die gleiche Kleidung, aber jede Martha hatte zudem einen Vornamen. Unsere hießen Vera, Rosa und Zilla; wir hatten drei Marthas, weil mein Vater so wichtig war. Zilla war meine Lieblings-Martha, weil sie mit sehr sanfter Stimme sprach, wogegen Vera immer barsch klang und Rosa ein mürrisches Gesicht hatte. Dafür konnte sie aber nichts, ihr Gesicht war einfach so. Sie war älter als die anderen beiden.
»Kann ich helfen?«, fragte ich unsere Marthas. Und sie gaben mir etwas Brotteig zum Spielen, und ich formte einen Mann aus Teig, und sie backten ihn im Ofen zusammen mit dem, was sonst gerade gebacken wurde. Aus dem Teig formte ich immer nur Männer, niemals Frauen, denn sobald sie aus dem Ofen kamen, aß ich sie auf, und das gab mir das Gefühl, insgeheim Macht über Männer zu haben. Allmählich wurde mir nämlich klar, dass ich trotz der Lüsternheit, die ich laut Tante Vidala in ihnen weckte, überhaupt keine Macht über sie hatte.
»Kann ich auch allein Brot backen?«, fragte ich eines Tages, als Zilla die Schüssel hervorholte, um mit dem Mischen der Zutaten anzufangen. Ich hatte ihnen so oft dabei zugesehen, dass ich von meinem Können überzeugt war.
»Lass mal, das hast du nicht nötig«, sagte Rosa noch mürrischer als sonst.
»Warum?«
Vera lachte ihr barsches Lachen. »Für so was wirst du deine Marthas haben«, sagte sie. »Wenn sie dir erst mal einen schönen fetten Ehemann ausgesucht haben.«
»Der wird nicht fett sein.« Ich wollte keinen fetten Ehemann.
»Natürlich nicht. Das sagt man nur so«, sagte Zilla.
»Du wirst auch nicht einkaufen gehen müssen«, sagte Rosa. »Das macht deine Martha. Oder vielleicht deine Magd, wenn du denn eine brauchst.«
»Sie braucht vielleicht keine«, sagte Vera. »Wenn man bedenkt, wer ihre Mutter …«
»Sei still«, sagte Zilla.
»Was?«, fragte ich. »Was ist mit meiner Mutter?« Ich wusste, dass meine Mutter ein Geheimnis umgab – es hatte damit zu tun, wie die Marthas ausruhen sagten –, und es machte mir Angst.
»Es ist nur so, deine Mutter konnte selbst ein Baby bekommen«, sagte Zilla sachte, »also wirst du es wahrscheinlich auch können. Du hättest doch gern ein Baby, nicht wahr, Liebes?«
»Ja«, sagte ich, »aber keinen Ehemann. Die finde ich eklig.« Die drei lachten.
»Aber nicht alle«, sagte Zilla. »Dein Vater ist ein Ehemann.«
Dagegen konnte ich schlecht etwas einwenden.
»Die sorgen schon dafür, dass es ein netter Mann ist«, sagte Rosa. »Nicht irgendein dahergelaufener Kerl.«
»Die haben ja ihren Stolz«, sagte Vera. »Die werden dich standesgemäß vermählen, so viel steht fest.«
Ich wollte nicht mehr über Ehemänner nachdenken. »Wenn ich es aber will?«, fragte ich. »Mein eigenes Brot backen?« Ich war gekränkt: Es war, als würden sie einen Kreis um sich ziehen, um mich auszugrenzen. »Was ist denn, wenn ich mein eigenes Brot backen will?«
»Na ja, natürlich, deine Marthas würden dich nicht davon abhalten dürfen«, sagte Zilla freundlich. »Du wärst ja die Herrin des Hauses. Aber du würdest in ihrer Achtung sinken. Und sie würden das Gefühl haben, du wolltest ihnen ihre Position streitig machen. Alles, was sie am besten können. Du würdest doch nicht wollen, dass sie das von dir denken, nicht wahr, Liebes?«
»Deinem Mann würde es auch nicht gefallen«, sagte Vera mit einem weiteren barschen Lacher. »Es ist schlecht für die Hände. Guck dir meine an!« Sie hielt sie mir hin. Ihre Finger waren knorrig, die Haut war rau, die Nägel kurz mit eingerissener Nagelhaut – ganz anders als die schlanken, eleganten Hände meiner Mutter mit ihrem Zauberring. »Hausarbeit ist schlecht für die Hände. Er wird nicht wollen, dass du nach Brotteig riechst.«
»Oder nach Chlor«, sagte Rosa. »Vom Schrubben.«
»Er wird wollen, dass du dich ans Sticken und dergleichen hältst«, sagte Vera.
»Petit Point«, sagte Rosa. In ihrer Stimme lag Spott.
Stickerei gehörte nicht gerade zu meinen Stärken. Ständig wurde ich wegen meiner lockeren und unsauberen Stiche kritisiert. »Petit Point finde ich grässlich. Ich will Brot backen.«
»Wir können nicht immer machen, was wir wollen«, sagte Zilla mit sanfter Stimme. »Nicht mal du.«
»Und manchmal müssen wir Dinge tun, die wir grässlich finden«, sagte Vera. »Sogar du.«
»Aber ihr sollt mich davor beschützen!«, sagte ich. »Ihr seid gemein!« Und ich rannte aus der Küche.
Mittlerweile war ich in Tränen aufgelöst. Obwohl ich meine Mutter nicht stören sollte, schlich ich mich nach oben in ihr Zimmer. Sie lag unter ihrer hübschen weißen Bettdecke mit den blauen Blümchen. Sie hatte die Augen zu, musste mich aber gehört haben, denn sie schlug sie auf. Jedes Mal, wenn ich sie sah, wirkten diese Augen größer und glänzender.
»Was ist los, mein Hase?«, fragte sie.
Ich kroch unter die Bettdecke und kuschelte mich an sie. Sie war sehr warm.
»Das ist unfair«, sagte ich schluchzend. »Ich will nicht heiraten! Warum muss ich das denn?«
Sie sagte nicht Weil es deine Pflicht ist, was Tante Vidala gesagt hätte, oder Du wirst es wollen, wenn es so weit ist. Sie sagte erst mal gar nichts. Stattdessen drückte sie mich an sich und strich mir übers Haar.
»Weißt du noch, wie ich dich auserwählt habe«, sagte sie, »aus all den anderen?«
Doch inzwischen war ich alt genug, um nicht mehr an die Auserwähltengeschichte zu glauben: das verwunschene Schloss, den Zauberring, die bösen Hexen, die Flucht. »Das ist nur ein Märchen«, sagte ich. »Ich bin aus deinem Bauch gekommen, genau wie die anderen Babys.« Sie stimmte mir nicht zu. Sie sagte nichts. Aus irgendeinem Grund machte mir das Angst.
»Bin ich doch! Oder?«, fragte ich. »Shunammite hat’s mir erzählt. In der Schule. Das mit den Bäuchen.«
Meine Mutter umarmte mich noch fester. »Was auch geschehen mag«, sagte sie nach einer Weile, »vergiss nie, dass ich dich sehr lieb gehabt habe.«
5
Wahrscheinlich könnt ihr euch schon denken, was ich euch als Nächstes berichte, leider nichts Schönes.
Meine Mutter lag im Sterben. Alle wussten Bescheid, nur ich nicht.
Ich erfuhr es von Shunammite, die angeblich meine beste Freundin war. Eigentlich sollten wir keine besten Freundinnen haben. Es sei nicht nett, geschlossene Kreise zu bilden, sagte Tante Estée: Es gebe anderen Mädchen das Gefühl, ausgegrenzt zu sein, und wir sollten doch alle einander helfen, so perfekte Mädchen wie möglich zu sein.
Tante Vidala sagte, beste Freundinnen führten zu Getuschel und Verschwörungen und Geheimnissen, und Verschwörungen und Geheimnisse führten zu Ungehorsam gegenüber Gott, und Ungehorsam führe zu Rebellion, und Mädchen, die rebellisch seien, würden zu Frauen, die rebellisch seien, und eine rebellische Frau sei schlimmer als ein rebellischer Mann, denn rebellische Männer würden zu Verrätern, rebellische Frauen aber zu Ehebrecherinnen.
Da meldete sich Becka mit ihrer Piepsstimme zu Wort und fragte, was das sei, eine Ehebrecherin. Wir Mädchen wunderten uns alle, denn Becka stellte ganz selten Fragen. Ihr Vater war kein Kommandant wie unsere Väter, sondern nur Zahnarzt. Aber er war der allerbeste Zahnarzt, und unsere Familien gingen alle zu ihm, weswegen Becka unsere Schule besuchen durfte, aber es hieß auch, dass die Mädchen auf sie herabsahen und wollten, dass sie vor ihnen kuschte.
Becka saß neben mir – sie versuchte immer, den Platz neben mir zu ergattern, sofern sie nicht von Shunammite weggedrängt wurde –, und ich merkte, wie sie zitterte. Ich hatte Angst, Tante Vidala werde sie bestrafen, weil sie unverschämt gewesen war, wobei es jedem schwergefallen wäre, auch Tante Vidala, sie so zu nennen.
Shunammite beugte sich über mich hinweg und flüsterte Becka zu: Bist du blöd oder was? Tante Vidala lächelte unentwegt und sagte, Becka werde es hoffentlich nie am eigenen Leib erfahren, denn alle Ehebrecherinnen würden gesteinigt oder kämen mit einem Sack über dem Kopf an den Galgen. Tante Estée sagte, es bestehe kein Grund, den Mädchen unnötig Angst zu machen; und dann lächelte sie und sagte, wir seien doch kostbare Blumen, und eine rebellische Blume, wo gebe es denn so was?
Wir sahen sie an und machten unsere Augen so rund wie möglich, als Zeichen unserer Unschuld, und wir nickten, um unsere Zustimmung zu zeigen. Hier gab es keine rebellischen Blumen, hier bestimmt nicht!
Bei Shunammite gab es nur eine Martha, und wir hatten drei, also war mein Vater wichtiger als ihrer. Heute ist mir klar, dass sie mich deswegen als beste Freundin wollte. Sie war ein stämmiges Mädchen mit zwei langen, dicken Zöpfen, um die ich sie beneidete, weil meine eigenen Zöpfe dünner und kürzer waren, und mit schwarzen Augenbrauen, die sie erwachsener wirken ließen, als sie war. Sie war aufsässig, aber nur hinter dem Rücken der Tanten. Bei unseren Streitigkeiten musste sie immer recht behalten. Widersprach man ihr, wiederholte sie ihre ursprüngliche Meinung, nur lauter. Sie war zu vielen anderen Mädchen grob, vor allem zu Becka, und zu meiner Beschämung muss ich sagen, dass ich es nicht geschafft habe, sie in die Schranken zu weisen. Im Umgang mit gleichaltrigen Mädchen war ich willensschwach, auch wenn ich zu Hause bei den Marthas als Sturkopf galt.
»Deine Mutter liegt im Sterben, stimmt’s?«, flüsterte mir Shunammite eines Tages in der Mittagspause zu.
»Nein, das stimmt nicht«, flüsterte ich zurück. »Sie ist nur leidend!« So formulierten es die Marthas: Deine Mutter ist leidend. Ihr Leiden war der Grund, weshalb sie sich so viel ausruhen sollte und ständig husten musste. In letzter Zeit brachten die Marthas ihr immer ein Tablett hinauf in ihr Zimmer, doch die Tabletts kamen zurück, und das Essen war kaum angerührt worden.
Ich durfte sie nur noch selten besuchen. Und wenn doch, lag ihr Zimmer im Halbdunkel. Es roch nicht mehr nach ihr, ein leichter süßer Duft wie die Herzblattlilien in unserem Garten, sondern so, als ob sich irgendein vergammelter und verdreckter Fremder ins Zimmer geschlichen und unterm Bett versteckt hätte.
Ich saß bei meiner Mutter, wo sie zusammengekrümmt unter ihrer mit blauen Blumen bestickten Bettdecke lag, und ich hielt ihr die schmale linke Hand mit dem Zauberring und fragte sie, wann denn ihr Leiden wieder weggehen werde, und sie sagte, sie bete zu Gott, dass die Schmerzen bald überstanden seien. Da war ich beruhigt, denn dann wäre sie ja bald wieder gesund. Danach fragte sie mich immer, ob ich brav gewesen sei und ob ich glücklich sei, und ich sagte jedes Mal Ja, und sie drückte mir die Hand und bat mich, mit ihr zu beten, und wir sangen das Lied mit den Engeln, die an ihrem Bett stehen. Und dann bedankte sie sich und sagte, genug für heute.
»Doch, sie stirbt«, flüsterte Shunammite. »Das ist ihr Leiden. Sie stirbt!«
»Gar nicht wahr«, flüsterte ich zu laut. »Es geht ihr schon besser. Ihre Schmerzen sind bald überstanden. Sie hat dafür gebetet.«
»Mädchen«, sagte Tante Estée. »Zur Mittagszeit sind unsere Münder zum Essen da, und wir können nicht gleichzeitig reden und kauen. Sollten wir uns nicht glücklich schätzen, so gutes Essen zu haben?« Es waren Sandwiches mit Eiersalat, die ich normalerweise mochte. Aber nun konnte ich nicht einmal den Geruch ertragen.
»Ich weiß es von meiner Martha!«, flüsterte Shunammite, als Tante Estée mit ihrer Aufmerksamkeit woanders war. »Und sie von deiner Martha. Also stimmt es.«
»Von welcher?«, fragte ich. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass irgendeine unserer Marthas so illoyal sein und verbreiten könnte, meine Mutter läge im Sterben – nicht mal die mürrische Rosa.
»Woher soll ich wissen, welche es war? Eine Martha ist doch wie die andere«, sagte Shunammite und warf ihre dicken Zöpfe zurück.
An diesem Nachmittag, nachdem ich von unserem Wächter von der Schule abgeholt und nach Hause gebracht worden war, ging ich in die Küche. Zilla rollte gerade Teig aus, Vera zerlegte ein Hähnchen. Auf der hinteren Herdplatte stand ein köchelnder Suppentopf: die überschüssigen Hähnchenteile kamen immer in die Suppe und alle Gemüsereste und Knochen. Unsere Marthas gingen sehr sparsam mit Lebensmitteln um, sie warfen nie etwas achtlos weg.
Rosa stand drüben am großen doppelten Spülstein und spülte Geschirr. Wir besaßen zwar eine Spülmaschine, aber die Marthas benutzten sie nur nach einem Kommandantenessen, denn die Maschine verbrauche zu viel Strom, sagte Vera, und es gebe Ausfälle wegen des Krieges. Die Marthas nannten ihn manchmal Schneebesenkrieg, weil er Schaumschlägerei war, oder Hesekiels Wagen, weil er planlos durch die Gegend rollte; aber nur, wenn sie unter sich waren.
»Shunammite hat gesagt, eine von euch hätte ihrer Martha erzählt, dass meine Mutter im Sterben liegt«, platzte ich heraus. »Wer hat das gesagt!? Das ist gelogen!«
Alle drei hielten inne. Es war, als hätte ich mit einem Zauberstab gewedelt und sie in Stein verwandelt: Zilla mit erhobenem Nudelholz, Vera mit dem Hackmesser in einer Hand und einem langen blassen Hähnchenhals in der anderen, Rosa mit Servierplatte und Geschirrtuch. Dann wechselten sie einen Blick.
»Wir haben gedacht, du wüsstest es«, sagte Zilla sanft. »Wir dachten, deine Mutter hätte es dir gesagt.«
»Oder dein Vater«, sagte Vera. Das war Unsinn, denn wann hätte das passieren sollen? Er war in letzter Zeit kaum noch zu Hause, und wenn doch, aß er entweder allein im Esszimmer zu Abend oder schloss sich in seinem Arbeitszimmer ein, um wichtige Sachen zu machen.
»Es tut uns sehr leid«, sagte Rosa. »Deine Mutter ist ein guter Mensch.«
»Eine vorbildliche Ehefrau«, sagte Vera. »Sie hat ihr Leiden klaglos auf sich genommen.« Inzwischen war ich am Küchentisch zusammengesunken, hatte die Hände vors Gesicht geschlagen und weinte.
»Wir alle müssen die Prüfungen erdulden, die Gott uns auferlegt«, sagte Zilla. »Wir müssen einfach weiterhoffen.«
Worauf denn, dachte ich. Was blieb denn noch? Alles, was ich sehen konnte, waren Verlust und Dunkelheit.
Am übernächsten Abend starb meine Mutter, auch wenn ich es erst am Morgen erfuhr. Ich war ihr sehr böse, dass sie todkrank gewesen war und mir nichts davon gesagt hatte – wobei sie es mir ja doch gesagt hatte, auf ihre Art: Sie hatte gebetet, dass ihre Schmerzen bald überstanden wären, und ihr Gebet war erhört worden.
Als ich dann nicht mehr wütend war, kam ich mir vor, als wäre mir ein Körperteil abgetrennt worden – ein Stück aus meinem Herzen herausgeschnitten, das bestimmt inzwischen ebenso tot war. Ich hoffte, dass die vier Engel an ihrem Bett echt gewesen waren und über sie gewacht hatten und dass sie ihre Seele sanft davongetragen hatten, genau wie in dem Lied. Ich versuchte, mir vorzustellen, wie sie sie immer höher und höher hinauf in die Lüfte trugen, hinein in eine goldene Wolke. Aber wirklich glauben konnte ich es nicht.
III
Choral
Das Hologramm von Haus Ardua
6
Als ich mich gestern Abend bettfertig machte, löste ich mein Haar oder das, was noch davon übrig ist. Vor einigen Jahren, in einer meiner Erbauungsreden vor den Tanten, da predigte ich wider die Eitelkeit, die uns trotz all unserer Maßnahmen immer wieder befällt. »Im Leben geht es nicht um Haare«, sagte ich damals nur halb im Scherz. Das ist zwar richtig, aber es ist ebenfalls richtig, dass Haare Leben bedeuten. Sie sind die Flamme der Kerze, die unser Körper ist, und wenn sie schwinden, schwindet und vergeht auch der Körper. Früher hatte ich genug Haare für jeden Haarknoten, der gerade in Mode war; heute sind meine Haare wie unsere Mahlzeiten hier in Haus Ardua: spärlich und kurz. Die Flamme meines Leben verlischt, langsamer, als es manchen um mich herum vielleicht lieb ist, aber schneller, als ihnen vielleicht klar ist.
Ich betrachtete mein Spiegelbild. Der Erfinder des Spiegels hat den wenigsten von uns damit einen Gefallen getan: Bevor wir wussten, wie wir aussehen, müssen wir glücklicher gewesen sein. Es könnte schlimmer sein, sagte ich zu mir: Mein Gesicht weist keinerlei Anzeichen von Schwäche auf. Es hat seine ledrige Beschaffenheit behalten, einen markanten Leberfleck auf dem Kinn, seine tiefen Furchen. Ich war nie übertrieben hübsch, aber recht gut aussehend; das lässt sich nun nicht mehr behaupten. Eindrucksvoll könnte man es allenfalls noch nennen.
Wie werde ich enden? Werde ich ein leicht verwahrlostes, hohes Alter erreichen und allmählich verkalken? Werde ich zu meinem eigenen Denkmal werden? Oder wird das Regime mit mir zusammen gestürzt werden und somit auch meine steinerne Replik, um fortgeschleppt und als Kuriosität verkauft zu werden, als überdimensionierter Gartenzwerg?
Oder werde ich als Ungeheuer vor Gericht landen und dann von einem Erschießungskommando hingerichtet und, an einer Straßenlaterne aufgehängt, zur Schau gestellt werden? Werde ich von einem wütenden Mob in Stücke gerissen, wird mein Kopf aufgespießt und zur Belustigung durch die Straßen getragen? Genügend Zorn hätte ich dafür jedenfalls entfacht.
Aber noch habe ich ein Wörtchen mitzureden. Nicht ob ich sterben muss, nur wann und wie. Ist das nicht auch eine Form von Freiheit?
Ach ja, und wer mit mir zugrunde gehen soll. Ich habe schon eine Liste gemacht.
Ich bin mir wohl bewusst, was du, mein Leser, von mir halten wirst; gesetzt den Fall, mein Ruf ist mir vorausgeeilt, und du bist dahintergekommen, wer ich bin – oder war.
Jetzt, zu meiner Zeit, bin ich eine Legende, lebend, aber mehr als lebend, tot, aber mehr als tot. Ich bin ein Kopf, der eingerahmt an der Rückwand der Klassenzimmer derjenigen Mädchen hängt, die hochrangig genug sind, um in den Genuss von Schulbildung zu kommen – grimmig lächelnd, wortlos mahnend. Ich bin ein Kinderschreck, mit dem die Marthas den Kleinen Angst machen: Wenn du dich nicht benimmst, kommt dich Tante Lydia holen! Außerdem bin ich der Inbegriff moralischer Unfehlbarkeit, mit Vorbildfunktion – Was würde Tante Lydia jetzt von dir erwarten? –, und Richterin und Mittlerin bei der trüben Inquisition des Gewissens – Was würde Tante Lydia dazu sagen?
Ja, heute strotze ich vor Macht, bin aber dadurch nebulös geworden – gestaltlos-vielgestaltig. Ich bin überall und nirgends: Selbst in den Köpfen der Kommandanten werfe ich einen beunruhigenden Schatten. Wie kann ich wieder zu mir selbst finden? Wie auf meine normale Größe zurückschrumpfen, auf die Größe einer gewöhnlichen Frau?
Aber womöglich ist es dafür zu spät. Man macht den ersten Schritt, und um sich vor dessen Konsequenzen zu retten, macht man den nächsten. In Zeiten wie unseren gibt es nur zwei Richtungen: aufwärts oder in den Abgrund.
Heute war der erste Vollmond nach dem 21. März. Anderswo auf der Welt werden Lämmer geschlachtet und gegessen; auch Ostereier werden verzehrt, aus Gründen, die mit steinzeitlichen Fruchtbarkeitsgöttinnen zu haben, an die sich niemand mehr erinnern möchte.
Hier in Haus Ardua lassen wir das mit dem Lammfleisch, aber das Eieressen haben wir beibehalten. Zur Feier des Tages erlaube ich, dass sie gefärbt werden, in Babyrosa und Babyblau. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie entzückt die Tanten und Supplikantinnen sind, die sich im Refektorium zum Abendbrot versammelt haben! Unser Speiseplan ist monoton, da ist ein wenig Abwechslung willkommen, und sei sie nur farblich.
Nachdem die Schüsseln mit den pastellfarbenen Eiern hereingetragen und bewundert worden waren, aber bevor wir unser karges Festmahl begannen, sprach ich das übliche Dankesgebet – Herr, segne diese Speise zur rechten Zeit und halte uns auf dem Pfad der Gerechten. Möge der Herr uns öffnen – und anschließend das besondere Frühjahrs-Äquinoktiumsgebet:
So, wie das Jahr übergeht in den Frühling, so mögen sich unsere Herzen öffnen; segne unsere Töchter, segne unsere Ehefrauen; segne unsere Tanten und Supplikantinnen, segne unsere Perlenmädchen bei ihrer Missionsarbeit jenseits der Grenzen und spende unseren Schwestern, den gefallenen Mägden, deine Gnade, erlöse sie durch das Opfer ihres Leibes und ihres Leibes Arbeit nach Deinem Willen.
Und segne die kleine Nicole, die von ihrer Mutter, der abtrünnigen Magd, entführt und im gottlosen Kanada versteckt worden ist; und segne alle Unschuldigen, die wie sie dazu verdammt sind, unter den Frevlern heranzuwachsen. Wir sind in unseren Gedanken und Gebeten bei ihnen. Möge durch Gottes Gnade unsere kleine Nicole zu uns zurückgelangen.
Per Ardua Cum Estrus. Amen.
Es gefällt mir, ein so raffiniertes Motto ausgeheckt zu haben. Steht Ardua für Mühsal oder für die Geburtswehen im Dienste der Arterhaltung? Und bezieht Estrus sich auf das Hormon Östrogen oder auf heidnische Frühjahrsrituale? Den Bewohnerinnen von Haus Ardua ist das unbekannt oder egal. Sie sprechen einfach die richtigen Worte in der richtigen Reihenfolge und sind damit auf der sicheren Seite.
Und dann ist da natürlich noch die kleine Nicole. Während ich für ihre Rückkehr betete, waren sämtliche Blicke auf ihr Bild hinter mir an der Wand gerichtet. Ausgesprochen nützlich ist sie, unsere kleine Nicole: Sie peitscht die Frommen auf, sie schürt den Hass auf unsere Feinde, sie ist Zeugin des möglichen Verrats innerhalb Gileads sowie der Arglist und Schläue der Mägde, denen auf keinen Fall und niemals zu trauen ist. Und ihre Nützlichkeit geht noch weiter, sinnierte ich: In meinen Händen – vorausgesetzt, sie landet dort – würde die kleine Nicole einer leuchtenden Zukunft entgegensehen.
Dergestalt waren meine Gedanken während des abschließenden Chorals, mehrstimmig gesungen von einem Trio unserer jungen Supplikantinnen. Ihre Stimmen waren rein und klar, und wir anderen lauschten voller Verzückung. Du magst denken, was du willst, lieber Leser, aber in Gilead gab es durchaus auch Schönheit. Warum hätten wir keine Schönheit haben wollen? Wir waren doch auch nur Menschen.
Ich merke, dass ich in der Vergangenheitsform von uns gesprochen habe.
Das Lied war eine alte Psalmodie, aber der Text stammte von uns.
In Gottes Aug erstrahlet wohl unser Wahrheit Schein
Wir sehen alle Sünde;
Was geht hinaus, was kommt herein.
Wir merzen jeden Frevel in eurem Herzen aus,
Und beten, weinen, fordern zum Opfer euch heraus.
Auf Demut eingeschworen, fordern wir Fügsamkeit,
Wir stehen stets bereit!
Die bittersten der Pflichten tun wir von Herzen gern,
Wir dienen unserem Herrn!
Frivolität und Freuden weichen dem höchsten Gut:
Selbstlosigkeit und Opfermut.
Banal und reizlos, diese Worte: Das darf ich ruhig sagen, da ich sie selbst verfasst habe. Aber bei solchen Liedern geht es nicht um Poesie. Sie sollen einfach nur die Singenden daran erinnern, welch hohen Preis sie zu zahlen hätten, sollten sie vom rechten Weg abkommen. Wir sind untereinander durchaus unnachsichtig gegenüber den Verfehlungen der anderen, hier in Haus Ardua.
Nach dem Singen begann das Gelage. Mir fiel auf, dass Tante Elizabeth sich ein Ei mehr nahm, als ihr zustand, und dass Tante Helena sich eins weniger nahm und dafür sorgte, dass es ja niemandem entging. Tante Vidala dagegen schniefte in ihre Serviette und ließ dabei ihre rot geränderten Augen zwischen den beiden hin und her schweifen, ehe sie meinem Blick begegnete. Was führt sie im Schilde? In welche Richtung wird die Katze springen?
Nach unserer kleinen Feierlichkeit machte ich meine nächtliche Pilgerfahrt zur Hildegard-Bibliothek im hinteren Teil des Hauses, entlang dem von Mondlicht erhellten Weg und vorbei an meinem schattenhaften Denkmal. Ich ging hinein, ich begrüßte die Nachtbibliothekarin, ich durchquerte den öffentlichen Bereich, wo drei unserer Supplikantinnen mit ihren kürzlich erworbenen Lesekenntnissen kämpften. Ich ging durch den Lesesaal, für den eine höhere Klassifizierung erforderlich ist und wo die Bibeln in ihren verschlossenen Kästchen im Dunkeln vor sich hin brüten, glosend vor zauberkräftiger Macht.
Dann schloss ich eine Tür auf und bahnte mir den Weg durch das Genealogische Archiv der Blutsverwandtschaft mit seinen streng vertraulichen Akten. Es ist von großer Bedeutung, festzuhalten, wer mit wem verwandt ist, sowohl offiziell als auch faktisch: Aufgrund des Mägdesystems muss das Kind eines Paars nicht zwangsläufig mit der Elite-Mutter und noch nicht einmal mit dem Elite-Vater biologisch verwandt sein, denn es kommt durchaus vor, dass eine verzweifelte Magd sich auf anderem Wege um eine Schwangerschaft bemüht. Es ist unsere Aufgabe, dies zu ermitteln, da Inzest unbedingt verhindert werden muss: Wir haben so schon genug Unbabys. Haus Ardua hat außerdem die Aufgabe, dieses Wissen sorgfältig zu hüten: Das Archiv stellt das Herzstück von Haus Ardua dar.
Schließlich erreiche ich mein Privatgemach ganz hinten im Bereich Verbotene Weltliteratur. In meiner Handbibliothek habe ich eine persönliche Auswahl geächteter Bücher zusammengetragen, die für die unteren Ränge tabu sind. Jane Eyre, Anna Karenina, Tess, Das Verlorene Paradies, Kleine Aussichten – Ein Roman von Frauen und Mädchen – welch eine moralische Panik jedes dieser Bücher auslösen würde, ließe man es auf die Supplikantinnen los! Hier verwahre ich noch ein anderes Aktenbündel, das den wenigsten zugänglich ist; diese Papiere nenne ich die Geheime Geschichte von Gilead. Es ist nicht alles Gold, was fault, doch kann es auf nichtmonetären Wegen profitabel gemacht werden: Wissen ist Macht, vor allem diskreditierendes Wissen. Ich bin nicht die Erste, die das erkannt oder nach Kräften Kapital daraus geschlagen hat: Jeder Geheimdienst der Welt hat es schon immer gewusst.
In dieser geschützten Klause nahm ich also mein werdendes Manuskript aus seinem Versteck, einem hohlen Rechteck, das in eines unserer Erwachsenenbücher geschnitten wurde: Kardinal Newman, Apologia Pro Vita Sua. Niemand liest mehr diesen Wälzer, wo der Katholizismus hierzulande als ketzerisch gilt, kaum besser als Voodoo-Zauber, insofern wird wohl keiner einen Blick hineinwagen. Wenn aber doch, heißt das für mich eine Kugel in den Kopf; eine verfrühte Kugel, denn ich bin noch lange nicht bereit zu gehen. Wenn ich meinen Abgang mache, dann bitte mit Pauken und Trompeten.
Meinen Titel habe ich mit Bedacht gewählt, denn was tue ich hier anderes, als mein Leben zu verteidigen? Das Leben, das ich geführt habe. Das Leben – sage ich mir immer –, das ich notgedrungen habe führen müssen. Früher, vor der Einführung des heutigen Regimes, habe ich nie einen Gedanken an die Verteidigung meines Lebens verschwendet. Es kam mir unnötig vor. Ich war Familienrichterin, eine Position, die ich durch jahrzehntelange Schufterei und eifriges Erklimmen der Karriereleiter erlangt hatte, und in dieser Funktion war ich immer so gerecht wie möglich. Ich habe mich nach meiner Vorstellung und im Rahmen der praktischen Möglichkeiten meines Berufs für eine bessere Welt eingesetzt. Ich habe für gute Zwecke gespendet, ich bin auf staatlicher und kommunaler Ebene wählen gegangen, ich habe ehrenhafte Ansichten vertreten. Ich war der Meinung gewesen, ein redliches Leben zu führen; ich war der Meinung gewesen, meine Redlichkeit werde zumindest wohlwollend anerkannt.
Doch dann musste ich erkennen, wie sehr ich mich darin geirrt hatte, genau wie in vielen anderen Dingen – und zwar am Tag meiner Festnahme.
IV
Der Spürhund
Abschrift von Zeugenaussage 369B
7
Ich bin fast wieder gesund, auch wenn die Narbe bleiben wird, sagen sie; und ja, ich denke, das kann ich jetzt schaffen. Ihr habt gesagt, ich soll euch erzählen, wie ich in diese ganze Geschichte hineingeraten bin, ich versuche es also; nur weiß ich nicht genau, wo ich anfangen soll.
Ich werde kurz vor meinem Geburtstag beginnen, genauer gesagt kurz vor dem Tag, von dem ich damals glaubte, er sei mein Geburtstag. Neil und Melanie haben mich da belogen: Sie hatten ihre Gründe und meinten es wirklich nur gut, aber als ich dahinterkam, war ich erst mal sehr wütend auf sie. Es zu bleiben aber war schwierig, denn mittlerweile waren beide tot. Man kann auf Tote wütend sein, aber man kann mit ihnen nie mehr über das reden, was sie getan haben; oder man redet ins Leere. Und ich fühlte mich genauso schuldig wie wütend, weil sie ermordet wurden, und ich glaubte damals, ich sei schuld daran.
Es war mein sechzehnter Geburtstag, angeblich. Am meisten freute ich mich auf meinen Führerschein. Ich fühlte mich zu alt für eine Geburtstagsparty, wobei Melanie immer Torte und Eis für mich besorgte und mir Daisy Bell vorsang, ein altes Lied, das ich als Kind geliebt hatte, inzwischen aber peinlich fand. Die Torte bekam ich dann später – Schokoladentorte, Vanilleeis, meine Lieblingssorten –, bloß konnte ich davon nichts mehr essen. Da war Melanie schon nicht mehr am Leben.
Dieser Geburtstag war der Tag, an dem ich entdeckte, dass ich eine Betrügerin war. Oder nein, keine Betrügerin wie ein schlechter Zauberer: eher gefälscht wie eine falsche Antiquität. Ich war eine absichtliche Nachbildung. Wie jung ich damals war – es scheint gerade einen Wimpernschlag her –, aber heute bin ich nicht mehr jung. Wie schnell sich ein Gesicht verändern kann: Es wird zurechtgeschnitzt wie ein Stück Holz, es wird hart. Schluss mit den großen Augen, Schluss mit der Tagträumerei. Ich wurde schärfer, fokussierter. Ich wurde enger gemacht.
Neil und Melanie waren meine Eltern, sie hatten einen Laden namens Spürhund. Im Grunde verkauften sie gebrauchte Bekleidung, wobei Melanie sagte, die Sachen seien »vorgeliebt«, denn »gebraucht« bedeute »ausgebeutet«. Draußen auf dem Schild war ein rosa Pudel im Rüschenrock mit rosa Schleife auf dem Kopf und Einkaufstasche in der Hand. Darunter stand kursiv und mit Anführungszeichen: »Nicht zu fassen!« Das sollte heißen, die gebrauchte Kleidung sei noch so gut in Schuss, dass man ihr gar nicht ansehe, dass sie gebraucht sei; aber das stimmte überhaupt nicht, die meisten Sachen waren nämlich Schrott.
Melanie sagte, sie habe den Spürhund von ihrer Großmutter geerbt. Sie sagte auch, ihr sei klar, dass das Schild altmodisch sei, die Leute seien das aber so gewohnt und es wäre respektlos, etwas daran zu ändern.
Unser Laden lag auf der Queen West in einem Viertel, wo es früher überall ähnliche Geschäfte gegeben hatte, sagte Melanie – Textilien, Knöpfe und Borten, billige Bettwäsche, Ein-Dollar-Läden. Aber damals wurde die Gegend gerade schick: Cafés mit fair gehandeltem Biokaffee hielten Einzug, Outlets und Boutiquen mit großen Markennamen. Melanie reagierte, indem sie ein Schild ins Fenster hängte: Tragbare Kunst. Dabei war der Laden vollgestopft mit Teilen, die man nie im Leben als tragbare Kunst bezeichnet hätte. Es gab eine Ecke mit – mehr oder minder – Designerklamotten, aber wirklich edle Sachen hätte der Spürhund gar nicht erst im Sortiment gehabt. Der Rest war einfach nur Ramsch. Und alle möglichen Leute kamen und gingen: jung, alt, Schnäppchenjäger, Schatzsucher, die, die nur stöbern wollten. Oder verkaufen: Sogar die Obdachlosen versuchten, sich mit Flohmarkt-T-Shirts ein paar Dollar dazuzuverdienen.