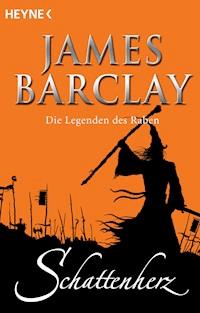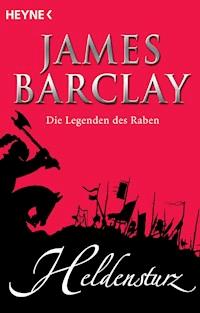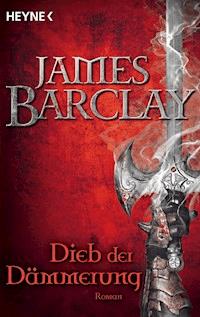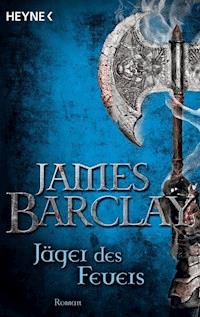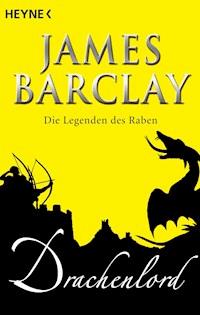
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Legenden des Raben
- Sprache: Deutsch
Ein neues actionreiches Abenteuer vom Star der britischen Fantasy
Die sagenumwobene Gruppe von Söldnern – sechs Krieger und ein Elfenmagier – kämpft erneut in geheimen Missionen für die Freiheit ihrer Heimat Balaia.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 433
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
DIE CHRONIKEN DES RABEN
DIE LEGENDEN DES RABEN
Inhaltsverzeichnis
Für Simon Spanton,einen großartigen Freundund Redakteur,ohne den es den Rabennicht gegeben hätte.
Auch auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole, möchte ich allen danken, die mich beim Schreiben dieses Buchs unterstützt und ermuntert haben: Peter Robinson, John Cross, Dave Mutton und Dick Whichelow für ihre Kritik, ihre Vorschläge und Anregungen. David Gemmell und Rob Grant für fundierte Ratschläge in einer Zeit, in der sich vieles verändert hat. Robert Kirby, der mir neue Perspektiven eröffnet hat, und Nicola Sinclair, die dafür gesorgt hat, dass ich auf dem Teppich blieb.
Meiner Familie einfach dafür, dass sie wundervoll ist.
Personenverzeichnis
Erstes Kapitel
»Noch einmal!« Tessaya ließ den Arm sinken. »Noch einmal!«
Abermals griffen die Wesmen die Mauern von Xetesk an. Ihre Stammesbanner flatterten in der Brise, und ihre Stimmen mischten sich zu einem einzigen Brüllen. Die Krieger brachten die Sturmleitern in Position und kletterten die groben Sprossen empor. Gleichzeitig versuchten die unter ihnen postierten Bogenschützen, die Verteidiger von den Wällen zu vertreiben, was angesichts der Entfernung jedoch keine leichte Aufgabe war.
In den tiefen Schatten der Nacht setzten die Kämpfer der Stämme unter den Mauern von Xetesk immer neue Leitern an, auf einer Breite von vierhundert Schritt. Die besten Leitern waren grob behauen und mit Seilen verzurrt, die schlechtesten waren kaum mehr als die geschälten Stämme der höchsten Bäume, die sie hatten finden können. Bei früheren Angriffen waren einige Leitern nicht lang genug gewesen.
Jetzt sah Tessaya, wie das Licht der Fackeln auf den Wällen die Leitern erfasste, ehe sie mit einem Knall gegen die Mauern prallten, damit die Krieger, immer zwei auf einmal, hinaufsteigen konnten.
Dieses Mal stand der Feind mit dem Rücken zur Wand. Dieses Mal würden die Wesmen die Verteidigung durchbrechen. Daran gab es keinen Zweifel. Bei Tageslicht waren viele gestorben. Sprüche und Pfeile hatten Holz und Fleisch zerfetzt. Brennende Krieger waren kreischend zu Boden gesunken. Verkohlte oder vereiste Leitern waren geborsten und binnen weniger Herzschläge zusammengebrochen.
Dennoch hatten die Stämme nicht aufgegeben. Angetrieben von ihren Lords, die den Sieg zum Greifen nahe wähnten, hatten sie den Angriff fortgesetzt. Hunderte suchten im Hinterland nach Bäumen, aus denen sie neue Leitern bauen konnten, und Hunderte starben an den Mauern, während sie taten, was getan werden musste. Sie laugten die Sprüchewirker aus.
Tessaya sah Männer auf den Mauern laufen und die Verteidigung organisieren. Unter ihnen, die Schilde über die Köpfe haltend, stießen seine Krieger vor. Es war der vierte Angriff binnen eines Tages. Die Nacht war gerade zur Hälfte vorbei, und die Wucht der Sprüche ließ nach.
Planlos erfasste hin und wieder ein Spruch die Spitze einer Leiter und die kletternden Männer, doch das war schon alles. Tessaya hatte diesen Moment kommen sehen und den größten Teil seiner Streitmacht zurückgehalten. Xetesk verfügte nicht mehr über die magische Kraft, um sie aufzuhalten. Jetzt kam es darauf an, wer mit Schwert, Axt und Speer der Stärkere war. Das war ein Kampf, den die Wesmen nicht verlieren konnten.
Er sah noch einen Augenblick zu. Immer noch prasselten Pfeile auf die Krieger nieder, die die Leitern emporstiegen. Immer noch fielen seine Leute zu Dutzenden. Tief atmete er die Nachtluft ein. Die Gerüche von Asche und Furcht mischten sich mit dem Duft von frischem Gras, den die Brise herantrug. Er hörte die Stimmen der Wesmen, ihre Stammeslieder, zwischen den Mauern von Xetesk hallen. Von Kraft und Sieg erzählten die Hymnen und schwollen mit jedem Herzschlag an.
Er wandte sich an Lord Riasu. Die kleinen Augen des Mannes funkelten in der Dunkelheit, und sein kantiges Gesicht war vor Erregung rot angelaufen.
»Ihr spürt es auch.«
»Ich spüre es, Lord Tessaya«, bestätigte Riasu. »Wir haben das Ziel fast erreicht.«
»Und was wünscht Ihr jetzt?«
Riasu nickte zu den Mauern hin. Die Wesmen stiegen auf den Leitern höher und höher, die Pfeile konnten sie nicht mehr abhalten, und Sprüche schlugen kaum noch ein. Ein dunkelblauer Blitz auf der linken Seite war eine letzte Erinnerung an die schwindende Bedrohung.
»Meine Männer sind auf den Leitern«, sagte er. »Ich will mich ihnen anschließen. Führe uns auf die Mauern.«
Tessaya versetzte Riasu einen festen Schlag gegen die Schulter. »Diesen Wunsch teile ich.«
Er sah sich rasch um. Sechs weitere Stammesfürsten standen bei ihnen. Ihre Krieger, tausend oder mehr, waren bereit, jederzeit anzugreifen. Unterdessen stärkten sie denjenigen, die schon vor den Mauern in Kämpfe verwickelt waren, mit aufmunternden Rufen den Rücken. Hinter ihnen brannten die Lagerfeuer, und die Wächter der Paleon-Stämme beschützten die Schamanen, die mit ihren Gebeten Anleitung und Kraft von den Göttern erflehten. Ihre Gebete waren ganz gewiss erhört worden.
Die Lords standen in der Nähe in einer Gruppe beisammen, alle wollten das Gleiche, doch sie warteten noch auf Tessayas Kommando. Der Ruhm, der Erste zu sein, der die Mauern erklomm, überwog die Todesangst.
»Es wird Zeit«, sagte Tessaya. Er löste die Axt vom Gürtel. »Meine Lords, wir wollen dem Gegner den vernichtenden Schlag versetzen.«
Er hob die Axt hoch über den Kopf, stieß den Kriegsschrei der Paleon-Stämme aus und leitete den Angriff auf die Mauern ein. Die Lords beschworen ihre Stammesgeister und folgten ihm. Ihnen wiederum folgten tausend Krieger und stimmten ein ohrenbetäubendes Gebrüll an.
Tessaya rannte. Seine grauen Zöpfe flatterten über seinen Schultern, er bewegte Arme und Beine rasend schnell und spürte den Luftzug im Gesicht. Er konnte sich nicht erinnern, sich schon einmal so lebendig gefühlt zu haben. Nicht einmal die Begeisterung, mit der er die Wesmen aus dem Schatten des Understone-Passes geführt hatte, war diesem Gefühl gleichgekommen. Damals hatten sie sich so viel vorgenommen und waren gescheitert. Jetzt war der Sieg in Reichweite.
Seine vergessene Jugend strömte in die nicht mehr jungen Adern zurück. Sein Herz pumpte die Lebenskraft durch seinen Körper. Sein Kopf war klar, sein Auge scharf. Die Geister waren bei ihm und in ihm. Nichts konnte ihn aufhalten. Er lachte laut und beschleunigte seine Schritte.
Unter Xetesks Mauern vertiefte sich die Dunkelheit. Siebzig Fuß hoch waren sie und leicht nach außen geneigt. Beeindruckend, drohend und noch nie überwunden. Hier waren auch die Kampfgeräusche lauter. Tessaya hörte das Summen der Bogensehnen, das Krachen der primitiven Leitern, die Rufe der Wesmen über ihm, die sich als schwarze Schatten vor den grellen Fackeln abhoben.
Wie er befohlen hatte, drängten sich die Wesmen nicht um die unteren Enden der Leitern. Alle, die nicht schon kletterten oder sich darauf vorbereiteten, hatten sich auf dem Feld verteilt und warteten auf den Ruf, ehe sie sich näherten. So gab es keine dicht gedrängt stehenden Gruppen, die den feindlichen Magiern und Bogenschützen ein bequemes Ziel boten.
Tessaya rannte an den wartenden Kriegern vorbei, die seinen Namen riefen. Schneller als ein Buschfeuer breitete sich der Ruf auf dem Schlachtfeld aus. Als er an den wartenden Kriegern vorbei war und die Leiter fast erreicht hatte, wurde ringsum sein Name gesungen.
Er setzte den Fuß auf die unterste Sprosse und trieb alle in der Nähe und über ihm an, sich noch schärfer ins Zeug zu legen. Riasu war direkt hinter ihm und rief etwas in einem Stammesdialekt, den Tessaya kaum verstehen konnte. Das war auch nicht nötig, denn die Botschaft war klar.
Tessaya kletterte schnell, das Holz gab unter seinem Gewicht nach, und die Leiter schwankte und bog sich durch. Die Bindungen waren aber fest und würden halten. Links und rechts eilten andere Wesmen die Leitern hoch. Jetzt, da Tessaya sich eingeschaltet hatte, bekam der Angriff neuen Schwung. Diejenigen, die schon kämpften, waren sich ihres Sieges sicher.
»Drückt euch dicht an die Sprossen«, befahl Tessaya. »Bietet ihnen kein Ziel.«
Eine Schande, dass nicht alle Männer seinen Rat befolgten. Immer noch flogen ihnen Pfeile um die Ohren. Einer traf den ungeschützten Hals eines Kriegers, der es riskierte, nach oben zu schauen, um zu sehen, wie weit er noch klettern musste. Schreiend stürzte er an Tessaya vorbei und schlug tot unten auf.
»Weiter!«, rief er.
Direkt über ihm war ein Mann, den Tessaya schamlos als Schild benutzte. Die Nähe der Wand hinter der Leiter verriet ihm, wie hoch sie schon geklettert waren. Es war nicht mehr weit.
Wieder zuckte ein Spruch über den Nachthimmel. Links schlug ein Eiswind in Fleisch und Holz, ließ es aufplatzen und zerfetzte Bindungen und Sprossen. Die Leiter fiel auseinander, und die Überlebenden stürzten in den Tod. Tessaya fluchte. Doch über ihm nahm das Gebrüll zu, und er vernahm das wundervolle Klirren von Metall auf Metall, als seine Krieger endlich von Angesicht zu Angesicht gegen die xeteskianischen Verteidiger kämpften. Er lächelte humorlos.
»Bist du noch hinter mir, Riasu?«, rief er.
»Ich bin da, Mylord«, kam die etwas atemlose Antwort. »Ich rieche schon ihre Angst.«
»Dann will ich dich nicht davon abhalten, ihnen auch in die Augen zu sehen«, sagte Tessaya. »Angriff!«
Jetzt schaute Tessaya nach oben. Er war höchstens noch zehn Fuß von der Mauerkrone entfernt. Der Pfeilhagel hatte aufgehört. Seine Männer kletterten schneller, und er hielt Schritt. Sie mussten unbedingt den Wehrgang erreichen, ehe der kleine Brückenkopf wieder aufgerieben wurde. Ein Toter fiel rechts neben ihm herab. Funken flogen, als die Waffen aufeinanderprallten, und die Wesmen sangen lauter denn je und weckten mit ihrem Gesang in allen Kämpfern die Lust, noch härter zu kämpfen. Für die Stämme, für sich selbst und für all jene, die gestorben waren, damit sie so weit kommen konnten.
Die Männer über ihm bewegten sich für seinen Geschmack immer noch zu langsam. Er hielt die Axt rechts neben der Leiter, beugte sich hinüber, so weit er es wagte, und rief den Kriegern über ihm zu, sie sollten ihm Platz machen.
»Nach links, geht nach links. Lasst mich durch. Los doch, los!«
Er spürte Riasu hinter sich. Mit der linken Hand hielt Tessaya sich fest und stieg eilig die Sprossen hinauf. Auf der schräg stehenden Leiter kam er gut voran. Der Brückenkopf hielt noch, seine Männer standen nur wenige Schritte vor ihm auf der Mauer. Er roch den Stein, kalt und uralt.
Die Kampfgeräusche drangen nur noch gedämpft an seine Ohren, die Kämpfe Mann gegen Mann, das erschöpfte Stöhnen, die Schreie der Qual und des Schocks. Das Dröhnen und Klirren der Waffen auf Leder und Kettenhemd. Das Kreischen der aufeinanderprallenden Klingen. Das dumpfe Aufschlagen der Toten auf dem Stein, das verzweifelte Scharren der Füße, die einen Halt suchten und nicht das Gleichgewicht verlieren wollten.
Am oberen Ende der Leiter wurde ihm klar, warum es so langsam gegangen war. Ein Krieger klammerte sich an die oberste Sprosse. Er hatte sich über seine Hände übergeben, seine Waffe steckte noch in der Scheide. Tessaya hielt bei ihm an und schluckte den Widerwillen über die Feigheit des Kämpfers herunter, als er dessen Alter sah.
»Bleib bei mir, Junge«, sagte er. »Im Leben oder im Tod wirst du Ruhm ernten.«
Der Junge sah ihn erschrocken an und nickte zaghaft.
»Braver Junge.«
Tessaya packte ihn am Kragen und schob ihn die letzte Sprosse hinauf. Noch ein Schritt, und sie standen auf den Mauern inmitten des Kampfgetümmels. Selbst Tessaya fand den Lärm und die Nähe der Feinde ungemütlich. Sein Schutzbefohlener knickte in den Knien ein. Urin lief über die Hose des Jungen, und er übergab sich abermals. Dennoch zog er seine Klinge, ein kurzes Stoßschwert.
Im Licht der Fackeln und Kohlenpfannen sah sich der kleine Brückenkopf heftigen Angriffen ausgesetzt. Links und rechts waren drei weitere Durchbrüche gelungen. Die Xeteskianer kamen von rechts gerannt und sammelten sich auch auf der linken Seite, wurden aber ihrerseits von Wesmen unter Druck gesetzt. Der Wehrgang war höchstens fünf Schritte breit, er hatte auf der Innenseite kein Geländer und war nicht dazu angelegt, auf diese Weise verteidigt zu werden. Tessaya ergriff sofort die Gelegenheit.
»Vorstoßen!«, rief er und sprang von der Mauer zwischen die Toten und in die Rücken der Lebenden, denen er einen festen Stoß versetzte.
Die Wesmen, die Tessaya im Weg waren, verloren das Gleichgewicht und konnten sich nur noch nach vorn werfen, den Feinden entgegen. Diese spürten schnell, dass der vermeintlich rettende Schritt zurück in Wirklichkeit tödlich war.
Drei Xeteskianer hatten keinen Platz mehr zum Ausweichen und traten ins Leere, hielten sich an ihren Gefährten fest und rissen mindestens ein halbes Dutzend hinab in die Stadt. Einer seiner Krieger stürzte mit ihnen, zwei weitere konnten sich retten.
»Bewacht den Brückenkopf«, befahl er. »Kämpft, meine Stämme, kämpft. Haltet rechts die Stellung und stoßt links vor. Wir müssen diese Bastarde isolieren. Und jemand muss die Toten über die Kante werfen.«
Sie gehorchten. Tessaya war bei ihnen, sie würden alles tun, was er verlangte. Er sah sich zum Jungen um, der inzwischen kämpfte und seine Gegner tötete. Die Furcht war dem Wunsch zu überleben gewichen, der ihm jedoch nicht erfüllt werden sollte.
Riasu setzte über die Zinnen hinweg und stieß einen Kampfschrei aus, während er die Axt über dem Kopf kreisen ließ.
»Riasu, gebt die Botschaft nach unten weiter. Dieser Abschnitt der Mauer muss zwischen den beiden nächsten Wachstuben gesichert werden. Los!«
Ohne zu zögern stürzte Tessaya sich in den Kampf. Seine Axt fuhr zwischen zweien seiner Krieger herab und spaltete einem Feind den Schädel. Blut spritzte im Fackelschein hoch empor. Seit Jahren das erste xeteskianische Blut, das er vergießen durfte. Er zog die Axt zurück und drang in den freien Raum vor, den seine Krieger ihm ließen.
Bevor er das nächste Opfer anging, blickte er zur Stadt Xetesk hinunter. Die Türme des Kollegs standen starr vor dem Himmel, in allen Fenstern und Mauern brannte Licht.
»Ich komme«, knurrte er. »Ich werde euch niederreißen.«
»Kehrt auf die Mauern zurück!«, befahl Dystran, der Herr vom Berge. »Wesmen stehen auf den Wällen. Ich sehe meinen obersten Kommandanten hier und frage mich, was dort los ist.«
Dystran hatte den Kommandanten Chandyr in der Kuppel zwischen den Türmen des Kollegs abgefangen, nachdem er gesehen hatte, dass sein höchstdekorierter Soldat auf seinem Pferd durch die Straßen der Stadt donnerte. In der sonst leeren Kuppel hallten ihre erhobenen Stimmen laut. Chandyrs in vielen Schlachten vernarbtes Gesicht war bleich und wutverzerrt. Dystran wusste genau, wie er sich fühlte.
»Mylord«, erwiderte Chandyr. »Ihr habt zu viele Magier ins Kolleg abberufen. Gebt sie mir zurück.«
»Ich werde nicht jeden Magier verschwenden, den ich habe.«
»Dann erwartet nicht von mir, die Mauern noch viel länger zu halten.«
»Nur der schlechte Soldat gibt dem Mangel an Ausrüstung und Unterstützung die Schuld.«
Chandyr kniff die Augen zusammen. »Dreitausend Mann gegen ein paar Hundert, von denen viele gerade erst von einem Gewaltmarsch aus Julatsa zurückgekehrt sind. Was soll ich Eurer Ansicht nach tun, Mylord?«
»Ich will, dass Ihr Eure Arbeit tut.«
»Ich bin dabei«, erwiderte Chandyr leise. »Ich stehe vor Euch und versuche, ein Massaker zu verhindern.«
»Wie kommt es dann, dass die Wesmen auf meine Mauern steigen konnten?«
Chandyr riss der Geduldsfaden. Dystran sah das Flackern in den Augen des Mannes und spürte einen Stich, als der Kommandant ihm den Zeigefinger seiner behandschuhten Hand in die Rippen stieß.
»Es sind Xetesks Mauern, nicht die Euren«, sagte er drohend. »Und die Gegner sind dort, weil Ihr mir in der Dämmerung die Kräfte genommen habt, die ich gebraucht hätte, um sie zu verteidigen. Ihr drückt Euch vor Eurer Verantwortung für diese Stadt. Welchen Nutzen hat das Kolleg noch, wenn ringsum die Stadt niedergebrannt ist, was?«
Dystran schwieg einen Moment, bis Chandyr die Hand sinken ließ.
»Das Kolleg ist die Stadt«, sagte er, »und da ich der Herr des Kollegs bin, sind auch die Mauern mein. Ich drücke mich nicht, Chandyr. Ich erwarte eher Beifall, da ich Magier aus dem Gemetzel zurückzog, das Ihr angerichtet habt. So sind sie wenigstens in der Lage, den Gegenschlag zu führen.«
»Noch einen Eurer ungezielten Dimensionssprüche, Dystran?«, spottete Chandyr. »Ihr werdet mehr Unschuldige als Feinde töten.«
»Ich werde die Wesmen aufhalten«, sagte Dystran, dem allmählich der Kragen platzte. »Und Ihr, Kommandant Chandyr, werdet nie mehr vergessen, mit wem Ihr redet, und wenn Ihr meinen Rat annehmt, dann werdet Ihr Eure nächsten Worte sehr, sehr sorgfältig wählen.«
Um Chandyrs Lippen spielte ein Lächeln, das die Augen nicht erreichte. Er nickte und machte einen Schritt, bis er so nahe vor Dystran stand, dass dieser ihn nur noch verschwommen wahrnehmen konnte.
»Beschuldigt mich nie wieder, ein schlechter Soldat zu sein.«
»Männer werden nach ihren Taten beurteilt«, erwiderte Dystran freundlich, obwohl sein Herz schneller schlug.
»Weitere Warnungen werdet Ihr nicht bekommen«, sagte Chandyr.
Der Kommandant machte auf dem Absatz kehrt und schritt aus der Kuppel, um sein Pferd zu rufen. Dystran sah ihm nach und spürte, wie seine Wut zunahm. Er hatte nicht den Wunsch, sie zu unterdrücken, und genoss sogar die Hitze, die sie in seinem Geist und seinem Körper entfachte.
Chandyr verstand nicht, worauf es ankam, überlegte er, als er die Kuppel verließ und zu seinem Turm eilte. Seine Wächter salutierten, als er sich näherte. Chandyr hatte sich den förmlichen Gruß geschenkt. Ein typischer Soldat. Blind für das Gesamtbild. Nur fähig, die Aufgabe zu erledigen, die unmittelbar vor ihm lag, und manchmal nicht einmal das.
»Sharyr soll sofort in mein Audienzzimmer kommen«, befahl er. »Er müsste in meinem Verteiler sein.«
»Ja, Mylord«, sagten beide Männer gleichzeitig.
Dystran stieg die Treppe seines Turms hinauf. Er dachte noch einmal an Chandyrs Worte, und der Zweifel kratzte mit winzigen Krallen an seinem Selbstvertrauen. Es stand außer Frage, dass er die Wesmen unterschätzt hatte. Dies war kein ungeordneter Angriff. Dahinter standen nicht nur Klugheit und Taktik, sondern auch eine grimmige Entschlossenheit und eine Bereitschaft zur Selbstaufopferung, die man nur als atemberaubend bezeichnen konnte.
Irgendwo dort draußen war Tessaya.
Was Dystran am meisten zusetzte, war nicht die Tatsache, dass der Lord der Wesmen es geschafft hatte, seine Krieger zu sehr wirkungsvollen Vorstößen anzustacheln und sie, wenn nötig, sofort wieder zurückzunehmen. Offenbar wusste er auch, wie schwach Xetesks Verteidigung war, was Magier und Soldaten anging, und schickte deshalb immer neue Angriffswellen, um die Verteidiger zu zermürben. Welche Spione hatten ihm dies verraten?
Tessayas Ziel war eine Weile vorher deutlich geworden, und deshalb hatte Dystran eine Reihe von Magiern abgezogen, um die Dimensionsmagier zu verstärken und den Spruch für das nächste Fenster vorzubereiten. Ein Fenster, das sich hoffentlich bald öffnete.
Chandyr hatte die Wesmen nicht zurückschlagen können, was Dystran zugleich überraschend und bedauerlich fand. Xeteskianische Soldaten und Bogenschützen sollten doch wohl in der Lage sein, mit ein paar Leitern fertig zu werden. Wieso war den Wesmen etwas gelungen, das eigentlich niemand je hätte schaffen dürfen?
Vielleicht hätte er gründlicher nachforschen sollen.
Doch als er sein Audienzzimmer im dritten Stock erreichte, hörte er schon eilige Schritte hinter sich. Er öffnete im schwach beleuchteten Raum die Blenden vor dem Balkon und sah den vollen Umfang der Bedrohung, der seine Stadt ausgesetzt war. Rasch verstärkte er mit einem Spruch seine Sicht, um auch die kleineren Details zu erkennen.
Rings um einen mehr als zweihundert Schritt langen Abschnitt brannten helle Lichter. Dort wimmelte es von Wesmen, doch es herrschte noch kein Gedränge. Sie griffen nach links und rechts die nächsten Türme an und hatten in Richtung der Stadt einen Schildwall errichtet, größtenteils aus frisch geschnittenem Holz. Bogenschützen erzielten hin und wieder einen Treffer, konnten aber den Vorstoß der Wesmen auf den Mauern nicht aufhalten.
Chandyr hatte die Türme zur Verteidigung stark besetzt. Die Wesmen erlitten beträchtliche Verluste, doch ohne die Sprüche der Magier war es nicht möglich, sie zu den Leitern zurückzudrängen, und letzten Endes würden sie allein dank ihrer Überzahl den Sieg erringen. Wie bald schon, das konnte man nicht sagen. Höchstwahrscheinlich noch vor der Morgendämmerung.
»Verdammt aber auch«, keuchte er. »Wo habe ich mich geirrt?«
»Mylord«, sagte jemand hinter ihm.
»Sharyr«, antwortete Dystran, ohne sich zum neuen Leiter der Dimensionsmagier umzudrehen. Er war kaum mehr als ein Adept, aber der Beste, den er noch hatte. »Kommt her und sagt mir, was Ihr seht.«
Darauf hörte Dystran ein nervöses Scharren und angestrengte Atemzüge, teils übertönt vom Schlachtlärm auf den Mauern. Nun drehte er sich zu Sharyr um, der das Geschehen beobachtete und sich fragte, was er nun eigentlich wahrnehmen sollte. Er trampelte unbehaglich von einem Fuß auf den anderen und zuckte unsicher mit den Achseln.
»Die Wesmen auf den Mauern?«, fragte er mit bebender Stimme.
»Ausgezeichnet«, sagte Dystran. »Macht Euch das Angst?«
»Ja, Mylord«, sagte Sharyr. »Ich habe Angehörige in der Stadt.«
»Dann haben sie Glück, denn Ihr werdet persönlich dafür sorgen, dass ihnen nichts passiert, nicht wahr?«
»Ich? Aber ich …«
»Die Entfernung zwischen den Mauern der Stadt und denen des Kollegs ist für ein tobendes Wesmen-Heer ein Kinderspiel. Weniger als eine Meile, oder was würdet Ihr sagen?«
»Mylord?«
»Diese Stadt ist nicht groß«, fuhr Dystran fort. »Was meint Ihr, wann werden die Wesmen einen jener Türme erobern?«
Sharyr starrte ihn fassungslos an.
»Ihr müsst nämlich wissen«, klärte Dystran ihn auf, »dass sie Zugang zu unseren Straßen und vor allem zum südlichen Torhaus haben werden, wenn dies geschieht. Draußen warten Tausende von Kriegern nur darauf, dass sie endlich hereinkommen können.«
»Ja, Mylord.«
»Ich will Euch damit sagen, dass diese nicht näher bestimmte, aber höchstwahrscheinlich kurze Frist genau der Zeitrahmen ist, in dem Ihr bereit sein müsst, den Spruch Eurer Wahl zu wirken.«
»Ich …« Sharyr wich einen Schritt zurück.
Dystran folgte ihm. »Ihr begreift doch, dass keiner dieser Männer jemals das Kolleg erreichen darf, nicht wahr? Wenn Chandyr sie nicht aufhalten kann, dann werdet Ihr es tun. Nicht wahr?«
»Die … die Ausrichtung der Dimensionen wird erst morgen Nacht um diese Zeit vollendet sein«, quetschte Sharyr hervor.
»Oh, du meine Güte.« Dystran schlug sich eine Hand vor den Mund. »Was werdet Ihr denn nun tun?«
»Also, das weiß ich nicht, Mylord«, erwiderte Sharyr, dem Dystrans Sarkasmus völlig entgangen war.
Dystran trat noch näher an Sharyr heran, was den jungen Mann veranlasste, abermals zurückzuweichen.
»Dann will ich Euch erleuchten.« Seine Worte verrieten seine lange Übung als Machthaber, denn sie waren kaum mehr als ein Flüstern, und doch voller Drohungen. »Ihr werdet bereit sein, den Spruch zu wirken, weil wir beide ganz genau wissen, dass die Konjunktion erzwungen und dem Spruch unterworfen werden kann. Ich habe ausführliche Kommentare zu diesem Thema verfasst. Der Spruch ist schwer zu beherrschen, und Ihr werdet Eure Untergebenen anweisen, wie sie mit den Kräften umzugehen haben. Ihr werdet sie auch über die Konsequenzen unterrichten, die sie im Falle eines Scheiterns zu tragen haben. Rückschläge von Dimensionssprüchen sind eine sehr, sehr hässliche Angelegenheit.«
Sharyr stand inzwischen mit dem Rücken zum Kamin. Glücklicherweise brannte kein Feuer darin.
»Die Gefahr für unsere Stadt …«, setzte er an.
Dystran beugte sich noch weiter vor. »Die Wesmen werden das Kolleg erobern, wenn sie nicht aufgehalten werden. Das ist die Gefahr für unsere Stadt. Ihr werdet sie aufhalten oder beim Versuch sterben. Falls jemand aus Eurer Gruppe meint, er sei der Aufgabe nicht gewachsen, kann er sich bei mir melden, und ich werde mit ihm darüber reden.«
»Ich …«
»Enttäuscht mich nicht, Sharyr.«
Dystran richtete sich auf und trat einen Schritt zurück, um das verängstigte Gesicht des Adepten zu betrachten, die Schweißperlen auf seiner Stirn und die hin und her zuckenden Augen. Er lächelte. »Kennt Ihr den Schlachtruf ›Tod oder Ruhm‹? Ich möchte wetten, Ihr habt gedacht, er gilt nur für Soldaten, was? Denkt noch einmal darüber nach, geht in die Katakomben, und trefft Eure Vorbereitungen. Wenn der Augenblick gekommen ist, werde ich Euch persönlich auf die Stadtmauer rufen. Nun geht.«
Sharyr hatte noch die Geistesgegenwart, sich wenigstens zu verneigen und zu murmeln: »Mylord.«
Die Tür des Empfangszimmers öffnete sich, bevor er sie erreichte. Ein alter Mann mit tränenüberströmtem Gesicht stand im Schein der Kohlenpfanne auf der Treppe. Es war Brannon, seit Jahrzehnten Ranyls Kammerdiener.
»Bitte, Mylord«, sagte er. »Ihr müsst schnell kommen.«
Dystran hatte das Gefühl, im Boden zu versinken, und die Furcht ließ ihn schaudern.
»Oh nein«, keuchte er und lief los. »Nicht jetzt. Nicht gerade jetzt.«
Zweites Kapitel
Hirad Coldheart saß vor dem Refektorium von Julatsa auf der Treppe. Es war eine warme, friedliche Nacht. Hier und dort waren draußen vor dem Kolleg Lebenszeichen zu hören. Ein Wagen rumpelte übers Pflaster, Pferdehufe hallten zwischen leeren Gebäuden, irgendjemand rief einen Gruß. Er atmete tief durch, bis die Brustverletzung unter dem Verband schmerzte. Sie heilte nur langsam. Die Magie hatte die Muskeln repariert, aber die Haut war noch wund und spannte sich. Ein Zeichen des Alters, nahm er an. So ähnlich wie die grauen Strähnen in seinen langen Zöpfen.
Eigentlich hatte er keinen Grund dazu, aber er war erleichtert. So viele Schwierigkeiten gab es noch in Balaia, doch zum ersten Mal seit langer Zeit waren er und der Rabe nicht durch ihre Ehre oder einen Vertrag verpflichtet, irgendetwas zu tun. Er hätte sich dennoch Sorgen machen müssen, aber irgendwie konnte er sich nicht dazu überwinden. Nicht in diesem Augenblick. Vielleicht nie wieder.
In Julatsa gab es Spannungen, seit diejenigen, die geflohen waren, zurückkehrten. Die Herrscher der Stadt fanden immer noch nicht den Mut, im Kolleg vorzusprechen. Es würde Streit geben, da war er sicher. Abgesehen davon hatten die Kämpfe zwischen Dordover, Xetesk und Lystern vermutlich immer noch nicht aufgehört. Sie würden aufeinander einschlagen, bis ein ermattetes Patt eintrat, viel zu stolz, um über einen Frieden zu verhandeln, solange sie nicht so viel Blut vergossen hatten, wie es nur irgend möglich war.
Er hätte sich Sorgen über das Schicksal des Landes machen müssen, das er liebte, aber irgendetwas fehlte ihm hier. Wenn er zum Herzen von Julatsa schaute, über dem bald ein neuer Turm errichtet werden sollte, dann wusste er auch, was es war. Es ging nicht um ein großartiges Land, das es wert war, gerettet zu werden. Es ging um die Menschen, die er liebte und die dort leben wollten. Sie waren tot oder gingen fort. Jeder Einzelne.
Auch wenn Ilkar der Tropfen gewesen war, der das Fass zum Überlaufen gebracht hatte – vorher waren Sirendor, Ras, Richmond, Will und Jandyr gestorben. Alle waren tot, obwohl er sich so sehr bemüht hatte, sie zu retten. Und der Unbekannte, Denser und Erienne, sie dachten an ihre Angehörigen auf der anderen Seite des Ozeans und würden bald abreisen. Thraun würde sie begleiten. Entweder dies, oder er kehrte zum Rudel zurück. Für ihn würde es keine Konflikte geben.
Blieb noch Darrick. Hirad kicherte. Wenn es einen Mann gab, nach dem noch dringender gefahndet wurde als nach den übrigen Rabenkriegern, dann war es Darrick. Er hatte kaum eine Wahl.
Also würden sie mit den paar Elfen, die nicht helfen mussten, das Kolleg wieder in Gang zu bringen, nachdem das Herz geborgen war, zurückreisen und in der Nähe von Blackthorne an Bord eines Schiffs gehen. Rebraal musste nach Hause, die Al-Arynaar brauchten ihren Anführer auf Calaius. Das Gleiche galt für Auum und die TaiGethen, die ihm natürlich folgten, wohin er auch ging. Im Übrigen wäre Hirad jede Wette eingegangen, dass auch das letzte noch lebende Krallenjägerpaar in den Regenwald zurückkehren würde. Sie hatten seit dem Ende der Belagerung um die verlorenen Gefährten getrauert. Sogar in den Augen des Panthers konnte Hirad erkennen, dass sie ihre Heimat und ihre Verwandten vermissten. Sie waren jetzt draußen, starrten zu den Sternen hinauf und sahen, dass sie sich am falschen Ort aufhielten.
Hirad leerte seinen Weinkelch und betrachtete seinen Teller. Das Brot und das Fleisch hatte er aufgegessen, und inzwischen war es vermutlich Zeit, ins Bett zu gehen. Er nahm den Teller und wollte aufstehen. In diesem Moment kamen Denser und der Unbekannte aus dem Refektorium, mit Weinschlauch und Kelchen bewaffnet. Er lächelte sie an, den Magier mit den markanten Gesichtszügen und den Krieger mit dem glatt rasierten Kopf.
»Wohin willst du, Coldheart?«, fragte der Unbekannte.
»Einen Nachschlag holen?«, meinte Hirad.
»Gute Antwort«, sagte Denser.
Die Männer setzten sich links und rechts neben ihn. Denser füllte seinen Kelch.
»Was ist das, eine Art Höflichkeitsbesuch?«
»Nein«, erwiderte der Unbekannte. »Wir dachten nur, es ist lange her, dass wir zusammengesessen und Wein getrunken haben. Die anderen kommen auch gleich raus.«
»Wird es Zeit, auf die Toten anzustoßen und weiterzuziehen, ja?« Hirad nickte in Richtung des Herzens.
»Etwas in dieser Art«, erwiderte Denser.
»Tja, es nützt ja auch nichts, weiter hier herumzuhängen.« Hirad hob sein Glas. »Auf Ilkar. Auf einen Elf, wie man ihn nicht zweimal trifft, und einen Freund, den ich immer vermissen werde.«
Sie stießen an. Hirad leerte seinen Kelch mit einem Zug und knuffte Denser, der ihm nachschenken sollte.
»Ich glaube, er wäre stolz auf uns.« Denser strich mit einer Hand über seinen sauber getrimmten, immer noch pechschwarzen Bart.
»Das will ich doch hoffen. Beinahe hätte unser letztes Stündlein geschlagen, als sie diesen Schutthaufen da aus dem Loch geholt haben.«
Denser lachte laut, draußen im Hof drehte das Pantherweibchen gelassen den Kopf. »Ah, Hirad, es gelingt dir doch immer wieder, die Dinge mit ganz einfachen Worten auf den Punkt zu bringen.«
»Das Schönste ist doch, dass wir ihm damit ein Denkmal gesetzt haben, was?«, sagte Hirad. »Ich meine, das Herz wurde nur geborgen, weil er uns in diese Richtung gelenkt hat.« Bekümmert seufzte er gleich darauf. »Er hätte aber dabei sein und es selbst sehen sollen, was?«
Darauf schwiegen auch die anderen, jeder in Gedanken verloren.
»Bist du bereit?«, fragte der Unbekannte schließlich.
Hirad zuckte mit den Achseln und sah dem Unbekannten in die schiefergrauen Augen. »Ist ja nicht so, als hätte ich viel zu packen.«
»Das meinte ich nicht.«
»Ich weiß.«
Der Unbekannte versetzte ihm einen Stoß. »Dann sag’s mir.«
»Das hat wehgetan.«
»Nicht so sehr, wie der nächste wehtun wird.«
Hirad beäugte die Muskelpakete des lächelnden Kriegers. »Ich habe übrigens auch schon darüber nachgedacht, bevor ihr zwei mich gestört habt. Hier hält mich nichts mehr, und ich bin das Kämpfen leid. Ehrlich. Seht doch nur, was wir erreicht haben, und die einzigen Monumente sind die Grabmale unserer toten Freunde. Fast alle hier wollen uns umbringen. Diese undankbaren Hunde.«
»Wir dachten daran, morgen aufzubrechen. Im Morgengrauen«, sagte der Unbekannte.
Hirad zog die Augenbrauen hoch. »Sind wir dazu gut genug in Form? Ich denke jetzt vor allem an Erienne.«
»Es geht ihr gut«, erklärte Denser. »Körperlich auf jeden Fall. Ich glaube, sie kann sich nur nicht entscheiden, was sie bei der Rückkehr nach Herendeneth unerfreulicher finden wird: den Anblick von Lyannas Grab oder die Ausbildung in der Magie des Einen durch Cleress.«
»Können wir überhaupt gefahrlos nach Süden reisen?«, fragte Hirad. »Da unten ist doch immer noch ein Krieg im Gange.«
»Dir entgeht auch gar nichts, was?«, meinte Denser.
»Darrick hat eine Route ausgesucht, die auch ich für gut halte«, sagte der Unbekannte. »Wir können sicherlich ohne große Schwierigkeiten Blackthorne erreichen. Danach müssen wir nur noch warten, bis die Calaianische Sonne in die Bucht von Gyernath einläuft.«
»Hauptsache, dir geht es gut«, sagte Hirad.
»Und ob«, erwiderte der Unbekannte. »Aber du weißt ja, wie das ist. Solange du es nicht sagst, brechen wir nicht auf.«
Hirad freute sich über die Vertrautheit. Selbst jetzt, da sie das Land verlassen wollten, für dessen Rettung sie so lange gekämpft hatten, selbst auf dem Weg in den Ruhestand funktionierte der Rabe noch. Er nickte.
»Es gibt keinen Grund hierzubleiben, wenn wir gut genug in Form sind, um zu reisen.« Lächelnd warf er dem Unbekannten einen Blick zu. »Aber danke, dass du gefragt hast.«
»Du weißt ja, wie das ist.«
»Ja.« Hirad stand auf und spähte in seinen Kelch, beobachtete die kleinen Wellen auf der dunklen Flüssigkeit. »Wo sind die anderen? Ich glaube, wir könnten noch mal auf den einen oder anderen anstoßen.«
Sha-Kaan drehte sich in der Luft gemächlich um sich selbst. Unter ihm verhüllte Nebel das Tal, in dem das Brutland der Kaan lag. Vor ihm erstreckten sich die Ebene von Domar und der dichte, dampfende Wald von Teras zu Füßen der Berge von Beshara, die der Drachendimension den Namen gegeben hatten. Diese ringförmige Bergkette, die das Tal so fruchtbar und feucht hielt, weil sie den Regen und die Wärme nicht entkommen ließ.
Er hörte die Rufe seiner fliegenden Brut, die auf festgelegten Routen patrouillierte, damit kein Eindringling das Brutland gefährdete. Mehr denn je durften sie jetzt nicht versagen. Mehr denn je waren sie Angriffen ausgesetzt.
Sha-Kaan segnete die Stärke Hirad Coldhearts und des Raben. Er segnete ihren Glauben und ihre Entschlossenheit, ihre Kraft und ihren Mut. Ohne sie wäre er jetzt nicht hier, um in dieser gefährlichen Zeit seine Brut zu führen, und ohne ihn müsste sie untergehen. Ohne Hirad wäre er nicht fähig gewesen, die letzten Tage im heilenden Energiestrom des interdimensionalen Raumes zu verbringen.
Um im Klene Entspannung zu finden, musste der Fusionskorridor an einem Ende im Bewusstsein der Brut und am anderen im bemerkenswerten Bewusstsein des Barbaren verankert werden, und die Diener, die Vestare, mussten zur Stelle sein. Treu und voller Ehrfurcht dienten sie den Herren und lebten unter deren Schutz. Es war eine Freude, die er schon verloren geglaubt hatte.
Sha-Kaan spürte die Furcht und die Erregung von einem Dutzend Drachen, deren Geburt bevorstand. Ihre Zeit war gekommen, im nächsten Zyklus von Helligkeit und Dunkelheit würde es bei den Kaan Neugeborene geben, die sie feiern durften und beschützen mussten. Die Energie einer Geburt strahlte weit über das Brutland hinaus, auch die Feinde konnten es spüren. So verband sich bei jeder Geburt die Freude mit der Gefahr. Das war auch der Grund dafür, dass die Brut flog und die Grenzen sicherte und bald schon in noch größerer Zahl fliegen würde. Die Kaan alterten. Sie konnten es sich nicht erlauben, auch nur ein Junges zu verlieren.
Sha-Kaan schickte einen Gedankenimpuls zu seiner Brut. Seine Rückkehr hatten sie wie eine Wiedergeburt empfunden, und jetzt wandten sie sich natürlich an ihren Großen Kaan, der sie führen sollte, wie es seit so vielen Zyklen seine Aufgabe war. Er schickte Befehle, sie sollten vorsichtig sein und sich genau an die Flugrouten halten, und sie sollten sich bei ihren Patrouillenflügen abwechseln, damit sich alle dazwischen ausruhen konnten. Den ungeborenen Jungen übermittelte er Gefühle von Harmonie, Ruhe und Zuversicht, dass sie alle lebend zur Welt kommen würden.
Ein Dutzend Mal schlug er kräftig mit den Flügeln und stieg höher, um vom Grenzbereich aus, wo seine Patrouillen mit scharfen Augen wachsam kreisten, auf das Land hinabzuschauen. Als er die gewünschte Höhe erreicht hatte, glitt er in sanften Spiralen wieder nach unten und spürte das Rauschen des Windes auf den Schuppen und den voll entfalteten Schwingen. Er suchte das Land drunten ab, ob er irgendetwas versäumt hatte, ob es irgendeine Lücke gäbe, die er noch schließen musste. Oberhalb des Nebels waren etwas mehr als einhundert Kaan unterwegs, darunter wachte eine ebenso große Zahl, und noch einmal doppelt so viele ruhten in den Chouls im Brutland.
Es sah nach einer beeindruckenden Verteidigung aus, doch unter denen, die im kampffähigen Alter waren, befanden sich auch Junge und sehr Alte. Die Naik waren stark. Sie wussten, dass die Geburten der Kaan bevorstanden. Er fragte sich, ob sie einen Angriff für lohnend hielten und bereit waren, die Verluste in Kauf zu nehmen. Immer wieder hatte er die Erfahrung gemacht, dass sie schwer einzuschätzen waren. Einerseits setzten sie sich geringschätzig über das Recht rivalisierender Bruten hinweg, in Beshara ein eigenes Gebiet zu besetzen, andererseits waren sie als Verbündete überraschend entgegenkommend und aufrichtig.
Die Kaan hatten noch kein Bündnis mit den Naik geschlossen, wie die Veret dies getan hatten, eine aussterbende Brut, die dank eines bizarren Gesinnungswandels von den Naik erst bedroht und dann verteidigt worden waren.
Ob die Naik angriffen oder nicht, hing davon ab, ob sie fähig waren, ihr Heimatland zu verteidigen, während sie das der Kaan zu erobern suchten. Neue Bündnisse mussten geschlossen werden. Sha-Kaan wünschte, er hätte die Zeit, die Veret aufzusuchen und einen Hinweis auf deren Stärke zu bekommen, doch sie waren zu weit entfernt.
Zufrieden, dass seine Patrouillen keinen Feind unbemerkt durchschlüpfen lassen würden, stieß er etwas schneller hinab. Jetzt brauchte er eine Ruhepause in einem Choul, um seine alternden Muskeln zu schonen, die auch nach der Erholung im interdimensionalen Raum noch nicht ganz verheilt waren. Die Kühle und Dunkelheit und die Gesellschaft der Gefährten wären ihm jetzt sehr willkommen. Vorher aber forschte er nach Hirad Coldhearts Bewusstsein. Über die Unwägbarkeit des interdimensionalen Raumes hinweg bis nach Balaia ließ er sein Bewusstsein schweifen.
Er spürte die Feinde, die gegen die Membran drängten und einen Zugang suchten. Die Arakhe. Dämonen, wie die Balaianer sie nannten. Eine allgegenwärtige Gefahr für jedes Lebewesen in den zahllosen Dimensionen, und die einzige echte Gefahr für die Kaan. Balaia war ruhig. Die Dimensionsmagie, die die Arakhe auf den Plan gerufen hatte, hatte keinen dauerhaften Schaden angerichtet. Die Risse im Raum waren klein und von vorübergehender Natur gewesen. Hirad Coldheart schlief, und sein Geist war frei, auch wenn er es nicht wusste.
Zufrieden zog Sha-Kaan sich wieder zurück. Das Gedränge der Arakhe um den balaianischen Raum bereitete ihm allerdings Sorgen. Es war, als warteten sie auf irgendetwas. Er spürte ihre Geister wie Dornen im Flammengras. Unangenehm, unwillkommen und unnatürlich.
Er würde sie genau beobachten. Sobald die Geburten überstanden waren und die Psyche der Brut sich beruhigt hatte, würde er mehr Zeit finden. Vielleicht konnte er dann eigene Bündnisse schmieden und etwas gegen die Arakhe unternehmen. Etwas Endgültiges.
Er bellte, um sein Kommen anzukündigen, und flog zu einem Choul.
Dystran zwang sich zur Ruhe, ehe er Ranyls Privatgemächer betrat. Er nahm sich einen Augenblick Zeit, sein Hemd zurechtzurücken und sich zu vergewissern, dass sein Haar glatt am Kopf lag. Er atmete bewusst langsam und hoffte, sein Gesicht sei nicht zu stark gerötet, nachdem er gerannt war. Auf sein Nicken öffnete ihm der Wächter die Tür. Wärme schlug ihm aus der schwach beleuchteten Kammer entgegen. Er trat ein.
Links brannte ein heißes, gelbes und orangefarbenes Feuer im Kamin und ließ auf den Wänden und Vorhängen trügerische Schatten tanzen. Rechts fiel der Schein einer abgeschirmten Laterne auf Ranyls Bett und die Frau, die danebensaß. Sie hatte einen Arm auf das Bett gelegt und hielt Ranyls Hand. Neben ihr stand eine Schale mit einem Tuch bereit.
Dystran hatte damit gerechnet, das Keuchen eines Mannes zu hören, dessen Ende nahte, doch es war still im Raum. Die Luft war drückend, es roch süß nach Kräuteraufgüssen und Blüten. Rasch trat er ans Bett.
»Danke, Mylady«, sagte er. »Wir wissen Eure Fürsorge in den letzten Tagen sehr zu schätzen.«
Nach kurzem Zögern stand die Frau auf. Sie zog ihre Hand zurück, drückte noch einmal kurz Ranyls Hand und beugte sich vor, um einige Worte zu flüstern und ihn zum Abschied auf die Stirn zu küssen.
Mit gesenktem Kopf eilte sie an Dystran vorbei, dem die Tränenspuren auf ihren Wangen, die im Feuerschein glänzten, nicht entgingen.
Als er saß, verspürte Dystran sofort den überwältigenden Drang fortzulaufen. Er wollte sich nicht dem stellen, was nun kommen musste. Draußen in der dunklen Stadt hallte der Lärm der Kämpfe. Alles, was er kannte und schätzte, war nun bedroht. Und hier, so leise atmend, dass man es kaum hören konnte, lag der Mann im Sterben, den er am dringendsten brauchte.
Er nahm Ranyls Hand und spürte, wie sich die Finger schwach bewegten.
»Seid Ihr müde, alter Knochen?«, fragte Dystran ruhig. Er bemühte sich sehr, sich nichts anmerken zu lassen. Nur wenige Tage war es her, dass Ranyl noch stark gewesen war; er war gelaufen und hatte aufrecht gesessen und ohne Hilfe gegessen. Es tat weh, diese abrupte Veränderung miterleben zu müssen.
Ranyls Augenlider öffneten sich flatternd im Zwielicht. So strahlend und voller Entschlossenheit waren die Augen vor Kurzem noch gewesen. Jetzt waren sie stumpf und lagen tief in den Höhlen. Seine Lippen bewegten sich und brachten ein Zischen hervor, die Worte waren kaum zu verstehen.
»… nicht ertragen, dass Xetesk angegriffen wird. Werft sie zurück.«
»Die Wesmen werden nicht über die Mauern hinauskommen«, erwiderte Dystran sanft. »Ruht Euch aus und haltet durch, damit Ihr seht, wie wir siegen.«
»Nein, junger Spund, ich bin müde.« Er brachte ein schwaches Lächeln zustande. »Ich überlasse das den jüngeren Männern. Ich war … eigentlich habe ich nur noch gewartet, dass Ihr mir Lebewohl sagt.«
Ranyls Stimme wurde jetzt so schwach, dass Dystran sich immer weiter vorbeugen musste. Die Worte jagten dem Herrn vom Berge einen kalten Schauder über den Rücken. Er packte die Hand des alten Mannes und schüttelte sie.
»Nein, Meister Ranyl«, widersprach Dystran. »Ich brauche Euch als Ratgeber. Es gibt sonst niemandem, dem ich trauen kann.«
»Ihr wart ein guter Freund«, sagte Ranyl, »und Ihr seid ein großer Führer. Ihr braucht niemanden.«
»Nein, Ranyl. Haltet durch. Die Schmerzen gehen vorbei, bald werdet Ihr wieder zu Kräften kommen.«
Doch es war nicht wahr, und das wusste er auch. Er sah es in Ranyls bleichem Gesicht, das im Zwielicht wie das eines Gespenstes wirkte. Und er roch es.
Ranyl hustete schwach. »Trauert um mich, aber vermisst mich nicht.«
Dystran nahm es nickend hin. Er lächelte und legte eine Hand auf Ranyls kalte Stirn. »Alles, was ich erreicht habe, habe ich Euch zu verdanken. Ich werde ewig in Eurer Schuld stehen.«
Ranyl kicherte. »Eine nette Grabinschrift«, sagte er, und in seinen Augen flammte noch einmal die alte Kraft auf.
So starb er.
Dystran öffnete die Blenden vor dem Balkon, um die frische Nachtluft hereinzulassen. Vor den Mauern brannten Feuer, und er hörte den Kampflärm und die panischen Schreie, die langsam auf die Straßen übergriffen. Beinahe glaubte er sogar, das Blut in der Luft zu schmecken.
Mehr als alles andere fühlte er sich einsam. Nur ein Mann konnte Xetesk jetzt noch retten. Leider war er selbst dieser Mann. Eine kleine Weile ließ er den Tränen freien Lauf und hörte dem Kreischen von Ranyls Hausgeist zu, der nun wie sein Herr sterben musste.
Der Sieg war zum Greifen nahe, Tessaya spürte es genau. Im Kernland der Wesmen wuchsen harte Männer heran, und er war stolz darauf, neben ihnen zu kämpfen. Die Xeteskianer mussten vor ihm zurückweichen, und sein Herz sang jubelnd vom Sieg.
Er hatte seine Krieger bei einem scharfen Angriff auf den Wehrgängen angeführt. Seine Axt war rot, und seine Arme und die Brust waren von den Klingen der Feinde zerschnitten. Doch jetzt gehörte ihnen der Turm. Vor ihm fiel ein Krieger, dem ein Streitkolben den Schädel eingeschlagen hatte. Tessaya packte ihn am Kragen, als er niedersank, und zerrte ihn zurück. Dann trat er in den frei gewordenen Raum und führte seine Axt von links unten nach rechts oben. Die Klinge traf den Gegner unter dem Kinn, sein Helm flog davon, sein Kiefer war zerschmettert, und sein Kopf wurde heftig zurückgeworfen. Er stürzte rückwärts und brachte die anderen Kämpfer hinter ihm aus dem Gleichgewicht.
Die Wesmen griffen weiter an, der Lärm wurde in der Enge immer größer.
»Haltet die hintere Tür«, befahl Tessaya und stieß einige Männer in diese Richtung. »Die anderen, ihr kümmert euch um die Treppe.«
Auf der engen Wendeltreppe mussten sich die Xeteskianer rasch zurückziehen. Tessaya führte seine Krieger nach unten und nahm sich das Innere des Turms persönlich vor. Die Axt führte er mit der rechten Hand in tödlichen Schwüngen.
Ihm war klar, dass der Rückzug der Xeteskianer am nächsten Treppenabsatz ein Ende finden würde. Befehle hallten durchs Treppenhaus. Die verschreckten Jünglinge vor ihm, denn mehr waren sie nicht, sammelten sich und versperrten ihm den Weg. Draußen vernahm er nach langer Zeit wieder den Einschlag eines Spruchs. Er knurrte, wich etwas aus und packte die Axt mit beiden Händen. Vor ihm stand ein Krieger und versperrte ihm den Weg. Hinter ihm und über ihm gingen die Kämpfe auf den Wehrgängen weiter. Er hörte seine Krieger singen, ihre Stimmen hallten herab, verliehen ihm neuen Mut und ängstigten die Feinde.
»Junge, du wirst sterben, wenn du die Klinge gegen mich erhebst«, sagte Tessaya, um das Patt aufzuheben. Er sprach laut, damit seine Stimme weiter trug als bis zu dem Burschen, der direkt vor ihm stand – ein zitternder Junge, dessen Helm zu groß für den Kopf und das verdreckte Gesicht war. »Aber wenigstens zeigst du im Tod mehr Mut als jene, die dir die Befehle geben. Wo sind sie überhaupt?«
»Wer …« Der Xeteskianer wusste nicht, ob er fragen sollte oder nicht, hin- und hergerissen zwischen Angst und Hochachtung.
»Ich bin Tessaya, der Lord der Paleon-Stämme und der Herrscher der Wesmen«, erwiderte er. »Was für ein Triumph wäre es, wenn du mich besiegen könntest. Der Augenblick ist gekommen. Leg die Klinge ab und bleibe verschont, oder stirb, während du träumst, ein Held zu werden.«
Tessaya glaubte nicht, dass der Bursche überhaupt noch den Mut finden würde, das Schwert zum Angriff zu heben, doch wenigstens in diesem Punkt hatte er sich geirrt. In allem anderen freilich lag er richtig. Mühelos lenkte er den schlecht geführten Streich ab und hackte durch die dünne Rüstung in die Schulter des Burschen. Dabei murmelte er ein Gebet an die Geister und bat sie, den Jungen gnädig aufzunehmen.
Er stieg über den Toten hinweg und stimmte ein Kampflied an, das seine Männer aufnahmen. Sie riefen die Geister an, die ihnen Stärke, ein genaues Ziel und allezeit eine scharfe Schneide schenken sollten. Ein kehliger Gesang war es, dessen Rhythmus zu den Axthieben passte.
Tessaya stieß weiter vor und fegte mit einem aufwärts geführten Schlag die Verteidigung eines Xeteskianers weg, riss einem zweiten auf der linken Seite den Bauch auf und hackte mit der Gegenbewegung einem dritten fast den Arm ab. Der Krieger neben ihm, der dröhnend in das Lied eingestimmt hatte, drang auf seinen Gegner ein, zerschlug dessen Deckung und versetzte ihm einen Kopfstoß auf die Nase. Der Xeteskianer stürzte mit rudernden Armen zurück und stellte vorübergehend für seine Gefährten eine größere Gefahr dar als die Wesmen.
Tessaya sah die Angst in ihren Augen und die zitternden Glieder. Blut troff von den Wänden, der Boden war mit Blut bedeckt, und die Leichen der gefallenen Xeteskianer stanken und dampften. Der Lord der Wesmen leckte sich die Lippen, stürmte los und trieb sie mit jedem Schritt weiter zurück.
Drittes Kapitel
Nichts, was Chandyr bisher erlebt hatte, hätte ihn auf dies vorbereiten können. Zwar war es nicht sein erster Kampf gegen die Wesmen, doch früher hatte er die Magier im Rücken gehabt, die nach Belieben die feindlichen Linien aufbrechen und die Feinde vernichten konnten. Und im Gefecht mit den feindlichen Kollegien verlieh das Gleichgewicht der magischen Kräfte der Kriegführung eine Symmetrie, die er begreifen konnte.
An diesem Abend aber, im Kampf Mann gegen Mann, sah er sich wilden, Ehrfurcht gebietenden Kämpfern gegenüber. Die Wesmen waren unermüdlich. Sie waren geschickt. Und sie schnitten sich durch die Reihen seiner Männer wie durch Papier.
Er saß vor dem verlorenen Turm auf seinem Pferd und sah die Männer nach draußen rennen, sich sammeln und wieder hineindrängen. Er hörte, wie der Hauptmann des Turms Ordnung befahl und nichts ausrichten konnte. Den paar Männern in seiner Nähe stand die Angst ins Gesicht geschrieben. Zu beiden Seiten, hoch droben auf den Wehrgängen, verhöhnten die Wesmen seine schwachen Streitkräfte. Er hatte so wenige Magier, und die Sprüche, die sie zuletzt gewirkt hatten, waren verschwendet gewesen. Jetzt waren die gedemütigten Sprüchewirker in einem Bogen rings um den Turm angetreten und erwarteten seine Befehle. Er wollte sie nicht lange warten lassen.
Chandyr hatte daran gedacht, wieder zum Kolleg zurückzureiten. Doch die Stimmung war schlecht, und man sollte nicht sehen, dass er die Front verließ. So stieg er ab und gab dem nächsten Meldegänger die Zügel seines Pferdes.
Bevor er sprach, betrachtete er noch einmal die Feuer, die auf den Mauern und jenen Gebäuden brannten, auf die die Wesmen Fackeln hatten schleudern können. Immer mehr feindliche Kämpfer sammelten sich hinter den primitiven hölzernen Barrikaden auf dem Wehrgang. Er wagte gar nicht, daran zu denken, wie viele draußen auf die Eroberung des Tors warteten.
In den Straßen ringsum war das frühere Selbstvertrauen der Bürger nackter Panik gewichen. Menschen drängten sich auf den Hauptstraßen und wollten zum Nordtor oder zum Kolleg fliehen, wo sie hofften, Schutz zu finden. Letzteres würde Dystran ihnen sicher nicht gewähren, aber, bei den brennenden Göttern, er würde ihnen die Zeit verschaffen, damit sie wenigstens fliehen konnten.
Sein erwartungsvoll neben ihm stehender Bote zuckte zusammen, als er das Triumphgeheul der Wesmen vernahm, die auf dem Wehrgang zum Turm des Südtors vorstießen.
»Reite zum Kolleg zurück«, befahl Chandyr und gab ihm sein Kommandeursabzeichen. »Sprich mit meiner Autorität und rede mit niemandem außer Dystran persönlich. Sage ihm dies: Wenn er seine Sprüche wirken will, dann muss es jetzt sofort geschehen. Wir verlieren den Kampf um das Südtor. Er muss uns mehr Magier zur Unterstützung geben, oder sie werden vor dem Morgengrauen am Kolleg sein. Hast du das verstanden?«
»Ja, Herr.«
Chandyr fasste den Boten am Arm. »Noch etwas. Sage ihm, er braucht seine Dimensionssprüche nicht zu wirken. Wir schaffen es auch ohne sie. Geh jetzt.«
Chandyr sah ihm nach, als er aufstand und fortritt. Dann drehte er sich um und warf sich mit aller Kraft in den Kampf um Xetesk.
Frühlingsnächte konnten kalt sein, und die Stunden vor der Dämmerung waren die kältesten. Bisher hatte Sharyr jedoch noch nicht gewusst, wie einsam sie sein konnten, vor allem nicht in der Gegenwart so vieler Freunde und Feinde.
Natürlich war es nicht nur sein Auftrag, der ihn so einsam machte. Es war der schreckliche Erfolgsdruck, der auf ihm lastete, und das ungeheure Risiko, das er eingehen musste, um diesen Erfolg zu erringen.
Er und seine zwanzig Köpfe starke Dimensionsgruppe — sie waren sowieso kaum genug – hatten ihre Berechnungen durchgeführt und abwechselnd ausgeruht. Verzweifelt suchten sie nach allem, was ihnen irgendeinen Vorteil verschaffen konnte. Sie brauchten einen stabilen Fokus, während sie gleichzeitig vor den Kräften geschützt blieben, mit denen sie herumspielten. Als Dystran sie zu den Mauern beorderte, hatten sie herzlich wenig gefunden. Das war nicht überraschend, sie hatten viel zu wenig Zeit gehabt.
Die Dringlichkeit der Befehle hatte ihn geängstigt. Im Laufschritt hatte er seine Gruppe aus den Katakomben nach oben geführt. Viel zu viel geschah auf einmal, als dass er die Übersicht behalten konnte. Männer brüllten, Waffen klirrten, Soldaten rannten umher. Das Flackern von Bränden auf dunklen Gebäuden. Menschen, die ihnen entgegengelaufen kamen und zur Seite gestoßen wurden, damit die Magier schneller vorankamen. Der Geruch von brennendem Holz. Die Pflastersteine unter seinen Füßen. Der ungeheure Schlachtlärm, der mit jedem Schritt lauter wurde, während sie sich den Mauern näherten.
Die Kollegwachen hatten sie auf das Dach eines Gebäudes geführt, von dem aus sie einen guten Blick auf die umkämpften Mauern hatten. Kommandant Chandyr war sofort zu ihnen gekommen. Sharyr verpasste die ersten Worte, weil er gebannt beobachtete, was sich vor ihm abspielte. Ein Gedränge von Kriegern auf den Wehrgängen, Leichen in den Straßen darunter. Brände in zwei Wachtürmen. Verzweifelte Verteidiger am Boden. Xetesk in Gefahr.
»… nicht die, die ich hier haben wollte. Warum seid Ihr hier?«
»Mylord Dystran befahl uns hierher, nachdem Ihr Euren Boten geschickt hattet.«
»Ich will Eure Dimensionssprüche nicht, Sharyr. Ihr wisst, was ich davon halte.«
»Kommandant, Ranyl ist gestorben. Dystran will kraftvoll zuschlagen. Wir sind alles, was Ihr habt, und wir haben Anweisung, welche Sprüche wir benutzen sollen.«
Chandyr nickte. »Na gut. Dann seid vorsichtig. Schaltet den Turm da drüben aus. Zerstört die Treppe.«
»Kommandant, so genau können wir nicht zielen. Die minimale Abweichung nach links und rechts beträgt jeweils zwanzig Schritte. Vorausgesetzt, wir können den Fokus halten. Die Ausrichtung der Dimensionen ist noch nicht ideal.«