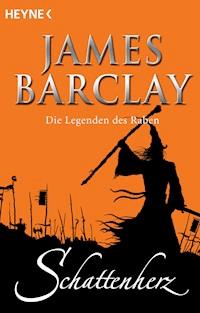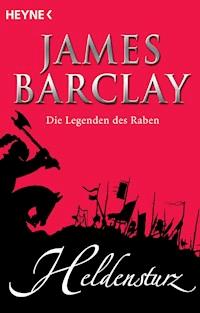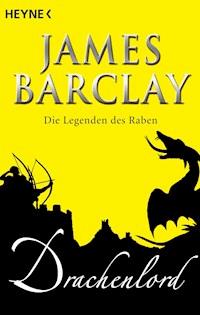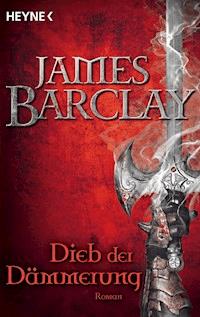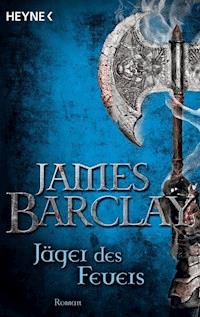6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Legenden des Raben
- Sprache: Deutsch
Die neuen Abenteuer des Raben
Nach der „Chronik des Raben“ nun die mit Spannung erwartete Fortsetzung: Mit den Legenden des Raben kehrt der britische Erfolgsautor James Barclay nach Balaia zurück, wo sich der Elfenmagier Ilkar der größten Herausforderung seines Lebens stellen muss. Können ihm seine Gefährten helfen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 446
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
DIE CHRONIKEN DES RABEN
DIE LEGENDEN DES RABEN
Inhaltsverzeichnis
Für Michael, Nancy und Virginia.Bessere Geschwister kann sich ein Brudergar nicht wünschen.
Es gibt Menschen, ohne die das Schreiben eines Romans nicht die Freude wäre, die es (meistens) ist. Zu ihnen zählen Simon Spanton, der ein großartiger Freund und Redakteur ist; Nicola Sinclair, die hervorragend zu argumentieren versteht und einen guten Blick für Publicity hat; Sherif Mehmet, ein Produktionsgenie, das zwischen den Zeilen immer eine Drohung zur Hand hat, und Robert Kirby, ein ausgezeichneter Agent, der ein Footballteam unterstützt und trotzdem noch lächeln kann …
Mein Dank gilt auch Peter Robinson, John Cross und Dave Mutton, weil ihr in eurer Kritik nicht nachlasst; meinem Neffen David Harrison, der in diesem Jahr mein größter Fan ist; Ariel für die magische Website; Caffe Nero auf der Edgeware Road für den besten Kaffee und die bequemsten Lederstühle in ganz London; und allen anderen, die sich die Zeit genommen haben, mir in Zusammenhang mit dem Raben eine E-Mail zu schreiben.
Personenverzeichnis
Erstes Kapitel
Der Unbekannte Krieger zügelte sein Pferd auf einer Anhöhe, von der aus er den einst so friedlichen Hafen Arlen überblicken konnte. In der aufkommenden Dämmerung und im herankriechenden Nebel tobte eine Schlacht in den Straßen der Stadt am See. Überall im Ort waren Brände ausgebrochen, dicker Rauch stieg auf und verstärkte den Dunstschleier. Das Donnern und Krachen der Sprüche hallte von den Bergen im Norden wider, dunkelblau auf der Seite von Xetesk und grell orangefarben bei den Magiern aus Dordover. Die Rufe der Männer und das vom Nebel gedämpfte Waffenklirren drangen bis auf den Hügel.
In den letzten beiden Jahreszeiten hatte es reichlich Belege dafür gegeben, dass die Beziehungen zwischen den Kollegien sich zusehends verschlechterten, doch dies hier war unendlich schlimmer. Es war ein regelrechter Krieg. Er hatte gehofft, seine Familie in Sicherheit bringen zu können, ehe es losging. Er hatte sogar gedacht, sein Plan könne Frieden stiften. Nun sah er den Beweis für seine Narrheit vor sich.
»Müssen wir wirklich durch diesen Tumult zum Hafen reiten?« Diera war neben ihm, ihr Pferd stupste seines mit den Nüstern an.
Er drehte sich zu ihr um, dann blickte er auf Jonas hinab, seinen kleinen Sohn, den er in seinem großen Arm wiegte. »Ich will euch beide in Sicherheit wissen, und deshalb müsst ihr Balaia verlassen.«
»Tomas war anderer Meinung«, wandte Diera ein. Einige Strähnen ihres blonden Haars drängten sich aus der Kapuze ihres Mantels.
»Tomas ist der sturste Mann, den ich kenne«, entgegnete der Unbekannte lächelnd. Er hatte sich redlich bemüht, auch Tomas zu bewegen, mit seiner Familie zu fliehen und den Krähenhorst zu verlassen. Der Gasthof, den sie zusammen geführt hatten, war von einem Wirbelsturm zerstört worden. »Abgesehen von einem einzigen anderen. Tomas hat Korina nie verlassen, er verschließt die Augen vor den Seuchen, den Ratten und der Hungersnot. Er hofft, es würde besser, sobald der Frühling beginnt. Ich glaube es nicht. Ich habe mehr von Balaia gesehen und glaube, dass es schlimmer wird und nicht besser. Ich will dich nicht hier lassen. Ich kann nicht.«
Diera schauderte, und als spüre er ihr Unbehagen, obwohl er geborgen im Arm seines Vaters lag, begann Jonas zu wimmern.
»Sch-sch«, machte der Unbekannte sanft und wiegte das Kind. »Alles ist gut.«
»Es ist nicht alles gut«, widersprach Diera. »Schau nur dort hinunter. Da bringen sie sich gegenseitig um, und du willst, dass wir mitten hindurchreiten.«
»Das ist erst der Anfang, glaube mir.« Er sah ihr tief in die Augen. »Bitte, Diera. Der Krieg ist ausgebrochen. Jetzt ist es in Balaia nirgends mehr sicher.«
Sie nickte. »Wie kommen wir zum Hafen?«
»Wir müssen beide auf einem Pferd reiten, also musst du bei mir mit aufsteigen. Setze dich vor mich und halte Jonas. Ich passe auf, dass du nicht herunterfällst. Hab keine Angst.«
»Sag das nicht«, erwiderte sie. »Ich habe schreckliche Angst. Du bist an den Lärm und an das Blut gewöhnt.«
»Ich werde nicht zulassen, dass dir irgendjemand etwas antut.«
»Das will ich doch hoffen.« Beinahe lächelte sie.
»Vergiss nur nicht zu tun, was ich dir sage. Es wird da unten schwieriger, und dort haben wir keine Zeit mehr für Diskussionen. Du musst mir vertrauen.«
»Immer.«
Sie stieg ab, und er half ihr, vor ihm aufzusteigen und ihren kleinen Sohn zu nehmen. Dann ließ er seinen großen Hengst im leichten Trab bergab nach Arlen laufen.
Als sie sich von Nordosten auf einem schmalen, wenig benutzten Weg der Stadt näherten, konnte der Unbekannte ein paar Meilen entfernt im Osten ein Lagerfeuer sehen. Eine dordovanische Truppe marschierte im Fackelschein auf der Hauptstraße zur Hafenstadt. Xetesk hatte Arlen insgeheim kontrolliert, als er vor zwei Jahren im Hafen eingetroffen war, und er sah keinen Grund zu der Annahme, dass sich seitdem etwas geändert hatte, abgesehen von der Tatsache, dass Dordover jetzt die offene Konfrontation suchte.
Während sie näher kamen, sahen sie brennende und einstürzende Gebäude. Sprüche krachten in Häuser und trafen Soldaten. Der Lärm des Nahkampfes war ohrenbetäubend. Jonas weinte, und Diera saß stocksteif im Sattel.
»Es wird alles gut«, beruhigte sie der Unbekannte.
»Bring uns nur hier heraus, Sol«, sagte sie und versuchte, das plärrende Kind zu beruhigen.
Durch eine Seitenstraße voller Schatten erreichten sie die Stadt. Der Unbekannte ließ die Zügel schnalzen.
»Halt dich fest«, sagte er. »Jetzt wird es schwierig.«
Er gab seinem Pferd einen Tritt mit den Hacken, und das nervöse Tier rannte los. Das Klirren von Stahl und die Rufe der Kämpfer ergaben in seinen Ohren zusammen mit dem Jammern seines Sohnes eine unangenehme Mischung. Er bemühte sich, das Pferd mitten auf der Straße zu halten, und galoppierte geradewegs zum Hafen. Er wollte am Ostrand der Stadt am Märtyrerpark vorbei und durchs Salzviertel reiten, um am Ende der Hafenanlagen herauszukommen, wo Kapitän Jevin die Calaianische Sonne festgemacht hatte.
Er konnte jetzt schon sehen, dass es schwierig, wenn nicht gar unmöglich war, den ringsum tobenden Kämpfen völlig zu entgehen. Rechts brannten mehrere Feuerkugeln den Nebel weg. Sie kamen in hohem Bogen geflogen und schlugen in Häuser ein oder landeten auf der Straße. Auf das scharfe Knacken und das orangerote Glühen eines zusammenbrechenden Manaschildes folgten sofort die Schreie derjenigen, die auf einmal ohne Schutz dastanden. Rauch wallte auf, als das Manafeuer das Holz und Fleisch verschlang, auf eine Seitenstraße übergriff und sich über Dächer ergoss, bis es ihnen auf allen Seiten den Weg zu versperren drohte.
Vor ihnen rannten Menschen ungeordnet und panisch umher. Es waren die Einwohner der Stadt, die vor den Klingen und den Sprüchen der Kollegien zu fliehen suchten. Einige Dutzend Menschen wurden von drei verunsicherten Kämpfern der Stadtmiliz angeführt. Sie blickten mehr hinter sich als nach vorn, und alle trugen Habseligkeiten oder Kinder und konnten sich nur schwerfällig bewegen. Der Unbekannte fluchte, das Pferd tänzelte nervös unter ihm und wurde unwillkürlich langsamer.
»Halte dich fest.«
Die Einwohner eilten weiter, keiner achtete auf das einzelne Pferd, als sie aus der Stadt flohen. Die schmutzigen, mit Ruß verschmierten Gesichter waren von Angst verzerrt.
»Ihr müsst umkehren, da gibt es kein Durchkommen«, rief einer der Milizionäre, als sie nahe genug waren.
»Wir wollen zum Hafen«, rief der Unbekannte. »Welches ist der beste Weg?«
»Es gibt keinen Weg«, antwortete der Soldat. »Genau dort kämpfen die Bastarde. Lauft weg, das ist eure einzige Chance.« Damit war er verschwunden.
Der Unbekannte ritt weiter, Jonas quiekte und hustete abwechselnd, als der Rauch dichter wurde, je näher sie dem Kampfgeschehen kamen. Dieras Gesicht war bleich und hart.
»Es ist nicht mehr weit.«
Einige Nachzügler kamen ihnen entgegen, als sie rasch die Straße hinunterritten. Den Park hatten sie bereits hinter sich gelassen. Vor ihnen tauchten jetzt niedrige Lagerhäuser und die dicht an dicht gebauten Mietshäuser des Salzviertels auf. Einst war hier Frachtgut gelagert worden, und Seeleute hatten sich hier herumgetrieben. Jetzt brannte es an unzähligen Stellen, und überall wurde gekämpft. Von rechts kamen Männer in enger Formation gerannt und kreuzten ihren Weg, ohne auf sie zu achten. Direkt vor ihnen ging die Außenwand eines Lagerhauses in Flammen auf, Balken brachen krachend zusammen. Ein Brüllen ertönte, das Waffengeklirr klang grimmiger denn je. Sie hatten den Schauplatz der Kämpfe fast erreicht.
Der Unbekannte nahm das Pferd nach links herum und lenkte es zwischen zwei finsteren Lagerhäusern einen schmalen, schlammigen Weg hinunter. Der Kampflärm war hier vorübergehend etwas gedämpft, obwohl er ganz aus der Nähe kam. Als sie im Handgalopp eine Kreuzung überquerten, spähte der Unbekannte nach rechts. Der Durchgang war voller Männer, die Flammen spiegelten sich in den Klingen der Kämpfer, die einen von hier aus unsichtbaren Feind angriffen.
Einen Herzschlag später stiegen Feuerkugeln aus der Finsternis und dem Rauch empor und trafen die vordersten Reihen der Kämpfer. Flammen loderten auf, Balken lösten sich von den Dächern und trafen die Soldaten, rissen sie von den Beinen und schleuderten sie zu Boden. Als kreischende menschliche Fackeln starben sie.
Das ohnehin schon verängstigte Pferd des Unbekannten brach aus und stieg hoch. Die zweifache Bewegung war zu viel für den Krieger, da er auch noch die ohnehin schon schwankende Diera festhalten musste. Er verlor den kurzen Kampf ums Gleichgewicht. Doch als er sich nach links und nach hinten fallen ließ, schloss er seine Frau und seinen Sohn fest in die Arme und federte ihren Sturz mit seinem Körper ab, indem er sich über die Schulter abrollte.
Er stöhnte, vorübergehend außer Atem, als ein stechender Schmerz durch seinen Rücken fuhr. Der Unbekannte rollte sich weiter ab und schützte seine Familie mit dem breiten Rücken vor den Trümmern und dem Schmutz, die durch den Durchgang flogen. Dann kam er wieder auf die Beine, zog Diera hoch und drehte sie zu sich herum. Der kleine Jonas war zu erschrocken, um zu weinen.
»Bist du verletzt?« Er zwang sich zu atmen. Wieder schossen die Schmerzen durch seinen Brustkorb.
Diera schüttelte den Kopf. »Was machen wir jetzt?« Sie presste Jonas an ihre Brust.
»Keine Sorge«, sagte er. »Ich beschütze euch.« Er trat einen Schritt zurück und zog das Schwert und den Dolch. »Mache alles, was ich sage, ohne zu fragen.«
Diera zuckte zusammen. Seine Stimme war hart, seine Augen kalt. Sie hatte Angst, doch es gab keinen anderen Weg, wenn sie überleben wollten. Er schätzte ihre Position ein. Sie mussten weitergehen, etwas anderes kam nicht in Frage. Aus der Querstraße stolperten schon die ersten blutenden, wütenden Überlebenden in ihre Richtung.
»Zurückweichen«, sagte der Unbekannte. Er schob sie sanft in die richtige Richtung. »Nicht rennen.«
Man hatte sie gesehen. Vier Männer mit gezückten Schwertern. Einen Moment lang wurde der Unbekannte von Schuldgefühlen geplagt, weil er seine Familie in diese Situation gebracht hatte. Andere wären als vermeintliche Einwohner Arlens ignoriert worden, doch sein rasierter Kopf, der Stiernacken und die Körpergröße des Unbekannten Kriegers sorgten dafür, dass man ihn sofort erkannte. Und jeder Dordovaner wusste, auf wessen Seite der Unbekannte auf Herendeneth gekämpft hatte. Auf der Seite von Xetesk.
»Rennst du, um dich deinen Seelenbrüdern anzuschließen?« , höhnte einer. Er hatte eine Verbrennung am Kopf, war aber sonst unverletzt. »Leider sind sie ein bisschen zu weit entfernt, was?«
»Ich bringe nur meine Familie in Sicherheit«, sagte der Unbekannte. »Ich habe keinen Streit mit euch.«
»Du bist ein Mann aus Xetesk.«
»Ich gehöre zum Raben.«
»Aber der Rabe ist nicht hier.«
»Halte Abstand, Diera«, sagte der Unbekannte.
»Warum?«
»Und halte Jonas verborgen.«
Der Unbekannte tippte einmal mit der Klinge auf den Boden, dann rannte er den Dordovanern entgegen. Überrascht zögerten sie einen Moment, wie er es erwartet hatte. Das war ihr Fehler. Seine Klinge schlitzte den Bauch des ersten Soldaten auf, wurde aber vom zweiten abgeblockt. Er wehrte einen wilden Hieb des dritten mit dem breiten Handschutz des Dolchs ab, dann ging er in die Hocke und trat dem Schwertkämpfer die Beine weg.
Mit dem rechten Bein stieß er sich ab und durchstach den Hals des Zweiten. Sein rascher Angriff unterlief jegliche Abwehr des Gegners. Kaum dass er zugeschlagen hatte, drehte er sich schon wieder, dieses Mal nach links. Mit dem Dolch wehrte er den raffinierten Stoß des vierten Kämpfers gegen seine Hüfte ab. Er ließ den Schlag abgleiten, brachte den Dolch in Position und stach ihn dem Soldaten ins Auge.
Er ließ die Klinge im Kopf des Toten stecken, bewegte sich sofort weiter, packte sein Langschwert mit beiden Händen, drehte sich um sich selbst und trieb es dem letzten Überlebenden in die Schulter, der gerade wieder aufstehen und sich verteidigen wollte. Weder das eine noch das andere gelang ihm.
Der Unbekannte kniete nieder, um seine blutbespritzte Klinge an der Kleidung der Gegner zu säubern. In der Nähe ertönten Rufe. Einige Dordovaner hatten seinen vernichtenden Angriff beobachtet und wollten auf ihn losgehen. Sie kamen aus beiden Richtungen und waren höchstens noch zwanzig Schritt entfernt. Ein Pfeil zischte an ihm vorbei.
»Verdammt.«
Er richtete sich auf, drehte sich um und steckte die Klingen ein. Diera starrte ihn mit großen Augen und kreidebleichem Gesicht an. Sie deutete auf die vier Leichen hinter ihm.
»Du …«, begann sie.
»Das ist nicht schön, was?« Er nahm sie beim Arm, drehte sie herum und begann zu rennen. »Wir müssen verschwinden. Sofort.«
»Sie sind tot. Du hast sie alle getötet.«
»Das ist mein Beruf. Du weißt das. Komm jetzt.«
Er trug sie fast, als er mit ihr durch die schmale Gasse eilte. Jenseits des Lagerhauses, das sich dunkelgrau rechts neben ihnen erhob, konzentrierten sich die Kämpfe auf den mittleren Bereich der Hafenanlagen. Er nahm an, dass sie noch zweihundert Meter laufen mussten, um das Zentrum des Salzviertels zu erreichen. Viel sicherer war es dort wohl nicht, aber vielleicht fanden sie dort freundliche Klingen.
Hinter ihnen brüllten die Verfolger. Ein Knall neben seinem Kopf und die herabregnenden Steinsplitter verrieten ihm, dass die Bogenschützen sich eingeschossen hatten. Er stieß Diera vor sich her und stützte sie, während sie stolpernd rannte und den wimmernden Jonas unter dem Mantel verbarg.
»Laufe weiter, falls ich hinfalle.«
Ein weiterer Pfeil pfiff knapp an seinem Kopf vorbei und blieb neben ihm in der Mauer stecken. Diera stieß einen erschrockenen Schrei aus. Noch zehn Schritte, dann kam eine Biegung.
»Nach links.«
Er sah sie nicken. Pfeile prasselten hinter ihm gegen die Mauer, einer flog über ihn hinweg. Er duckte sich und hob instinktiv die Arme, um Diera zu schützen. Sie bogen nach links ab. Der Unbekannte spürte, dass ganz in der Nähe gekämpft wurde. Der Durchgang endete vor einer nackten Wand, vor der es entweder links oder rechts weiterging.
»Rechts, geh nach rechts«, sagte er und trieb Diera weiter. Sie stolperte beinahe wieder.
»Bitte«, sagte sie. »Denk an Jonas.«
»Beweg dich«, fauchte er. »Bleib nicht stehen.«
Sie erschrak und rannte weiter nach rechts.
Zwanzig Schritt vor ihnen tobte der Kampf. Die Straße brannte lichterloh, überall rannten Männer umher, Befehle wurden gebrüllt, um das Schlachtgetümmel zu übertönen. Sprüche schlugen hier und dort ein, Feuer und Blitze rissen den Boden auf und vernichteten ungeschützte Soldaten. Leichen und kreischende Verwundete lagen überall am Boden.
»Zehn Schritt noch, dann stehen bleiben«, rief der Unbekannte. »In den Hauseingang, und duck dich.«
Er wartete nicht, ob sie seine Anweisungen befolgte, sondern drehte sich zum Ende der Gasse um, zog das Schwert und tippte rhythmisch auf den Boden. Ihre Verfolger waren nur noch wenige Schritte entfernt, er konnte schon ihren Atem und ihre Rufe hören. Der Erste war ein Bogenschütze, der blindlings um die Ecke rannte, einen Pfeil schussbereit in den Bogen gespannt. Der Unbekannte verlagerte sein Gewicht und zog dem Bogenschützen das Schwert vom Schritt bis in den Brustkorb hoch. Die Wucht des Schlages warf den Mann zurück. Er war tot, ehe er auf den Boden stürzte.
Gleich hinter ihm kamen zwei Schwertkämpfer, einer ein wenig vor dem anderen. Sie waren vorsichtiger als ihr gefallener Kamerad. Der Unbekannte fegte die erste Klinge zur Seite und versetzte dem Soldaten einen Schlag ins Gesicht, der ihm die Nase brach und ihn zurücktaumeln ließ. Der Zweite, ein schneller und gewandter Kämpfer, fügte dem Unbekannten einen tiefen Schnitt im Unterarm bei.
Er fluchte über die plötzlichen Schmerzen, zog einhändig das Schwert herum und traf den Oberschenkel des Angreifers. Der Mann schrie auf und krümmte sich. Der Unbekannte ergriff die Chance, trat nach dem Soldaten und traf sein Kinn. Es riss dem Mann den Kopf zurück, und sein Genick brach mit einem scharfen Knacken. Er sackte in sich zusammen.
Der Unbekannte wandte sich dem zweiten Schwertkämpfer zu, der ihn durch blutverschmierte Finger anstarrte, kehrt machte und um Hilfe rufend wegrannte. Das sollte reichen. Der Rabenkrieger eilte zu Diera.
»Komm jetzt.«
»Dein Arm.« Sie wollte die Wunde berühren.
»Das geht schon«, sagte er mit einem Blick auf das Blut, das über seine Hand rann.
»Nein, du bist verletzt.«
»Wir haben keine Zeit, die Wunde zu verbinden. Wir müssen gehen, jetzt sofort.« Er beugte sich zu ihr und küsste sie. »Bleib nahe bei mir, dann wirst du überleben.«
»Müssen wir da raus?«
»Es ist der einzige Weg.«
Der Unbekannte wusste, was er zu tun hatte. Das Schwert in der Rechten und Dieras zitternde Hand mit der Linken umfasst, lief er rasch auf die breite Hauptstraße hinaus, hielt sich dabei jedoch so gut wie möglich im Schatten.
Draußen auf der Straße war die Hölle los. Links verteidigte Xetesk den Zugang zu einem kleinen Platz, doch die Reihe der Kämpfer war zersplittert. Dordovanische Kräfte drängten von Norden her auf die Straße, ihre Magier bombardierten die Gegner mit Feuerkugeln und Heißem Regen, sodass der ganze Himmel rot zu glühen schien. Soldaten stürzten sich auf die geschwächten Xeteskianer, machten sie nieder, trieben sie weiter und drohten gar, sie einzukesseln. In der Stadt wurde an einem halben Dutzend Stellen gekämpft, doch die Verteidigung, die er brauchte, war nicht hier.
»Wo sind sie nur?«
»Wer denn?«
»Du weißt schon«, erwiderte der Unbekannte. Ein Kraftkegel wurde von der xeteskianischen Seite losgelassen und vertrieb die ungeschützten Dordovaner. Eine Lücke entstand. »Los jetzt.«
Dieras Schrei verlor sich im Lärm, der sie draußen auf der Straße umfing. Der Unbekannte schlug nach links, und ein Soldat fiel, die Hände vor seinen Bauch gepresst. Der große Krieger zerrte seine Frau und sein Kind hinter sich her und folgte so schnell er konnte den dordovanischen Angreifern.
Er ignorierte die Rufe der Dordovaner, als er sie überholte, und betete, dass die Verwirrung im Kampf ihnen lange genug Deckung gab. Er blickte auf die zierliche, zerbrechliche Diera hinab, und sein Herz war von Angst erfüllt. Vielleicht brachte er sie doch nicht unversehrt hier heraus. Vielleicht würden sie und Jonas von den Schwertern der Männer getötet, die nur deshalb angriffen, weil man ihn so leicht erkannte. In diesem Augenblick schaute sie auf, und hinter der Angst sah er ihre Entschlossenheit. Sie drückte Jonas unter dem Mantel eng an sich. Der Unbekannte nickte.
Er ließ sie keine Sekunde los und zog sie dicht hinter sich her, während er sich durch das Chaos, das sie hoffentlich schützte, einen Weg bahnte. Er drängte Männer zur Seite, stieß ihnen unsanft den Schwertgriff gegen die Schulter, ins Gesicht und in den Rücken.
»Platz da, macht Platz!«
Sie reagierten, wie alle Soldaten auf eine befehlsgewohnte Stimme reagieren. Ein paar kostbare Augenblicke lang öffnete sich eine Gasse in den Reihen der Kämpfer, doch er wusste, dass es nicht mehr lange gut gehen konnte. Einer drehte sich um und erkannte ihn.
»Was …«
Das Schwert des Unbekannten zerfetzte seine Kehle. Der große Krieger packte Dieras Hand fester und drängte sich weiter, doch inzwischen waren alle Soldaten ringsum auf den Feind in ihrer Mitte aufmerksam geworden. Er trieb seine Klinge einem Mann in den Rücken, der zu langsam reagierte, beförderte ihn mit einem Tritt zur Seite, wich nach links aus, um einem Schwerthieb zu entgehen, und parierte mit der Klinge den Angriff eines Dritten, der sich zu ihm umgedreht hatte.
»Öffnet die Linien!«, brüllte er zu den Xeteskianern hinüber. »Öffnet die Linien!«
Doch es waren immer noch zu viele Dordovaner im Weg. Nur wenige Schritte noch, bis sie in Sicherheit waren, doch er steckte in der Falle. Er zog Diera herum und wich rückwärts zum linken Straßenrand aus.
»Rufe, wenn uns jemand folgt«, sagte er.
Feuerkugeln schlugen im Zentrum der Straße ein und prallten von magischen Schilden ab. Das Feuer verlor sich harmlos im Boden. In den grellen Lichtblitzen konnte der Unbekannte acht oder zehn Dordovaner ausmachen, die sich ihm näherten. Im Gegensatz zu den anderen hatten sie ihn erkannt. Sie waren vorsichtig, aber trotzdem siegesgewiss.
»Sol …«
»Es wird schon gut gehen«, sagte der Unbekannte.
Doch es sah nicht danach aus. Er blickte hektisch zu den xeteskianischen Linien hinüber, die von Bogenschützen und Magiern unterstützt wurden, während die Dordovaner angriffen.
»Stoßt nach rechts vor, verdammt«, rief er. Er wusste nicht einmal, ob sie ihn überhaupt bemerkt hatten.
Ein Schwertstreich wurde gegen ihn geführt, den er mühelos abwehrte. Er stellte sich der überwältigenden Zahl der Angreifer, ließ Diera endlich los und packte sein Schwert mit beiden Händen. Er bewegte es langsam vor sich hin und her und wehrte die ersten Finten ab. Er wählte das erste und das zweite Ziel aus und fragte sich, wie viele er mitnehmen konnte.
»Zieh einen Dolch aus meinem Gürtel. Wenn ich falle, läufst du. Bleib an der Mauer und versuche durchzukommen. Suche einen Protektor.«
»Ich werde dich nicht verlassen.«
»Du wirst tun, was ich dir sage. Ich habe dich in diese Lage gebracht, und ich hole dich wieder heraus.«
Er machte einen Ausfall, schlug von links nach rechts zu, fegte die schwache Verteidigung weg und schlitzte die Lederrüstung des Gegners auf. Sein Gegner wich zurück, der Unbekannte zog sich ebenfalls zurück. Die anderen schlossen auf, waren nur noch wenige Schritte entfernt, konnten sich aber noch nicht überwinden, ihn anzugreifen. Es war eine versprengte Gruppe ohne Offizier. Vielleicht ging es noch einmal gut. Vielleicht.
Bestürzung machte sich zu seiner Linken in den Reihen der Dordovaner breit. Kraftkegel der xeteskianischen Magier sausten herüber und trieben die Dordovaner zurück. Zwei seiner Angreifer stürzten. Eine schwere Explosion war zu hören. Das Gebäude neben ihm bebte und schwankte unter einem Erdhammer. Weitere Kraftkegel kamen. Sehr nahe waren sie. Der Rand eines Kegels traf ihn, und er stürzte. Diera schrie.
Der Unbekannte rollte sich auf den Rücken herum. Dordovaner kamen angerannt; mindestens drei waren sehr schnell wieder aufgestanden.
Wir kommen.
Panik breitete sich in den dordovanischen Reihen aus. Die drei, die den Unbekannten angreifen wollten, zögerten, dann rückten sie weiter vor. Erst halb auf die Beine gekommen, lenkte der Unbekannte einen Schlag auf seine Brust ab und sprang zurück. Ein zweiter Schlag wurde geführt, der ihn aber nicht mehr erreichte, weil er von der flachen Klinge einer riesigen Axt aufgehalten wurde.
Vor ihm waren jetzt Protektoren. Er kam mühsam auf die Beine, Diera stieß einen überraschten Schrei aus. Als er sich umdrehte, sah er, dass einer der xeteskianischen Elitekrieger sie geschnappt hatte und in Sicherheit brachte.
»Du musst auch gehen«, sagte jemand dicht neben ihm.
Er drehte sich um und sah die leere Maske eines Protektors. Er nickte.
»Danke.«
»Geh jetzt.«
Ein rascher Blick nach hinten zeigte ihm, dass die Protektoren die Lücke zwischen den Gebäuden hielten. Der Unbekannte nickte noch einmal und rannte hinter seiner Frau her über die Mole, an der die Calaianische Sonne dümpelte.
Als seine Frau und sein Sohn wohlbehalten unter Deck in der Kabine waren, kehrte er aufs Ruderdeck zurück, um Jevin, dem Kapitän, die Hand zu geben. Er sah sofort, dass nicht alles im Lot war. Überall waren Protektoren und xeteskianische Magier, und das Schiff hatte bereits abgelegt.
»Danke, dass Ihr gewartet habt.«
»Dafür habt Ihr mich bezahlt«, meinte Jevin kurz angebunden.
»Was ist hier eigentlich los?«, fragte der Unbekannte. »Ich habe zugestimmt, dass ein halbes Dutzend Magier mitkommen. Es müssen mindestens zwanzig sein.«
»Dreißig«, korrigierte Jevin. »Und einhundert Protektoren.«
»Was?«
»Fragt den da.« Jevin deutete auf einen jungen Magier, der sich der Leiter zum Ruderdeck näherte. »Ich muss das Schiff steuern.«
Der Unbekannte sah zu, wie der Magier rasch die Leiter hochkletterte und lächelnd zu ihm kam.
»Der Unbekannte Krieger.« Er streckte die Hand aus. »Ich bin froh, dass Ihr Euch durchgeschlagen habt.«
»Sytkan.« Der Unbekannte übersah die ausgestreckte Hand. »Wollt Ihr mir vielleicht verraten, was diese kleine Armee an Bord von Jevins Schiff zu suchen hat?«
Sytkan besaß immerhin den Anstand, verlegen dreinzuschauen. »Man glaubte auf höchster Ebene, Herendeneth müsse vor einer Invasion aus Dordover geschützt werden.«
Der Unbekannte räusperte sich und blickte zum Hafen zurück. Überall brannte es, doch der Hafen war gesichert. Spruch auf Spruch ging auf die Schilde nieder, und hoch am Himmel konnte er gerade eben noch die Silhouetten xeteskianischer Hausgeister ausmachen, die die Umgebung überwachten. Er schauderte, als er sich an das irre Lachen dieser Dämonen erinnerte.
»Es sollte eine friedliche Mission werden«, sagte er. »Ihr sollt Eure Erkenntnisse den anderen Kollegien zur Verfügung stellen. So war es jedenfalls abgesprochen.«
Sytkan deutete auf die Ruinen von Arlen. »Manchmal ändern sich die Dinge«, sagte er. »Die Dordovaner haben etwas verlangt, das wir ihnen nicht gewähren konnten.«
»Was denn?«
»Sie wollten ihre Magier an der Forschungsexpedition teilhaben lassen.«
»Und das hier ist die Folge davon?« Der Unbekannte schüttelte den Kopf. »Bei den brennenden Göttern, war es die Sache wirklich wert, deshalb einen Krieg anzufangen?«
»Wenn es nicht dieser ist, dann findet sich ein anderer Grund.« Sytkan zuckte mit den Achseln.
Der Unbekannte klatschte die flache Hand auf die Reling. »Die Expedition sollte doch eigentlich einen Friedensschluss fördern. Was, zum Teufel, ist denn schief gegangen?«
Sytkan schwieg sich aus.
»Dystran und Vuldaroq«, sagte der Unbekannte, der die Antwort bereits ahnte. »Das hier könnt ihr wirklich nicht gebrauchen. Ich meine jetzt alle Kollegien. Es gibt schon genug Unruhe.« Er deutete auf Arlen. »Das da wird letzten Endes der Tod der Magie sein.«
Sytkan schnaubte. »Ich denke nicht.«
Der Unbekannte trat auf ihn zu und kam seinem Gesicht sehr nahe. »Unterschätzt nur Selik und die Schwarzen Schwingen nicht. Wenn Ihr mich jetzt entschuldigen wollt, ich muss mich um meine Familie kümmern und eine Schnittwunde nähen lassen.«
Er nickte Jevin zu, als er die Leiter hinunterstieg. Der Schmerz schoss durch seine linke Hüfte und sein Kreuz. Jetzt, da das Adrenalin verbraucht war, forderte auch die alte Verletzung ihren Tribut. Bevor er nach unten ging, warf er noch einen Blick zum Deck und sah viel zu viele Xeteskianer.
Das würde Ilkar nicht gefallen. Es würde ihm ganz und gar nicht gefallen.
Zweites Kapitel
Zwei Stunden vor der Dämmerung veränderte sich die Atmosphäre im Regenwald. Es war für niemanden zu spüren, dessen Leben nicht untrennbar mit dem Blätterdach verbunden war, und doch war es eine deutliche Veränderung. Rebraal hielt sich völlig still und verschmolz beinahe mit dem Hintergrund.
Hinter ihm erhob sich das grün-goldene Dach von Aryndeneth zweihundert Fuß hoch in die Luft. Die Spitze der Kuppel befand sich auf gleicher Höhe mit den höchsten Zweigen des Blätterdachs. Der Tempel stand dort seit mehr als fünftausend Jahren, sein Stein war teilweise hinter einem Vorhang aus dichtem Moos, Efeu und Lianen verborgen. Hin und wieder wurde er von den Pflanzen befreit, doch der wuchernde Wald ließ sich nicht lange zurückhalten.
Ob freigeräumt oder nicht, der Tempel war aus fünfzig Schritt Entfernung kaum zu sehen.
So war es schon immer gewesen. In den Jahrhunderten nach seinem Bau war Aryndeneth ein Ziel für Pilger gewesen, ein heiliger Ort der Elfen, der das Zentrum ihres Glaubens bildete. Das Heim der Erde. Ein großer, mit Stein ausgelegter Vorplatz und ein gewundener Weg zwischen mächtigen Steinplatten hatten die Wanderer empfangen. Der Weg durch den Regenwald war in nördlicher Richtung hundert Meilen weit sorgfältig gesäubert und unterhalten worden.
Der Weg war schon lange verschwunden, ein Teil des Vorplatzes und des Weges waren noch unter den Pflanzen und Lianen sichtbar, doch der Regenwald rückte unerbittlich weiter vor, und Rebraal und seine Leute kämpften einen ewigen Kampf gegen den Wald.
Rebraal blickte nach rechts zu den großen, mit Eisen beschlagenen Holztüren des Tempels. Auch Mercuun hatte es gespürt. Er spähte suchend in die Dunkelheit, und seine Ohren zuckten, als er die Stimmung des Waldes auffangen wollte. Ein Stück entfernt hatten Skiriin, Rourke und Flynd’aar auf den Baumplattformen die Bogen gehoben. Das war die Bestätigung, die Rebraal brauchte.
Er stellte ein Ohr schräg, lauschte angestrengt und versuchte, die Bedrohung zu identifizieren. Die Geräusche des Waldes umgaben ihn, die Hitze war selbst in den Stunden vor der Dämmerung erdrückend. Ein Dutzend Vogelarten stieß Warn- oder Paarungsrufe aus, Affen schrien und begrüßten einander kreischend. Ihre Wanderung durch die Baumkronen war am Rascheln und Knacken der Äste zu erkennen. Unzählige Insekten summten und flatterten und surrten, und das Knurren einer Wildkatze vervollständigte die morgendliche Kakophonie.
Beinahe war es eine Nacht wie jede andere, an die Rebraal sich erinnern konnte. Die Warnrufe fühlten sich jedoch anders an. Die Atmosphäre hatte sich verändert, und alle Wesen im Wald spürten es. Fremde. Nahe und direkt voraus.
Das Schmatzen eines braunen Baumfrosches drang von einer Baumplattform herunter. Rebraal schaute auf. Rourke signalisierte acht Fremde, die sich im Gänsemarsch näherten. Krieger und Magier, die sich einen Weg nach Aryndeneth freihackten. Sie waren keine Pilger. Die Pilger kamen erst nach der Regenzeit, die noch fünfzig Tage anhalten würde. Rebraal nickte, legte die Finger auf die Augen und zog eine Hand quer über seinen Hals. Wer sie auch waren, man durfte nicht erlauben, dass sie entkamen und jemandem den Standort des Tempels verrieten.
Er schnippte zweimal mit den Fingern und hörte, wie Erin’heth und Sheth’erei zu seiner Linken aufschlossen. Magische Schilde wurden eingerichtet, und dann ging er los. Mercuun passte sich seinem Tempo an. Die beiden Krieger liefen geräuschlos, die Magier hinter ihnen bewegten sich nur, um die Krieger innerhalb der Schilde zu halten. Als er zu den dreißig Fuß hoch in den Bäumen hängenden Plattformen sah, konnte Rebraal beobachten, wie die drei Bogenschützen ihre Ziele ins Visier nahmen. Aus dem Winkel der Bogen zu schließen, waren die Eindringlinge nahe, höchstens noch fünfzig Schritt entfernt. Er blieb stehen und hob die Hand.
Die unbeholfen trampelnden Fremden waren jetzt deutlich zu hören. Rings um sie wurde es still im Wald. Er winkte mit dem linken Arm und deutete nach oben. Erin’heth sollte aufsteigen und die Plattform schützen. Er zog seine schlanke, leichte Klinge und hielt sie mit der rechten Hand fest. Mit der Linken öffnete er die Gürteltasche mit den Jaqrui-Wurfsternen.
Er ging weiter, kniff die Augen zusammen und bemerkte vor sich in der Dunkelheit eine Bewegung. Die Fremden benutzten keine Fackeln, doch das Zwielicht konnte sie nicht verbergen. Er hörte das regelmäßige Hacken der Klingen, mit denen die Pflanzen aus dem Weg geräumt wurden, er hörte Zweige unter den Füßen knacken und hin und wieder ein Wort. Zweifellos hatte man ihnen gesagt, dass Lärm im Regenwald die Raubtiere abschreckte. So war es auch, doch es gab eine besonders gefährliche Ausnahme.
Die Fremden sollten den Tempel niemals zu sehen bekommen. Rebraal stieß den eigenartigen klagenden Ruf des braunen Bussards aus und begann zu rennen. Wie ein Geist huschte er über den Vorplatz und verschwand im Wald.
Von den Plattformen wurden Pfeile abgefeuert. Die Fremden stießen erstickte Schreie aus, und er hörte ihre Körper auf den Waldboden stürzen. Eine weitere Pfeilsalve surrte in die Dunkelheit. Befehle und Rufe waren zu hören, und die noch lebenden Fremden verteilten sich. Rebraal nahm einen Jaqrui und duckte sich, während er ins dichte Unterholz eindrang. Mit der Rückhand warf er ihn, als er einen hockenden fremden Krieger über einen umgestürzten Baumstamm spähen sah. Der Wurfstern war wie eine kleine Sichel geformt und hatte an einem Ende einen Griff für zwei Finger. Die rasiermesserscharfe doppelschneidige Klinge flüsterte, während sie flog. Die Waffe war klein genug, um durch die hängenden Ranken einen Weg zu finden.
Der fremde Krieger sah die Waffe nicht kommen, obwohl er geradewegs in ihre Flugbahn blickte; sie traf direkt über den Augenbrauen seine Stirn. Er schrie auf und kippte zurück. Rebraal stieß weiter vor, huschte durch Lücken in der üppigen Pflanzenwelt und schlug einen Bogen um die Überlebenden. Er konnte Mercuun sehen, der die Fremden auf der anderen Seite umging; sie würden sie in die Zange nehmen.
Zwei Magier, einer gebückt und der andere stehend, schauten mit leeren Gesichtern zum Blätterdach hinauf und suchten nach den Plattformen. Einer hatte einen Spruch vorbereitet, der andere hatte gerade einen Spruch gewirkt und vor Konzentration die Stirn in Falten gelegt. Wahrscheinlich wollte er mit einem harten Schild weitere Pfeilsalven abwehren.
Rebraal stürmte los, und der stehende Magier sah ihn erst, als er nur noch fünf Schritt entfernt war. Er sprang über den hockenden Magier hinweg und prallte mit den Füßen voraus gegen die Brust des zweiten. Der Mann ging zu Boden, ehe er einen Spruch wirken konnte. Rebraal landete breitbeinig über ihm, stach ihm die Klinge ins Herz, drehte sich um und schlitzte dem hockenden Magier die Kehle auf, als dieser sich gerade erst umzudrehen begann. Ein weiterer Pfeil durchschlug das Blattwerk, rechts neben Rebraal gurgelte ein Mann und stürzte. Stahl klirrte, ein Schwert prallte klatschend gegen eine Lederrüstung, dann ertönte ein gequälter Schrei, der rasch wieder abbrach.
»Das waren alle«, rief jemand von einer Plattform herunter.
»Beobachte weiter, Rourke«, antwortete Rebraal. »Guter Schuss.«
Er sah sich um, ob die in der Nähe gefallenen Feinde noch lebten, dann drang er ins Gebüsch ein, um seinen Wurfstern zu bergen. Der Krieger atmete noch, obwohl Blut und Gehirnmasse aus der Wunde quollen. Rebraal bohrte ihm die Klinge ins Herz und setzte einen Fuß auf den Kopf des Mannes, um den Wurfstern aus dem Schädel zu bekommen. Er wischte die Waffe am Hemd des Opfers ab, bevor er sie in den Beutel steckte, den er wieder verschloss.
Mercuun kam zu ihm.
»Was sollen wir mit ihnen tun?«
Rebraal wandte sich zu seinem dunkelhäutigen Freund um und sah die Falten auf der Stirn über den schrägen, ovalen Augen. Seine blattförmigen, leicht zugespitzten Ohren zuckten, während er zu verarbeiten versuchte, was gerade geschehen war.
»Hole Skiriin und schleppe die toten Fremden fort vom Weg, den sie sich gebahnt haben. Legt sie auf die Lichtung im Norden. Behaltet alles, was nützlich scheint, zerschneidet die Kleidung und lasst die Körper liegen. Der Wald wird sich um sie kümmern.«
»Rebraal?« Mercuuns Stimme verriet sein Unbehagen.
»Ja, Meru?«
»Wer waren sie, und woher wussten sie, wo sie uns finden können?«
Rebraal fuhr sich mit gespreizten Fingern durchs lange schwarze Haar. »Das sind zwei sehr gute Fragen«, sagte er. »Sie stammen sicherlich aus Balaia, aber viel mehr kann man wohl nicht sagen. Ich werde morgen versuchen, ihren Weg zurückzuverfolgen. Vielleicht finde ich dabei etwas heraus. Inzwischen müssen wir wachsam bleiben.«
»Sie waren sicher nicht die Letzten, oder?«, fragte Mercuun.
»Nein«, erwiderte Rebraal. »Wenn ich raten sollte, dann würde ich sagen, dass sie anderen den Weg hierher bahnen sollten. Ihr Gepäck war zu leicht für irgendetwas anderes. Noch mehr werden kommen, und vielleicht sind sie schon in der Nähe. Wir haben möglicherweise nicht mehr viel Zeit.«
Rebraal sah Mercuun tief in die Augen. Sein Freund machte sich Sorgen, genau wie er selbst. Es war schon schlimm genug, dass die Männer vom nördlichen Kontinent es überhaupt geschafft hatten, an Informationen zu gelangen, die eigentlich niemand haben sollte. Außerdem aber waren sie nicht auf diejenigen hereingefallen, die Fehlinformationen streuten, und sie waren den TaiGethen entgangen, die jeden töten sollten, der allzu beharrlich war. Der Regenwald war ungeheuer groß, doch der äußere Verteidigungsring und die von seiner Art, die in den Städten lebten, hatten mehr als vierhundert Jahre lang alle uneingeladenen Gäste von Aryndeneth fern gehalten.
Er schnalzte mit der Zunge, die Entscheidung war gefallen. »Meru, du sollst die Kunde verbreiten. Beginne bei Sonnenaufgang. Wir können nicht auf die Ablösung warten. Alle verfügbaren Al-Arynaar müssen so schnell wie möglich hierher kommen. Die äußeren Ringe müssen nach Norden gehen. Sie müssen im Norden in Told-Anoor, im Westen in Ysundeneth und im Osten in Heri-Benaar Bescheid geben. Nimm Vorräte für zwei Tage mit, verbreite die Neuigkeiten und komme wieder hierher.«
Mercuun nickte.
Rebraal kehrte zum Tempel zurück und betrachtete dessen verborgene Schönheit. Es war ein Anblick, an dem er sich nicht satt sehen konnte. Er kniete auf dem Vorplatz nieder und schickte ein Gebet zu Yniss, dem Gott der Harmonie, der sie alle beschützen sollte. Danach stützte er die Hände auf die Oberschenkel und lauschte dem Wald.
Wenigstens der Wald hatte sich wieder beruhigt.
Hirad Coldheart, an Sha-Kaans breiten Hals gelehnt, änderete ein wenig seine Position. Die Schuppen kratzten ihn sogar durch das Wollhemd. In der Luft hing eine Wolke von ranzigem Öl und Holzgeruch. Hirad war froh, dass sie im Freien lagerten. Der mächtige Körper des Großen Kaan, mehr als hundertzwanzig Fuß lang von der Schnauze bis zur Schwanzspitze, war auf dem Hang ausgestreckt, auf dem sie ausruhten. Von hier aus konnten sie das verschandelte Idyll von Herendeneth betrachten.
Die kleine Insel, nur anderthalb Meilen breit und zwei Meilen lang, lag tief im Inneren des Ornouth-Archipels. Hier im Süden, nicht weit vor der nordwestlichen Spitze des Südkontinents Calaius, schien die Sonne warm vom Himmel. Die Landschaft war eine wundervolle Mischung aus üppigen grünen Hängen, lichten Buchenhainen und spektakulären Felsformationen, die einen flachen Berggipfel umgaben, auf dem eine mächtige Säule aus Stein als monumentale Erinnerung an eine lange untergegangene, alte Magie erinnerte. Doch die Schönheit war durch Kämpfe und den Tod Unschuldiger unwiderruflich besudelt.
Sha-Kaan hatte sich so hingelegt, dass er Hirad sehen und gleichzeitig über den Hang zu den Hainen, den terrassenförmig angelegten Gräberfeldern und den Gärten blicken konnte. Hinter ihnen standen die Ruinen des einst stolzen Hauses der Al-Drechar. Es war von einer Magie zerstört worden, die die gesamte balaianische Dimension bedroht hatte. Der Drache verdrehte das linke Auge und warf dem Barbarenkrieger einen unergründlichen Blick zu.
»Stören dich meine Schuppen?«, grollte er.
»Tja, ein besonders angenehmes Polster geben sie nicht ab«, sagte Hirad.
»Ich lasse sie von jemandem für dich glatt polieren. Sage mir nur, welche der besonderen Aufmerksamkeit bedürfen.«
Hirad kicherte, drehte sich um und erwiderte den Blick des Großen Kaan. Die strahlend blauen Augen saßen in einem Kopf, der fast so groß war wie er selbst.
»Wie ich sehe, erwacht dein Humor wieder zum Leben«, sagte er. »Aber das wird noch eine Menge Arbeit erfordern.«
Sha-Kaans schlitzförmige schwarze Pupille verengte sich. »Eine kleine Drehung, und dein winziger Körper zerbricht wie ein Zweig.«
Hirad spürte die Belustigung in seinem Bewusstsein wie Nebelschwaden in einer Brise. Zweifellos war der Drache während des erzwungenen Aufenthalts auf Herendeneth milde geworden. In früheren Zeiten hätte er eine solche Bemerkung in vollem Ernst und mit voller Absicht gemacht. Doch ob es in diesem Fall ein Scherz war oder nicht, es entsprach der Wahrheit.
»Ich wollte nur ehrlich sein«, sagte Hirad.
»Ich auch.«
Sie schwiegen. Es war nicht leicht gewesen, sich in den letzten sechs Jahren aneinander zu gewöhnen, doch inzwischen hatte Hirad das Gefühl, Sha-Kaan als Freund bezeichnen zu können. Er hatte seine Beziehung zu dem Drachen als eine Art Lehrzeit verstanden. Seit er sich einverstanden erklärt hatte, der Drachenmann des Großen Kaan zu werden und dem Drachen eine lebenserhaltende Verbindung zur Dimension von Balaia zu öffnen, war er der geringere Partner in einem Bündnis zwischen Ungleichen gewesen. Zwar waren die Vorteile eines direkten Kontakts mit einem Drachen – und die Gewissheit, im Notfall dessen Unterstützung zu bekommen – nicht von der Hand zu weisen, doch solange sie sich kannten, hatte das Ehrfurcht gebietende Wesen, das sich seiner Herrschaft und seiner Kräfte sicher war, nie das Gefühl gehabt, sich dem Menschen gegenüber bewähren zu müssen. Hirad dagegen hatte genau das Gegenteil empfunden.
Doch das Gefälle hatte sich während des langen Exils Sha-Kaans und seines Brutbruders Nos-Kaan etwas ausgeglichen. Die Drachen saßen in einer fremden Dimension fest, der Rückweg war ihnen nach einer gewaltsamen Neustrukturierung der Dimensionen versperrt, und sie konnten ihre Heimat nicht mehr spüren. So war Sha-Kaan sich seiner Sterblichkeit bewusst geworden, da seine Gesundheit stetig schlechter wurde. Hirad dagegen glaubte, seine unerschütterliche Loyalität den Kaan-Drachen gegenüber habe bewiesen, dass er weit mehr war als ein geschätzter Diener – und dass er sich als echten Freund betrachten durfte. Es schien, als teilte mindestens Sha-Kaan diese Ansicht.
Hirads Aufmerksamkeit wurde durch eine Bewegung unten auf den Terrassen erregt. Eine Frau kam hinter einer baumbestandenen Grabstätte hervor und kniete vor einem kleinen, sorgfältig gepflegten und mit einem wundervollen Blumenarrangement geschmückten Grabhügel nieder. Sie war von mittlerer Größe und hatte eine reife Figur, das braune Haar war mit einem schwarzen Band zurückgebunden. Sie zupfte einige Gräser aus dem Beet, und Hirad konnte sehen, wie sie die toten Triebe von einem blühenden Strauch entfernte, dessen gelbe Blüten leise im warmen Windhauch nickten.
Wie immer, wenn er sie sah, schlug Hirads Herz etwas schneller, seine Stimmung sank, und er wurde traurig. Dem unbedarften Auge wäre es so vorgekommen, als erfreue die Frau sich einfach an der Schönheit, die sie dort geschaffen hatte. Doch diese Frau, Erienne, litt unvorstellbare Qualen, weil unter den Blüten ihre Tochter Lyanna begraben war.
Lyanna, die der Rabe hier auf der Insel hatte retten wollen. Lyanna, die mit dem Verstand eines fünfjährigen Mädchens nicht die Kräfte verstehen konnte, die in ihr entfesselt worden waren. Lyanna, die mit ihrer unkontrollierten Magie ganz Balaia hätte zerstören können. Lyanna, die von genau denen dem Tod überlassen worden war, die Erienne versprochen hatten, sie würden das Kind ausbilden, damit es überleben konnte.
Dies war etwas, das Hirad einfach nicht verstehen konnte, obwohl er im letzten halben Jahr auf Herendeneth reichlich Gelegenheit gehabt hatte, es sich zusammenzureimen. Zwei der vier Al-Drechar, die Lyanna hatten sterben lassen, lebten in den noch bewohnbaren Bereichen ihres Hauses hier auf der Insel. Doch die Erklärungen zu Lyannas keimenden Kräften und die Unfähigkeit des Mädchens, diese Kräfte zu kontrollieren, weil sie viel zu klein und körperlich zu schwach war, überstiegen sein Begriffsvermögen.
Er wusste nur, dass der Kern der Einen Magie, der in Lyanna zu keimen begonnen hatte, auf Erienne übertragen worden war, als das kleine Mädchen starb. Und er wusste, dass Erienne das Eine hasste. Sie erlebte es wie eine unheilbare Krankheit, und daher hasste sie die noch lebenden Al-Drechar umso mehr. Sie bekam davon Kopfschmerzen, sagte sie; und auch wenn die Al-Drechar, die schwachen uralten Elfenfrauen, Erienne angeblich helfen konnten, diese Kräfte zu kontrollieren, zu benutzen und zu entwickeln, war sie nicht bereit, ihre Gegenwart überhaupt zur Kenntnis zu nehmen.
Diese Reaktion konnte Hirad verstehen. Im Grunde wunderte er sich sogar darüber, dass Erienne noch nicht versucht hatte, die beiden überlebenden Al-Drechar zu töten. Er wusste, was er gegenüber Leuten empfunden hätte, die sein Kind ermordet hatten. Dennoch war er dankbar, denn trotz Sha-Kaans momentan gelöster Stimmung brachte das Exil in Balaia die Drachen langsam um, und die Al-Drechar konnten mit ihrem Verständnis und ihrer Erfahrung in der Dimensionstheorie den Kaan eine echte Chance bieten, wieder nach Hause zu gelangen.
Das alles hatte die Spannungen verstärkt, unter denen sie während der letzten beiden Jahreszeiten auf Herendeneth ständig gelitten hatten. Hirad brauchte genau die Leute, die Erienne mit inbrünstiger Leidenschaft hasste. Doch hinter ihrem Hass gab es eine Ebene, auf der auch Erienne die Al-Drechar brauchte. Lyanna war das Kind des Einen gewesen, der alten magischen Ordnung, die in Balaia geherrscht hatte, bevor die vier Kollegien vor über zweitausend Jahren entstanden waren. Erienne und ihr Mann Denser glaubten an diese Ordnung, und die Al-Drechar waren deren letzte lebende Vertreter. Was Erienne in ihrem Bewusstsein barg, war die letzte Hoffnung für diese Ordnung, doch sie musste dazu die Hilfe der Al-Drechar annehmen. Allein dieses Wissen verstärkte ihr Elend erheblich.
»Ihr Geist ist umwölkt«, sagte Sha-Kaan, der zu Erienne hinabschaute. »Kummer verschleiert die Vernunft.« Die Bemerkung des Großen Kaan, der die extreme Verfassung von Eriennes Geist in seinem eigenen spüren konnte, verriet kein besonderes Mitgefühl.
»Das ist nur natürlich«, erwiderte Hirad.
»Für Menschen vielleicht«, antwortete Sha-Kaan. »Es macht sie gefährlich.«
Hirad seufzte. »Sha-Kaan, sie hat mit ansehen müssen, wie drei ihrer Kinder ermordet wurden, Lyanna von den Al-Drechar und ihre Zwillinge von den Hexenjägern der Schwarzen Schwingen. Es wundert mich, dass sie überhaupt noch bei Verstand ist. Würdest du dich nicht ähnlich fühlen?«
»Ehrlich gesagt sind Geburten bei den Kaan schon seit langer Zeit ein sehr seltenes Ereignis«, erwiderte der Drache nach einer Weile. »Wenn ein junger Kaan stirbt, dann müssen wir ihn ersetzen. Wir haben keine Zeit zu trauern.«
»Aber du musst doch etwas für die Mutter und das junge Wesen empfinden, das gestorben ist«, sagte Hirad.
»Die Brut trauert, und die Brut unterstützt. Der Geist der Mutter wird durch die Psyche der Brut getröstet, und ihr Schmerz wird geringer, wenn sie ihn teilt. So ist es bei den Drachen. Bei den Menschen ist Kummer etwas Einsames, das daher lange anhält.«
Hirad schüttelte den Kopf. »Einsam ist es nicht. Wir sind alle hier, um Erienne zu helfen.«
»Aber da du nicht in ihren Geist schauen kannst, kannst du ihr nicht dort helfen, wo sie es am dringendsten braucht.«
Ein reptilisches Bellen hallte über die Insel. Nos-Kaan umrundete die dreißig Fuß hohe Steinsäule und glitt herab, um dicht neben Sha und Hirad zu landen. Seine goldenen Rückenschuppen schimmerten im Sonnenlicht, und die Erde bebte, als seine Hinterpfoten den Boden berührten. Die mächtigen Schwingen, die hundert Fuß oder mehr von Spitze zu Spitze maßen, schlugen noch einmal, damit er nicht das Gleichgewicht verlor, dann faltete er sie auf seinem langen Körper zusammen. Der Luftzug wehte Hirad ins Gesicht. Nos-Kaan krümmte den Hals, um den Kopf dicht neben Sha-Kaans Kopf zu legen. Die Drachen berührten sich kurz mit den Mäulern. Selbst jetzt noch, nach so vielen Jahren, fand Hirad den Anblick Ehrfurcht gebietend und fühlte sich einen Moment lang klein und unbedeutend angesichts solcher Größe und Pracht.
»Sei gegrüßt, Hirad«, sagte Nos-Kaan mit schmerzerfüllter Stimme.
»Wie war der Flug?«
»Willst du die Wahrheit wissen?«, fragte der Drache. Hirad nickte. »Ich brauche die heilenden Ströme des interdimensionalen Raumes, sonst muss ich sterben. Vorher jedoch werde ich an den Boden gefesselt sein.«
Hirad war erschüttert. Er hatte angenommen, die Ruhe, die die beiden Kaan in den letzten beiden Jahreszeiten auf Herendeneth gefunden hatten, hätte die magischen Wunden heilen lassen, die sie sich beim Kampf gegen die dordovanischen Magier zugezogen hatten.
»Wie lange noch?«
»Eine Jahreszeit noch, länger nicht. Ich bin schwach, Hirad.«
»Und du, Großer Kaan?«
»Ich bin bei besserer Gesundheit«, erklärte Sha-Kaan. »Aber auch mein Tod ist unausweichlich, wenn ich nicht bald nach Hause komme. Wo sind dein Unbekannter Krieger und seine Forscher?«
»Er müsste bald kommen. Er hat es versprochen.«
Eigentlich hätte er längst hier sein müssen. Die letzte Begegnung mit dem großen Mann lag lange zurück, und Hirad begann allmählich zu fürchten, ihm sei etwas zugestoßen. Aus Balaia hatten sie wenig gehört. Was sie erfahren hatten, hatte auf dem unvollständigen Wissen der Protektoren beruht, und nichts davon hatte erfreulich geklungen.
»Deine Loyalität ist bewundernswert«, meinte Sha-Kaan.
»Er gehört zum Raben«, erklärte Hirad. Er zuckte mit den Achseln und stand auf. »Es ist mal wieder Zeit, nach Schiffen auf dem Meer Ausschau zu halten.«
Vor allem wollte er aber einen Augenblick allein sein. Nur noch eine Jahreszeit, bis Nos-Kaan sterben musste. Auch beim allerbesten Willen auf der Welt konnte die Forschung bis dahin keine brauchbaren Sprüche zur Neuanordnung der Dimensionen entwickeln. Nos-Kaans Grabstein würde auf Herendeneth stehen.
Hirad ging rasch den Hang hinunter, ließ Erienne einen guten Vorsprung und bewegte sich im Dauerlauf, sobald er am verbarrikadierten Haupteingang des Hauses vorbei war. Der Protektor Aeb stand dort und blickte nach Norden. Hirad nickte ihm im Vorbeigehen zu.
Der Weg, der zur einzigen Landestelle der Insel hinunterführte, schlängelte sich durch Buchenhaine bis zu einer kleinen, von Riffen gesäumten Bucht. Es war ein friedlicher Spaziergang. Der warme Luftzug ließ die Blätter der Bäume rascheln, Vogelrufe drangen von den Ästen herab, in der Ferne war das Rauschen der Wellen am Strand zu hören. Trotz allem, was er gerade gehört hatte, musste Hirad lächeln. Als er um die nächste Ecke bog, verflog das Lächeln auf der Stelle.
»Bei den brennenden Göttern.« Er langte instinktiv nach der Klinge, die er schon seit hundert Tagen nicht mehr trug, und zog sich bergauf zurück.
Männer in langen Gewändern und Roben kamen den Weg herauf. Es waren zwei Dutzend, vielleicht mehr. Magier. Und wo Magier auftauchten, waren Soldaten nicht fern.
»Aeb!«, rief er über die Schulter nach hinten. »Darrick! Wir werden angegriffen!«
Einer der Magier hob die Hände. Er wollte sicher einen Spruch wirken. Da es zum Weglaufen zu spät war und die Gegner ihm hoffnungslos überlegen waren, tat Hirad das Einzige, was ihm jetzt noch einfiel. Er griff an. Um seinen Kopf zu klären, stieß er einen Schrei aus und stürzte sich mit erhobenen Fäusten auf den Magier. Sein Zopf flatterte hinter ihm.
»Hirad! Bei den Göttern, so beruhige dich doch!«, rief jemand hinter der Gruppe der Magier, die stehen geblieben waren und ihn erschrocken ansahen.
Hirad bremste ein paar Schritte vor ihnen in einer Staubwolke schlitternd ab.
»Unbekannter?«
Er sah genau hin. Da näherte sich der unverkennbare rasierte Schädel; neben ihm ging eine Frau, und Protektoren umringten ihn. Viele Protektoren. Hirad schnaufte erleichtert.
»Bei den ertrinkenden Göttern, ihr habt mir vielleicht einen Schrecken eingejagt.«
Die Magier teilten sich, und der Unbekannte kam nach vorn. Er humpelte stärker als sonst und hatte das Gesicht vor Schmerzen verzogen.
»Es ist schön, dich zu sehen«, sagte der Unbekannte und erdrückte Hirad fast mit seiner Umarmung.
»Ich freue mich auch, Unbekannter. Allerdings siehst du etwas blass aus. Hast du die Familie in den Urlaub mitgebracht, damit ihr etwas Farbe bekommt?«
Der Unbekannte gab Hirad lachend wieder frei und wich einen Schritt zurück. Diera, mit zurückgekämmtem langem Haar und starken, schönen, aber bleichen Gesichtszügen, trat neben ihren Mann. Jonas zappelte in ihren Armen und wollte alles gleichzeitig sehen. Verunsichert starrte er Hirad an, und der Barbar erwiderte kichernd den Blick des kleinen Jungen. Der Unbekannte nahm seine Frau in den Arm und zog sie an sich.
»Wir hatten in den letzten beiden Jahreszeiten leider nicht die Muße, uns in der Sonne aalen zu können«, antwortete er. »Ganz im Gegensatz zu dir, wie es scheint.«
»Ganz so einfach war es freilich nicht«, entgegnete Hirad.
»Das glaube ich dir gern«, lenkte der Unbekannte ein.
»Ich vergesse meine Manieren«, sagte Hirad. Er beugte sich vor und küsste Diera auf die Wange, dann streichelte er Jonas’ Kopf. »Schön, dich zu sehen, Diera. Und wie ich sehe, hat Jonas die Haarpracht vom Vater geerbt.«
Diera blickte lächelnd auf den völlig kahlen Kopf ihres Sohnes hinab. »Hirad, er ist noch kein Jahr alt, der arme Kleine. Vor einer Jahreszeit hatte er noch reichlich Haare.«
Hirad nickte. »Das wächst wieder nach, junger Mann«, sagte er zu Jonas. »Hoffentlich. Und wie geht es dir, Diera? Du siehst ein bisschen müde aus, wenn ich das sagen darf.«
»Seereisen behagen mir nicht«, gab sie zu.
»Darüber solltest du mal mit Ilkar reden. Er ist unser Experte fürs Fische füttern.«
»Hirad, du bist widerlich«, ermahnte Diera ihn sanft. »Ich brauche einfach nur einen Platz zum Schlafen, der sich nicht ständig unter mir bewegt.«
»Ich denke, so etwas lässt sich hier einrichten.« Hirad sah sich zum Unbekannten um, legte den Kopf schief und musterte die zahlreichen Protektoren und xeteskianischen Magier.
»Was hat das zu bedeuten?«, fragte er. »Das ist ein bisschen mehr als eine Forschungsexpedition, oder?«
Der Unbekannte schüttelte ernst den Kopf.
»Es ist viel mehr als das«, sagte er. »Hör mal, wir können nicht hier bleiben. Auf Balaia gibt es Arbeit für den Raben.«
»Wir müssen wohl zuerst nach Calaius.« Hirad führte sie den Weg hinauf und warf einen letzten Blick zu den Xeteskianern. »Das wird Ilkar nicht gefallen. Kommt schon, wir wollen euch im Haus unterbringen.«
Drittes Kapitel
Dystran, der Herr vom Berge in Xetesk, dem Dunklen Kolleg der balaianischen Magie, hatte es sich in seinem tiefen, mit Leder gepolsterten Lieblingssessel bequem gemacht. Ein Feuer wärmte an diesem kühlen Spätfrühlingstag sein Arbeitszimmer und erfüllte es mit einem gelben, flackernden Schein, passend zum bleichen Sonnenlicht, das durchs Fenster hereinfiel. Ein Becher Kräutertee dampfte rechts neben ihm auf dem niedrigen Tisch.