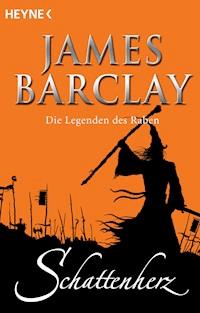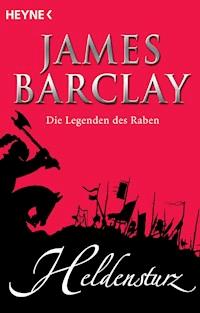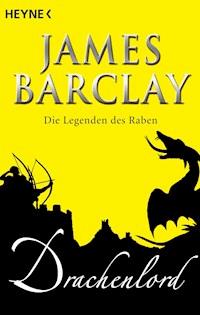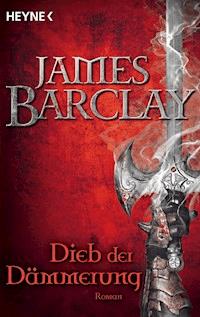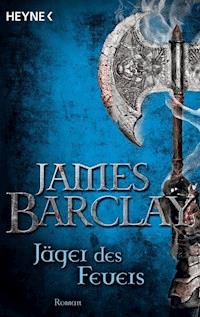6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Legenden des Raben
- Sprache: Deutsch
Nach „Schicksalswege“ der zweite Roman in James Barclays „Legenden des Raben“
In Balaia weiten sich die Kämpfe aus. Die Elfen, die bisher fern aller Intrigen in Frieden lebten, sehen sich in tödlicher Bedrängnis. Nachdem ihr Heiligtum entweiht wurde, sterben sie zu Tausenden an einer mysteriösen Krankheit. Können der Elfenmagier Ilkar und seine sechs Gefährten die magische Ordnung wiederherstellen und so das Sterben der Elfen beenden?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 443
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
DIE CHRONIKEN DES RABEN
DIE LEGENDEN DES RABEN
Inhaltsverzeichnis
Für Michael, Nancy und Virginia.Bessere Geschwister kann sich ein Bruder gar nicht wünschen.
Es gibt Menschen, ohne die das Schreiben eines Romans nicht die Freude wäre, die es (meistens) ist. Zu ihnen zählen Simon Spanton, der ein großartiger Freund und Redakteur ist; Nicola Sinclair, die hervorragend zu argumentieren versteht und einen guten Blick für Publicity hat; Sherif Mehmet, ein Produktionsgenie, das zwischen den Zeilen immer eine Drohung zur Hand hat, und Robert Kirby, ein ausgezeichneter Agent, der ein Footballteam unterstützt und trotzdem noch lächeln kann …
Mein Dank gilt auch Peter Robinson, John Cross und Dave Mutton, weil ihr in eurer Kritik nicht nachlasst; meinem Neffen David Harrison, der in diesem Jahr mein größter Fan ist; Ariel für die magische Website; Caffe Nero in der Edgeware Road für den besten Kaffee und die bequemsten Lederstühle in ganz London; und allen anderen, die sich die Zeit genommen haben, mir in Zusammenhang mit dem Raben eine E-Mail zu schreiben.
Personenverzeichnis
Erstes Kapitel
Unter einem freundlichen, leicht bewölkten Morgenhimmel öffnete sich das Osttor von Xetesk. Dreihundert Kavalleristen und Magier trabten hindurch, gefolgt von fünfzehnhundert Fußsoldaten und Dutzenden Wagen.
An der Spitze des Zuges, neben dem xeteskianischen Kommandanten Chandyr, ritt Rusau, Seniormagier und Angehöriger der lysternischen Delegation. Entsetzt betrachtete er das Durcheinander von Leichen und Kleiderfetzen, die das Gelände des ehemaligen, brutal geräumten Flüchtlingslagers bedeckten. Als die Pferde vorbeikamen, flogen die Aasvögel auf, und Fliegenschwärme summten zornig über dem verwesenden Fleisch. Es herrschte ein unbeschreiblicher Gestank.
»Seht nur, welches Zerstörungswerk Ihr angerichtet habt, Kommandant Chandyr«, sagte er. »Ihr habt Menschen vertrieben wie Tiere und dabei viele getötet.«
Keine Spur von Reue war Chandyr anzusehen, als er Rusaus Blick erwiderte. Er war Berufssoldat, hatte die Vierzig überschritten und war im letzten Jahrzehnt Zeuge vieler Kämpfe geworden. Pockennarben verunstalteten sein Gesicht, und auf Kinn und Stirn prangten bleiche Schmisse. In seiner Rüstung aus verstärktem Leder bot er einen blutrünstigen Anblick, und sein Weltbild war schlicht.
»Zuerst waren sie Opfer, jetzt sind sie Parasiten. Wir müssen uns um unsere eigenen Probleme kümmern und können uns nicht noch die Sorgen anderer Leute aufhalsen. Dordover ist ein mächtiger Gegner.«
»Allerdings hättet Ihr auch beschließen können, diesen Leuten zu helfen, Holz für neue Häuser zu schlagen und Felder für neue Saaten zu pflügen. Die Feldschmiede hätten dazu beitragen können, dass diese Flüchtlinge neue Hoffnung schöpfen.«
»Häuser zu bauen, ist dem Tod im Kampf durchaus vorzuziehen«, räumte Chandyr ein, »aber wir müssen uns zunächst verteidigen, ehe wir uns in ganz Balaia verstreuen, um den Menschen zu helfen. Seid Ihr in der letzten Jahreszeit einmal durch das Land gereist?«
»Nein«, gestand Rusau. »Meine Pflichten hielten mich in Lystern fest.«
»Ihr solltet mit den Magiern reden, die hier eintreffen. Zwar trifft es zu, dass die Schwarzen Schwingen überall den Hass gegen uns schüren, doch das Land ist nicht ganz so stark zerstört, wie sie uns glauben machen wollen. Es gibt da draußen durchaus noch Schmiede und Holzfäller, ebenso Baumeister und Bauern. Das Land muss sich aus eigener Kraft erholen. Wir als Soldaten des Kollegs haben vor allem die Pflicht, unsere Grenzen zu schützen.«
»Dies ist jedoch ein Konflikt, der am Verhandlungstisch mithilfe von Vernunft und Beratungen beigelegt werden kann. Der Krieg gibt dem Hass nur immer wieder neue Nahrung. Und schließlich geht es auch um ganz einfache Dinge, oder?«
»Die Dinge, um die es geht, interessieren mich nicht. Ich bin für den Schutz von Xetesk zuständig.«
Rusau atmete tief durch. Vor ihnen erstreckte sich das schöne Reich der xeteskianischen Magier nach Nordosten in Richtung Lystern und nach Norden in Richtung Dordover. Kein Zweifel, es war eine liebliche Landschaft. Sie präsentierte sich in vielen Grünschattierungen – Bäume, Büsche, Farn und Gräser. Überall sprossen die ersten Frühlingsblumen und brachten die unerschöpfliche Kraft der Natur mit frischen Farben zum Ausdruck.
»Ich kann dem Einhalt gebieten«, sagte Rusau, und er glaubte tatsächlich fest daran.
»Wirklich?«, entgegnete Chandyr. »Genau wie die dordovanische Delegation? Was haben sie denn bisher zustande gebracht, einmal abgesehen von ihren unverschämten Forderungen, die in der Offiziersmesse für Heiterkeit sorgen?«
»Es liegt in der Natur aller Verhandlungen, mit dem Unerreichbaren zu beginnen und einen Kompromiss anzustreben.«
»Kompromisse!« Chandyr spie das Wort förmlich aus. »Wir verteidigen uns gegen einen Angriff, den wir nicht provoziert haben.«
»Demnach ist Xetesk Eurer Ansicht nach kein Vorwurf zu machen?«
Chandyr lief rot an. »Ihr reitet an meiner Seite, weil ich Euch schätze, Rusau. Und weil Dystran, der Herr vom Berge, einen unvoreingenommenen Bericht über das hören will, was wir vorfinden. Wir sind nicht die Aggressoren. Wir haben diesen Konflikt nicht vom Zaun gebrochen, er wurde uns vielmehr aufgedrängt. Es sind nicht unsere Streitkräfte, die Flüchtlinge in Nachbarländer treiben. Nicht wir sind es, die Unschuldige als Unterpfand einsetzen. Allerdings werden wir nicht untätig zusehen, wie so etwas geschieht. Wir werden nicht zulassen, dass Dordover unser Land besetzt. Wir werden kämpfen, um zu beschützen, was uns gehört.«
»Ich will Euch nicht zu nahe treten, Kommandant«, sagte Rusau, »aber wenn wir die Dordovaner treffen, dann solltet Ihr Euch besser zurückhalten und mich sprechen lassen, ob sie sich nun auf dem Land von Xetesk befinden oder nicht. Worte sind eine Sache, der Verlust vieler Menschenleben ist eine ganz andere. Wenn sie Euch sehen und mich anhören, werden sie es sich vielleicht überlegen.«
»Ihr seid naiv, so etwas zu glauben«, sagte Chandyr. »Dennoch bete ich darum, dass Ihr Recht behaltet. Vergesst aber nicht, dass Soldaten Befehle ausführen und kämpfen, wie es ihren Anweisungen entspricht. Ihnen ist bekannt, dass nicht jeder, der das Schlachtfeld betritt, es lebendig wieder verlässt. In den dordovanischen Streitkräften werdet Ihr meiner Ansicht nach niemanden finden, der berechtigt ist, die Entscheidung zum Rückzug zu treffen.«
»Das mag sein, aber wärt Ihr denn bereit, auf den Kampf zu verzichten, wenn es mir gelingt, einen Waffenstillstand auszuhandeln, damit die Herrscher miteinander sprechen können?«
»Ich werde die Lage einschätzen, wenn wir den Dordovanern begegnen«, sagte Chandyr. »Doch wir befinden uns im Krieg, Rusau, und ich werde keine Entscheidung treffen, die unser Land in Gefahr bringt.«
»Mir muss allerdings erlaubt werden, die Linien zu überschreiten«, sagte Rusau.
»Genug«, fauchte Chandyr. »Ich muss mein Land verteidigen, und ich werde in Abstimmung mit dem Seniormagier meine Entscheidungen treffen, wie ich es für richtig halte. Wenn Ihr mir dabei ins Gehege kommt, riskiert Ihr Kopf und Kragen. Ich hoffe, Ihr versteht das. Jetzt lasst mich nachdenken. Bitte zieht Euch ins Zentrum der Marschkolonne zurück.«
Er sah Rusau scharf an, und dem lysternischen Magier war die Verunsicherung deutlich anzumerken.
»Sofort, Rusau. Ich möchte Euch nicht mit Gewalt entfernen lassen.«
Rusau gehorchte und hielt sich bis auf weiteres vom xeteskianischen Kommandanten fern. Am Spätnachmittag des zweiten Tages, als eine leichte Bewölkung den bislang schönen Frühlingstag trübte, wurde er jedoch wieder nach vorn gerufen.
Chandyr war in eine Unterhaltung mit dem Seniormagier Synour vertieft, der im Zentrum der xeteskianischen Macht rasch aufgestiegen war. Sie näherten sich der Kuppe eines niedrigen Hügels, hinter dem ein flaches Tal lag. Dort floss der Dord, der in seinem weiteren Verlauf das Land von Dordover berührte, bis er nördlich des Triverne-Sees in den Triverne mündete. Der Dord bildete zugleich die Nordgrenze der Gebiete von Xetesk und Lystern.
»Kommandant«, meldete er sich, als er zu Chandyr aufgeschlossen hatte.
Chandyr nahm seine Ankunft mit einem Nicken zur Kenntnis, beendete aber zunächst seine Unterhaltung, bevor er sich wieder Rusau zuwandte.
»Meine Späher berichten, dass eine Streitmacht von etwa achtzehnhundert Dordovanern gleich nördlich des Flusses ein Lager aufschlägt«, erklärte er. »Dort haben sich schätzungsweise fünfhundert Flüchtlinge gesammelt. Sie sind von den Dordovanern eingekesselt, befinden sich aber derzeit südlich des Flusses, also auf dem Land von Xetesk. Ihr werdet bald bemerken, dass Dordover darauf achtet, niemanden auf das Land von Lystern zu lassen. Ich denke, die Botschaft ist klar.«
»Was habt Ihr nun vor?«
»Die Flüchtlinge müssen sofort freigelassen werden, damit sie ihre Häuser wieder aufbauen können. Die Dordovaner dürfen sie nicht daran hindern. Ich schicke dem dordovanischen Kommandanten, wer es auch sei, eine entsprechende Nachricht. Ihr könnt gern unter der Parlamentärsflagge hinüberreiten, dürft Euch aber nicht in die Übermittlung der Botschaft einschalten. Dieser Punkt ist nicht verhandlungsfähig. Die Flüchtlinge dürfen nicht als Geiseln gegen uns eingesetzt werden.«
»Ich will sehen, was ich tun kann«, sagte Rusau.
»Bringt nicht Euer Leben in Gefahr«, warnte Chandyr ihn. »Ich bin so wenig für Euch verantwortlich, wie es die Dordovaner sind. Mein Bote wird umgehend mit der Antwort zurückkehren. Falls die Antwort negativ ausfällt, werden wir sofort vorstoßen, solange wir noch Tageslicht haben.«
»Kommandant, Ihr müsst mir eine Chance geben«, flehte Rusau.
»Nein, Rusau, das muss ich nicht«, erwiderte der Befehlshaber. »Bei allem Verständnis für Euch, meine Befehle sind eindeutig. Dordover hat eine Invasion gegen uns begonnen. Diese Invasion werde ich abwehren. Reden können wir, sobald sie sich nördlich des Dord befinden. Ich schlage vor, dass Ihr Euch möglichst rasch in Deckung begebt.«
Rusau nickte. »Ich hatte auf etwas mehr Verständnis von Eurer Seite gehofft. Wo ist Euer Bote?«
»Er wird bereits vom Sergeant eingewiesen. Ihr findet beide zu Eurer Rechten.« Chandyr deutete auf zwei Reiter, die sich ein wenig abseits des Zuges unterhielten. »Noch etwas, Rusau: Ich weiß eines ganz genau. Wir haben diesen Krieg nicht gewollt, aber wir werden ihn führen. Vielleicht gelingt es Euch, die Dordovaner zur Vernunft zu bringen, aber wenn ihr mich fragt, ist die Zeit der Verhandlungen vorbei.«
Als der Bote den Abhang hinauf und über die Hügelkuppe ins Tal sprengte, folgte Rusau ihm. Eine weite, mit Gras bewachsene Ebene erstreckte sich leicht abschüssig bis zum anderthalb Meilen entfernten Dord. Am Südufer wartete eine dichte Traube von Menschen. Der Begriff ›eingekesselt‹ beschrieb ihre Lage recht gut. Sie standen eng beisammen und wurden von Reitern und Fußsoldaten der Dordovaner bewacht. Nördlich des Flusses hatten die Feinde Zelte aufgeschlagen, Lagerfeuer angezündet und Banner aufgezogen. Hammerschläge und das Wiehern von Pferden wehten herüber.
Als sie an den Flüchtlingen vorbeikamen, löste sich ein dordovanischer Reiter aus der Wachabteilung und setzte sich neben sie.
»Du verschwendest deine Zeit, Xeteskianer«, sagte er zum Boten. »Schone die Beine deines Pferdes und spare dir selbst den Atem, solange du überhaupt noch atmen kannst.«
»Wie heißt dein vorgesetzter Offizier? Ich habe eine Botschaft für ihn.«
Der Kavallerist lachte. »Wie diszipliniert du bist. Kehre um und merk dir meine Worte, Junge.«
»Sein Name«, verlangte der Bote.
»Meistermagier Tendjorn«, erwiderte der Kavallerist. »Er wird dich zum Frühstück verspeisen.«
Damit entfernte er sich und ritt zu seinen Gefährten zurück, die in ein demonstratives lautes Lachen ausbrachen.
»Wie freundlich«, bemerkte Rusau.
Der Bote antwortete nicht, sondern ritt unbeirrt weiter zum höchstens dreißig Schritt breiten Dord, dessen flaches Wasser nicht einmal seine Stiefel benetzte. Ohne aufgehalten zu werden, gelangten sie bis ins Zentrum des Lagers und stiegen ab. Das Kommandantenzelt mit den hochgeklappten Seitenwänden war nicht zu übersehen. Drinnen stand ein Tisch, der bis auf verschiedene Becher und einige Flaschen leer war. Fünf Männer warteten dort bereits auf die Boten.
»Ihr habt Euch Zeit gelassen«, sagte einer, den Rusau für Tendjorn hielt. Ein hässlicher Mann mit Knollennase, winzigen Ohren und schütterem, ungepflegtem Haar. »Und wer seid Ihr? Haben sie einen lysternischen Lakaien geschickt, der für sie betteln soll? Wir haben schon genug Ärger mit Euresgleichen.«
»Ich bin Rusau aus Lystern«, bestätigte er. »Ich will Frieden, wie wir es letzten Endes wohl alle wollen.«
»Nun, das wäre bereits Euer erster Irrtum«, sagte Tendjorn. »Die erste Kampfhandlung des Krieges bestand darin, dass Xetesk das Nachtkind geschützt hat, und jetzt setzen wir ihnen die Konsequenzen ihrer Invasion vor die Tür, damit sie sich damit beschäftigen können.«
»Das Schicksal dieser Leute ist nicht die Folge des Streits«, erwiderte Rusau. »Ihr könnt sie nicht als Geiseln einsetzen.«
»Wirklich nicht? Xetesk hat uns daran gehindert, uns bei der ersten sich bietenden Gelegenheit mit dem Nachtkind zu befassen. Xetesk hat dazu beigetragen, dass das Kind viel länger überleben konnte, als es uns lieb war, und dadurch wurde Balaia länger als nötig von den Elementargewalten heimgesucht. Deshalb sind die Flüchtlinge auch deren Problem.«
»Euer Erinnerungsvermögen ist getrübt«, widersprach Rusau, doch Tendjorn brachte ihn mit einem Fingerschnippen zum Schweigen.
»Eure Botschaft, Xeteskianer«, sagte er.
Der Bote zog einen ledernen Umschlag unter dem Wams hervor und überreichte ihn.
»Mein Auftrag lautet, Eure Antwort so bald zu übermitteln, wie es Euch nur möglich ist.«
Tendjorn öffnete den Umschlag und zog das einzelne Blatt Papier heraus. Es war eine kurze Botschaft, die der Magier lächelnd und kopfschüttelnd las.
»Du meine Güte, wie berechenbar«, murmelte er und reichte das Dokument den vier Soldaten und Magiern, die sich hinter ihm versammelt hatten. Dem Boten klatschte er den leeren Umschlag vor die Brust. »Bestellt Eurem Kommandanten, dass wir uns nicht zurückziehen, solange er nicht zusagt, sich um die Leute zu kümmern, die sein Kolleg obdachlos gemacht hat. Jeder Versuch, sie zurück über den Fluss zu treiben, wird eine angemessene Antwort nach sich ziehen.«
»Ja, Mylord.« Der Bote verneigte sich mit ausdruckslosem Gesicht.
Rusau fasste ihn an der Schulter. »Wartet. Ihr könnt doch nicht diese Botschaft überbringen. Das ist verrückt. Tendjorn, ich beschwöre Euch, überlegt es Euch noch einmal.«
»Ihr müsst die Hand wegnehmen, Sir«, sagte der Bote. »Ihr dürft einen Boten unter der Parlamentärsflagge nicht behindern.«
»Ich weiß, aber …« Er zog die Hand zurück, worauf der Bote sich abrupt umdrehte und das Zelt verließ. »Überlegt Euch doch, was Eure Botschaft bedeutet. Noch mehr Männer werden sterben.«
»Hört auf zu blöken, Rusau, und seht der Realität ins Gesicht«, erwiderte Tendjorn. »Dieser Streit dreht sich um erheblich mehr als nur um Herendeneth. Es geht um das Gleichgewicht, das Xetesk zerstören will.«
»Ihr müsst nur eure Streitkräfte zurückziehen und den Leuten erlauben, in ihre Heimat zurückzukehren, damit sie alles wieder aufbauen können. So hätten wir auch eine Verhandlungsgrundlage. Bitte, Tendjorn, irgendjemand muss doch einen Anfang machen, damit der Frieden eine Chance hat.«
Doch Tendjorn trat zu Rusau und sah ihm in die Augen.
»Es gibt nur eine Möglichkeit, diesen Krieg zu beenden. Lystern muss sich auf unsere Seite stellen. Seht Ihr es denn nicht? Xetesk wollte von Anfang an den Krieg, wir haben nur die Planungen gestört. Versagt Ihr uns Eure Unterstützung, könnten sie uns schlagen, anderenfalls sicherlich nicht. Heryst ist vorsichtig. Doch was nützt ihm das noch, wenn Xetesk bis vor seine Tore marschiert? Ihr Lysternier, Ihr und Eure Unterhändler, habt Euer Bestes gegeben. Hat Xetesk Euch zugehört? Schlagt Euch jetzt auf unsere Seite. Wir wollen Xetesk nicht zerstören, wir wollen das Gleichgewicht wiederherstellen. Sie wollen dominieren, begreift Ihr das nicht?«
»Ich weiß nur, dass der Krieg die ganze Magie erheblich schwächt und auch das Volk treffen wird, das wahrlich schon genug gelitten hat. Noch mehr Unschuldige werden in diesem Krieg sterben, und der Hass wird zunehmen. Glaubt nicht, die Nichtmagier seien zu schwach zum Kämpfen. Seht Euch nur an, was die Wesmen Julatsa angetan haben.«
»Ja, Rusau«, grollte Tendjorn. »Und seht Euch an, was mit dem Gleichgewicht der Magie geschehen ist. In diesem Augenblick beschützen wir Julatsa vor der unausweichlichen Invasion von Xetesk. Wo sind die Lysternier, die angeblich mit Julatsa befreundet sind? Xetesk darf diesen Krieg nicht gewinnen.«
»Heryst ist bereits unterwegs, um genau diese Frage mit Vuldaroq zu besprechen. Hat man Euch darüber nicht informiert? Wartet ab, bis sie eine Übereinkunft erzielt haben.« Angesichts dieser engstirnigen Entschlossenheit, Blut zu vergießen, konnte Rusau nur verzweifeln.
»Bei den Göttern, Mann, seid Ihr blind?«, rief Tendjorn. Er entfernte sich einen Schritt und hob beide Arme. »Ihr wart in Xetesk, habt Ihr es nicht gesehen?«
»Was soll ich gesehen haben?«
»Ich kann’s nicht glauben«, sagte Tendjorn. »Ist Euch nicht aufgefallen, dass sie jeden kampffähigen Mann in der Stadt bewaffnen und ausrüsten? Buchstäblich jeden. Sie unterweisen Frauen und Kinder, damit sie die kämpfenden Truppen versorgen. Die Schmieden sind Tag und Nacht in Betrieb. Sie wollen diesen Krieg gewinnen, und sie wollen nichts von Frieden wissen. Ob Ihr es glaubt oder nicht, die Funde auf Herendeneth werden sie nur noch weiter stärken. Und jetzt geht mir aus dem Weg, ich muss mich auf die Schlacht vorbereiten.«
Im Laufschritt verließ Rusau das Zelt und sprang auf sein Pferd. Er bahnte sich einen Weg durch das Heer, das gerade Aufstellung nahm. Rufe ertönten im Lager, die Männer sattelten ihre Pferde und stiegen auf, einige gaben ihren Waffen mit dem Wetzstein den letzten Schliff. Magier planten Manöver zur Verteidigung und zum Angriff. Niemand achtete auf ihn, als er durch den Fluss stürmte. Zu seiner Rechten wurden die Flüchtlinge aus der Kampfzone getrieben. Jetzt hörte er sie rufen und sah, wie groß ihre Angst war. Vor ihm galoppierte der Bote den Hang hinauf, schwenkte seine Parlamentärsflagge und nahm sie dann schräg herunter.
»Verdammt auch«, fluchte Rusau.
Die erste Reihe der Xeteskianer erschien auf dem Hügel und zeichnete sich vor dem Horizont ab.
Avesh stand da und hielt die weinende Ellin in den Armen. Seit sie sich am Dord getroffen und ihren Sohn begraben hatten, weinte sie. Essen wollte sie nicht, nur ein wenig Wasser aus dem Fluss hatte sie getrunken. Er konnte sie verstehen. Ihr Sohn war tot, und sie konnte nicht einmal fliehen und trauern, weil die Dordovaner sie gefangen hielten. Der Weg über den Fluss war versperrt, sie konnten nirgendwohin. Die Dordovaner hatten ihnen zu essen gegeben und freundlich mit ihnen gesprochen, doch es bestand kein Zweifel, dass die Flüchtlinge jetzt Geiseln waren, die gegen Xetesk eingesetzt werden sollten. Wie, das wagte er sich nicht auszumalen.
Am liebsten hätte er sie fortgeschafft, fort an irgendeinen sicheren Ort, damit er tun konnte, was er tun musste. Zurückschlagen. In diesem Augenblick war er hilflos gefangen zwischen zwei Kollegien, und beiden war es egal, ob er lebte oder starb.
Er hatte die beiden Reiter den Hang heruntergaloppieren und den Fluss überqueren sehen, um das dordovanische Lager aufzusuchen. Dann waren sie getrennt voneinander zurückgekehrt, der mit der Flagge als Erster. Anschließend war die Schlachtreihe von Soldaten und Reitern auf dem Hügel erschienen, bereit zum Angriff. Er schauderte und fluchte halblaut. Ihm fehlte sogar die Kraft, sich zu ängstigen wie all die anderen ringsum. Er hatte nicht mehr viel zu verlieren.
Fest drückte er Ellin an sich und küsste sie aufs Haar.
»Sei stark, meine Liebe«, sagte er. »Und höre mir zu. Wir müssen noch einmal fliehen.«
Zweites Kapitel
Sobald Rusau und der Bote hinter dem Hügel verschwunden waren, hatte Chandyr begonnen, seine Männer einzuteilen. Die Kavallerie bildete zwei Flügel, dazwischen waren seine Fußsoldaten postiert. Magier hatten entlang der Linien Aufstellung genommen und lieferten Deckung für Offensive und Defensive.
Chandyrs Ziel war klar. Seine Männer würden keinen Fuß ins Wasser des Dord setzen, denn dies war nicht ihr Auftrag. Allerdings würden sie jeden Feind ans andere Ufer zurücktreiben.
Er rief seine Kräfte zur Ordnung. Geschwenkte Fahnen meldeten ihm, dass die linke Flanke bereit war. Die rechte würde er selbst anführen.
»Bogenschützen bereit?«, rief er.
»Aye!«, kam die Antwort.
»Fußsoldaten bereit?«
»Aye!«
»Greift nur Bewaffnete an, schießt nur auf Bewaffnete. Ich will so wenig Blutvergießen wie möglich unter den Flüchtlingen. Niemand darf dordovanisches Land betreten. Wir wollen keine Invasion durchführen. Noch nicht. Leutnant, blast zum Angriff.«
Befehle liefen die Linie hinunter, die sich über eine drittel Meile erstreckte. Chandyr ritt im Trab hinter seine Kavallerie. Wenn es gut lief, sollte es ein klassischer Zangenangriff werden. Allerdings musste er damit rechnen, dass die Dordovaner die Taktik durchschauten. Für den Fall, dass es nicht gelang, hatte er seinen Offizieren bereits Befehle erteilt, die im Handumdrehen an alle Einheiten weitergegeben werden konnten. Chandyr hatte Ry Darricks Manöver gründlich studiert und eine Menge über Kampfstrategien gelernt. Er fragte sich, ob er irgendetwas davon praktisch anwenden konnte.
Das Heer rückte langsam bis auf den Hügel vor, die Kavallerie bewegte sich im gleichen Tempo. Es war ein gleichmäßiger, geordneter Vorstoß wie aus dem Lehrbuch. Nur der Späher, der zu Fuß über den Hügel zurückgerannt kam, störte das Bild. Der Mann hielt direkt auf Chandyr zu.
»Der Bote kehrt zurück, Sir«, sagte der Mann atemlos. »Die Flagge ist unten, Sir, sie ist unten.«
»Verschnaufe und reihe dich ein.«
»Ja, Sir.« Der Späher salutierte und rannte sofort weiter, um der Kavallerie auszuweichen.
Chandyr sah nach links zum Melder. »Gib das Zeichen zum Angriff.«
»Sir!«
Der Mann hob eine schmale rote Flagge und schwenkte sie zweimal in einem weiten Kreis. Der Befehl wurde aufgenommen und durch die Linie weitergegeben.
»Im Trab!«, befahl Chandyr.
Die Kämpfer beschleunigten ihre Schritte, liefen den Hang hinauf, überwanden die Hügelkuppe und stürmten mit unvermindertem Tempo auf der anderen Seite hinunter. Chandyr konnte beobachten, dass die Flüchtlinge nach links gescheucht wurden, doch sie waren nicht schnell genug. Am Nordufer nahmen die Dordovaner Aufstellung, locker aufgereihte Kavallerie hinter Fußsoldaten, dazwischen einzelne Reiter, bei denen es sich um Magier handeln musste. Mitten auf der leeren Ebene ein einsamer Reiter. Rusau.
»Bei den Göttern, du Narr«, murmelte Chandyr. »Du verdammter Narr.«
Jetzt konnte er nichts mehr für den Beobachter tun. Er hatte den Mann deutlich genug gewarnt, und doch empfand er eine Spur Bedauern.
Links hatten die Flüchtlinge jetzt das anrückende Heer bemerkt. Sie hatten Angst, und die Dordovaner hatten Mühe, die aufkeimende Unruhe zu unterdrücken. Die Ersten waren den Wächtern bereits entkommen. Einige rannten weiter nach links, andere eilten den Abhang herauf und den Xeteskianern entgegen. Die meisten flohen jedoch zum Fluss.
»Eng zusammenbleiben«, rief Chandyr. »Formation halten!«
Als sie den Abhang herunterkamen, durchquerten die Dordovaner gerade den Fluss und nahmen auf dem diesseitigen Ufer erneut Aufstellung. Sie bewegten sich nur langsam und blieben auf ebenem Grund, um den Xeteskianern nicht den Vorteil zu geben, bergab angreifen zu können. Die Streitkräfte näherten sich einander, Rusau befand sich immer noch zwischen den Fronten.
»Weg da«, flüsterte Chandyr. Dann rief er laut: »Verschwindet von dort, Rusau!«
Seine Stimme trug weit. Rusau nahm sein Pferd herum und hielt direkt auf Chandyr zu. Er rief etwas, doch der Xeteskianer konnte ihn erst verstehen, als Rusau dicht vor ihm sein Pferd zügelte.
»Hört doch auf mit diesem Wahnsinn!«, rief er.
»Letzte Warnung, Rusau. Zieht Euch zurück.« Er drehte sich zu seinen Leutnants um und gab mit geballter Faust ein Zeichen. Sie waren noch hundert Schritt von den Dordovanern entfernt, die Magier bereiteten schon die Sprüche vor. »Melder! Bereithalten!«
»Sir!«
»Chandyr.«
»Geht jetzt.«
Rusau zog abermals sein Pferd herum und galoppierte zu den Dordovanern zurück.
»Bogenschützen!«, rief Chandyr. Die Bogenschützen blieben hinter den Fußsoldaten stehen und knieten nieder, die Dordovaner auf der anderen Seite folgten ihrem Beispiel. »Schilde hoch.« Die Befehle wurden sofort über die Befehlskette weitergegeben. Harte Schilde und magische Schilde wurden errichtet, und die Magier meldeten den Vollzug. »Feuer frei!«
Pfeile flogen; eine Salve nach der anderen sauste durch die Luft und prallte gegen die Schilde der Dordovaner, die auf die gleiche Weise dagegenhielten. Rusau, der inzwischen wieder unten angekommen war, wurde von den dordovanischen Soldaten unsanft beiseite geschoben. Chandyr hatte keine Zeit mehr, ihn zu beobachten. Die dordovanische Kavallerie war links und rechts ausgebrochen und galoppierte hinter den Linien entlang, wo die Pikeniere schon bereitstanden.
»Warten«, rief Chandyr. »Warten.«
Er beobachtete die Kavallerie genau. Sie war nicht zahlreich, die xeteskianischen Reiter waren deutlich in der Überzahl; allerdings war noch nicht zu erkennen, welche Taktik die Dordovaner verfolgten. Dreißig Schritt, das war nahe genug.
»Angriff!«, rief er.
Der Melder stieß die Flagge nach vorn, die Fußsoldaten brüllten und griffen an, seine Kavallerie galoppierte los. Bogenschützen ließen die Bogen fallen und stürzten sich in den Nahkampf, Sprüche knallten. Inmitten des Tumults trieb Rusau, der seinen Fehler erkannte, sein Pferd verzweifelt an, um nach rechts zu entkommen. Er würde es nicht schaffen.
Einige xeteskianische Feuerkugeln sausten durch den Spätnachmittagshimmel, schlugen zwischen Magiern und Bogenschützen ein, zischten und knallten auf Schilde oder explodierten auf dem Boden. Ein kurzer Wolkenbruch von Heißem Regen ging auf die dordovanischen Fußsoldaten nieder. Die feindlichen Magier waren bereit, und ihre Schilde hielten ebenso wie die der Xeteskianer, als die nahe liegende Reaktion erfolgte.
Allerdings hatte Chandyr noch etwas in Reserve. Wie sie es geübt hatten, machten die xeteskianischen Fußtruppen, die immer noch der Kavallerie voraus waren, plötzlich vier erheblich langsamere Schritte. Unerwartet wurde so die dordovanische Linie für xeteskianische magische Angriffe zugänglich. Weitere Feuerkugeln schlugen in einem konzentrierten Angriff auf der linken Seite ein. Mindestens ein magischer Schild brach unter dem plötzlichen, konzentrierten Feuer zusammen. Magische Flammen fraßen sich in Rüstungen und Kleidung, Gesichter verkochten, Pelze und Haut verbrannten. Rasch starben die hilflosen Opfer in den nicht löschbaren Flammen.
»Nach rechts vorstoßen, achtet auf die Kavallerie an der Flanke!«
Chandyr ritt mitten in die dordovanische Kavallerie hinein, die Reiter zu seiner Linken griffen die desorientierten und geschwächten Gegner an, zu seiner Rechten schwärmten seine Soldaten aus, um die anderen Kämpfer vor Flankenangriffen zu schützen.
Rusau geriet mitten ins Getümmel, er lenkte sein Pferd nach links und rechts, während rings um ihn die Schwerter gehoben wurden und sich senkten. Chandyr beugte sich nach links und führte über den Kopf seines Pferds hinweg einen Streich gegen die Waffe eines Feindes. Er ließ den Zügel los und zog mit der linken Hand die Schulter des Mannes nach vorne, während er die Waffe zurücknahm. Aus dem Gleichgewicht gebracht, sah der Dordovaner nicht, dass Chandyrs Klinge sich in die Gegenrichtung bewegte, um seinen behelmten Kopf zu treffen. Betäubt fiel der Mann vom Pferd und wurde von den Hufen zertrampelt.
Der xeteskianische Kommandant sah sich nach seinen Soldaten um. Sie hatten die Dordovaner auf der rechten Flanke zurückgedrängt, bald würden die feindlichen Linien vollends zusammenbrechen. Wieder zuckten Sprüche über seinen Kopf hinweg, und die feindlichen Magier waren vollauf damit beschäftigt, ihre Schilde zu halten. Mindestens einer brach mit einem Knall zusammen.
»Rusau!«, brüllte er, doch seine Stimme ging unter im Schlachtlärm, im Klirren der Schwerter, in den Schreien der sterbenden Männer, den Rufen von fünfzig Leutnants und dem Stampfen unzähliger Hufe.
Ein Schwert fuhr auf ihn herunter. Instinktiv blockte er den Schlag ab. Sein gut platzierter Hieb warf den Dordovaner in den Sattel zurück, und im Nachsetzen konnte er dem Gegner mit einem zweiten Stoß die Schwertspitze durch den Hals treiben.
»Weiter, weiter!«, drängte er, als er sah, wie die Dordovaner zurückwichen.
Chandyr zog sein Pferd nach links, schlug nach unten und traf die Schulter eines Pikeniers, dessen Waffe sich am Boden verfangen hatte. Im Schlachtgetümmel war jede Ordnung dahin, und die Männer kämpften nur noch um ihr nacktes Überleben. Chandyr entschloss sich jedoch, um das Leben eines anderen Menschen zu kämpfen – das von Rusau. Kaum zu glauben, aber der Lysternier saß immer noch aufrecht im Sattel, auch wenn sein Mantel und die Kleider voller Blut waren.
»Zieht Euch zurück, verdammt!« Dabei wusste Chandyr genau, dass der Magier ihn nicht hören konnte, da er mitten im dichtesten Kampfgetümmel steckte. Sein Pferd war verletzt und verängstigt, es stieg hoch und bockte, und Rusau legte eine bemerkenswerte Geschicklichkeit an den Tag, als es ihm gelang, dennoch im Sattel zu bleiben.
Chandyr hackte sich den Weg zum hilflosen Magier frei. Sein Pferd, das für den Kampf ausgebildet war, trat dabei nach allen Seiten aus und stieß mit dem Kopf, um die Feinde zu vertreiben und seinem Reiter ein gutes Gesichtsfeld und Bewegungsfreiheit mit dem Schwert zu geben. Der Xeteskianer hielt die Beine hinten und das Schwert vorn, um den Gegnern ein möglichst kleines Ziel zu bieten.
»Rusau! Zu mir!«
Sein Schwert traf das Gesicht eines Fußsoldaten, und er sah erleichtert, dass der Magier ihn gehört hatte.
Doch Rusaus Pferd gehorchte nicht. Der Magier zerrte an den Zügeln und wollte sich etwas Platz verschaffen, was ihm jedoch nicht gelang.
»Helft ihm!« Chandyr beugte sich im Sattel weit nach vorn und ließ das Schwert herabfahren. Wieder ein Schritt gewonnen. Ringsum stießen seine Männer vor. »Los doch, los!«
Jetzt war es sinnlos geworden, Befehle an Männer zu geben, die weiter als fünf Schritte entfernt waren. Es kam nun vor allem darauf an, dass die Truppführer den Schlachtverlauf richtig deuteten. Erfahrene Männer, die inmitten von Metall und Blut, Panik und Tod nicht die Übersicht verloren. Darrick hatte es ihn gelehrt, und er hatte seine Männer entsprechend unterwiesen. In dieser Schlacht war die Übersicht der entscheidende Faktor. Auf der ganzen Linie hielt Xetesk die Formation, und Dordover musste zurückweichen.
Noch einmal spornte er sein Pferd an, beförderte einen Mann mit einem Tritt zur Seite und drängte sich durchs Kampfgetümmel.
»Rusau!« Er konnte den Mann jetzt fast berühren. »Springt hinter mir auf.«
Auf einmal, als ein wenig Raum entstand, stießen von beiden Seiten Piken zu. Chandyrs gut ausgebildetes Pferd wich sofort einen Schritt zurück und stieg hoch, um die Vorderhufe zur Verteidigung einzusetzen. Auch Rusaus Reittier stieg voller Panik hoch, warf dabei aber den Reiter ab. Mit einem Schrei stürzte der Magier, verzweifelt mit den Armen rudernd, aus dem Sattel und fiel geradewegs in eine erhobene xeteskianische Pike hinein.
»Nein!«, schrie Chandyr, doch es war zu spät.
Die Klinge durchbohrte den Rumpf des Lysterniers und trat, nachdem sie alle Rippen gebrochen hatte, an der Brust wieder aus. Ein Blutschwall schoss aus dem Mund des sterbenden Magiers, und der Pikenier ließ den Stab fallen und zog sein Kurzschwert. Er fürchtete viel zu sehr um sein Leben, als dass er sich hätte Gedanken machen können, was er gerade getan hatte.
Chandyr nahm das Pferd herum und galoppierte aus dem Getümmel heraus, um sich einen Überblick über den Verlauf der Schlacht zu verschaffen. Der Sieg war ihnen sicher, die Dordovaner wurden über den Fluss zurückgetrieben. Das war für Chandyr in diesem Augenblick jedoch zweitrangig. Viele Dordovaner hatten Rusau sterben sehen – einen neutralen Beobachter durch die Pike eines Xeteskianers. Er wagte sich nicht auszumalen, welche Konsequenzen dies haben würde.
Es war Nacht, und die Schlacht war gewonnen. Die Dordovaner waren vernichtet oder über den Fluss zurückgetrieben, hatten allerdings vorher viele Flüchtlinge zu Tode gehetzt, die hilflos zwischen den Fronten eingekeilt gewesen waren.
Drei Meilen weiter im Westen hatten sich die überlebenden Flüchtlinge gesammelt und drängten sich Schutz suchend um ihre Lagerfeuer. Ihre Zuversicht hatte abermals einen starken Dämpfer bekommen, und nun waren sie ohne Essen, Obdach und Hoffnung gestrandet.
Die Flucht vom Schlachtfeld war schrecklich gewesen. Sobald die dordovanischen Wächter sie verlassen hatten, um die brüchige Front zu verstärken, hatte Avesh Ellin aus der verängstigten Menschenmenge fortgezogen, die zum Dord rannte oder sich der Gnade der Xeteskianer ausliefern wollte. Viele waren ihm gefolgt, und im Laufe des Tages gesellten sich noch weitere dazu.
In fast völligem Schweigen saßen sie im Nieselregen, der aus dem bewölkten Himmel fiel. Ellin lag reglos in Aveshs Armen. Er wiegte sie leicht und verfluchte diejenigen, die sie vom hellen Sonnenlicht in diesen inneren Abgrund gestoßen hatten. Er wollte zurückschlagen, wusste aber nicht, wie er mit denen Verbindung aufnehmen konnte, an die er dachte. Dann aber, als er schon mit dem Schlaf kämpfte, ritten drei von ihnen ins Lager.
Die erschöpften Flüchtlinge schreckten hoch, doch die Reiter versuchten, die Unruhe rasch zu besänftigen, und versicherten ihnen, sie kämen aus keinem Kolleg. Avesh richtete sich auf, die Müdigkeit wich langsam von ihm, und als die Leute verstummten, ergriff einer der Reiter das Wort.
»Ich und meine Männer haben die heutigen Ereignisse beobachtet, und ich will Euch mein Mitgefühl für Euer schweres Los aussprechen. Für diejenigen, die Euch kaum besser als Tiere behandelt haben, empfinde ich Zorn. Allerdings bin ich zu Euch gekommen, weil ich Euch eine Hoffnung bieten und einen Weg aufzeigen kann, wie Ihr etwas ändern und der Verfolgung ein Ende setzen könnt. Mein Name ist Edman, und ich bin ein Abgesandter der Schwarzen Schwingen.«
Er wartete, bis sich die Nervosität der frierenden, durchnässten und hungrigen Flüchtlinge wieder gelegt hatte.
»Bitte«, fuhr er mit erhobenen Händen fort, »ich weiß, dass wir keinen guten Ruf genießen, doch ich will Euch versichern, dass wir nichts Böses im Schilde führen. Wir wollen wiederherstellen, was untergegangen ist, doch wir brauchen Helfer, damit das Wirklichkeit wird. Ich kann Euch Essen und einen Unterschlupf bieten. Es ist von hier aus ein weiter Fußmarsch, doch wir werden Euch bei jedem Schritt des Weges beschützen. Wir werden Euch vor dem gemeinsamen Feind abschirmen und den Kranken und Verwundeten helfen. Wer zurückkehren möchte, um das Leben wiederaufzubauen, dass die Kollegien Euch genommen haben, soll mit unserem Segen gehen. Wer aber mit uns kommen will, wird das Seine dazu beitragen, dass alle in den kommenden Jahren sicher und in Frieden leben können. Wer will uns begleiten?«
Es gab keine Fragen, die Leute waren misstrauisch und ängstlich, doch Avesh war nicht der Einzige, der ein neues Ziel vor sich sah. Ellin streichelte sein Gesicht.
»Du musst gehen«, sagte sie. »Räche unseren Sohn für mich. Und wenn du es getan hast, findest du mich in den Trümmern unseres Hofs, wo wir noch einmal von vorne anfangen.«
Avesh blickte auf sie hinab, die Tränen schossen ihm in die Augen; er hatte sie noch nie so sehr geliebt wie in diesem Augenblick.
»Ich werde dich nicht enttäuschen.«
»Komm nur zu mir zurück.«
»Das werde ich ganz gewiss tun«, sagte er und gab ihr einen sanften Kuss auf die Lippen. Dann stand er auf, um zu hören, was Edman von ihm wollte.
Mitten in der kalten, dunklen Nacht traf Heryst in Dordover ein. Nach dem langen Ritt waren er und seine Begleiter müde, doch Vuldaroq war nicht in der Stimmung, ihnen viel Zeit zum Essen und Ruhen zu lassen. Den Straßenstaub noch auf der Kleidung, traf Heryst den rotgesichtigen, fetten Erzmagier der Dordovaner in einem kleinen, mit langweiligen Portraits geschmückten Empfangszimmer. Im Kamin prasselte ein mächtiges Feuer.
So oberflächlich das Händeschütteln ausfiel, der Wein, den Vuldaroq anbot, war mehr als willkommen. Die beiden Männer ließen sich zu beiden Seiten des Kamins in großen Ledersesseln nieder.
»Dann kommt Ihr endlich zu Sinnen, mein guter Lord Heryst?«
»Ich war die ganze Zeit ganz und gar bei Sinnen, Vuldaroq. Allerdings hatte ich gehofft, Xetesk und Ihr könntet allmählich zur Vernunft kommen.«
»Worauf genau habt Ihr denn gehofft?«
»Auf eine Möglichkeit, durch Diplomatie Frieden zu schließen, was sonst?«
Vuldaroq lächelte nachsichtig. »Wie Ihr wisst, achte ich Eure Fähigkeiten als Politiker und Magier, aber in diesem Fall seid Ihr so naiv wie ein Kind. Ihr könnt doch kaum Eure Augen vor dem verschließen, was gerade geschieht. Frieden ist nur möglich, wenn beide Seiten ihn wollen.«
»Naiv war ich nie, Vuldaroq«, entgegnete Heryst. »Ich war einfach entschlossen, einen weniger blutigen Weg zu gehen.«
»Glaubt Ihr denn, wir wollten gegen sie Krieg führen?«
»Ich glaube, Dordover war nach der Niederlage auf Herendeneth erbost genug, um einen bewaffneten Konflikt dem Verhandlungstisch vorzuziehen. Ihr habt ebenso wie sie dazu beigetragen, dass wir heute an diesem Punkt stehen.«
Dies nahm Vuldaroq ungnädig auf. »Das ist absurd, Heryst. Wir suchten Gerechtigkeit für Balaia und wollten die Schätze teilen, die auf der Insel entdeckt wurden.«
Heryst blinzelte und hatte alle Mühe, nicht mit einem bösen Lächeln zu reagieren.
»Was glaubt Ihr eigentlich, mit wem Ihr hier sprecht? Ihr werdet Euch hoffentlich erinnern, dass wir eigens ein Bündnis geschlossen haben, weil wir das Nachtkind davon abhalten wollten, Fähigkeiten zu entwickeln, die es nicht mehr kontrollieren konnte. Der Tod des Mädchens war eine Möglichkeit, mit der wir durchaus gerechnet haben. Allerdings hattet Ihr verborgene Motive. Nichts und niemand hätte auf der Insel überlebt, hätte nicht der Rabe eingegriffen – habe ich nicht Recht? Habt Ihr Euch nicht deshalb mit den Hexenjägern eingelassen?«
»Sie waren als Einzige fähig, die zu finden, die wir suchten.«
»Verdammt, das waren sie nicht!« Heryst machte vor Erregung eine ungeschickte Bewegung, ein wenig Wein schwappte auf seine Hand. »Ihr habt ihnen Erienne ausgeliefert. Eine Eurer eigenen Magierinnen.«
»Eine Verräterin«, erwiderte Vuldaroq aalglatt. »Eurem General Darrick nicht ganz unähnlich, würde ich sagen.«
»Darricks Verhalten war bedauerlich, wie ich zugeben muss, doch er war nicht bereit, Seite an Seite mit denen zu kämpfen, die uns alle töten wollen, wie Ihr es getan habt. Keine Sorge, er wird für sein Verhalten zur Rechenschaft gezogen. Er ist wenigstens ein Ehrenmann.«
Vuldaroq trank einen Schluck Wein. »Während ich keiner bin? Jetzt stehe nur noch ich mit meinem Kolleg zwischen Xetesk und der Herrschaft über ganz Balaia. Vergesst nicht, warum wir uns verbündet haben. Wir dürfen nicht zulassen, dass ein Kolleg allein die ganze Macht in Händen hält, denn dann würden wir in die Barbarei zurückfallen.«
»Ich bin ganz Eurer Meinung. Allerdings sind wir unterschiedlicher Ansicht, was die anzuwendenden Methoden angeht«, sagte Heryst, obwohl ihm klar war, dass dieses Hin und Her sie nicht weiterbringen würde.
»Stimmt Ihr denn zu, dass dieser Krieg inzwischen Euch ebenso bedroht wie uns?«
»Und Julatsa auch, das ist wahr«, räumte Heryst ein. »Deshalb bin ich hier. Ich bin entsetzt über das, was Xetesk in Arlen und vor den eigenen Toren angerichtet hat. Ihr habt wenigstens die Regeln des Kriegshandwerks beachtet und die Flüchtlinge verschont.«
Vuldaroq neigte den Kopf. »Dies aus Eurem Munde ist in der Tat ein Kompliment.«
»Ich will jedoch mit großem Nachdruck klarstellen, dass ich nicht auf ein formales Bündnis aus bin«, sagte Heryst. »Wir sind allerdings verpflichtet, die Verteidigung von Julatsa zu verstärken. Auch glaube ich, dass wir eine Blockade um das Land von Xetesk einrichten müssen, um die Verlegung von Truppen und Vorräten zu verhindern.«
»Auch in diesem Punkt sind wir einer Meinung«, erklärte Vuldaroq. »Aber inwiefern soll dies keine Allianz sein?«
»Lystern befindet sich nicht mit Xetesk im Krieg, und das soll auch so bleiben. Meine Soldaten werden nicht Eurem Kommando unterstellt. Ich schlage eine Aufgabenteilung vor, um Xetesk wieder an den Verhandlungstisch zu bringen. Genau dies werde ich auch Dystran sagen.«
»Selbstverständlich respektiere ich Eure Wünsche«, sagte Vuldaroq, und Heryst bemerkte durchaus das zufriedene Funkeln seiner Augen.
»Hintergeht uns nicht – ich bitte Euch um die Zusicherung, dass Ihr unseren guten Willen nicht missbrauchen werdet, um Eure Position in diesem Konflikt zu stärken.«
Vuldaroq hob beide Hände. »Aber, aber, Heryst.«
»Gut. Ich schlage vor, wir beenden unser Gespräch, damit unsere Mitarbeiter meine Vorschläge erörtern können. Wir können später noch einmal zusammenkommen, um etwaige Differenzen beizulegen.«
Ein dringliches Klopfen unterbrach sie, dann stürmten zwei von Herysts Magiern herein.
»Entschuldigt die Störung, Mylords«, sagte einer, ein junger Magier namens Darrow. »Ich habe schlimme Neuigkeiten.«
Fragend blickte er zu Vuldaroq, doch Heryst bedeutete ihm weiterzusprechen.
»Er wird es sowieso erfahren, also kann er es auch gleich von Euch hören.«
»Kayvel hat mit uns Kontakt aufgenommen«, sagte Darrow. »Wie Ihr wisst, ist Rusau mit den xeteskianischen Streitkräften geritten, die an der Furt des Dord die Dordovaner angreifen wollten. Es scheint, als sei er mitten in den Konflikt geraten. Es tut mir Leid, Mylord, aber er wurde getötet.«
Heryst schloss die Augen. Das hatte er befürchtet. Er holte tief Luft, ehe er wieder das Wort ergriff.
»Wie ist es geschehen?«
»Von den Dordovanern, die dabei waren, haben wir erfahren, dass er von einem xeteskianischen Pikenier getötet wurde.«
Heryst warf sein Glas in den Kamin, der Wein zischte. Eine Weile rang er um Fassung, während seine Gedanken rasten und sein Puls heftig pochte.
»Er war ein Diplomat, er war neutral«, sagte er schließlich mit erstickter Stimme.
»Ja, Mylord.«
»Und er war mein Freund.« Heryst schlug einen Moment die Hände vors Gesicht. »Seid Ihr sicher, dass die Berichte der Wahrheit entsprechen?«
»Dass er tot ist?«, fragte Darrow.
»Nein«, fauchte Heryst. »Dass er starb, wie Ihr es gehört habt.«
»Wir sind recht sicher. Er geriet im Kampfgeschehen zwischen die Schlachtreihen. Er war im Weg und wurde von Xetesk beseitigt.« Darrow zuckte mit den Achseln.
»Kann es nicht ein Unfall gewesen sein? In der Schlacht herrscht manchmal Verwirrung«, sagte Heryst. »Ihr müsst verstehen, dass ich sichergehen will. Könnte es auch eine dordovanische Pike gewesen sein?«
Darrow schüttelte den Kopf. »Nein, Mylord. Das Bild ist recht klar. Eine xeteskianische Pike durchbohrte seinen Körper von hinten. Die Schlacht ging weiter. Xetesk warf Dordover über den Fluss zurück, und jetzt bewacht Xetesk den ganzen Abschnitt und sendet Patrouillen aus, um die Grenze nach Dordover zu sichern.«
Heryst blickte zu Vuldaroq, der aufrichtig bekümmert schien. Hinter dieser Maske, das wusste der Lysternier genau, frohlockte er innerlich über diese Neuigkeiten.
»Was haben wir aus Xetesk gehört?«, fragte er.
»Wie zu erwarten, streiten sie es ab«, sagte Darrow. »Kayvel hat sich mit den anderen Delegierten beraten. Sie sind keinerlei Druck ausgesetzt und wurden nicht verhaftet, aber die Geschichte, die sie erzählen, klingt nicht glaubwürdig.«
»Wie lautet sie denn?« Heryst richtete sich auf.
»Der xeteskianische Kommandant habe versucht, Rusau aus der Kampfzone zu holen, habe es aber nicht rechtzeitig geschafft, weil Rusau von seinem Pferd abgeworfen wurde. Dabei sei Rusau in eine Pike gestürzt.«
»Ein Märchen«, murmelte Vuldaroq. »Es tut mir Leid, dass Ihr Euren Freund verloren habt, Heryst, aber dies wirft ein neues Licht auf das, was wir gerade besprochen haben, meint Ihr nicht auch?«
Heryst hob eine Hand, um den dordovanischen Erzmagier zum Schweigen zu bringen. »Wagt es ja nicht, mich unter Druck zu setzen, Vuldaroq. Im Augenblick bin ich nicht an Euren Gedanken interessiert. Vielleicht könntet Ihr so freundlich sein und mich einen Augenblick allein lassen.«
Vuldaroq nickte und erhob sich, Heryst sah ihm nach.
»Was Dordover angeht, so ändert dies nichts«, sagte er zu Darrow. »Ihr werdet die Verhandlungen fortsetzen, als hätte es dieses schreckliche Ereignis nie gegeben. Habt Ihr verstanden?«
»Ja, Mylord, aber …«
»Kein Aber, Darrow«, sagte Heryst leise. »Ich traue Dordover nicht mehr als Xetesk, und ich möchte Euch raten, meinem Beispiel zu folgen. Morgen werde ich aufbrechen und nach Lystern zurückkehren, dann wird die Verantwortung auf Euren Schultern ruhen. Wir werden die Wahrheit herausfinden, aber im Augenblick will ich nur sagen, dass wir den Einsatz unserer Truppen beschleunigen müssen. Verdammt, Darrick, wo seid Ihr, wenn ich Euch am dringendsten brauche?«
Drittes Kapitel
»Au, verdammt!«, rief Darrick und riss sein Bein zurück. »Das hat wehgetan.«
»Tut mir Leid, Darrick, aber mit freundlichen Worten lassen sie sich nicht entfernen«, sagte Ilkar. »Halte jetzt ruhig, du hast meine Konzentration gestört.«
»Es hat sich angefühlt, als hättest du mir das Bein gebrochen.«
»Tja, ich kann sie ja drin lassen, wenn dir das lieber ist«, sagte Ilkar und sah den Lysternier im Feuerschein fragend an.
Darrick schüttelte den Kopf. »Was, um alles in der Welt, ist nur über mich gekommen, als ich mich eurem Haufen angeschlossen habe?«
»Die Aussicht auf Ruhm und Abwechslung«, meinte der Unbekannte.
»Das muss es gewesen sein.«
Die Rabenkrieger hatten über Nacht eine Rast eingelegt, bevor sie am nächsten Morgen zum Tempel gingen. Zwei Tage hatte der dichte Regenwald ihre Nerven und ihre Geduld auf eine harte Probe gestellt. Die drückende Hitze wechselte mit sintflutartigen Regengüssen, und anscheinend hatte es jedes Insekt, das hüpfen, kriechen, fliegen oder sich eingraben konnte, auf ihre Haut abgesehen. Eine Meute wilder Hunde hatte sie verfolgt, sie hatten ihr Lager verlegen müssen, als es einer Armee von Ameisen im Weg war, und sie hatten eine riesige Würgeschlange gestört, die einen jungen, ausgewachsenen Affen verschlingen wollte.
Es war schwer zu entscheiden, welches Ereignis das beunruhigendste gewesen war, und Darrick schenkte sich den Versuch, darüber nachzudenken. Er beobachtete lieber Ilkar, der ihn versorgte. Auch wenn er nichts sehen konnte, wusste er, was der Magier tat – er stach ihm Nadeln aus Mana-Energie in die Beine, um die Insekten, die sich in die Haut eingegraben hatten, und deren Eier abzutöten. Jede kleine Wunde wurde sofort kauterisiert, und nachdem er vom Fußgelenk bis zu den Schenkeln Dutzende solcher Stiche ertragen hatte, fühlte Darrick sich, als hätte er mit glühenden Kohlen geduscht.
Außerdem war er ein wenig verstimmt. Bei den abendlichen Überprüfungen durch die Magier, auf denen Ilkar bestand, stellte sich heraus, dass die anderen kaum unter den sich eingrabenden Insekten litten und meist nur die üblichen Stiche und Blasen davongetragen hatten. Es hatte hauptsächlich Darrick getroffen, und Hirad empfand, was wenig überraschend war, dessen Schmerzen als Quelle der Belustigung.
Rebraal hatte mit einem wissenden, irgendwie zufriedenen Ausdruck zugeschaut. Er hatte einen Trank gebraut, der die Insekten abwehren sollte, der aber anscheinend nur bei den Elfen und aus irgendeinem unerfindlichen Grund wohl auch bei Thraun wirkte. Die anderen Menschen waren auf magische Hilfe angewiesen, und inzwischen wurden alle drei Magier müde, weil sie ihre Mana-Reserven stark beansprucht hatten.
»Ist das denn wirklich nötig?«, fragte Darrick.
»Darrick, du hast keine Ahnung, was dieses Land dir antun kann und wie krank du wirst, wenn die Insekten aus diesen Eiern schlüpfen. Sie werden sich von dir ernähren, bis sie groß genug sind, um sich nach draußen zu graben. Rebraal ist immun. Fragst du dich, warum sie dich auffressen? Ganz einfach – weil du es nicht bist.«
»Was ist mit den anderen, sind die auch immun?«
»Nein, aber du bist ein leichteres Ziel. Wenigstens hast du keine Furunkel in den Kniekehlen wie Hirad. Nimm die Kräuter, die wir dir geben, und vergiss nicht, dass wir nicht mehr lange hier ausharren müssen.«
Natürlich wusste Darrick, dass Ilkar Recht hatte. Er hatte Denser und Erienne beobachtet, die unter Ilkars Aufsicht Schnittwunden, Blasen und Stiche versorgten, und er hatte seinen Anteil der Kräuter, die Rebraal ihnen gab, auf die Haut gerieben und den Sud getrunken. Rebraal ließ sich von Erienne die Schulter behandeln, aber weitere Heilsitzungen nahm er nicht in Anspruch. Er war hier zu Hause, ganz im Gegensatz zum Raben.
Nicht zum ersten Mal vermisste Darrick schmerzlich die Kameradschaft seiner Offiziere, den Gehorsam und die Achtung seiner Männer und das geordnete Leben als lysternischer Soldat. Das Problem war nur, dass der Rabe ihn mit unwiderstehlicher Kraft angezogen hatte. Ihre Tatkraft, ihre Freude an den immer neuen Herausforderungen. Und ihr Glaube an das, was sie am Leben hielt. Das Wissen, dass sie überleben würden, ganz egal, was kommen mochte. Das konnte man nicht in den Sack stecken und mitnehmen, das musste man erleben. Und Darrick hatte eine Menge mit den Rabenkriegern erlebt.
»Wie du meinst, Ilkar.«
Der Magier nickte. »Im Augenblick meine ich vor allem, du solltest still sein und mich arbeiten lassen.«
In diesem Moment, genau wie im Kampf, verstand Darrick den Raben. Sie waren keine Horde Waffen schwingender Machos. Sie waren eine Gruppe von Menschen, die sich immer wieder für ihre Gefährten aufopferten, weil sie dadurch insgesamt stärker wurden. Eigentlich war es ganz einfach.
In der folgenden Nacht schlief Darrick etwas ruhiger.
Eriennes Kopf pochte, es war ein zunehmendes, unablässiges Dröhnen, das kein Spruch lindern konnte. Außerdem verwandte sie ihre ganze Energie darauf, den Raben gesund zu halten. Es war schwer. Sie war erschöpft und hatte immer größere Mühe, sich zu konzentrieren, war am Ende ihrer Kräfte.
Die Schmerzen fühlten sich nicht wie eine Krankheit an. Sie wusste, was sie zu bedeuten hatten, und schon bald würde sie es nicht mehr verleugnen können. Es arbeitete in ihr, und sie hasste es. Sie liebte es. Jeder Pulsschlag weckte frische Erinnerungen an Lyanna. In den Tagen, nachdem sie das Dorf verlassen hatten, waren die Erinnerungen sogar ungewöhnlich klar geworden. Schöne Erinnerungen waren es, weil ihr Bewusstsein zunehmend die dunklen Momente verdrängte. Erienne glaubte beinahe, die Al-Drechar seien sowohl für die Schmerzen als auch für die Erinnerungen verantwortlich, auch wenn sie die alten Elfenfrauen nicht in ihrem Bewusstsein gespürt hatte.
»Wie geht es dir?«
Es war der Unbekannte, mit dem sie sich die erste Wache teilte. Sie hatte bereits etwas geschlafen, doch die Kopfschmerzen hatten sie aus der Hängematte getrieben. Sie fand das Feuer tröstlich, und der Unbekannte, der neben ihr saß, war ein Symbol der Sicherheit.
»Ich werd’s überleben«, sagte sie.
»Ich habe gesehen, wie du zusammengezuckt bist«, wandte er ein. »Hast du Denser gesagt, wie groß deine Schmerzen sind?«
Erienne schüttelte den Kopf. »Ich habe ihm schon genug aufgehalst.«
Der Unbekannte kicherte. »Ich glaube, Denser könntest du nicht überlasten.«
»Du warst nicht dabei. Das Schlimmste hast du nicht gesehen.«
»Glaubst du denn, er würde es nicht verstehen, dir Vorwürfe machen oder so etwas?«
»Lyanna war auch seine Tochter«, flüsterte Erienne. Da war es wieder, das schreckliche Verlustgefühl, das ihre Seele in den Abgrund zog. Es würde niemals aufhören, aber wenigstens drohte es sie jetzt nicht mehr völlig zu übermannen.
»Erienne, du hast etwas Einzigartiges und sehr Tragisches erlebt. Füge nicht noch Schuldgefühle dem hinzu, was du sowieso schon ertragen musst.«
»Ich kann’s nicht ändern.« Erienne zuckte mit den Achseln.
»Aber du weißt, dass er dir alles verziehen hat. Er hat dir niemals Vorwürfe gemacht, und das gilt für uns alle.«
»Ich weiß.« Erienne betrachtete den Unbekannten im Feuerschein und erinnerte sich, wie überrascht sie gewesen war, als sie das Einfühlungsvermögen hinter dieser harten Schale entdeckt hatte. Manchmal konnten die Augen, die sie jetzt so mitfühlend anschauten, sehr kalt sein.
Dieser Mann war der stärkste und beste Kämpfer, den sie je gesehen hatte. Nein, er war es gewesen. Nachdem seine Hüfte zertrümmert worden war, hatte er auf das Zweihandschwert verzichten müssen, mit dem er so gern gekämpft hatte, und darunter hatte auch seine Kampfkraft gelitten. Wenn sie jedoch die Muskulatur seiner Arme und Schultern sah, dann musste sie annehmen, dass es ihm gelungen war, den Mangel wieder auszugleichen. Es war leicht zu erkennen, warum seine Feinde ihn fürchteten, und ebenso leicht zu verstehen, warum sie selbst und alle anderen, die ihm lieb und teuer waren, diesem Mann rückhaltlos vertrauten.
»Ich habe euch alle gehasst, weil ihr mich gezwungen habt, hierher zu gehen. Fort von Lyanna.«
Wieder ein Kichern. »Aber wir hatten doch Recht, oder?«
»Ich weiß nicht«, antwortete sie. »Die Sehnsucht nach ihr kann ich nicht abstreifen. Ich will es auch nicht.«
Sie hielt inne und sah sich im stillen Lager um – Denser, Hirad und Ilkar, die in Hängematten über den wimmelnden Bewohnern des Waldbodens schliefen –, und nicht zum ersten Mal wurde ihr klar, wie viel es ihr bedeutete, mit diesen Männern zusammen zu sein.
»Aber jetzt seid ihr alle bei mir, oder? Ihr alle.«
»Wir haben dich nie verlassen«, sagte der Unbekannte.
»Ich sehe es, wenn ich bei euch bin«, versuchte sie zu erklären.
»Deshalb musstest du die Insel verlassen. Wir waren auch dort bei dir, aber du hast uns nicht gesehen.«
»Sie war mein Leben.«
»Beinahe wäre sie dein Tod gewesen«, wandte er ein.
Die Worte taten weh, doch sie wusste, dass er Recht hatte. Von Denser hätte sie es sich allerdings nicht gefallen lassen.
»Ich werde sie nie vergessen.«
»Niemand erwartet das von dir, Erienne.« Er legte seine Hände um die ihren. »Niemand wird das jemals von dir verlangen. Du musstest aber Herendeneth verlassen, du musstest aufhören, deinem Kummer immer neue Nahrung zu geben.«
»Und deshalb bin ich jetzt hier?« Erienne erschrak, auch wenn sie nicht genau verstand, was er ihr sagen wollte.
»Nein«, erwiderte der Unbekannte. »Nicht deshalb. Du bist hier, weil du zum Raben gehörst, und weil Ilkar dich braucht. Der Rabe braucht dich. Aber niemand leugnet, dass es ein glückliches Zusammentreffen war.«
Erienne lachte. »So etwas nennst du glücklich? Ist das dein Ernst? Glaubst du, ich hätte mich darauf eingelassen, wenn ich gewusst hätte, dass es unter meiner Hängematte vor Schlangen nur so wimmelt?«
»Kannst du dir vorstellen, diese Bemerkung vor zehn Tagen gemacht zu haben?«
»Nein«, gab Erienne zu. »Bei den Göttern, was habt ihr nur an euch?«
Der Unbekannte drückte ihre Hände. »Das ist ganz einfach. Wir lieben dich und wollten nicht, dass dir etwas Schlimmes geschieht, wie es dir auf Herendeneth drohte. Wir verstehen deinen Kummer, und wir wissen auch, dass du stärker bist als er. Und wir wissen, was du in dir trägst.«
Unfähig zu sprechen, starrte Erienne ins Feuer.
»Auch auf die Gefahr hin, dass ich rede wie Hirad, aber genau darauf kommt es beim Raben an«, fuhr der Unbekannte fort. »Niemand sonst hat das, was wir haben. Erklären kann man es nicht, aber deshalb habe ich meine Frau und mein Kind verlassen, um mit dem Raben das zu tun, was ich tun muss; und deshalb kann Diera es auch verstehen. Ich bin nicht gern hochtrabend, aber wir sind einzigartig. Du hast im Augenblick Schmerzen, also solltest du Gebrauch von uns machen. Das erwarten wir, das wollen wir.«