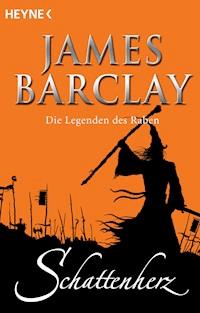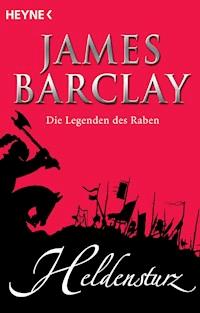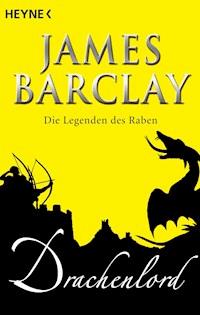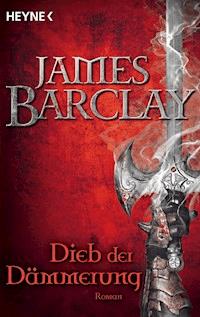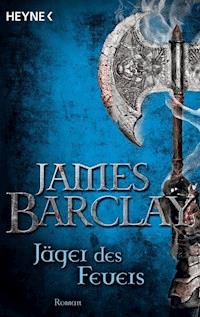9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
Eine weitere Herausforderung für die beste Söldnertruppe der Welt ...
Sie sind Söldner und sie sind die Besten – sie nennen sich der »Bund des Raben«. Jetzt stehen sie vor ihrer größten Herausforderung, denn schwere Katastrophen erschüttern ihr Land Balaia und die Magie wendet sich plötzlich gegen die Menschen. Als bekannt wird, dass ein Kind dafür verantwortlich ist, beginnt eine wilde Hetzjagd. Denn das kleine Mädchen ist die Tochter von einem der Raben – und keiner weiß, wo sie zu finden ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 872
Ähnliche
DER ROMAN
Balaia, das Land der Magie und die Heimat der Söldnertruppe, die sich selbst »Bund des Raben« nennen, ist von Kriegen und Kämpfen zerrissen. Seit dem Sieg über die grausamen Wytchlords sind die Raben bekannt für ihren Wagemut, doch nun stehen sie vor einem Problem, das auch die Fähigkeiten der besten Söldnertruppe der Welt an die Grenzen bringt: Seit dem gewaltigen Zauber gegen die Wytchlords zerbricht das empfindliche Gleichgewicht der Magie, und offenbar ist ein kleines Kind die Ursache dafür. In dem fünfjährigen Mädchen hat sich die Macht der Natur manifestiert, und nun steht das Land am Rand der Zerstörung. Es gibt nur einen Weg, um das Verhängnis aufzuhalten: Die Raben müssen so schnell wie möglich die Mutter und das Kind finden. Denn der Vater des Kindes ist einer der Rabenkrieger …
»James Barclays Fantasy-Romane lesen sich wie Thriller: mächtige Krieger, finstere Magier und knallharte Action!« The Guardian
James Barclays DER BUND DES RABEN:
Erster Roman: Dieb der Dämmerung Zweiter Roman: Jäger des Feuers Dritter Roman: Kind der Dunkelheit
DER AUTOR
James Barclay wurde 1965 in Suffolk geboren. Er begeisterte sich früh für Fantasy-Literatur und begann bereits mit dreizehn Jahren, die ersten eigenen Geschichten zu schreiben. Nach seinem Abschluss in Kommunikationswissenschaften besuchte Barclay eine Schauspielschule in London, entschied sich dann aber gegen eine Bühnenkarriere. Seit dem sensationellen Erfolg seiner Romane um den »Bund des Raben« konzentriert er sich ganz auf das Schreiben. James Barclay ist verheiratet, hat einen Sohn und lebt und arbeitet in Teddington bei London.
Mehr zu Autor und Werk unter: www.jamesbarclay.com
Inhaltsverzeichnis
Dieses Buch ist dem Gedenken anStuart Bartlett gewidmet.Er war mir ein großartiger Freund,ein wundervoller Gatte für Vivund ein hingebungsvoller Vater fürTim, Emma, Claire und Nick.Stuart, wir vermissen dich,und deshalb ist dieses Buch dir gewidmet.
Wenn die Unschuld den Elementen befiehltUnd das Land bedrückt und zerrissen liegt,Dann soll die Spaltung überwunden werden,Und aus dem Chaos soll sich das Eine erheben,Das niemand mehr besiegt.
TINJATA, ERZMAGIER VON DORDOVER
Personenverzeichnis
Prolog
Jarrin fischte schon sein ganzes Leben lang in den Gewässern nördlich von Sunatas Zähnen. Er kannte die tückischen Gezeiten und die Launenhaftigkeit des Windes genau. Und er wusste die Einsamkeit zu schätzen. Er ließ seine Leinen und Reusen in einer geschützten Bucht ins tiefe Wasser hinab, und dann begann die wundervolle Wartezeit. Das war die Zeit, die er besonders genoss. Er streckte sich auf den Decksplanken seines achtzehn Fuß langen Fischkutters aus; das Segel war am Mast festgezurrt, und das Boot wiegte sich sanft in der Dünung.
Jarrin zog den Stöpsel aus seiner Flasche, in der er mit Wasser verdünnten Wein mitgebracht hatte, und entschied sich für ein dickes Schinkenbrot, das er im Rucksack fand. Er legte es neben sich auf die Bank und betrachtete den wundervollen, mit Wolken getupften blauen Himmel. An einem Tag wie diesem konnte er sich nicht vorstellen, dass es ein besseres Leben gab als seines.
Er musste wohl eine Weile eingeschlummert sein, denn als er erschrocken wieder auffuhr, spürte er, dass sich das Boot auf eine eigenartige Weise unter ihm bewegte, und die Sonne war inzwischen ein Stückchen weitergewandert. Irgendetwas störte den makellosen Tag, ein fernes Dröhnen durchbrach die Ruhe.
Jarrin stemmte sich auf die Ellenbogen hoch, neigte den Kopf zur Seite und steckte sich einen Finger ins linke Ohr. Er konnte keinen einzigen Vogel hören. Im Lauf der Jahre hatte er sich so sehr an die Möwen gewöhnt, die über ihm kreisten oder nach einem guten Fang sein Boot verfolgten, dass er ihre heiseren Schreie kaum noch bewusst wahrnahm. Jetzt aber machte ihn ihr Schweigen nervös. Die Tiere konnten viele Dinge spüren.
Inzwischen war er völlig wach. Der Himmel droben war immer noch schön, aber die Luft roch nach Regen. Das Meer zog das Boot nach draußen, obwohl ihn eigentlich die Flut zum Land drücken sollte. Und dieses Dröhnen, das von Sunatas Zähnen zu kommen schien, war ein unirdisches, beängstigendes Geräusch, das ihm den Magen umdrehte.
Er runzelte die Stirn und setzte sich aufs Dollbord. Sein Blick blieb an einer Bewegung draußen auf dem Meer hängen. Er erstarrte vor Schreck.
Mit unglaublicher Geschwindigkeit näherte sich eine Wand aus Wasser, hinter der eine dunkle, schwere Wolkendecke heranwehte. So weit sein Auge reichte, erstreckte sich die riesige Welle quer durch die ganze Bucht, ein Ehrfurcht gebietendes, gewaltiges Gebirge aus Wasser mit Gipfeln aus weißem Schaum.
Jarrin starrte und starrte. Er hätte versuchen können, den Anker zu lichten, das Segel zu setzen und zum Strand zu fliehen, doch das wäre vergebens gewesen. Die Welle musste mehr als hundert Fuß hoch sein. Vor ihr konnte man nicht weglaufen. Er konnte nur noch darauf warten, dass er an die Felsküste geschmettert wurde und starb.
Jarrin hatte sich einst geschworen, er werde seinem Tod ins Auge blicken. So stand er auf, sang ein Gebet an den Geist, bat um sichere Überfahrt ins Reich der Ahnen und betrachtete die Pracht der übermächtigen Natur, bis die Wassermassen über ihm zusammenschlugen.
1
Die geschlossene Kutsche rumpelte am Westrand des Dornenwaldes auf einem überwucherten Weg mit tief ausgefahrenen Rinnen in Richtung der Varhawk-Klippen dahin. Bretter knarrten, Räder rumpelten über Steine, die Eisenbolzen stöhnten in den Verankerungen. Der Kutscher trieb die beiden Pferde mit Zügelschnalzen und aufmunternden Rufen an, und gehorsam zogen sie ihre schwankende Last mit viel zu hoher Geschwindigkeit. Es konnte nur ein schlimmes Ende nehmen.
Aber noch war es nicht so weit.
Bei jedem Buckel auf dem Weg, der ihm das Hinterteil durchschüttelte, drehte sich der Kutscher um. Trotz der Staubwolke, die das Gespann aufwirbelte, konnte er sehen, wie sie sich näherten. Sechs Männer zu Pferd, die ihn bald einholen würden. Durch das Gelände, das die Räder der Kutsche so sehr beanspruchte, wurden sie kaum behindert.
Schon den halben Tag hatte er die Verfolger beobachten können. Mit seinen scharfen Augen hatte er die Männer bald bemerkt, kaum dass sie die Verfolgung aufgenommen hatten. Zuerst hatte er die Pferde noch nicht galoppieren lassen, doch als der Nachmitttag sich dahinzog, wurde deutlich, dass die Verfolger ihre Pferde zu Tode hetzen würden, um die Kutsche einzuholen. Überrascht war er nicht. Was die Verfolger im Wagen zu finden hofften, war mehr wert als das Leben einiger Gäule.
Er lächelte, drehte sich wieder zum Weg um und ließ die Zügel knallen. Über ihm zogen sich Wolken zusammen, und der schöne Tag ging allmählich in die Abenddämmerung über. Er kratzte sich am Kinn und betrachtete die Pferde. Der Schweiß lief ihnen in Strömen über die Flanken, unter den Ledergurten bildete sich Schaum. Ihre Köpfe nickten, als er sie antrieb, sie hatten die Augen weit aufgerissen und die Ohren flach angelegt.
»Gut gemacht«, lobte er sie. Sie hatten ihm die Zeit verschafft, die er brauchte.
Wieder sah er sich um. Die Verfolger waren schon bis auf hundert Schritt herangekommen. Ein dumpfer Knall verriet ihm, dass der erste Pfeil den Wagen getroffen hatte. Er atmete tief durch. Jetzt oder nie.
Er bückte sich, ließ die Zügel fallen und sprang auf den Rücken des rechten Pferds. Unter den Händen und durch seine Beine spürte er die Hitze des Tiers, und er hörte das angestrengte Schnaufen.
»Ruhig«, sagte er. »Ganz ruhig.«
Er klopfte dem Pferd auf den Hals und zog seinen Dolch. Die Klinge war gut geschärft, und mit einem schnellen Schnitt durchtrennte er die langen Zügel. Ein zweiter Schnitt, und der Ledergurt, mit dem das Pferd an die Deichsel gebunden war, fiel herunter. Er trat dem Tier die Hacken in die Flanke und ließ es nach rechts abschwenken, fort von der Kutsche, die, jetzt nur noch von einem Pferd gezogen, deutlich langsamer wurde und nach links abbog. Er betete, dass sie nicht umkippte.
Er nahm die Reitzügel, die vorn im Zaumzeug festgesteckt waren, kämpfte kurz um die Kontrolle über das Tier und beugte sich dicht über seinen Hals. Jetzt kam es nur noch darauf an, sich möglichst schnell von der Kutsche zu entfernen. Als er die Rufe hinter sich hörte, zügelte er das Pferd und drehte sich um.
Die Feinde hatten die Kutsche eingeholt und die Türen geöffnet. Die Reiter umkreisten sie, stießen wütende Rufe aus und gaben sich gegenseitig die Schuld. Er wusste, dass sie ihn sehen konnten, doch er war ihnen gleichgültig. Sie würden ihn nicht weiter verfolgen. Wichtig war nur, dass er sie von ihrer Beute weggelockt hatte. Sie hatten einen halben Tag lang eine leere Kutsche verfolgt. Nun konnten sie nicht mehr finden, was sie suchten.
Doch er durfte sich nicht zu früh freuen. Die sechs hier waren Stümper, die man leicht hereinlegen konnte. Es gab weitaus klügere Feinde, die ebenfalls auf der Jagd und nicht so leicht zu täuschen waren wie diese hier.
Erienne beobachtete ihre Tochter, die unruhig in ihrem Schoß schlief, und fragte sich, ob sie nicht doch einen schrecklichen Fehler gemacht hatte. Der erste Tag im Dornenwald war recht angenehm verlaufen. Lyanna war guter Dinge gewesen, und sie hatten auf dem Weg nach Süden Wanderlieder gesungen. Der vom Sonnenlicht gesprenkelte Wald hatte sauber und frisch gerochen, hier schien keine Gefahr zu drohen. Die erste Nacht war für Lyanna ein kleines Abenteuer gewesen, denn sie hatte zum ersten Mal, unter den Mantel ihrer Mutter gekuschelt und von Wachsprüchen beschützt, im Freien übernachtet. Während Lyanna schlief, hatte Erienne sich aufs Mana-Spektrum eingestimmt und im Chaos nach Anzeichen geforscht, ob irgendetwas nicht in Ordnung war.
Nicht, dass Erienne fürchten musste, sie könnten in dieser Nacht wirklich in Gefahr sein. Sie baute darauf, dass die Gilde wusste, was sie tat, und auf sie Acht geben würde. Es gab zwar Wölfe im Dornenwald, sie fanden jedoch keinen Geschmack an Menschenfleisch. Außerdem verfügte sie als dordovanische Magierin über erheblich bessere Möglichkeiten, sich zur Wehr zu setzen, als viele andere Menschen.
Am zweiten Tag hatte sich die Stimmung allerdings geändert. Sie waren tiefer in den Wald eingedrungen, das Blätterdach war dichter geworden, und sie waren die meiste Zeit im Schatten gewandert. Nur wenn die Sonne einmal durchkam und den Boden vor ihren Füßen erreichte, besserte sich ihre Stimmung. Sie hatten nicht mehr so oft gesungen und geplaudert, und nach einer Weile liefen sie ganz und gar schweigend. Erienne bemühte sich, ihrer zunehmend eingeschüchterten Tochter etwas zu erzählen oder interessante Dinge zu finden, auf die sie hinweisen konnte, doch was sie sagte, stieß auf taube Ohren, oder sie verkniff sich die Bemerkungen gleich ganz, wenn sie Lyannas ängstliches Gesicht sah.
In Wahrheit ging es ihr ja selbst nicht besser. Sie begriff – oder sie glaubte jedenfalls zu begreifen –, warum sie allein gehen mussten. Doch ihr Vertrauen in die Gilde schwand zusehends. Sie hatte damit gerechnet, irgendeine Art von Kontakt zu haben, bisher war allerdings nichts geschehen. Inzwischen ließ sie jedes Knacken eines Zweiges unter ihren Füßen und jedes Knarren eines Baumes im Wind zusammenzucken. Sie lauschte, ob sie Vögel singen hörte, und benutzte ihre Lieder, um Lyannas Stimmung zu heben. Wenn die Vögel singen, so hatte sie gelogen, dann droht keine Gefahr.
Erienne hatte dazu gelächelt, obgleich sie wusste, dass Lyanna alles andere als überzeugt war. Wie auch immer, das kleine Mädchen war bald müde geworden, und so hatten sie am Spätnachmittag gerastet. Erienne hatte sich an einen mit Moos bewachsenen Baum gelehnt, und Lyanna war eingeschlummert. Das arme Kind. Erst fünf Jahre alt, und schon musste es um sein Leben rennen, auch wenn es nichts davon wissen konnte.
Erienne streichelte Lyannas langes schwarzes Haar und zog unter ihrem Gesicht vorsichtig die Puppe hervor, auf der sie unbequem mit eingedrückter Wange gelegen hatte. Sie sah sich im Wald um. Das Rauschen des Windes in den Bäumen und die düster nickenden Zweige über ihr hatten etwas Bedrohliches. Sie stellte sich vor, wie ein Rudel Wölfe sie umkreiste, und schüttelte den Kopf, um das Bild zu vertreiben. Doch sie wusste genau, dass sie verfolgt wurden, sie konnte es spüren. Und sie wurde das Gefühl nicht los, dass es nicht die Gilde war, die sie beobachtete.
Auf einmal schlug ihr Herz wie wild in der Brust, und sie geriet in Panik. Schatten tanzten vor ihr und nahmen am Rande ihres Gesichtsfeldes menschliche Gestalten an, blieben aber immer gerade eben außer Sicht. Ihr Mund wurde trocken. Was, bei allen Namen der Götter, wollten sie denn nur von ihr? Eine Frau und ein kleines Mädchen, verfolgt von einer Macht, die viel zu groß war, als dass man gegen sie hätte ankämpfen können. Und sie hatte ihr Leben in die Hand von Fremden gelegt, die sie jetzt gewiss im Stich gelassen hatten.
Erienne schauderte, obwohl es ein warmer Nachmittag war. Die kleine Bewegung weckte Lyanna. Das Mädchen schaute zur Mutter auf und suchte in deren Augen einen Trost, den sie nicht finden konnte.
»Mami, warum beobachten sie uns immer nur? Warum helfen sie uns nicht?«
Erienne schwieg, bis Lyanna die Frage wiederholte. »Mögen sie uns denn nicht?«, bohrte sie. Erienne kicherte und zauste Lyannas Haar.
»Wie könnte irgendjemand dich nicht mögen? Natürlich mögen sie uns, meine Liebe. Ich glaube, sie müssen sich vielleicht von uns fern halten, damit uns nichts Böses zustoßen kann.«
»Wann sind wir da, Mami?«
»Es dauert nicht mehr lange, mein Liebes. Nicht mehr lange. Dann kannst du ruhig schlafen. Wir haben schon ein großes Stück geschafft.« Ihren Worten fehlte es an Überzeugungskraft, und der Wind, der durch die Zweige strich, erzählte flüsternd vom Tod.
Lyanna sah sie ernst an, und ihr Kinn bebte ein wenig.
»Es gefällt mir hier nicht, Mami.«
Wieder schauderte Erienne. »Mir auch nicht, Liebes. Sollen wir eine bessere Stelle suchen?«
Lyanna nickte. »Du passt doch auf, dass mich die bösen Leute nicht kriegen, ja?«
»Aber natürlich, meine Kleine.«
Sie half Lyanna auf und schulterte den Rucksack, und dann gingen sie weiter nach Süden, wie man es ihr gesagt hatte. Unwillkürlich machte sie schnellere Schritte, um den Phantomen zu entkommen, deren Nähe sie spürte. Erienne versuchte sich zu erinnern, wie der Unbekannte Krieger oder Thraun die Verfolger abgeschüttelt hätten. Sie hätten ihre Spuren verwischt, sich vorsichtig bewegt und falsche Fährten gelegt. Sie fragte sich sogar, ob sie Lyanna tragen konnte, während sie unter dem Tarnzauber lief, sodass sie beide unsichtbar wären. Es wäre sicherlich eine ermüdende, anstrengende Übung.
Sie lächelte grimmig. Es war ein neues Spiel für Lyanna, und vielleicht half es sogar, ihre Stimmung zu bessern. Ein Spiel, bei dem es um den höchsten Einsatz ging.
Sie bewegten sich durchaus gewandt durch den Wald, doch unter dem Blätterdach entging den Elfen nichts. Ren’erei war überrascht über ihre Geschicklichkeit und die Lautlosigkeit, mit der sie liefen, und tatsächlich hinterließen sie kaum eine Spur am Boden. Die Elfenfrau musste auch anerkennen, dass sie so klug waren, zu beiden Seiten von dem Weg abzuweichen, dem sie eigentlich folgen wollten, um etwaige Verfolger abzuschütteln.
Bei den meisten Verfolgern hätten sie Erfolg gehabt. Doch Ren’erei und Tryuun waren im Wald geboren und konnten jede noch so winzige Spur lesen, die ein Mensch im Wald hinterließ. Ein geknicktes Blatt im Laub auf dem Boden, ein Stück lose Borke, das in verräterischer Höhe von einem Baumstamm abgestreift worden war. Im Falle dieser Leute waren es auch Schatten, die nicht zum Sonnenlicht unter dem Blätterdach passen wollten, außerdem kleine Luftbewegungen und die veränderten Rufe der Waldbewohner.
Ren’erei ging vorne, Tryuun deckte seine Schwester und blieb zwanzig Schritt seitlich hinter ihr. Die beiden Elfen waren den ganzen Tag lang den Spuren gefolgt und hatten stetig aufgeschlossen, ohne jemals den Verfolgten einen Hinweis zu geben, dass sie beobachtet wurden.
Tief gebückt lief sie, die Augen immer am Boden, jeder Tritt ihrer leichten Lederstiefel war sicher und lautlos, ihr braun und grün gesprenkelter Mantel, das Wams und die Hosen waren im scheckigen Sonnenlicht kaum auszumachen. Sie waren jetzt ganz nahe. Die Waldmurmeltiere, die vor ihnen in den Wurzeln der hohen Fichten lebten, hatten einen Warnruf ausgestoßen, der aufgewirbelte Staub von der Baumrinde schwebte dicht über dem Waldboden in der Luft, und auf der getrockneten Erde nickten noch leise die Grasbüschel. Die Stängel richteten sich nach und nach wieder auf, nachdem ein menschlicher Fuß sie niedergedrückt hatte.
Ren’erei blieb neben dem breiten Stamm einer mächtigen alten Eiche stehen und legte eine Hand an die Rinde, um die Energie zu spüren. Die andere Hand hob sie zum Zeichen für Tryuun. Ohne sich umzudrehen, wusste sie, dass ihr Bruder das Signal auffangen und in Deckung bleiben würde.
Zehn Schritt voraus ließ eine unruhige Luftströmung die Farnwedel und die niedrigen Blätter nicken. Ein Magier unter Tarnzauber. Der Magier bewegte sich leicht, um den Tarnzauber nicht im Stillstand zu verlieren, und wieder musste Ren’erei die Geschicklichkeit dieses Menschen bewundern.
Ihre Finger berührten fast den Boden, als sie gebückt die Distanz überwand und sich im Geist ein Bild vom Magier machte. Groß, schlank und athletisch. Er wusste allerdings nicht, in welch gefährlicher Situation er sich befand. Die Elfenfrau bewegte sich lautlos, kein Blatt rührte sich, und die Bewohner des Waldes empfanden sie nicht als Störung.
Im letzten Moment zog sie das Messer aus der Lederscheide, richtete sich auf, packte die Stirn des Magiers, riss seinen Kopf zurück und schlitzte ihm mit einer einzigen, fließenden Bewegung den Hals auf. Sie ließ das Blut auf die Pflanzen spritzen. Der Mann starb zitternd und war zu schockiert, um noch Alarm zu schlagen. Der Tarnzauber fiel, und zum Vorschein kamen schwarze, eng sitzende Kleider und ein rasierter Kopf. Ren’erei schaute den Opfern nie ins Gesicht, wenn sie auf diese Weise jemanden töten musste. Der Anblick ihrer Augen, so überrascht und ungläubig, erzeugte nur Schuldgefühle.
Sie legte den Toten mit dem Gesicht nach unten auf den Boden, säuberte sich und steckte das Messer wieder ein. Mit einem Handzeichen ließ sie Tryuun wissen, dass sie weitergehen konnten.
Noch einer von dieser Sorte war im Wald unterwegs. Erienne und Lyanna liefen verängstigt weiter, und der Tag neigte sich dem Ende zu.
Denser hockte im kalten Arbeitszimmer am Kamin. Der Herbstwind rüttelte an den Fenstern, Blätter flatterten unter trübgrauem Himmel vorbei. Die Kälte draußen war allerdings nichts gegen die Kälte im Bauch des xeteskianischen Magiers, der im Turm von Dordover saß.
Als der berittene Bote aus Dordover gekommen war und ihn gebeten hatte, das Kolleg aufzusuchen, war ihm sofort klar gewesen, dass es um etwas Ernstes ging. Das Rumoren in seinem Bauch und der aufgeregte Herzschlag waren nicht gewichen, sondern hatten sich in kalte Wut verwandelt, als ihm bewusst wurde, dass Dordover volle sechs Wochen gebraucht hatte, um sich zu der Ansicht durchzuringen, dass es sinnvoll sei, ihn zu rufen. Anfangs war er enttäuscht gewesen, weil Erienne nicht versucht hatte, mittels Kommunion Kontakt mit ihm aufzunehmen, auch wenn es gar nicht so ungewöhnlich war, dass zwischen ihren Begegnungen mehrere Wochen vergingen. Inzwischen, so dachte er traurig, war vermutlich die Entfernung viel zu groß für eine Kommunion.
Er faltete den Brief zusammen und schob ihn in die Tasche, bevor er den Blick hob und Vuldaroq ansah. Der dicke Herr des Turms von Dordover war mit einer dunkelblauen Robe und weißen Schärpe bekleidet. Er schwitzte vor Anstrengung, nachdem er Denser in Eriennes Gemächer begleitet hatte, und wand sich unbehaglich unter dem Blick des Dunklen Magiers.
»Sechs Wochen Vuldaroq. Was, zum Teufel, habt Ihr nur die ganze Zeit gemacht?«
Vuldaroq tupfte sich die Stirn und die Glatze mit einem Tuch ab. »Wir haben gesucht. Wir haben uns bemüht, die beiden zu finden. Wir versuchen es immer noch. Schließlich sind sie Dordovaner.«
»Und außerdem sind sie meine Frau und mein Kind, auch wenn wir im Augenblick getrennt leben. Ihr hattet nicht das Recht, mir auch nur einen Tag lang zu verschweigen, dass sie verschwunden sind.«
Denser sah sich im Arbeitszimmer um, betrachtete die Stapel verschnürter Dokumente, die Bücher und Pergamente, die pedantisch in den Regalen aufgereiht waren, die ordentlich geputzten Kerzen und Lampen, das Spielzeugkaninchen, das auf einem dicken Kissen saß. Das sah ganz und gar nicht nach Erienne aus, die bei der Arbeit sonst eher chaotisch war. Gegen ihren Willen war sie nicht verschwunden, so viel war klar. Sie hatte aufgeräumt, weil sie die Absicht hatte, lange nicht mehr zurückzukehren. Vielleicht nie wieder.
»Ganz so einfach ist das nicht«, wandte Vuldaroq vorsichtig ein. »Es gibt gewisse Verfahren und Vorschriften …«
Denser sprang vom Stuhl hoch und baute sich drohend vor dem Herrn des Turms auf.
»Kommt mir ja nicht mit so einem Mist«, knurrte er. »Der verdammte Stolz und die Intrigen in Eurem Quorum haben mich sechs verfluchte Wochen lang daran gehindert, meine Tochter und die Frau, die ich liebe, zu suchen. Sie könnten inzwischen wer weiß wo sein. Was ist denn nun eigentlich bei Euren Nachforschungen herausgekommen?«
Denser konnte beobachten, wie sich Schweißtropfen auf Vuldaroqs rotem, fleischigem Gesicht bildeten.
»Vage Hinweise. Gerüchte, dass man sie gesehen habe. Nichts Konkretes.«
»Ihr habt sechs Wochen gebraucht, um ›nichts Konkretes‹ herauszufinden? Die gesammelte, nicht unbeträchtliche Macht von Dordover?« Denser hielt inne, als er sah, wie Vuldaroqs Blick verunsichert abirrte. Er lächelte und trat einen Schritt zur Seite, drehte sich halb um und spielte nachdenklich mit einigen aufgestapelten Papieren. »Sie hat Euch völlig überrascht, was? Euch alle.« Er lachte humorlos. »Ihr hattet nicht die geringste Ahnung, dass sie fortgehen könnte, und wenn, wohin sie sich dann wenden würde, nicht wahr?«
Vuldaroq schwieg. Denser nickte.
»Was habt Ihr also getan? Habt Ihr Magier und Soldaten nach Lystern geschickt? Nach Korina? Nach Blackthorne? Oder gar nach Xetesk? Nein? Was dann? Habt Ihr die Wälder in der Umgebung durchsucht? Habt Ihr Botschaften nach Gyernath und Jaden geschickt?«
»Es gilt ein großes Gebiet zu durchsuchen«, erwiderte Vuldaroq vorsichtig.
»Und trotz Eurer großen Weisheit war keiner von Euch so klug, sich in sie hineinzuversetzen und sich zu überlegen, in welche Richtung sie sich gewandt haben könnte, nicht wahr?« Denser schürzte die Lippen und tippte sich an die Stirn. Einen Augenblick lang genoss er Vuldaroqs Verlegenheit. »Keine Instinkte, was? Und deshalb habt Ihr nach mir geschickt, weil ich jemand bin, der es vielleicht weiß. Nur, dass Ihr Euch so viel, so unglaublich viel Zeit gelassen habt. Warum, Vuldaroq?«
Der dordovanische Herr des Turms wischte sich erneut mit dem Tuch übers Gesicht und trocknete seine Hände, ehe er es wieder wegsteckte.
»Trotz Eurer Beziehung zu Erienne und Lyanna unterstehen beide der Obhut von Dordover«, sagte Vuldaroq. »Wir haben unseren Ruf zu wahren und müssen uns ans Protokoll halten. Wir wollten, dass sie ohne … dass sie möglichst ohne großes Aufhebens zurückkehren.« Er spreizte die Finger und lächelte zaghaft.
Denser schüttelte den Kopf und machte wieder einen Schritt auf ihn zu. Vuldaroq wich zurück, prallte gegen einen Stuhl und ließ sich unbeholfen darauf fallen. Sein Gesicht lief wieder rot an.
»Erwartet Ihr wirklich, dass ich das glaube? Eure Geheimniskrämerei in Zusammenhang mit Lyannas Verschwinden hat nur bedingt damit zu tun, dass es Euch peinlich sein könnte, wenn ihr Verschwinden öffentlich bekannt wird. Nein, es steckt mehr dahinter. Ihr wolltet sie ins Kolleg zurückholen, bevor ich erfahren konnte, dass sie fort ist, nicht wahr?« Denser beugte sich über das schwitzende Gesicht. Warmer, leicht nach Alkohol riechender Atem schlug ihm entgegen. »Ich frage mich nur, warum? Hattet Ihr etwa Angst, sie könnte an die Tür eines besser geeigneten Kollegs klopfen?«
Wieder spreizte Vuldaroq die Finger. »Lyanna ist ein Kind mit wahrhaft einzigartigen Begabungen, und diese Begabungen müssen in die richtigen Bahnen gelenkt werden, wenn sie keine unglücklichen Folgen zeitigen sollen.«
»Wie etwa die Erweckung einer magischen Begabung, in der die Kräfte aller Kollegien vereint sind, meint Ihr? Das wäre wohl kaum ein Unglück.« Denser lächelte. »Wenn das geschieht, dann sollten wir feiern.«
»Seid vorsichtig, Denser«, warnte Vuldaroq. »In Balaia ist kein Platz für einen zweiten Septern. Heute nicht, niemals. Die Welt hat sich verändert.«
»Dordover kann für sich selbst sprechen, aber nicht für ganz Balaia. Lyanna kann uns den Weg in die Zukunft zeigen. Uns allen.«
Vuldaroq schnaubte. »In die Zukunft? Die Rückkehr auf den Einen Weg wäre ein Schritt zurück, mein xeteskianischer Freund, und ein einziges begabtes Kind kündigt noch lange keinen solchen Schritt an. Ein Kind alein ist machtlos.« Der alte Dordovaner biss sich auf die Unterlippe.
»Aber nur, wenn Ihr es daran hindert, sein Potenzial zu entwickeln.« Was als scharfe Antwort begonnen hatte, endete in einem Flüstern. »Darum geht es in Wirklichkeit, nicht wahr? Bei allen fallenden Göttern, Vuldaroq, wenn ihr auch nur ein Härchen gekrümmt wird …«
Vuldaroq stand schwerfällig wieder auf. »Niemand wird ihr etwas tun, Denser. Beruhigt Euch. Wir sind Dordovaner, keine Hexenjäger.« Er bewegte sich zur Tür. »Aber findet sie und bringt sie wieder her, Denser. Bald. Glaubt mir, das ist uns allen sehr wichtig.«
»Raus«, murmelte Denser.
»Darf ich Euch daran erinnern, dass dies hier mein Turm ist?«, fauchte Vuldaroq.
»Raus!«, rief Denser. »Ihr habt keine Ahnung, womit Ihr spielt, was? Nein, Ihr habt keine Ahnung.« Denser setzte sich wieder auf seinen eigenen Stuhl.
»Ganz im Gegenteil, Ihr werdet sicher bald feststellen, dass wir es sogar sehr genau wissen.« Vuldaroq blieb noch einen Moment in der Tür stehen, ehe er sich schlurfend zurückzog. Denser lauschte den schweren Schritten, die sich auf dem holzvertäfelten Flur entfernten. Er faltete den Brief auseinander, den sie anscheinend bisher nicht gefunden hatten, obwohl er in Eriennes Gemächern nicht einmal richtig versteckt gewesen war. Denser hatte gewusst, dass er dort war, an ihn adressiert. Er hatte auch, genau wie sie, gewusst, dass sie ihn nicht finden würden. Keine Instinkte.
Er las den Brief noch einmal durch und seufzte. Viereinhalb Jahre waren vergangen, seit sie vor Septerns Haus auf dem Schlachtfeld gestanden hatten, und doch waren die Rabenkrieger die einzigen Menschen, denen er sich anvertrauen konnte, wenn er Hilfe brauchte, obschon sie stark dezimiert waren. Erienne war verschwunden, und Thraun rannte vermutlich immer noch mit seinem Wolfsrudel im Dornenwald herum. So blieb noch Hirad, mit dem er ein Jahr zuvor einen üblen Streit gehabt hatte. Seitdem hatten sie kein Wort mehr miteinander gesprochen. Dann war da noch Ilkar, der sich in den Ruinen von Julatsa zu Tode schuftete, und natürlich der große Mann.
Denser lächelte. Der Unbekannte Krieger war immer noch der Dreh- und Angelpunkt. Wenn er den ganzen Weg flog, konnte Denser in etwas mehr als zwei Tagen in Korina sein. Ein Abendessen im Krähenhorst und ein Glas roter Blackthorne mit dem Unbekannten Krieger. Eine angenehme Aussicht.
Er beschloss, Dordover im ersten Morgengrauen zu verlassen. Jetzt wollte er läuten, damit in Eriennes Gemächern ein Feuer entfacht wurde. Er hatte noch viel zu tun. Densers Lächeln verschwand. Die Dordovaner würden ihre Suche fortsetzen, und er durfte nicht riskieren, dass sie Lyanna vor ihm fanden. Nicht, dass er dies noch für wahrscheinlich hielt, nachdem er den Brief gelesen hatte, aber man konnte nie wissen. Und solange man nicht sicher war, schwebte seine Tochter bei genau den Leuten, die Erienne um Hilfe gebeten hatte, in Gefahr.
Das war aber noch nicht alles. Irgendetwas arbeitete in ihm, er konnte es jedoch nicht ans Licht zerren. Es hatte mit Lyannas Erweckung zu tun.
Eine starke Bö rüttelte am Fenster, flaute aber ebenso schnell wieder ab, wie sie aufgekommen war. Denser zuckte mit den Achseln, drehte sich zum Schreibtisch um und machte sich daran, alle Papiere gründlich durchzugehen.
In Korina herrschte viel Betrieb. Der Handel war den ganzen Sommer über hervorragend gelaufen, und der Wechsel der Jahreszeit hatte dem kaum Abbruch getan, abgesehen davon, dass die Zahl der Reisenden und Wanderarbeiter zurückging, nachdem diese der Sonne gefolgt und mit Schiffen zum Südkontinent gefahren waren.
In den ersten zwei Jahren nach dem Krieg hatte es Gerüchte über weitere Kämpfe, Steuererhöhungen und eine erneute Invasion der Wesmen gegeben, doch schließlich war auf Korinas vormals nahezu verlassenen Hafenmolen und Märkten wieder etwas Zuversicht eingekehrt, und alle Händler schienen fest entschlossen, den entgangenen Profit so schnell wie möglich hereinzuholen. Die Markttage wurden länger und länger, mit jeder Flut legten mehr Schiffe an, und die Gasthöfe, Wirtshäuser und Herbergen hatten einen Ansturm zu verzeichnen wie seit der Blütezeit der Handelsallianz von Korina nicht mehr. Selbstverständlich begann unter den Baronen wieder das alte Gezänk, und der Beruf des Söldners schien abermals sehr zukunftsträchtig zu sein. Dies war freilich ein Gewerbe, an dem der Rabe keinen Anteil mehr hatte.
Der am Zentralmarkt gelegene Krähenhorst platzte vom frühen Morgen, wenn das Frühstück serviert wurde, bis zum späten Abend, wenn der Spießbraten bis auf Knochen und Knorpel abgenagt war, aus allen Nähten.
Der Unbekannte Krieger schloss hinter dem letzten Betrunkenen des Abends die Tür und drehte sich zum Schankraum um. Er sah sein Ebenbild in einem der kleinen Spiegel, die überall an den Pfeilern hingen. Das kurz rasierte Haar konnte das sich ausbreitende Grau, das zu den Augen passte, nicht verbergen. Sein Gesicht war so markant wie eh und je, und der kräftige Körperbau unter dem weißen Hemd und der dunkelbraunen Hose wurde mit religiösem Eifer in makelloser Form gehalten. Achtunddreißig war er jetzt. Er spürte sein Alter nicht, aber andererseits kämpfte er auch nicht mehr, und dies aus gutem Grund.
Die Stadtwache hatte gerade die erste Stunde des neuen Tages ausgerufen, doch es würde noch einmal zwei Stunden dauern, bis er endlich durch seine Haustür treten konnte. Er hoffte nur, dass Diera und Jonas in dieser Nacht etwas ruhiger schlafen konnten. Der Kleine hatte das Bauchgrimmen und war die meiste Zeit äußerst schlecht gelaunt.
Lächelnd ging er zur Theke, wo Tomas inzwischen zwei dampfende Eimer Seifenwasser, Tücher und einen Schrubber bereitgestellt hatte. Der schönste Moment eines jeden Tages war der, wenn er nachts an der Wiege seines neugeborenen Kindes stehen konnte, oder wenn er neben Diera aufwachte, während die Sonne schon durchs Schlafzimmerfenster schien. Er rückte einen Stuhl zurecht, bevor er die Hände auf die Theke klatschte. Tomas tauchte dahinter auf und brachte eine Flasche roten Traubenbrand von den Südinseln und zwei Schnapsgläser mit. Er schenkte ihnen beiden reichlich ein. Tomas war inzwischen völlig kahlköpfig und fünfzig Jahre alt, doch seine Augen funkelten lebhaft wie eh und je, und er hielt sich aufrecht und war kerngesund.
»Auf einen schönen Abend, mal wieder«, sagte er und reichte dem Unbekannten ein Glas.
»Und auf die Klugheit, zwei zusätzliche Mitarbeiter einzustellen. Die haben es uns wirklich leichter gemacht.«
Die beiden Männer, Freunde seit mehr als zwanzig Jahren und seit gut einem Dutzend Jahren gemeinsam die Besitzer des Krähenhorsts, stießen an und tranken. Nur einen Schnaps an jedem Abend, so hielten sie es seit mehr als vier Jahren. Wenn sie den ganzen Tag gearbeitet hatten, mochten sie darauf so wenig verzichten wie auf das Atmen. Schließlich hatte der Unbekannte mit dem Raben mehr als ein Jahrzehnt lang dafür gekämpft, solche Momente in einem beschaulichen Alltagsleben genießen zu können. Schade nur, dass er auch nach vier Jahren innerlich immer noch nicht zur Ruhe gekommen war.
Der Unbekannte rieb sich das Kinn und kratzte über die Stoppeln, die tagsüber gewachsen waren. Er blickte zur Tür des Hinterzimmers, die mit dem Symbol des Raben geschmückt war. Der Raum wurde kaum noch benutzt.
»Na, juckt’s dich, alter Junge?«, fragte Tomas.
»Ja«, erwiderte der Unbekannte, »aber nicht an der Stelle, an die du jetzt denkst.«
»Wirklich?« Tomas zog kritisch die Augenbrauen hoch. »Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sehen würde – dass du dich niederlässt und den Laden hier mit mir zusammen führst.«
»Du hättest nicht gedacht, dass ich so lange überlebe, was?« Der Unbekannte schnappte sich einen Eimer und einen Putzlappen.
»Daran habe ich nie gezweifelt. Aber du bist ein Wandervogel, Sol. Ein Krieger. Es liegt dir im Blut.«
Nur Tomas und Diera durften seinen richtigen Namen, den er als Protektor getragen hatte, benutzen, und wenn sie es taten, dann hielt er immer kurz inne. Es bedeutete, dass sie sich wegen irgendetwas Sorgen machten. Die Wahrheit war ja, dass er sich tatsächlich noch nicht richtig zur Ruhe gesetzt hatte. In Xetesk gab es noch viel zu tun, man musste dringend weitere Forschungen durchführen, um die Protektoren freizulassen, die das wollten. Davon abgesehen musste er hin und wieder seine Freunde besuchen, was aber eigentlich nur eine bequeme Ausrede war. Irgendwie konnte er nicht bestreiten, dass er manchmal dieses ruhige Leben satt hatte und sich danach sehnte, sich das Schwert auf den Rücken zu schnallen und loszureiten.
Auch ihm machte es Sorgen. Wenn er sich nun tatsächlich niemals wirklich niederlassen wollte? Aber seine Sehnsucht musste sich doch in nicht allzu ferner Zukunft endlich einmal auf ruhigere Dinge richten. Wenigstens verspürte er nicht mehr den Drang, ständig in vorderster Reihe zu kämpfen, und das hatte etwas Tröstliches. Dabei hatte er Angebote bekommen, viele Angebote.
Er lächelte Tomas an. »Nein, nicht mehr. Ich wische lieber den Boden als zu kämpfen. Dabei riskiert man doch nur Kopf und Kragen.«
»Was juckt dich dann?«
»Denser kommt. Ich kann es spüren. Es ist das Gleiche wie immer.«
»Oh, wann denn?« Tomas runzelte die Stirn.
Der Unbekannte zuckte mit den Achseln. »Bald schon, sehr bald.«
Rhob, Tomas’ Sohn, tauchte in der Hintertür auf, die zu den Ställen führte. In den letzten Jahren war der nervöse Junge zu einem kräftigen, besonnenen jungen Mann herangewachsen. Grüne Augen funkelten unter kurzem braunem Haar in einem Gesicht mit markanten Wangenknochen. Sein kräftiger Körperbau war die Folge von vielen Jahren körperlicher Arbeit mit den Pferden, Sätteln und Kutschen, und sein angenehmes Wesen war ein Spiegelbild des Charakters seines Vaters.
»Alles drin und gesichert?«, fragte Tomas.
»Alles klar«, sagte Rhob. Er kam zur Theke und schnappte sich den zweiten Eimer und den großen, zerfransten Putzwedel. »Mach nur, alter Herr, geh du nur ins Bett und lass die Jugend hier aufräumen.« Er grinste breit, seine Augen funkelten vorwitzig im Schein der Lampen.
Der Unbekannte lachte. »Es ist lange her, dass mich jemand als Jugendlichen bezeichnet hat.«
»Das ist eben immer eine Frage des Standpunkts«, meinte Rhob.
Tomas wischte die Theke ab und warf das Tuch in den Wascheimer. »Also, der alte Herr wird dann wohl den Rat seines Sohnes annehmen. Wir sehen uns morgen gegen Mittag.«
»Gute Nacht, Tomas.«
»Gute Nacht, Vater.«
»So«, meinte der Unbekannte. »Ich übernehme die Tische, du den Boden und den Herd.«
Als sie sich an ihre jeweiligen Aufgaben machen wollten, wurden sie von einem drängenden Klopfen an der Vordertür unterbrochen. Rhob schaute auf, er hatte gerade den Herd abgewischt. Der Unbekannte blies die Wangen auf.
»Ich denke, ich weiß, wer das ist«, sagte er. »Sieh doch mal nach, ob wir noch Wasser für Kaffee haben, Rhob. Und richte eine Platte mit Brot und Käse.«
Rhob lehnte den Schrubber in die Ecke und verschwand hinter der Theke. Der Unbekannte schob unterdessen die Riegel zurück und zog die Tür auf. Denser fiel ihm beinahe entgegen.
»Bei den Göttern, Denser, was, zum Teufel, hast du nur angestellt?«
»Bin geflogen«, sagte er. Sein Blick war unstet, die Augen tief eingesunken, das Gesicht kreidebleich und eiskalt. »Kannst du mir etwas Warmes zu essen besorgen? Mir ist kalt.«
»Hmm.« Der Unbekannte führte den schlotternden Denser ins Hinterzimmer und zog einen Stuhl vor den kalten Kamin. Dort ließ sich der Magier ins weiche Polster sinken. Der Raum hatte sich kaum verändert. Vor den mit Läden gesicherten Fenstern stand die große Tafel des Raben, die Stühle waren mit weißem Tuch abgedeckt. An diesem Tisch hatten sie gefeiert und getrauert. Er war betrübt, dass seine klarste Erinnerung die an Sirendor Larn war, Hirads besten Freund, der auf diesem Tisch, in Laken gehüllt, aufgebahrt worden war.
Die Stühle der Rabenkrieger standen wie gewohnt vor dem Kamin, doch der Unbekannte rückte sie jeden Tag zur Seite, um heimlich mit seinem Zweihandschwert zu trainieren. Wenn es eines gab, das der Unbekannte durch Erfahrung gelernt hatte, dann war es die Tatsache, dass in Balaia nichts so blieb, wie es war.
Rhob stieß die Tür auf und kam mit einem dampfenden Krug, Bechern und einem Tablett mit Essen zurück. Das alles trug er auf einem Arm, damit er die zweite Hand für eine Schaufel mit glühenden Kohlen frei hatte. Der Unbekannte nahm ihm alles mit einem dankbaren Nicken ab.
»Ist schon gut, ich räume vorne allein weiter auf«, sagte Rhob.
»Danke.«
»Geht es ihm nicht gut?«
»Ihm ist nur etwas kalt«, erklärte der Unbekannte, doch er wusste, dass dies ganz sicher nicht alles war. Er hatte den schmerzlichen Ausdruck in Densers Augen keineswegs übersehen. Der Magier war nicht nur erschöpft, sondern auch verzweifelt.
Der Unbekannte zündete rasch ein Feuer an, drückte dem Magier einen Becher Kaffee in die Hand und stellte Brot und Käse in Reichweite auf einem Tisch neben ihm ab. Dann zog er seinen eigenen Stuhl heran und wartete, was Denser ihm zu sagen hatte.
Der Xeteskianer sah schrecklich aus. Der Bart war ungepflegt, das schwarze Haar drang zottelig unter der Kappe hervor, das Gesicht war bleich, die blutunterlaufenen Augen hatten schwarze Ringe, und die Lippen waren bläulich verfärbt. Seine Blicke irrten im Raum umher, er war überhaupt noch nicht richtig angekommen und bemühte sich, die passenden Worte zu finden, brachte aber keinen Laut über die Lippen. Er hatte sich bis aufs Äußerste verausgabt, und jetzt konnte er nicht mehr. Sein Mana war ganz und gar erschöpft, und selbst bei einem Magier von Densers außerordentlichen Fähigkeiten konnte eine einzige Fehleinschätzung tödlich sein. Vor allem, wenn man mit Schattenschwingen flog.
Der Unbekannte fühlte sich mit Denser verbunden, seit er – noch als Protektor – Denser zugeteilt worden war. Wenn er Denser jetzt anschaute, konnte er nicht ruhig bleiben.
»Ich verstehe, dass dich irgendetwas schnell hierher getrieben hat, aber es wird dir nicht helfen, wenn du dich umbringst. Nicht einmal du kannst einen Spruch unbeschränkt lange aufrechterhalten.«
Denser nickte und hob den Becher an die zitternden Lippen. Er keuchte, als ihm die heiße Flüssigkeit die Kehle verbrannte.
»Ich war schon so nahe und wollte nicht kurz vor der Stadt noch einmal rasten. Wir hätten damit einen ganzen Tag verloren.« Seine tauben Lippen hatten Mühe, die Worte zu formen. Er wollte noch mehr sagen, wurde aber durch einen heftigen Husten unterbrochen. Der Unbekannte beugte sich vor und nahm Denser den Becher ab, ehe der Magier sich den heißen Kaffee über die Hände kippte.
»Nimm dir Zeit, Denser. Du bist ja jetzt angekommen. Wenn du willst, lasse ich dir ein Bett richten. Immer mit der Ruhe.«
»Ich kann aber nicht ruhig sein«, sagte er. »Sie sind hinter meinem Mädchen her. Erienne ist mit Lyanna verschwunden. Wir müssen sie als Erste finden, sonst wird sie umgebracht. Bei den Göttern, sie ist doch kein böser Geist, sie ist nur ein kleines Mädchen. Ich brauche den Raben.«
Der Unbekannte zuckte zusammen. Densers Ausbruch ging ihm unter die Haut, doch die Lösung machte ihm beinahe ebenso große Sorgen wie das Problem. Der Rabe hatte sich aufgelöst. Für sie alle hatte ein neuer Lebensabschnitt begonnen. Es war völlig ausgeschlossen, dass sie sich wieder zusammentaten.
»Sammle deine Gedanken, Denser, und beruhige dich. Ich muss es im Zusammenhang und von Anfang an hören.«
Es war Nacht auf den Südhängen der balaianischen Berge, einen halben Tagesritt von der weitgehend wieder aufgebauten Stadt Blackthorne entfernt. Die Sterne standen am Himmel, der Mond spendete sein bleiches Licht und vertrieb die schlimmste Dunkelheit.
Hirad Coldheart lief beinahe geräuschlos den steilen Weg hinunter. Es war ein Weg, dem er mit einer Augenbinde hätte folgen können, doch als er dieses Mal über glitschigen Schlamm und glatten Stein eilte, kam es vor allem auf Schnelligkeit und Heimlichkeit an. Wieder waren Jäger im Anmarsch, die wie die anderen zuvor aufgehalten werden mussten. Die Dummheit würde wohl nie ein Ende nehmen, auch wenn diese letzten wie alle vorherigen den Tod fanden.
Noch wagten sich nicht sehr viele an diese Aufgabe heran, doch ihre Zahl wuchs, und ihre Pläne wurden raffinierter und gerissener, während die Informationen über Flugwege und Sichtungen in Balaia die Runde machten und auf interessierte Ohren stießen. Ihm wurde übel bei diesem Gedanken, doch andererseits verstand er auch, was diese Männer und Frauen trieb.
Die Habgier war es. Und der Ruhm, der demjenigen zuteil wurde, der die schönste Beute machte, die sich ein Jäger nur wünschen konnte. Der Kopf eines Drachen. Deshalb konnte er die Kaan nicht allein lassen, selbst wenn er es gewollt hätte. Nicht, dass sie besonders verletzlich gewesen wären. Doch man konnte nie wissen. Die Menschen waren äußerst hartnäckig und erfinderisch, und diese letzte Gruppe bewies, dass es einen weiteren Entwicklungsschritt gegeben hatte.
Hirad konnte immer noch nicht recht verstehen, warum die Menschen so schnell vergaßen, wie viel man den Drachen der Kaan zu verdanken hatte. Der Unbekannte hatte jedoch den richtigen Zusammenhang hergestellt, als er Hirad, nachdem er im Krähenhorst die Prahlerei eines Betrunkenen belauscht hatte, vor dem ersten Angriff warnte, der damals gerade geplant wurde.
»Das sollte dich doch eigentlich nicht wundern, Hirad«, hatte er gesagt. »Letzten Endes hat alles und jedes seinen Preis, und es gibt Leute, die einfach nicht glauben wollen, was die Kaan für Balaia getan haben. Dann gibt es wieder andere, denen es schlicht und ergreifend egal ist. Für sie zählt nur der Verkaufswert einer Handelsware. Und Ehre und Ruhm sind sowieso nicht in Gold zu fassen.«
Die Worte hatten Hirad wütend gemacht, wie es der Unbekannte beabsichtigt hatte. So blieb er wachsam und war den Jägern immer einen Schritt voraus. Sie hatten es mit Magie, mit Gift, mit Feuer und in ihrer Unwissenheit auch mit Frontalangriffen versucht. Jetzt verlegten sie sich auf das, was sie aus den bisherigen Todesfällen und durch Beobachtung gelernt hatten. Zum ersten Mal musste Hirad sich Sorgen machen.
Eine Gruppe von sechs Jägern war unterwegs – drei Krieger, ein Magier und zwei Techniker. Sie bewegten sich unterhalb des Choul, in dem die Drachen lebten, vorsichtig durch die Vorberge. Sie waren Ansiedlungen ausgewichen, von denen Hirad hätte Warnungen bekommen können, und sie hatten eine handgefertigte Balliste dabei, um Holzpfähle mit Stahlspitzen abzuschießen.
Ihr Plan war, wie alle guten Pläne, im Grunde recht einfach. Wenn Hirad sich nicht sehr irrte, dann wollten sie an diesem Abend mit dem Angriff beginnen, weil sie wussten, dass die Kaan im Schutz der Dunkelheit jagten und fraßen. Die Balliste sollte unter einem häufig benutzten Flugweg aufgestellt werden, und ihre Geschosse hatten, wenn die Schützen richtig zielten, genügend Durschlagskraft, um einen Drachen zu verwunden oder zu verstümmeln.
Hirad war nicht bereit, irgendein Risiko einzugehen, und stieg hinunter, um sie abzufangen, bevor er den Kaan das Signal gab, dass sie fliegen konnten. Die Jäger hatten bei ihrem Plan zwei Fehler gemacht. Sie hatten nicht mit Hirad gerechnet, und nur einer unter ihnen war ein Elf. Sie waren in der Nacht praktisch schutzlos, und sie sollten bald herausfinden, dass es in der Nacht tatsächlich keinen Schutz gab.
Durch einen Spalt zwischen zwei Felsen beobachtete er sie. Sie waren ungefähr dreißig Fuß unter ihm und noch hundert Schritt entfernt. Da sie eine abgeblendete Laterne dabei hatten, konnte der Barbar in der dunkelgrauen Landschaft ihre Bewegungen leicht verfolgen. Er hörte die Räder der Balliste knarren und die Hufe der Zugpferde auf dem Boden stampfen.
Sie näherten sich einer kleinen Lichtung, auf der sie, wie Hirad vermutete, die Balliste aufbauen wollten. Das Gelände war dort leicht abschüssig, und eine Felsnase bot eine ideale Verankerung. Hirad wusste, was er zu tun hatte.
Er zog sich ein Stück zurück, wich nach rechts aus und erreichte einen flachen Graben, der parallel zum Plateau verlief. Mit den Augen auf Bodenhöhe schlich er am Rand der Lichtung entlang und wartete den richtigen Zeitpunkt ab. Das Schwert blieb in der Scheide, damit er beide Hände frei hatte.
Der Magier führte die Pferde den Hang hinauf, auf der anderen Seite bewachte ein Krieger den Zug. Die beiden Techniker liefen hinter der Balliste, und ganz hinten kamen zwei weitere Jäger.
Hirad konnte den angestrengten Atem der Zugtiere hören. Ihre Hufe waren mit Tüchern umwickelt, um die Geräusche zu dämpfen. Der Hufschlag war kaum mehr ein dumpfes Klopfen auf dem Boden. Die Räder der Balliste quietschten und knarrten, obwohl die Techniker sie ständig nachfetteten. Hin und wieder war ein leiser, warnender Ruf oder ein ermunterndes Wort zu hören.
Hirad machte sich bereit. Kurz bevor das Gelände eben wurde, lief der Weg noch einmal etwa zwanzig Schritt weit steil bergauf. Diese Stelle musste nach den Regenfällen des Tages glitschig sein. Als die Jäger sich näherten, wurden sie langsamer. Der Magier bildete die Vorhut, er hatte die Zügel in die Hand genommen und trieb die Pferde hinauf.
»Halte sie bloß in Bewegung«, zischte jemand von unten. Es klang laut in der stillen Nachtluft.
»Immer mit der Ruhe, das wird schon«, sagte ein anderer.
Der Magier tauchte über der Kante auf. Hirad sprang aufs Plateau, packte seine Beine und zog sie weg. Der Magier stürzte schwer. Hirad war über ihm, bevor er einen Ruf ausstoßen konnte, und schlug ihm die Faust auf die Schläfe. Der Mann prallte mit dem Kopf gegen einen Stein und blieb reglos liegen.
Hirad rannte um die nervösen Pferde herum und zog im Laufen sein Schwert. Der Krieger auf der anderen Seite hatte sich erst halb herumgedreht und war nicht darauf vorbereitet, sich zu verteidigen. Hirad trieb ihm seine Klinge in die Seite, und als der Mann schreiend zu Boden ging, beugte sich der Barbar über ihn.
»Glaube mir, du hast noch Glück gehabt«, keuchte er. Er beruhigte die scheuenden Pferde und rannte zur Balliste, um eins der Zugseile durchzuhacken. Die Balliste geriet ins Rutschen, und die Pferde reagierten instinktiv, um den veränderten Zug im Geschirr auszugleichen. Eines wieherte nervös. Von unten schauten vier Gesichter stumm und erschrocken zu ihm auf. Klingen wurden blank gezogen.
»Die Letzten, die gekommen sind, habe ich gewarnt. Sie sollten allen anderen sagen, dass jeder, der sich hierher wagt, den Tod findet. Ihr wolltet nicht hören.« Er hackte auf das zweite Zugseil ein, das beim zweiten Schlag zerriss. Die Balliste rollte rückwärts den Hang hinunter, die Jäger mussten sich mit raschen Sprüngen in Sicherheit bringen. Das Geschütz holperte über Stock und Stein und wurde immer schneller. Ein Rad löste sich, das Fahrgestell kippte nach links und stürzte über den Wegrand. Mit lautem Krachen landete die Balliste zweihundert Schritt tiefer in einer Baumgruppe.
Unter der Rampe rappelten sich die Jäger wieder auf, und die Techniker sahen fragend und verunsichert die Krieger an.
»Die können nichts mehr für euch tun«, sagte Hirad. Es ist jetzt sicher, Großer Kaan.
Ein Schatten erhob sich hinter Hirad aus den Hügeln und fegte den Weg herunter. Er war riesig, und die großen Schwingen erzeugten einen künstlichen Wind. Ein Wutschrei drang aus dem großen Maul. Die Jäger drehten sich um und rannten weg, doch ein zweiter Schatten stieg weiter unten am Weg auf, und ein dritter gesellte sich hinzu und scheuchte sie zu Hirad zurück.
Die drei Drachen verdeckten die Sterne, ihre gewaltigen Körper zogen über den Himmel, ihr Brüllen hallte zwischen den Bergen, und die Jäger, die jetzt zu Gejagten wurden, stießen erschrockene Schreie aus. Sie kauerten dicht beieinander, die Drachen umkreisten sie träge, die langsamen Flügelschläge drückten Gras und Büsche nieder und ließen Staubwolken in die Luft steigen. Jeder von ihnen war mehr als hundert Fuß lang, und ihre Größe und Kraft ließ die armselige Bande, die versucht hatte, einen Drachen zu töten, wie einen Witz erscheinen. Sie waren hilflos, und sie wussten es. Sie starrten in die Mäuler, die sie mühelos verschlingen konnten, und dachten an die heißen Flammen, die sie im Handumdrehen zu Asche verbrennen konnten.
»Bitte, Hirad«, murmelte einer der Techniker. Er hatte den Barbaren erkannt und starrte ihn mit verzweifelten, weit aufgerissenen Augen an. »Wir hören jetzt auf dich.«
»Zu spät«, sagte Hirad. »Zu spät.«
Sha-Kaan raste herbei, seine Flügel schlugen heftig, der Wind fegte die Jäger von den Beinen. Er bog den langen Hals nach unten, schnappte blitzschnell wie eine Schlange zu und packte einen Krieger mit dem Maul. Dann verschwand er mit unglaublicher Geschwindigkeit im Himmel, seine Beweglichkeit in der Luft war atemberaubend. Er war schnell für ein Tier von seiner Größe, und die Jäger, die am Boden lagen, starrten ihm offenen Mundes hinterher. Sie waren viel zu erschrocken, um aufzustehen.
Der Mann, den Sha-Kaan im Maul hatte, schrie nicht einmal auf, als sein Körper entzweigerissen wurde und der Drache einen Schauer von Blut und Fleisch ausspuckte. Der Große Kaan bellte wütend, das Geräusch hallte wie ferner Donner zwischen den Bergen. Nos-Kaan stieg hoch empor und kam im Sturzflug wieder herunter, und drunten kreischten die Menschen endlich, als er zu fallen schien wie ein Stein. Mit einem einzigen Flügelschlag fing er sich ab, der Luftzug ließ die Jäger hilflos durch den Dreck rollen, und ihre Schreie verloren sich im Wind. Er schaute hin und schlug zu, wie Sha-Kaan es getan hatte, zerfetzte sein Opfer und ließ die Überreste vor den anderen Jägern fallen.
Und schließlich Hyn-Kaan. Während der Große Kaan bellte, segelte er dicht über dem Boden dahin, ein mächtiger dunkler Schatten im Sternenlicht. Nur wenige Fuß über den Felsen strich er vorbei. Auch er ließ den Kopf ein wenig sinken, um sein Opfer aufzunehmen. Er schlug mit den Flügeln und schoss wieder hinauf, ein menschlicher Klagelaut drang herab und brach ab, und dann war das Geräusch eines Körpers zu hören, der auf dem Fels aufschlug.
Hirad leckte sich die Lippen, die auf einmal ausgetrocknet waren. Sie hatten gesagt, sie wollten sich rächen. Und sie hatten gesagt, sie wollten den Menschen zeigen, welche Macht sie besaßen. Doch der Elf lag noch bewusstlos vor seinen Füßen und hatte nichts gesehen. Er hatte Glück gehabt. Hirad liebte die Kaan, und die starke Verbindung zu ihnen konnte nicht durch einen solchen gewaltsamen Tod gestört werden. Doch nicht zum ersten Mal wurde er an die großen Unterschiede zwischen Menschen und Drachen erinnert. Sie waren majestätisch und die Menschen ihre Sklaven, sofern sie dies wollten.
Hirad blickte wieder zum letzten Techniker, der sich, von den Leichen seiner Freunde umgeben, in die Hosen gemacht hatte. Um seine Stiefel war eine Lache entstanden. Vor Angst gelähmt, beobachtete er die drei Drachen, die über ihm kreisten. Sha-Kaan landete, packte ihn mit einer Vorderpranke, hob ihn hoch und zog ihn dicht an sein Maul heran. Der Mann heulte und bibberte.
Hirad drehte sich zum Magier um, entstöpselte seinen Wasserschlauch und kippte dem Elf den Inhalt über den Kopf. Der Mann keuchte und würgte und stöhnte vor Schmerzen. Hirad packte ihn am Kragen, zog ihn hoch und setzte ihm einen Dolch an die Kehle.
»Wenn du nur daran denkst, einen Spruch zu wirken, stirbst du. Du bist nicht schnell genug, um mich zu schlagen, kapiert?« Der Magier nickte. »Gut. Und jetzt pass auf! Schau zu und lerne etwas.«
Sha-Kaan zog den hilflosen Techniker noch näher an sich heran. »Warum jagt ihr uns?«, fragte er. Sein Atem ließ das Haar des Mannes flattern, der antworten wollte, aber nur ein ersticktes Stöhnen herausbekam. »Antworte mir, Mensch.« Der Techniker strampelte ohnmächtig mit den Beinen in der Luft und zerrte instinktiv an den Klauen, die er mit seinen schwachen Kräften nicht wegschieben konnte.
»Die Aussicht, den Rest meines Lebens bequem zu leben«, quetschte er heraus. »Es war mir nicht klar, ich wollte dir nichts tun. Ich dachte …«
Sha-Kaan schnaubte. »Du wolltest mir nichts tun? Du hast uns für dumme Reptilien gehalten. Und mich oder einen aus meiner Brut zu töten, war für dich – wie hat Hirad es genannt? Ja, es wäre ein ›Sport‹ gewesen. Das ist jetzt anders, ja? Du weißt jetzt, dass wir denken können?«
Der Techniker nickte. »Ich w-werde es nie w-wieder tun, ich verspreche es.«
»Nein, du wirst es nie wieder tun«, sagte Sha-Kaan, »und ich hoffe, dein glücklicher Kumpan passt jetzt genau auf.«
»M-mein glückli…« Der Techniker konnte den Satz nicht mehr beenden. Sha-Kaan packte mit seiner riesigen Vorderpranke den Schädel des Mannes und zerquetschte ihn wie eine reife Frucht. Das feuchte Knacken hallte zwischen den Felsen.
Der Magier zitterte und keuchte, und seine Knie wurden weich, doch der Barbar hielt ihn aufrecht. Sha-Kaan ließ den zuckenden Leichnam fallen und sah in ihre Richtung. Seine durchdringenden blauen Augen glänzten kalt in der Dunkelheit.
»Hirad Coldheart, ich überlasse es dir, die Botschaft zu vervollständigen.« Der Große Kaan flog auf und führte seine Brut auf die Jagd.
Hirad stand da, hielt den Magier fest und wartete, bis der verängstigte Elf das Gemetzel ringsum in sich aufgenommen hatte. Der Mann zitterte wie Espenlaub. Als ihm der Geruch von Urin in die Nase stieg, stieß Hirad den Magier fort.
»Du lebst noch, weil ich entschieden habe, dass du leben sollst.« Er starrte dem Elf ins kreidebleiche Gesicht. »Und du weißt jetzt, was du den Leuten erzählen sollst. Niemand, der hierher kommt, um die Kaan zu jagen, wird etwas anderes finden als den eigenen schnellen Tod. Drachen sind keine potenziellen Trophäen, sondern erheblich mächtiger, als du es dir überhaupt vorstellen kannst. Hast du das so weit verstanden?«
Der Magier nickte. »Warum ich?«
»Wie ist dein Name?«, fragte Hirad.
»Y-Yeren«, stammelte er.
»Du bist Julatsaner, oder?«
Wieder ein Nicken.
»Das ist der Grund. Ilkar braucht Magier. Du wirst zum Kolleg gehen und die Kunde von dort aus weiterverbreiten. Du bleibst dort und hilfst ihm, wie er es für richtig hält. Falls ich höre, dass du es nicht getan hast, wird es keinen sicheren Ort mehr für dich geben. Nicht einmal im Abgrund der Hölle, nirgends. Ich werde dich finden, und ich bringe meine Freunde mit.« Hirad deutete mit dem Daumen zu den Bergen.
»Und jetzt verschwinde. Und hör nicht auf zu rennen, bis Ilkar sagt, dass du aufhören kannst. Verstanden?«
Ein drittes Nicken. Hirad drehte sich um und entfernte sich, und das Geräusch rennender Füße ließ ihn grimmig lächeln.
2
Die ersten Tage an Bord des Schiffs waren die ruhigsten und entspanntesten in Eriennes bewegtem Leben gewesen. Inzwischen war sie sicher, dass sie den Fesseln der Kollegien endgültig entkommen war. Das galt nicht nur für Dordover, sondern für alle. Im spätsommerlich ruhigen Südmeer, wo immer noch eine schöne, trockene Wärme herrschte, konnten sie und Lyanna endlich aufatmen und sich überlegen, was hinter ihnen lag und was noch kommen mochte.
Im Rückblick hatte sie das Gefühl, die Stimmen in ihrem Kopf seien so vertraut gewesen wie ein Teil von ihr selbst. Sie drängten sie, aufzubrechen und zu ihnen zu kommen. Erienne erinnerte sich noch an die Nacht, in der die Entscheidung gefallen war. Es war eine von vielen Nächten in Dordover gewesen, in denen Lyanna von Albträumen geplagt wurde. Es sollte die letzte sein, wie sich herausstellte.
Dordover. Der Ältestenrat der Kollegien hatte sie nach ihrem Abschied aus Xetesk zunächst wieder aufgenommen. Man hatte sie mit einer Mischung aus Ehrfurcht und Abscheu angesichts ihrer turbulenten jüngsten Vergangenheit empfangen. Die außergewöhnlichen Begabungen ihrer Tochter waren gefördert und von Magiern erforscht worden, deren Nervosität die Erregung überwog.
In dem Jahr, in dem die Dordovaner ihr zu helfen versucht hatten, war freilich nichts herausgekommen, das Erienne und Denser nicht schon selbst gewusst oder erraten hätten. Tatsache war, dass Lyannas Fähigkeiten weit über das begrenzte Verständnis der dordovanischen Magier hinausgingen. Sie konnten ihre Begabungen ebenso wenig fördern, wie sie eine Maus das Fliegen hätten lehren können.
Eine Magie, ein Magier.
Die dordovanischen Ältesten hassten diesen Spruch, und sie hassten Erienne dafür, dass sie entschieden daran glaubte. Diese Überzeugung verstieß gegen die Grundsätze der dordovanischen Unabhängigkeit. Zuerst hatten sie Lyannas Ausbildung mit großer Hingabe in Angriff genommen. Nachdem sie aber erkannt hatten, über welche Fähigkeiten das Mädchen wirklich verfügte, hatte sich ihre Haltung verändert, oder – noch wahrscheinlicher – sie fühlten sich durch die Kleine sogar bedroht.
Doch die ganze Zeit über hatte jemand es verstanden. Leute, die Macht hatten. Ihre Stimmen hatten in Eriennes und, wie sie wusste, auch in Lyannas Kopf gesprochen. Die Stimmen hatten ihr Mut gemacht, ihren Glauben bestärkt und dafür gesorgt, dass sie nicht den Verstand verlor und gelassen blieb. Die Stimmen hatten sie gedrängt anzunehmen, was ihr geboten werden konnte – Wissen und die Macht zu helfen.
Und dann war diese eine Nacht gekommen. Erienne hatte eingesehen, dass die Dordovaner Lyanna nicht mehr helfen konnten, und dass ihre ungeschickten Versuche das Mädchen sogar in Gefahr brachten. Sie konnten Lyanna nicht von ihren Albträumen befreien, und sie bekam keinen Raum mehr, um sich zu entwickeln. Ihre Frustration über die Behinderungen hätten unausweichlich in die Katastrophe geführt. Sie war so jung, sie konnte nicht einmal verstehen, was sie entfesselt hätte. Selbst jetzt war sie manchmal hitzköpfig und darin ein genaues Ebenbild ihrer Mutter. Bisher hatte sie ihre Wut noch nie in Form von Magie ausgetobt, aber dieser Augenblick würde früher oder später kommen, wenn sie ihre Begabung nicht zu beherrschen lernte.
Lyanna war weinend aus einem Albtraum erwacht. Ihre schrillen Schreie hatten Erienne mehr Angst eingejagt als alles andere bisher. Sie hatte das zitternde, verschwitzte Mädchen in den Armen gewiegt und beruhigt, und ihr war bewusst geworden, dass es so nicht weitergehen konnte. Sie erinnerte sich an das Gespräch mit ihrer Tochter, als habe sie es gerade eben erst geführt.
»Schon gut, deine Mami ist ja da. Niemand kann dir etwas tun.« Erienne hatte ein Taschentuch aus dem Ärmel gezupft und Lyannas Gesicht getrocknet und versucht, das heftig pochende Herz zu beruhigen.
»Ich weiß, Mami.« Das kleine Mädchen hatte sich an sie geklammert. »Die dunklen Ungeheuer sind gekommen, aber die alten Frauen haben sie weggejagt.«
Erienne hatte aufgehört, sie zu wiegen.
»Wer war das, Lyanna?«
»Die alten Frauen. Die werden mich immer beschützen.« Sie hatte sich noch enger an ihre Mutter gekuschelt. »Jedenfalls wenn ich bei ihnen bin.«
Erienne lächelte und traf ihre Entscheidung.
»Schlaf jetzt wieder, Liebes.« Sie legte das kleine Mädchen wieder aufs Bett und streichelte ihr Haar. »Mami muss im Arbeitszimmer noch einige Dinge erledigen, und dann machen wir vielleicht eine kleine Reise.«
»Gute Nacht, Mami.«
»Gute Nacht, Liebes.« An der Tür hörte Erienne, wie Lyanna noch etwas flüsterte. Sie drehte sich um, doch Lyanna hatte nicht mit ihr gesprochen. Mit geschlossenen Augen sank ihre Tochter in einen, so die Götter es wollten, hoffentlich ruhigen Schlaf, in dem sie nicht mehr von Albträumen geplagt wurde. Sie flüsterte noch einmal, und dieses Mal konnte Erienne die halb gesungenen Worte verstehen, und sie hörte, wie die Kleine kicherte, als sei sie gekitzelt worden.
»Wir kommen, wir kommen.«
Die bald darauf folgende nächtliche Flucht aus Dordover ließ Erienne auch lange danach noch schaudern. Die erste Zeit war von Angst und Furcht und von der ständigen Sorge geprägt gewesen, die Flucht könnte doch noch scheitern. Inzwischen war allerdings klar, dass sie nie wirklich in Gefahr geschwebt hatten, aufgegriffen zu werden. Acht Tage in einer Kutsche, die von einer schweigsamen Elfenfrau gelenkt wurde, waren den drei unangenehmen Tagen im Dornenwald vorausgegangen. Damals hatte sie es noch für einen schlechten Einfall gehalten, doch mit der Zeit hatte sie begriffen, dass die Elfen der Gilde kaum etwas dem Zufall überließen. Angeschlossen hatte sich eine letzte, eilige Kutschfahrt nach Südosten bis Arlen, wo sie an Bord eines Schiffs gehen und alle Sorgen vergessen konnten.
Das Schiff, die Meerulme, war ein Dreimastkutter, der vom Bugspriet bis zum Ruder fast hundert Fuß maß. Das schlanke und schmale Schiff war auf Geschwindigkeit ausgelegt, die Kabine unter Deck war eng, aber recht bequem. Die aus dreißig Elfen bestehende Besatzung hielt es makellos sauber, und so war die Meerulme ein ansehnliches Schiff, das sich solide unter den Füßen anfühlte. Die dunkelbraunen, fleckigen Balken waren gegen das Salzwasser imprägniert, und die Masten waren kräftig und doch zierlich.