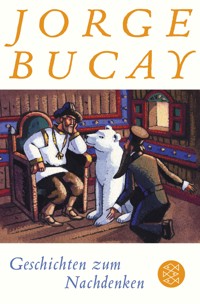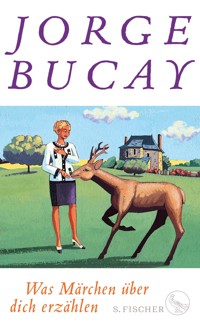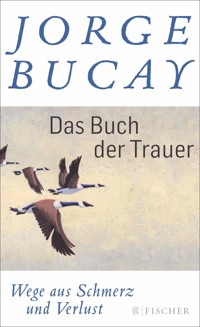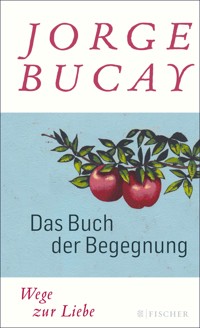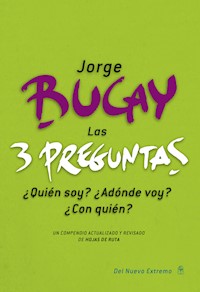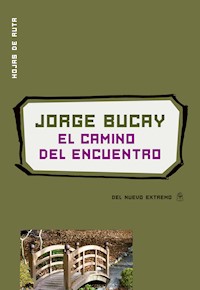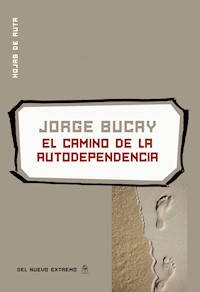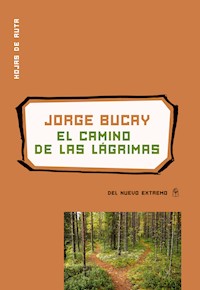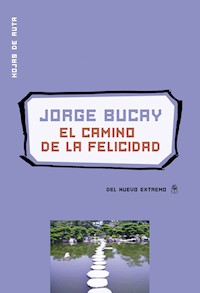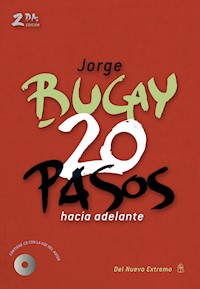9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Für die Suche nach dem Glück gibt es definitiv kein Rezept. Und Jorge Bucay, der angesehene Psycho- und Gestalttherapeut, gaukelt uns auch gar nicht vor, über ein solches zu verfügen. Er weiß, wie vielfältig die Wege sind, die wir bei der Suche nach einem erfüllten Leben beschreiten können. Und doch: Wie individuell ein Weg auch immer sein mag, es gibt ein gemeinsames Merkmal. Denn bei unserer Suche werden wir von drei Fragen geleitet, die wie ein roter Faden dieses Buches durchziehen. Wer bin ich? Wohin gehe ich? Und mit wem? Drei Fragen, drei Aufgaben. Die Antwort auf die erste Frage liegt in der aufrichtigen Begegnung mit mir selbst. Die auf die zweite darin, zu entscheiden, welchen Sinn und welche Erfüllung ich in meinem Leben finde. Und die dritte besteht darin, auszuwählen, was mir entspricht, sich dem Prozess der Liebe zu öffnen und meinen Wegbegleiter oder meine Wegbegleiterin zu finden. Jorge Bucay erläutert in ›Die drei Fragen‹ den Prozess der Persönlichkeitsentwicklung, indem er, angeregt durch Ideen aus Psychologie, Pädagogik und Philosophie, die Suche nach dem Glück als unsere wichtigste Lebensaufgabe darstellt. Wobei er immer wieder kleine, beispielhafte Allegorien und Geschichten in seine Überlegungen mit einbezieht, die komplexe Sachverhalte sinnfällig auf den Punkt bringen. Die Suche nach einem erfüllten Leben ist ein Weg, den jeder für sich selbst beschreiten muss, doch dieses Buch wird ihm sicher dabei helfen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 350
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Jorge Bucay
Drei Fragen
Wer bin ich? Wohin gehe ich? Und mit wem?
Aus dem Spanischen von Stephanie von Harrach
Fischer e-books
Ich wäre gern
Eines Abends, vor ziemlich langer Zeit, berief Gott eine Versammlung ein.
Von allen Lebewesen war ein Abgesandter aus jeder Gattung geladen.
Nachdem sie alle zusammengekommen waren und Gott sich viele Klagen angehört hatte, stellte er eine einzige schlichte Frage: »Und, was möchtest du nun gerne sein?«
Unverblümt und frei heraus gab jeder seine Antwort darauf:
Die Giraffe sagte, sie wäre gern ein Pandabär.
Der Elefant wünschte sich, eine Mücke zu sein.
Der Adler eine Schlange.
Der Hase wäre gern eine Schildkröte gewesen und die Schildkröte eine Schwalbe.
Der Löwe bat darum, Kätzchen sein zu dürfen.
Der Otter Wasserschwein.
Das Pferd eine Orchidee.
Und der Walfisch wäre gern eine Drossel gewesen …
Schließlich war der Mensch an der Reihe, der zufällig gerade vom Weg der Wahrheit kam.
Er überlegte eine Weile, dann hatte er endlich die Erleuchtung und rief:
»Herr, ich wäre gerne … glücklich.«
Vivi García
Vorwort
Ein Großteil der Gedanken dieses Buches wie auch die meisten Geschichten darin sind bereits vor zehn Jahren innerhalb der Reihe der vier Wege publiziert worden, einer Essayfolge, erschienen im Rahmen einer Sammlung namens Hojas de ruta (Wegweiser), in der ich die Wege beschreibe, die ich persönlich für unumgänglich halte bei unser aller und immerwährenden Suche nach dem Glück.
Aktualisiert und neu geordnet sollen diese Überlegungen zur Beantwortung der drei Fragen beitragen, die seit Urzeiten sämtliche Völker der Erde beschäftigen. Es geht um die drei Grundfragen des Lebens:
Wer bin ich?
Wohin gehe ich?
Und mit wem?
In einem dieser Bände habe ich selbst im Vorwort gestanden, dass ich es mir niemals hätte träumen lassen, einmal über das Glück zu schreiben. Wie damals befürchte ich noch immer, der Leitsatz, unter dem die Hojas de ruta stehen, könnte missverständlich sein:
Eine Anleitung zur Suche nach dem Weg zum Glück.
Noch heute stört mich, was dieser Satz scheinbar impliziert. Solange ich das nicht richtigstelle, könnte man meinen, es gäbe EINE Formel, EINEN Weg oder EINE Art und Weise, glücklich zu sein. Außerdem könnte man annehmen, ich hätte sie entdeckt, könnte darüber verfügen und schreibe nun darüber, um andere daran teilhaben zu lassen wie an einem Kochrezept.
Ich fürchte, auch jetzt einige Menschen enttäuschen zu müssen, wenn ich sage, dass ich auch heute, viele Jahre später und nachdem ich die verschiedensten Wege ausprobiert habe, die Formel für das Glück noch immer nicht gefunden habe. Vielleicht zweifele ich auch deshalb daran, dass es überhaupt eine solche gibt. Ich gehe noch einen Schritt weiter und behaupte, wir sollten uns womöglich gar nicht so lange mit der Suche nach einem Rezept aufhalten. Ich bin überzeugt davon, es würde mehr als ausreichen, wenn wir uns aufmerksamer, in zuträglicherer Weise und mit größerem Nachdruck um all das kümmern würden, was uns davon abhält, glücklich zu sein.
Denn was sind unsere Probleme anderes als Hindernisse oder Hürden auf dem Weg zu unserer persönlichen Entfaltung? Welches andere Thema könnte uns stärker beschäftigen als ebendiese Aufgabe, auch wenn es vielen, mich selbst eingeschlossen, schwerfällt, sie mit einem Wort zu umreißen?
Manche bezeichnen es als »Selbstverwirklichung«, andere als »ganzheitliches Bewusstsein« oder »Gewahrwerdungsprozess«, für einige kommt es dem Zustand der Erleuchtung oder spiritueller Ekstase nahe, für ein paar wenige bedeutet es, inneren Frieden zu finden, und andere nennen es einfach Erfüllung.
Ob wir nun groß darüber nachgedacht haben oder nicht und wie wir es auch nennen mögen, eins steht fest: Glücklichsein ist eine unserer größten Herausforderungen. Daher ist die Suche nach dem Glück ein ebenso wichtiges und ergründenswertes Thema wie die Liebe, die Bedeutung von Kommunikation, der Umgang mit dem Tod oder die Frage, welcher Irrglaube manche Menschen annehmen lässt, über das Leben anderer verfügen zu dürfen.
Auf dieser Erkundungsreise wird manch einer verlorengehen oder sich verspäten, einige finden Abkürzungen, werden selbst zu Experten und leiten wieder andere Menschen an.
Möglicherweise bleiben auch diese Meister uns die magische Formel schuldig, doch von ihnen können wir lernen, dass es die verschiedensten Wege gibt, um ans Ziel zu gelangen, unendlich viele Herangehensweisen und Vorgehensarten sowie Dutzende von Marschrouten, die uns auf den rechten Pfad führen.
Viele dieser Meister haben mir gezeigt, dass jeder Weg seine Berechtigung hat und dass es sehr unterschiedliche Wege gibt, doch auf sie alle trifft eins zu: Es ist ein durch und durch menschliches Bedürfnis, Antwort auf die wichtigsten Fragen zu erhalten, auf jene Fragen, die wir uns früher oder später alle einmal stellen und die der Anlass für dieses Buch sind.
Unter all diesen Fragen gibt es ein paar unausweichlich wichtige.
Es handelt sich um die drei existentiellen Fragen, die die Menschheit beschäftigen, seit sie begonnen hat, logisch zu denken.
Fragen, die sich unweigerlich auf jedem der eingeschlagenen Wege stellen und daher nicht umgangen werden können.
Fragen, die es der Reihe nach zu beantworten gilt, angesichts jener Herausforderung, die Carl Rogers »Die Entwicklung der Persönlichkeit« genannt hat. Denn nur wer aufrichtig nach ihrer Beantwortung sucht, lernt all das, was für das spätere Weiterkommen unverzichtbar ist.
Mit anderen Worten, jede dieser Fragen konfrontiert uns mit der zwingenden Aufgabe, Antworten darauf zu finden. Das Bewusstsein zu schärfen für einen Prozess, der zwar oft über verschlungene und sich überschneidende Wege ablaufen mag, die sich aber immer wieder deutlich abzeichnen und in ihrer immer gleichen Abfolge begangen sein wollen.
Wer bin ich?
Wohin gehe ich?
Und mit wem?
Drei Aufgaben, drei Wege, drei Fragen, die es strikt der Reihe nach zu beantworten gilt.
Um der Versuchung zu widerstehen, dass, wer auch immer der Mensch an meiner Seite sein mag, darüber bestimmt, wohin ich gehe.
Um nicht den Fehler zu begehen, mich über den Menschen zu definieren, der mich begleitet.
Um gar nicht auf den Gedanken zu verfallen, meinen Weg mit deinem in Übereinstimmung zu bringen.
Um nicht zuzulassen, dass ich aufgrund der von mir eingeschlagenen Richtung definiert werde, und noch viel weniger, dass man mich mit diesem Teil der Wegstrecke gleichsetzt, auf der ich mich befinde.
»Immer mit dem Ersten anfangen«, pflegte mein Großvater zu sagen, und mit einem Augenzwinkern fügte er hinzu: »Das Letzte kommt nämlich erst zum Schluss.«
Und die erste Aufgabe ist es, herauszufinden, wer ich bin.
Die definitive Begegnung mit mir selbst.
Zu lernen, von niemandem abhängig zu sein.
Die zweite Aufgabe besteht darin, mich zu entscheiden, wohin ich gehe.
Die Suche nach Erfüllung und Sinn.
Unsere Bestimmung im Leben zu finden.
Und als Drittes gilt es, sich auszusuchen, mit wem.
Die Begegnung mit dem anderen und der Mut, all das zurückzulassen, was sich nicht stimmig anfühlt.
Sich der Liebe zu öffnen und die passenden Wegbegleiter zu finden.
Während eines Großteils meines Lebens habe ich mich an Aufzeichnungen orientiert, die sich andere auf ihren Reiserouten gemacht haben. Ratschläge und Weisheiten vieler Menschen, die mich wieder auf meinen Weg zurückgeführt haben, wenn ich ihn einmal aus den Augen verloren hatte. Und beinahe die gesamte restliche Zeit habe ich damit verbracht, meine eigenen zurückgelegten Wegstrecken gedanklich zu notieren.
Vielleicht können die verschiedenen Antworten, auf die ich dabei gestoßen bin, ermutigen und dem einen oder anderen nützlich sein, der – wie ich – froh ist zu erfahren, dass andere auf ganz unterschiedlichem Weg an den gleichen Ort gelangt sind. Hoffentlich sind sie auch denen dienlich, die keine Antworten suchen, sondern lieber ihre eigenen Fragen finden wollen.
Selbstverständlich geht es nicht darum, sich sklavisch an irgendein Konzept zu halten, das ich hier aufstelle. Wie jeder weiß, entspricht die Karte niemals exakt dem Gebiet, und so ist auch jeder Leser aufgerufen, den vorgeschlagenen Kurs zu korrigieren, wann immer der Autor seiner Meinung nach falschliegt.
Nur so werden wir am Schluss zueinanderfinden. Du mit deinen Antworten und ich mit meinen.
Das heißt, du hast deine Antworten gefunden.
Und ich die meinen.
Die erste Frage:
Wer bin ich?
1 Die Allegorie von der Kutsche
Eines Tages klingelt das Telefon.
Der Anruf ist für mich.
Kaum habe ich meinen Namen gesagt, da höre ich auch schon eine sehr vertraute Stimme:
»Hallo, ich bin’s. Geh mal raus auf die Straße, da wartet eine Überraschung auf dich.«
In freudiger Erwartung trete ich auf den Bürgersteig, und vor mir sehe ich das Geschenk. Eine kostbare Kutsche steht direkt vor meiner Haustür. Sie ist aus poliertem Nussbaum gefertigt, hat bronzene Verzierungen und Lampen aus weißem Porzellan, alles sehr fein, sehr elegant, sehr chic.
Ich öffne die Tür zur Kabine und steige ein. Ein großer halbrunder Sitz mit bordeauxrotem Cordbezug und weiße Spitzenvorhänge geben dem Innenraum etwas Vornehmes. Ich setze mich und merke, dass alles für mich maßgefertigt ist: auf meine Beinlänge abgestimmt, mit passender Sitzbreite und Dachhöhe … Alles ist ausgesprochen bequem, und Platz ist hier nur für mich.
Ich schaue also aus dem Fenster und betrachte »die Landschaft«: auf der einen Seite die Fassade des Hauses, in dem ich wohne, auf der anderen diejenige meines Nachbarn … Und ich sage: »Was für ein wundervolles Geschenk! Fabelhaft, so schön …« Und genieße dieses Gefühl.
Nach einer Weile fange ich an, mich zu langweilen, denn vor dem Fenster sieht man immer das Gleiche.
Ich frage mich: »Wie lang kann man sich eigentlich dieselben Sachen anschauen?« Und langsam komme ich zu dem Schluss, dass dieses Geschenk eigentlich nicht besonders viel taugt.
Lauthals beschwere ich mich darüber. Irgendwann kommt mein Nachbar vorbei, und als könnte er Gedanken lesen, sagt er:
»Merkst du denn nicht, dass an dieser Kutsche was fehlt?«
Mit dem Was-fehlt-denn-wohl-Ausdruck im Gesicht schaue ich mir die Polsterung und die Vorhänge an.
»Na, die Pferde fehlen«, sagt er, noch bevor ich überhaupt nachfragen kann.
Ach, deshalb sehe ich immer dasselbe, denke ich, darum ist es so langweilig …
»Ja, stimmt«, sage ich.
Und ich mache mich auf den Weg zum Fuhrpark und erstehe zwei kräftige, junge, schneidige Pferde. Ich spanne die Tiere vor die Kutsche, steige wieder ein und brülle von drinnen:
»Hüüaahh!!«
Die Landschaft wird phantastisch schön, außergewöhnlich, sie verwandelt sich permanent und überrascht mich immer wieder neu.
Trotzdem spüre ich schon ziemlich bald eine gewisse Vibration, und auf der einen Wagenseite entsteht ein tiefer Riss.
Die Pferde ziehen mich über die schlechtesten Pisten, sie springen über jeden Graben, holpern über Bürgersteige, bringen mich in die übelsten Gegenden.
Mir wird klar, dass ich nicht die geringste Kontrolle über die Lage habe, diese Biester zerren mich dorthin, wohin es ihnen beliebt.
Am Anfang hat mir dieses Abenteuer großen Spaß gemacht, inzwischen bin ich mir aber sicher, dass die Sache ziemlich heikel ist.
Ich bekomme es mit der Angst zu tun und stelle fest, dass auch das nicht wirklich weiterhilft.
Da sehe ich meinen Nachbarn, der ganz nah in seinem Auto vorbeifährt, und schimpfe auf ihn ein:
»Was hast du mir da eingebrockt!«
Er schreit zurück:
»Was dir fehlt, ist der Kutscher!«
»Aha!«, sage ich.
Unter größten Schwierigkeiten und nur mit seiner Hilfe gelingt es mir, die Pferde zu stoppen, und ich mache mich auf die Suche nach einem Kutscher.
Ich habe Glück. Ich finde einen.
Er ist ein zurückhaltender, zuverlässiger Mann, und aus seiner Miene lässt sich schließen, dass er vielleicht nicht gerade Spaß, dafür aber umso mehr von seinem Handwerk versteht.
Sofort tritt er seinen Dienst an.
Mir scheint, erst jetzt weiß ich mein Geschenk wirklich zu schätzen.
Ich steige in die Kutsche, mach es mir bequem, nicke mit dem Kopf und sage dem Kutscher, wo ich hin will.
Er hält die Zügel in der Hand und hat die Lage völlig unter Kontrolle. Er bestimmt die angemessene Geschwindigkeit, er wählt den besten Weg.
Während ich drinnen in der Kabine sitze … und die Fahrt genieße.
Diese kleine Allegorie aus Der Weg der Unabhängigkeit[1] veranschaulicht das ganzheitliche Konzept des Seins, wie es in dem vorliegenden Buch verstanden werden soll.
Als Produkt aus der Vereinigung zweier winziger Zellen und des Begehrens zweier Menschen sind wir vor vielen Jahren entstanden. Und noch vor der Geburt haben wir bereits das erste Geschenk erhalten: unseren Körper.
Eine Art Kutsche, maßgefertigt für jeden von uns. Ein Gefährt, das Veränderungen unterliegt, mit der Zeit gewisse Modifizierungen erlebt, aber dazu bestimmt ist, uns ein Leben lang zu begleiten.
Kaum haben wir uns aus dem Schutz des »Mutterhauses« begeben, verspürt dieser unser Körper ein Begehren, ein Bedürfnis, eine instinktive Notwendigkeit und setzt sich in Bewegung.
Der Körper ohne Wünsche, Bedürfnisse, Regungen und Affekte, die ihn zum Handeln antreiben, wäre wie eine Kutsche ohne Pferde.
Schon von den ersten Lebensstunden an haben wir durch Weinen auf beinahe tyrannische Weise die Befriedigung unserer Bedürfnisse erlangt. Wir brauchten bloß die Ärmchen auszustrecken, den Mund aufzumachen und mit einem winzigen Lächeln das Köpfchen zu heben, um ungehindert zu bekommen, was wir wollten.
Ziemlich rasch hat man jedoch die Erfahrung gemacht, dass mancher Wunsch, lässt man ihm erst einmal freien Lauf, auf ziemlich riskante, frustrierende, ja sogar gefährliche Wege führen kann. Und schon bald stellt sich die Notwendigkeit der Mäßigung ein.
Hier kommt die Figur des Kutschers ins Spiel: in Form unserer selbst, unseres Geistes, unseres Verstandes und unserer Fähigkeit, rational zu denken.
Ein tüchtiger Kutscher, der die Aufgabe hat, uns den Weg zu bahnen und vor Strecken zu bewahren, auf denen mancherlei unnötige Gefahr und übergroße Risiken lauern.
Jeder von uns vereinigt in sich jene drei Instanzen aus der Allegorie, das heißt, auf der gesamten Strecke unseres Lebensweges sind wir die Kutsche, die Pferde und der Kutscher, genauso wie wir der beförderte Fahrgast sind. Wir sind unser Körper, unsere Wünsche, Bedürfnisse und Gefühle, wir sind unser Verstand und unser Geist, genauso wie unsere spirituellen und metaphysischen Kräfte.
Und nun gilt es, all diese Elemente miteinander in Einklang zu bringen, ohne dass einer der Beteiligten vernachlässigt wird.
Den Körper seinen Impulsen, Anwandlungen oder Leidenschaften zu überlassen kann äußerst gefährlich sein. Und meist ist es das auch. Wir brauchen den Verstand, um eine gewisse Ordnung in unser Leben zu bringen.
Der Kutscher ist dazu da, den Weg und die Strecke einzuschätzen. Wer die Kutsche aber tatsächlich zieht, das sind die Pferde. Wir dürfen nicht zulassen, dass der Kutscher sie vernachlässigt. Sie müssen gefüttert und gepflegt werden, denn … Was täten wir ohne die Pferde? Was wären wir, wenn wir bloß aus Körper und Gehirn bestünden? Wenn wir ohne Begehren wären, wie sähe unser Leben dann aus? Es wäre wie das Leben von Leuten, die ohne Kontakt zu ihren Gefühlen durch die Welt gehen und ihre Kutsche allein vom Gehirn ziehen lassen.
Natürlich dürfen wir auch die Kutsche nicht vernachlässigen. Und das bedeutet, sie zu reparieren, zu pflegen, herauszufinden, was zu ihrer Instandhaltung beiträgt, denn sie muss die ganze Fahrt lang halten. Wird sie nicht ausreichend gewartet, erleidet sie Schaden, und die Reise kann ein vorzeitiges Ende nehmen.
Erst wenn ich all das verinnerlicht habe,
wenn mir bewusst ist, dass ich mein Körper bin, meine Hände, mein Herz, meine Kopfschmerzen genauso wie mein Hungergefühl,
wenn ich weiß, dass meine Gelüste, meine Wünsche und meine Instinkte genauso zu mir gehören wie meine Liebe und meine Wut,
wenn ich akzeptiere, dass ich genauso gut auch meine Überlegungen bin, mein denkender Geist und meine Erfahrungen …
Erst dann bin ich in der Lage, den für mich am besten geeigneten Weg zu begehen, das heißt ebenjenen Weg, der in diesem Augenblick für mich bestimmt ist.
2 Eltern und Kinder: Eine Verbindung im Namen von Wachstum und Auseinandersetzung
Jedes Lebewesen, vom primitivsten Einzeller bis zu den am höchsten entwickelten Tieren, hat – so verletzlich es in diesem Moment auch sein mag – bei seiner Geburt eine gewisse mehr oder weniger hohe Überlebenschance, selbst wenn zu diesem Zeitpunkt keiner seiner Elternteile in der Nähe ist, um sich um seinen Schutz und seine Nahrung zu kümmern.
Angefangen bei den Insekten, die gleich nach dem Schlüpfen absolut unabhängig sind, bis hin zu den Säugetieren, die, eine Stunde nachdem sie das Licht der Welt erblickt haben, bereits auf eigenen Beinen stehen und nach der Zitze der Mutter oder einem Ersatz dafür suchen können – ein jedes Tier kann überleben, auch wenn die Wahrscheinlichkeit nur eins zu einer Million ist.
Betrachten wir zum Beispiel die Meeresschildkröten. Bei dieser Spezies schleppen sich die Mütter unter größter Anstrengung zweihundert Meter weit an den Strand, um Hunderte von Eiern in den Dünen abzulegen, sie mit Sand zu bedecken und anschließend wieder ins Meer zurückzukriechen.
Von den frisch geschlüpften jungen Meeresschildkröten schafft es der Großteil nicht bis ins rettende Meer. Schutzlos fallen sie Vögeln und Reptilien zum Opfer, oder sie werden von der Sonne verbrannt … Doch trotz all dieser Beschwernisse überleben ein oder zwei von Tausend.
Ein Menschenkind hingegen, das während der ersten Lebensstunden gänzlich sich selbst und seinem Instinkt überlassen bleibt, hat keine Chance. Die Überlebenswahrscheinlichkeit beträgt noch nicht einmal eins zu einer Million. Ein Neugeborenes ist vollkommen abhängig.
Für diejenigen unter uns, die auch nur ein kleines bisschen von Biologie verstehen, liegt es also auf der Hand, dass ein neugeborenes Menschenkind das zerbrechlichste, abhängigste und verletzlichste Wesen der Schöpfung ist. Die Geburt stellt demnach für die Neuankömmlinge der Spezies Mensch, ganz gleich welcher Rasse, welcher Region und welcher Epoche sie auch angehören mögen, eine äußerste Bedrohung und Gefahr dar.
Als Lösung und zum Ausgleich für diese extreme Abhängigkeit der menschlichen Säuglinge hat die Natur eine besondere Art von Beziehung gestiftet, die es den Eltern fast unmöglich macht, ihre Kinder sich selbst zu überlassen. Der Instinkt oder die Liebe (ich stelle es mir lieber als Liebe vor) lässt uns diese »Welpen« als das betrachten, was sie (in biologischer Hinsicht) auch sind: ein Stück von uns selbst. Sie schutzlos zurückzulassen käme der freiwilligen Selbstverstümmelung gleich, als würde man einen Teil des eigenen Körpers verleugnen.
So schaltet sich die Natur zur Sicherung des Lebens ein. Da die Schutzlosigkeit der Neugeborenen tödlich wäre, sorgt sie dafür, dass sich instinktiv immer jemand um das verletzliche Baby kümmert, und sichert es gegen das Verlassenwerden von den Eltern ab.
Die Liebe zum eigenen Kind unterscheidet sich von der Liebe für andere. Mit einer Tochter oder einem Sohn erleben wir Dinge, die wir mit anderen Menschen niemals erleben werden. Nicht nur, dass wir sie bedingungslos lieben, wir lieben sie auch auf andere Art, wir lieben sie wie einen Teil unserer selbst, wie man seine eigene Hand liebt oder sein Augenlicht. Vielleicht sogar noch mehr …
Dieses selbstbezogene Gefühl ist wohl allen Eltern zu eigen, es wird gesteuert durch den Instinkt, der uns – ohne auch nur im Geringsten darüber nachzudenken – die Pflege und den Schutz unserer Kinder übernehmen lässt und der in gewisser Weise auch dafür gesorgt hat, dass wir sie empfangen haben. Der Arterhaltungstrieb, mehr als unser bewusster Wunsch, bestimmt unser »Bedürfnis«, Kinder zu haben, oder eben unsere Frustration im Fall von Kinderlosigkeit.
Besähe man die Sache mal nüchternen Auges, würde man feststellen, dass jemand, der vollständig zufrieden ist mit seinem Leben und dem, was er besitzt, und der nicht das dringende Bedürfnis nach Selbsterweiterung oder Selbstverwirklichung durch Vater- bzw. Mutterschaft samt Gründung einer Familie hat, womöglich keine Kinder bekommen würde.
Unser Kinderwunsch entspringt einer inneren Notwendigkeit – egal ob diese nun anerzogen oder natürlich, übernommen, instinktiv, kulturell oder persönlich ist.
Doch wie immer gibt es nichts Menschliches ohne seine Widersprüche: Dieser primitive Instinkt trägt uns neben einer gewissen Fortpflanzungsgarantie und der anschließenden Sorgepflicht für die Kinder vor allem Probleme und Konflikte ein. Ein Mann und eine Frau, die sich dafür entscheiden, eine Familie zu gründen und Kinder in die Welt zu setzen, unternehmen einen weit über sich selbst hinausreichenden Schritt. Nicht nur, dass sie eine unabweisbare Verantwortung in Hinblick auf die Zukunft auf sich nehmen, sie geraten auch, ob sie nun wollen oder nicht, in einen unlösbaren Interessenskonflikt zwischen ihren eigenen Bedürfnissen und egoistischen Anwandlungen und den Bedürfnissen des neugeborenen Kindes. Es ist schon generell nicht einfach, Gefängniswärter und Befreier in einer Person zu sein, aber als Elternteil fällt es ganz besonders schwer. Kinder werden als Erweiterung ihrer Eltern behandelt und entsprechend behütet, selbst wenn diese sich darin einig sind, dass ein Teil ihrer Aufgabe (womöglich der wichtigste in ihrer Rolle als Erzieher) darin liegt, aus ihren Sprösslingen eigenständige, unabhängige Wesen zu machen, die es auf den Moment der Trennung vorzubereiten und zu trainieren gilt.
Gleichermaßen erleben auch die Kinder die symbiotische Erfahrung mit den Eltern sowohl als Freud wie als Leid. Häufig erweisen sich eine allzu häufig erlebte emotionale Bestätigung und ein Übermaß an Zärtlichkeit im frühen Kindesalter in den späteren Lebensjahren als große Belastung.
Erziehung: Lehren und lernen
Einen hohen Anteil aller unserer im Lauf des Lebens erworbenen Kenntnisse verdanken wir der Vermittlung durch unsere Eltern.
Den Teil, den wir durch Anweisungen, Ratschläge, Empfehlungen, Belohnungen und Bestrafung erwerben, bezeichnen wir als »formale Erziehung«. Ein anderer Teil, der nonverbale, vermittelt sich über wortlose Kommunikation und spielt aufgrund der starken kindlichen Bereitschaft zur Nachahmung von Vorbildern eine große Rolle.
Und ein letzter, weder messbarer noch absehbarer Teil ist jenes Wissen, das sich von Generation zu Generation überträgt, die Informationen unseres Genmaterials mit eingeschlossen. Oft diskutiert und verwechselt mit den gesellschaftlichen und kulturellen Einflüssen, erkennen heute fast alle Verhaltensforscher die Existenz eines angeborenen Kenntnisschatzes an, der auch ein »ererbtes« Wissen über Dinge beinhaltet, die wir niemals gelernt haben. Ohne dass uns sein Ausmaß bekannt wäre, noch wie sehr diese Informationen unser menschliches Dasein bestimmen.
Auf alldem – zusätzlich zu jenen Erfahrungen, die sie durch Interaktion mit der Welt außerhalb der Familie machen, wozu ihre eigenen Lebenserfahrungen genauso gehören wie das, was sie die Lehrer oder gewisse zufällige Begebenheiten gelehrt haben – gründen die moralischen, ethischen und sozialen Strukturen unserer Kinder. Sie stehen vor der Aufgabe, unser Vermächtnis über unsere eigenen Beschränkungen hinaus weiterzuführen. Tatsächlich sind sie wie Zwerge auf den Schultern von Riesen, und deshalb können sie, obwohl sie kleiner sind, immer weiter sehen als wir. Und ihre Kinder werden, glücklicherweise, wiederum weiter sehen als sie.
In einer Welt, die sich so schwindelerregend schnell verändert, ist das viel mehr als nur ein Vorteil, es ist schlichtweg eine Überlebensvoraussetzung für die Menschheit an sich.
Ich sage immer, dass wir noch nach dem alten Schlag erzogen wurden, wo Erziehung nicht im Servieren der Fische bestand, sondern darin, dass man Kindern beibrachte, selbst zu fischen. Es ist immer noch ein schönes Bild, aber leider keine sehr gebräuchliche Praxis mehr.
Wenn ich meinen Kindern eine Angelrute schenke und ihnen das Fischen beibringe, mag es ihnen vielleicht für den Moment nützlich sein (oder auch nicht), aber meine Lehre ist schnell überholt, und das Werkzeug – welches auch immer – ist bald veraltet. Womöglich angelt man, wenn sie erwachsen sind, mit einer solchen Rute, in deren Gebrauch ich sie unterwiesen habe, keinen einzigen Fisch mehr. Und wenn ich ihnen sonst nichts beibringe, gebe ich sie sehr wahrscheinlich dem Verhungern preis.
Heute besteht die neue Aufgabe der Eltern darin, den Kindern beizubringen, ihr eigenes Werkzeug herzustellen. Sie zu befähigen, ihre eigenen Angelruten zu bauen, das eigene Netz knüpfen und ihr eigenes Fischfangkonzept entwickeln zu können. Dazu muss man sich als Allererstes bescheiden eingestehen, dass es völlig unzureichend ist und ihnen womöglich niemals nützen wird, wenn man ihnen beibringt, wie man selbst die Fische fängt.
Diese elterliche Unzulänglichkeit, Kindern beizubringen, wie sie die auf sie zukommenden Probleme bewältigen können, hat sich im 20. Jahrhundert immer mehr verstärkt. Mitverantwortlich hierfür ist ein Phänomen, das die Wissenschaftler seit längerem beobachten: die Tatsache, dass sich das Wissen der Menschheit weltweit immer schneller verdoppelt. Diese zunehmende Beschleunigung ist – neben anderen Dingen – ausschlaggebend für einen großen Teil der Verschlechterung und des Prestigeverlusts des Eltern-Kind-Verhältnisses. Und die künftigen Aussichten stehen nicht gerade unter dem Zeichen der Verlangsamung.
Beschützende Eltern. Rebellische Kinder
Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts existierte die praktische Psychologie im Grunde nicht als eigenständige Wissenschaft.
Ihr Wirkungsfeld beschränkte sich auf die Beantwortung menschlicher Grundfragen, die Erklärung neurologischer Vorgänge rund um das Thema Wahrnehmung oder Gedächtnis und auf einige wenige andere Dinge. Mit der Entwicklung des Menschen befasste sich die Pädagogik, die Erziehungslehre.
Auf einem französischen Kongress zum Thema Pädagogik und Ehe im Jahr 1894 wurden unter anderem die folgenden Schlussfolgerungen gezogen:
In den für Familie und Ehe so schwierigen Zeiten unseres Jahrhunderts (des 19.) neigen Ehepaare mit Kindern zu derart übergroßer Unsicherheit und Zukunftsängsten, dass sie ihre Kinder unter allen Umständen vor jeglichen Problemen zu bewahren trachten. Es ist jedoch notwendig, auf die Gefahren solchen Verhaltens hinzuweisen, denn tun die Eltern dies allzu eifrig, so werden die Kinder niemals lernen, ihre Probleme selbst zu lösen.
Sollte es nicht gelingen, dieses Verhalten einzudämmen, werden wir Ende des 20. Jahrhunderts Millionen Erwachsene haben, die zwar über wunderbare Kindheits- und Jugenderinnerungen verfügen, aber eine schmerzliche Gegenwart erleben und in der Zukunft häufig die Erfahrung des Scheiterns machen werden.
Diese mehr als hundert Jahre alte Prognose überrascht uns heute durch ihre Treffsicherheit.
Wir Eltern, vor allem diejenigen unter uns, die selbst aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts stammen, haben ein eher entmündigendes als behütendes Verhalten unseren Kindern gegenüber entwickelt, eins, das stärker von Angst geprägt ist als von Beschützerinstinkt. Anstatt unsere Kinder zu befähigen, ihre Konflikte und Schwierigkeiten selbst lösen zu lernen, haben wir uns vor allem darum bemüht, ihnen eine unbeschwerte und sorglose Kindheit zu bescheren. Anstatt sie für die Lösung ihrer eigenen Probleme auszurüsten, haben wir sie regelrecht daran gehindert.
Stattdessen und möglicherweise im Ausgleich dafür haben wir – die heute über Fünfzigjährigen –, jenseits unserer eigenen Defizite und Beschränkungen, vielleicht ein einziges, aber nicht unwesentliches Verdienst – wir haben unsren Kindern etwas Neuartiges zugestanden:
die Erlaubnis zu rebellieren.
Erinnern wir uns daran, dass die meisten von uns aus Familienverhältnissen stammen, in denen Rebellion verboten war.
Sobald ihnen die Argumente zur Rechtfertigung ihrer seltsamen Ansichten ausgingen, haben selbst die liebevollsten und zärtlichsten unter unseren Eltern mit einer gewissen Bestimmtheit gesagt: »Ihr Rotzlöffel haltet den Mund«; und nach der unvermeidlichen Pause kam der Satz, den sie schon von ihren Eltern kannten: »Solange du die Füße unter meinen Tisch stellst, bestimme ich, wo’s langgeht.«
Ganz anders meine Kinder: Noch bevor sie »Papa« sagen konnten, haben sie das Wörtchen »Warum?« gelernt.
Meine Kinder wie auch die meiner Altersgenossen haben permanent alles hinterfragt … Und sie tun es immer noch.
Wir haben ihnen diesen Rebellionsgeist beigebracht, der sie vor uns rettet, vor allem vor der bereits beschriebenen Manie, ihnen eine anachronistische Weltsicht aufzwängen zu wollen.
Das ist unser großer Beitrag, vielleicht der einzige, den wir in unserer Generation haben leisten können – was vielleicht gar nicht mal so wenig ist, wenn man bedenkt, dass man damit die Welt verändern kann.
Ein klein wenig Theorie: die drei Drittel
Rebellionsgeist hin oder her, irgendwann wird einem klar, dass man nicht ewig eine Mutter haben wird, die einem Essen macht, einen Vater, der auf einen aufpasst, einen Menschen, der die Entscheidungen für einen trifft … Dann bleibt einem nichts anderes übrig, als sich um sich selbst zu kümmern. Und das Nest zu verlassen … Man muss sich von seinen Eltern lösen und aus dem Haus begeben, diesen Hort der Sicherheit und des Aufgehobenseins.
Häufig stellt sich die Frage, zu welchem Zeitpunkt das geschehen wird. Die Antwort ist eindeutig, auch wenn sie vielleicht nicht viel zur Klärung beiträgt: am Ende der Adoleszenz. Damit wandelt sich die Frage, und oft hört man aus Elternmund: »Und wann ist die Adoleszenz zu Ende? In welchem Alter ist sie abgeschlossen?«
Als wir Kinder waren, begann die Adoleszenz mehr oder weniger mit dreizehn Jahren und endete mit zweiundzwanzig. Heute, zu Beginn des 21. Jahrhunderts, beginnt sie häufig bereits im Alter von zehn Jahren und kann sich hinziehen bis ins fünfundzwanzigste, sechsundzwanzigste oder siebenundzwanzigste Lebensjahr. Auch wenn die Adoleszenz in mancherlei Hinsicht ein wunderbarer Zeitraum ist – unter einem anderen Gesichtspunkt ist sie eine große Leidensphase, und fünfzehn Jahre Adoleszenz sind beim besten Willen genug …
Über das Mysterium der verlängerten Adoleszenz hat inzwischen jeder Idiot seine eigene Theorie.
Auch ich habe eine.
Und von der werde ich jetzt erzählen. Vor allem, weil ich weiß, dass so mancher Schlaukopf selbst aus der idiotischsten Idee noch erhellende Schlüsse zu ziehen weiß.
Stellen wir uns einmal vor, jeder von uns erhält ein verwaistes Stück Brachland. Es stehen zwar Wasser, Dünger und Werkzeug zur Verfügung, aber kein Buch oder kein weiser Alter, das oder der uns zu sagen wüsste, was zu tun ist. Wir bekommen Saatgut zum Anbauen und die Anweisung: »Von dem, was der Boden abwirft, müsst ihr leben.«
Wie also gehen wir vor, um uns und unsere Lieben ernähren zu können?
Natürlich werden wir zuerst einmal jäten, den Boden bereiten, ihn umgraben, die Erde rechen … und dann Saatfurchen ziehen.
Anschließend säen wir aus und warten … Und kümmern uns sorgsam um alles … Stellen Rankhilfen auf, damit die Pflänzchen daran hochwachsen können, hegen sie. Am Ende, sollte unsere Arbeit Früchte tragen, kommt gewiss der Moment, an dem wir einen Teil unserer Saat ernten können.
Ich sehe eine bemerkenswerte Parallele zwischen der Aufgabe, unser eigenes Leben zu meistern, und der, Land urbar zu machen.
Spinnt man einmal den Gedanken weiter, den mein Freund und Kollege Enrique Mariscal in seinem wunderbaren Handbuch des menschlichen Gärtnerns[2] angelegt hat, so lässt sich das menschliche Dasein in drei große Phasen unterteilen, die jeweils ein Drittel der Lebenszeit ausmachen:
Ein Drittel zur Bereitung des Bodens.
Ein Drittel für Aussaat, Keimen und Wachstum.
Ein Drittel für die Pflege der Frucht und das Einbringen der Ernte.
Schauen wir uns die drei Phasen einmal genauer an.
Die erste Phase entspricht unserer Kindheit und Adoleszenz. In dieser Periode stehen das Lernen und das Bereiten des Bodens an, Unkraut jäten, umgraben, düngen, alles vorbereiten für den Zeitpunkt der Saat.
In der ersten Phase gehört es zu den Hauptaufgaben der Psyche, die körperliche und geistige Entwicklung während des Wachstums zu begleiten und die Stabilität und Sicherheit zu schaffen, die man im Umgang mit sich selbst und der Welt benötigt. Es ist die Zeit, in der sich unsere »Identität« ausbildet, ein Konzept, das C. G. Jung ironisch als die Summe all dessen definiert hat, was uns in Wahrheit nicht ausmacht, mit dem wir uns aber ständig produzieren, um uns und andere glauben zu machen, wir wären so.
Bevor er sein eigenes Leben beginnen kann, muss der Jugendliche das Zutrauen entwickeln, dass er den Mut und die Kraft findet, mit dem Alten zu brechen.
Was für ein Fehler, schon säen zu wollen, bevor der Boden entsprechend bereitet ist! Es wäre dumm, bereits in dieser Phase ernten zu wollen. Man würde sich nur aus einem Haufen Müll die Saatreste anderer zusammenklauben. Eine Ernte, bei der überhaupt nichts Gutes oder Nahrhaftes herauskommen kann.
Die zweite Phase steht für die Zeit der Jugend und das Erwachsenenalter. Es geht ums Wachsen. Die Zeit ist reif, den Samen einzupflanzen, zu begießen, zu hegen und ihm beim Wachsen zuzuschauen. Wir befinden uns in der Periode der Saat, der Entfaltung, des Aus-sich-Herausgehens. Dies ist die Phase, in der man sich als Person verwirklicht, auch wenn das oft bedeutet, sich unhinterfragt in gesellschaftliche oder kulturelle Muster zu fügen.
Was für ein Fehler, sich weiter mit der Bereitung des Bodens aufzuhalten, wenn es schon längst an der Zeit wäre, mit der Saat zu beginnen! Was für ein Fehler, bereits ernten zu wollen, was noch nicht gesät ist. Alles zu seiner Zeit.
Die letzte Phase ist die der Reife. Die Zeit der Ernte.
Der Moment, da man sich der eigenen Taten bewusst wird und sich ihrer erfreut. Die Zeit, da einem die Endlichkeit vor Augen liegt und man verantwortungsbewusster, hingebungsvoller und mit größerem Weitblick handelt.
Es wäre ein großer Fehler, zum Zeitpunkt der Ernte noch umgraben, weiter aussähen oder gießen und anbauen zu wollen, um das Feld jetzt noch zu vergrößern! Und es wäre ein Fehler, statt sich an der Ernte zu erfreuen, weiter zu säen! Wenn die Ernte reif ist, bleibt nichts weiter zu tun, als die Früchte einzubringen. Denn versäumt man den richtigen Zeitpunkt, dann war’s das womöglich für immer.
Natürlich hängt es von der jeweils maßgeblichen menschlichen Lebenserwartung ab, wie lang jedes dieser Drittel dauert.
Zur Zeit unserer Vorfahren lag die durchschnittliche Lebenserwartung bei fünfunddreißig bis vierzig Jahren, und das erste Drittel dauerte etwa zwölf oder dreizehn Jahre (weshalb die Bar-Mizwa der Juden, die Konfirmation der Protestanten und die Beschneidung der Muslime ungefähr für dieses Alter vorgesehen sind). In diesem Alter endete das erste Lebensdrittel und damit auch die Adoleszenz. Das Individuum hatte den Boden bereitet und trat ins Erwachsenenalter ein. Die zarte Blüte der Jugend dauerte also maximal bis zum fünfzehnten Lebensjahr, und bis zum achtundzwanzigsten oder dreißigsten Lebensjahr hatte man das Erwachsenenalter durchlebt.
Von diesem Zeitpunkt an befanden sich unsere Großeltern und deren Großeltern bereits im gereiften Lebensalter. Die Frauen bekamen keine Kinder mehr, und den Männern blieb nichts anderes mehr zu tun, als bereitwillig auf ihren Tod zu warten.
Als dann zu Anfang des 20. Jahrhunderts die Generation meiner Eltern geboren wurde, lag die Lebenserwartung bereits bei sechzig Jahren. Weshalb sich die Adoleszenz zu verlängern begann. Mit zwanzig galt man bei uns als volljährig, und mit sechzig ging man in den Ruhestand (was rein statistisch gesehen mit dem Ende der Adoleszenz und dem Abschluß des aktiven Lebensalters zusammenfiel).
Mehr Details braucht es wohl nicht, um zu verstehen, dass man bei einem heutigen Durchschnittsalter von achtundsiebzig oder mehr Jahren vernünftigerweise nicht davon ausgehen sollte, dass die Adoleszenz bereits vor dem fünfundzwanzigsten oder sechsundzwanzigsten Lebensjahr abgeschlossen ist. Offenbar richtet sich das Erwachsensein nicht nach dem, was im Personalausweis steht oder was das Gesetz bestimmt. Die Adoleszenz endet, sobald man lernt, definitiv für sich selbst geradezustehen und somit die Verantwortung für das eigene Leben und die eigene Zukunft zu übernehmen. Wer die Adoleszenz erfolgreich hinter sich gebracht hat, ist in der Lage, seinen Eltern offen und ohne einen Funken Ironie oder Rache ins Gesicht zu sagen: »Von jetzt an könnt ihr euch wieder um euer eigenes Leben kümmern, denn mein Leben nehme ich ab heute selbst in die Hand.«
Die Kinder freilassen
In meinen mehr als dreißig Jahren als Therapeut habe ich mich Hunderte von Malen mit Kindern unterhalten, die sich nicht ablösen konnten, jungen Männern und Frauen, die an ihre Eltern gekettet blieben und nicht den Mut hatten, unter ihrem schützenden Flügel hervorzukriechen, um ihr eigenes Leben zu leben. In der Mehrzahl der Fälle, das muss ich hier deutlich machen, ist die Ursache hierfür eher bei den Eltern zu suchen, die es aus Unerfahrenheit, Angst oder aufgrund ihrer eigenen Neurosen versäumt oder absichtlich unterbunden haben, ihre Kinder auf den Abflug vorzubereiten.
Ein Mann aus Jalisco, Mexiko, hat mir folgende Geschichte erzählt, die in manchem einer anderen Geschichte ähnelt, die mir über eine Leserin aus der Provinz Catamarca in Argentinien zugetragen wurde.
Eines Nachmittags fand ein Bauer im hinteren Teil seines Gartens ein sehr großes gesprenkeltes Ei. Ein solches Ei hatte er noch nie zuvor gesehen.
Überrascht und voller Neugier trug er es ins Haus.
»Könnte das nicht ein Straußenei sein?«, fragte ihn seine Frau.
»Das hätte eine andere Form«, sagte der Großvater, »dafür ist es viel zu riesig.«
»Können wir’s essen?«, fragte der Sohn.
»Nicht, solange wir nicht wissen, ob es giftig ist …«, überlegte der Bauer. »Erst müssen wir herausfinden, was für ein Tier solche Eier legt.«
»Wir könnten es doch der Gans ins Nest legen, die brütet sowieso gerade«, schlug die jüngste Tochter vor, »sobald es dann ausgeschlüpft ist, sehen wir ja, was es ist …«
Alle waren einverstanden, und so wurde es gemacht. Doch irgendwann hatte jeder im Haus das arme Ei vergessen.
Nach zwei oder drei Wochen sprang die Schale auf, und ein dunkler großer, nervöser Vogel schlüpfte heraus, der gierig nach allem Fressbaren in seiner Umgebung pickte.
Als er alles vertilgt hatte, sah der seltsame Vogel die Gans auffordernd an und sagte erwartungsvoll zu ihr:
»Gehen wir jetzt jagen?«
»Jagen, wie denn?«, fragte die Gänsemutter ein wenig erschrocken.
»Wieso denn wie?«, wunderte sich der Kleine. »Na, im Fluge natürlich. Also, fliegen wir los!«
Die Gänsemutter war sehr überrascht über den Vorschlag ihres frisch geschlüpften Zöglings, und mit engelsgleicher Geduld erklärte sie ihm:
»Schau, mein Kind, Gänse fliegen nicht. Auf solche Schnapsideen kommst auch nur du, weil du so verfressen bist. Man soll nicht so schlingen und sich vor allem nicht so den Ranzen vollschlagen.«
Von der Mutter über die aberwitzigen Gelüste des jüngsten Sprosses informiert, achtete die Gänsefamilie von nun an darauf, dass das neue Gänsekind nicht so viel und vor allem nicht so schnell fraß. Sie fütterten es mit leichterer Kost und ermahnten es, langsamer zu essen und mehr Pausen einzulegen.
Und dennoch, sofort nach dem Mittag- oder Abendessen und gleich nach jedem Frühstück und jeder Vesper rief das Gänslein unweigerlich:
»Also, Leute, fliegen wir jetzt eine Runde?«
Alle Gänse auf dem Hof mussten ihm ein ums andere Mal erklären:
»Kapierst du nicht, dass Gänse nicht fliegen? Kaue gut, friss mit Maßen und schlag dir diese Dummheiten aus dem Kopf, sonst wird es noch einmal böse enden.«
Die Zeit verging, und das Gänslein wuchs heran, beklagte sich zunehmend über Hunger und erwähnte kaum mehr das Fliegen.
Als das Küken ganz ausgewachsen war, wurde es zusammen mit den anderen Gänsen des Hofs geschlachtet und endete als Weihnachtsbraten auf dem Tisch der Bauernfamilie.
Aber niemand mochte sein Fleisch, es war zäh und schmeckte nicht nach Gans.
Und das war nur folgerichtig, denn das Küken war gar keine Gans, es war ein Adler, ein Bergadler, der sich dreitausend Meter hoch in die Lüfte erheben und ein kleines Ei in den Klauen tragen konnte …
Doch er starb, ohne das jemals zu erfahren … Denn niemand ermutigte ihn dazu, seine Schwingen auszubreiten … Niemand hatte ihm je gesagt, dass er eigentlich ein Adler war!
Normalerweise begreifen es die Kinder und gehen von allein …
Tun sie das aber nicht, müssen wir sie leider – zu ihrem und zu unserem Besten – dazu drängen, sich aus ihrer Abhängigkeit zu befreien.
Wir Eltern müssen uns darüber im Klaren sein, dass es im Zweifelsfall unsere Aufgabe ist, unsere Kinder zum Absprung und Losfliegen zu animieren. Unter anderem deshalb, weil wir selbst ja nicht ewig für sie da sein können.
Sollten sich die Kinder trotz unserer Ermunterung und Bemühung nicht auf ihre eigenen Füße stellen wollen, müssen wir Eltern ihnen mit viel Liebe und unendlicher Zärtlichkeit die Tür weisen … Und sie mit einem kräftigen Tritt hinausbefördern!
Ich halte es kaum aus, wenn ich Eltern sehe oder höre, die sich ihr ganzes Leben lang abgemüht haben, um ein paar dürftige Ersparnisse oder ein kleines Sicherheitspolster fürs Alter beiseitelegen zu können, und dies nun an ihre verkorksten, undankbaren und nichtsnutzigen Kinder vergeuden müssen, von denen häufig die unglaublichsten Ansprüche kommen wie: »Du musst mich unterstützen, du bist ja mein Vater …«, »Hilf mir und verkaufe, was du hast, es gehört ja sowieso alles auch mir …«
Natürlich kann man seinen Kindern gelegentlich unter die Arme greifen, wenn man das will, und das ist sicherlich auch gut so. Aber wir Eltern müssen auch einsehen, dass unsere Pflicht und Verantwortung ihnen gegenüber irgendwann ein Ende hat. Es ist an der Zeit, die Grenzen der Vater- oder Mutterrolle anzuerkennen.
Es ist so wichtig, unseren Kindern den Schritt in die Freiheit zu ermöglichen …
Es ist so wichtig, sie zu beschützen und zu erwachsenen Menschen zu erziehen …
Und danach? Wenn sie erst einmal bis dahin gekommen sind?
Dann schlage ich die Philosophie des DSSK vor.
Was DSSK heißt?
Na, dass sie selbst klarkommen … So gut sie können.
Und wenn sie mit ihrem Erbteil nicht umgehen können?
Und wenn sie nicht mit dem auskommen, was sie verdienen?
Und wenn sie nicht wissen, wie sie von ihrem Einkommen ihre Kinder ernähren sollen?
Dann gilt, was Brozo, der sarkastische mexikanische Clown, immer sagt: »Das ist aber jammerschade, Margarito …«
Natürlich will niemand, dass die eigenen Kinder Hunger leiden … Und ich habe auch vollstes Verständnis für das Angebot, dass sie sich eine gewisse Zeit lang jeden Morgen ein Frühstücksbrot abholen können … Aber eben nur eine gewisse Zeit!
Ich halte dieses künstlich aufrechterhaltene Abhängigkeitsverhältnis für schädlich und für alles andere als einen Akt der Liebe. Es gibt einen Zeitpunkt, da bedeutet Liebe, den Kindern die Verantwortung für ihr eigenes Leben zu übergeben. Und danach müssen wir uns raushalten und nur dann helfen, wenn und wie wir es wollen und nur solange es uns in den Kram passt. Und das heißt, niemals mehr Hilfe anzubieten, als man tatsächlich auch zu geben vermag, und sich keinesfalls das Leben zu ruinieren, bloß um ihnen aus der Patsche zu helfen.
Mich selbst und alle Eltern, die ich kenne, würde es glücklich machen zu wissen, dass meine Kinder allein zurechtkommen, sollte ich einmal nicht mehr sein.
Und deshalb wünsche ich mir, dass sie es auch vor meinem Tod bereits tun.
Damit ich es noch erleben kann.
Damit ich zumindest in Ruhe sterben kann, mit dem Gefühl, meine Aufgabe erledigt zu haben.
3 Die Abhängigkeit
Haben wir die Adoleszenz erst einmal hinter uns gebracht und ist der Boden bereitet, dann wäre es wünschenswert und richtig, wenn wir uns allmählich um die Aussaat kümmern würden und die Früchte gedeihen ließen, die wir später einmal ernten wollen.
Im Begriff »abhängig« ist das Wort »hängen« enthalten, was auch »hängend« und »aufgehängt« impliziert; nämlich, herab- und in der Luft baumelnd, ohne Boden unter den Füßen. Außerdem bedeutet es »unselbständig«, »angewiesen«. Substantivisch gebraucht, bedeutet »Abhang« eine Ausrichtung nach unten, ein Gefälle, etwas steil Abschüssiges und vermutlich Gefährliches.
Bei all diesen Eintragungen im Wörterbuch finde ich es nicht verwunderlich, dass das Wort »Abhängigkeit« solch seltsame Assoziationen in uns hervorruft: Abhängig ist jemand, der sich an jemand anderen anhängt, der in der Luft hängt, haltlos, ohne eigenes Fundament, ein »Anhang« oder »Anhänger«, somit ein Schmuck, getragen von jemand anderem. »Abhängig« ist jemand, der nach unten zieht, sich allein unvollständig fühlt und daher immer auf jemanden angewiesen ist.