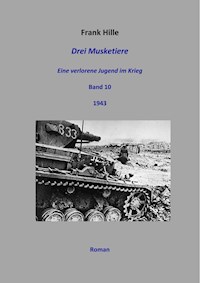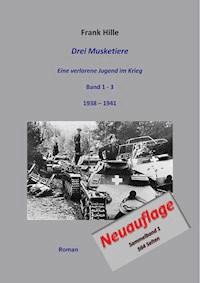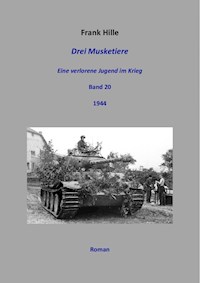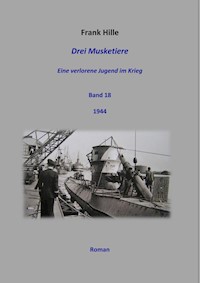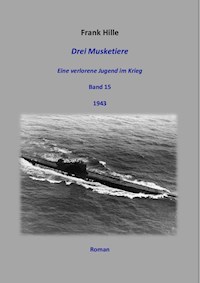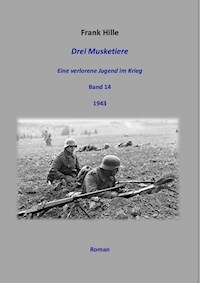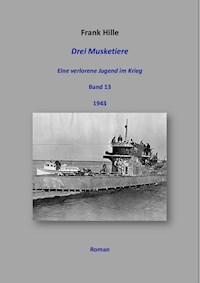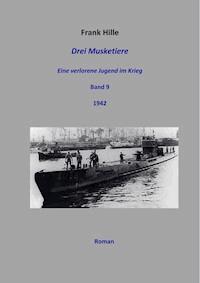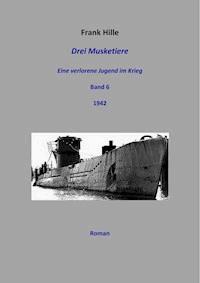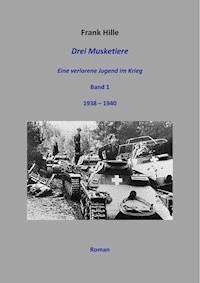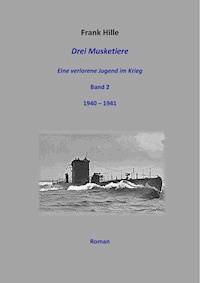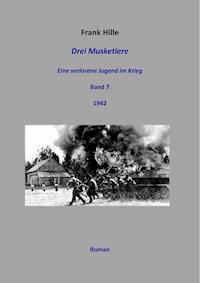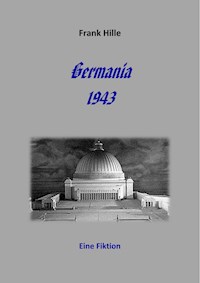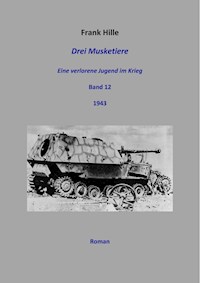
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Am 5. Juli 1943 beginnen die deutschen Truppen im Gebiet zwischen Orel und Belgorod an der Ostfront das Unternehmen "Zitadelle". Operatives Ziel ist es, den fast 150 Kilometer nach Westen ausbauchenden Frontvorsprung der russischen Truppen zwischen diesen Städten durch eine weitausholende Zangenbewegung abzuschneiden, die gegnerischen Truppen einzuschließen, zu vernichten, und dann das östlich liegende Kursk einzunehmen. Während die deutsche Nordgruppe bei Orel bald in einem von den Sowjets festungsartig ausgebauten Verteidigungssystem steckenbleibt, kommt die Südgruppe besser voran. Dort sind 200 Panzer V "Panther" erstmalig in einem Großkampf im Einsatz. Zusammen mit den anderen gepanzerten Verbänden, die vor allem aus kampfwertgesteigerten Panzern IV der Ausführungen G und H bestehen, durchdringen die deutschen Truppen recht zügig die drei sowjetischen Armee-Verteidigungsstreifen. Am 12. Juli 1943 kommt es dann bei Prochorowka zu einer Massierung von Panzerkräften beider Seiten und zu einer Vielzahl heftiger Gefechte. Im Ergebnis dieser Auseinandersetzung verlieren die Russen eine enorme Anzahl an gepanzerten Fahrzeugen. Die immer noch kampfstarken und erfolgreichen deutschen Einheiten bereiten sich im Süden nun für den endgültigen Raid auf Kursk vor. Am 16. Juli 1943 befiehlt Hitler allerdings den Abbruch von "Zitadelle" mit der Begründung, der Landung der Alliierten auf Sizilien mit der Verlegung von Truppen der Ostfront nach Italien begegnen zu müssen. Nichts dergleichen geschieht jedoch in der nächsten Zeit. Vielmehr hat die deutsche Führung alle Mühe, die von den Russen im Norden begonnene Offensive "Kutusow" zur Wiedereroberung von Orel abzufangen. Martin Haberkorn hat in Hamburg ein neues Boot übernommen und führt bei der AGRU in Hela Übungsfahrten zur Fronttauglichkeitsmachung durch. Die Fähigkeiten der unerfahrenen Besatzung bereiten ihm allerdings große Sorgen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 146
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Impressum
Drei Musketiere
Eine verlorene Jugend im Krieg
Band 12
1943
Copyright: © 2017 Frank Hille
Published by: epubli GmbH, Berlin
www. epubli.de
Martin Haberkorn, 8. Juli 1943, Hamburg
Günther Weber, 7. Juli 1943, vor Orel
Fred Beyer, 7. Juli 1943, bei Belgorod
Martin Haberkorn, 7. Juli 1943, bei Hamburg
Fred Beyer, 7. Juli 1943, bei Belgorod
Günther Weber, 8. Juli 1943, vor Orel
Martin Haberkorn, 10. Juli 1943, Hela
Fred Beyer, 11. Juli 1943, vor Prochorowka
Günther Weber, 11. Juli 1943, bei Orel
Martin Haberkorn, 11. Juli 1943, Hela
Fred Beyer, 11. und 12. Juli 1943, Prochorowka
Günther Weber, 12. Juli 1943, bei Orel
Martin Haberkorn, 12. Juli 1943, Hela
Fred Beyer, 12. Juli 1943, Prochorowka
Günther Weber, 17. Juli 1943, bei Orel
Martin Haberkorn, 20. Juli 1943, Hela
Fred Beyer, 20. Juli 1943, Prochorowka
Günther Weber, 21. Juli 1943, bei Orel
Martin Haberkorn, 27. Juli 1943, bei Island
Fred Beyer, 27. Juli 1943, bei Slawjansk
Martin Haberkorn, 8. Juli 1943, Hamburg
Als er immer noch total benommen, mit dröhnendem Kopf, zitternden Beinen und vollkommen mit Ziegel- und Betontaub bedeckt über die von den Feuerwehrleuten und Hitlerjungen freigelegte enge Stelle an der Kellerwand über Betonbrocken nach oben gestiegen war, fiel Martin Haberkorn nach wenigen Schritten mit den Knien auf den Boden. Er stützte sich mit den Händen ab und hatte Mühe nicht umzufallen. Keineswegs war es eine schwere körperliche Anstrengung gewesen die ihn so erschöpft hatte, aber er war mit den anderen Überlebenden des Bombenangriffes in dem Keller eine für sie unendlich erscheinende Zeit verschüttet gewesen und die Befürchtung, daraus nicht mehr lebend entkommen zu können, hatte seine Nerven bis aufs Äußerste zerrüttet. Haberkorn nahm trotz seines Zustandes wahr, dass um ihn herum nur noch Ruinen standen, Brände flackerten und Rauchwolken über die Stadt zogen. Ringsum heulten immer noch Sirenen der Feuerwehr oder von Sanitätsfahrzeugen. Im nahegelegenen Hafenbecken kurvte ein Schlepper zwischen aus dem Wasser ragenden Aufbauten von versenkten Schiffen umher und versuchte offensichtlich vorsichtig aus dem nunmehr größtenteils unbefahrbaren Gebiet herauszukommen. Nach dem krachenden Inferno des Luftangriffes war es jetzt fast unnatürlich still und lediglich die Rufe der Rettungsmannschaften waren in der Nähe zu vernehmen.
„Vergiss es“ hörte er deutlich „die kannste nur noch mit ner Grabegabel und Schaufeln rausholn. Weißt doch sowieso nich, wer wer is, sind doch alle total zusammengebackn. Das war n Ausbläser. Is durch das ganze Haus durchgerauscht und dann im Keller nich explodiert, sondern der Sprengstoff is nur schnell abgefackelt. Jedenfalls ham die armen Schweine davon nich mehr viel gemerkt. Los, weiter zum nächsten Keller, hat doch keinen Sinn mehr hier.“
Martin Haberkorn hatte sich auf den Boden gesetzt und mit dem Rücken gegen ein noch intaktes Mauerstück gelehnt. Der Obersteuermann saß wie schon im Keller wieder neben ihm und starrte wortlos und mit leerem Blick in die Gegend. Beide Männer tröstete etwas, dass sie sich keine Sorgen um ihre Familien oder Angehörigen machen mussten, die Frau und die Kinder des Obersteuermanns lebten in Kiel, und Marie war in Frankreich weit weg. Haberkorn war dennoch erschüttert, mit welcher Brutalität Krieg gegen Frauen und Kinder geführt wurde. Auf den Gedanken, dass deutsche Bomber lange vor den britischen Bombardements englische Städte angegriffen und ebenfalls vor allem die Zivilbevölkerung terrorisiert hatten kam er in diesem Moment nicht, zu groß war sein Entsetzen gewesen und sollte sich unauslöschlich in seine Erinnerungen einbrennen. Bis vor wenigen Stunden hatte er noch geglaubt, dass eine lange Wasserbombenverfolgung das Höchstmaß an nervlicher Anspannung und Todesangst wäre, jetzt aber wusste er, dass dieses Grauen noch Steigerungen erfahren konnte. Es war vor allem die Gewissheit gewesen, der Bedrohung aus der Luft vollkommen ausgeliefert zu sein und sich nicht einmal mit den blanken Händen dagegen wehren zu können. Dass die Menschen in den nur notdürftig geschützten Luftschutzkellern bei der Abwehr des Angriffes so scheinbar allein gelassen worden waren bestürzte ihn, aber er wusste natürlich, dass es nicht so war. Rings um die Stadt waren schwere Luftabwehrbatterien mit den gewaltigen 8,8-Zentimeter Flakgeschützen stationiert, die von als Flakhelfern eingesetzten Hitlerjungen bedient wurden. Keineswegs waren diese jungen Männer schlechtere Kanoniere als die wenigen dort dienenden älteren Männer, vielfach war sogar das Gegenteil der Fall. Haberkorn war inzwischen durch seine eigenen Kriegserlebnisse von einem nahezu kritiklosen und begeisterungsfähigen jungen Mann zu Beginn seines Dienstes in der Marine zu einem erfahrenen Soldaten gereift, der die Dinge nicht mehr mit dem verklärten Blick der Jugend und deren Lust auf Abenteuer sah, sondern seine eigenen Schlüsse ziehen konnte. Als er anfangs als Dieselheizer auf einem VII C-Typ eingestiegen war hatte ihn die scheinbar willkürlich angeordnete Technik an Bord des Bootes heillos verwirrt. Erst nach und nach war ihm aufgegangen, was für ein kompliziertes System so ein U-Boot darstellte und dass das auf den ersten Blick planlose Durcheinander der technischen Apparaturen einem wohldurchdachten, aber durch verschiedene Zwänge bedingtem Plan folgte. Der Spagat zwischen der unbedingten militärischen und damit vorrangigen Zweckerfüllung dieser riesigen Maschine und den Anforderungen an ordentliche Lebensbedingungen der Besatzung konnte den Konstrukteuren gar nicht gelingen, und Komfort war auch nicht unbedingt gewollt, das war ihm schnell klar geworden. Ganz ähnlich wie in einem Panzer waren die Männer in einer Stahlhülle eingeschlossen aber der Unterschied war eben der, dass sie in Phasen ohne Bedrohungslagen nicht einfach ihre Zelte an der frischen Luft aufschlagen konnten, sondern fast ununterbrochen im eigenen Mief, Dieselgestank, unter künstlichem Licht, vorrangig von Konservennahrung und in einem ungesunden Rhythmus der Wachwechsel leben mussten. Sein Freund Fred Beyer hatte ihm in den letzten Briefen geradezu begeistert von seinem neuen Panzer, einem „Panther“, berichtet. Haberkorn als Techniker hatte schon seit einiger Zeit erkannt, dass der deutsche Generalstab im Vertrauen auf die absolute Überlegenheit der eigenen Waffen grundlegende Neukonstruktionen oder echte Weiterentwicklungen nicht für notwendig erachtet hatte. Man ging davon aus, dass die fast alle schon Mitte der 30iger Jahre entstandenen – und damals führenden Rüstungsprodukte – bei Weitem ausreichen würden, die potentiellen Gegner in schnellen Waffengängen zu besiegen. Dass diese Rechnung nicht aufgegangen war konnte er auch in Bezug auf die deutschen U-Boote feststellen. Haberkorn hatte sich in den furchtbar angstaufgeladenen Stunden in dem verschütteten Keller Flugzeuge gewünscht, die auch bei Nacht erfolgreich gegen die Bomber vorgehen konnten. Er wusste nicht, dass es diese Muster bereits gab. In der Nacht vom 11. auf den 12. Juni 1943 hatte der erste Fronteinsatz einer Heinkel He 129 „Uhu“ stattgefunden. Dieser mit einem Bordradar FuG 212 Lichtenstein C-1 ausgerüstete und speziell für die Nachtjagd konzipierte zweimotorige Jäger hatte innerhalb kurzer Zeit 5 schwere britische Avro Lancaster Bomber abschießen können. Dass diese modernen Flugzeuge erst jetzt eingesetzt werden konnten war allgemein symptomatisch für den der Entwicklung nachhinkenden technischen Ausrüstungsstand aller deutschen Teilstreitkräfte.
„Da sind wir ja gerade noch mal mit viel Glück klargeslippt“ sagte Haberkorn leise zum Obersteuermann.
„Kann man wohl so sagen, Herr Oberleutnant. Andere haben nicht so viel Dusel wie wir gehabt.“
Haberkorn folgte seinem Blick. Direkt auf ein von Trümmern freies Stück der Straße und neben der zerstörten Häuserzeile hatten die Retter geborgene Leichen aus den freigelegten Luftschutzräumen gelegt. In den Ruinen brannten die noch erhaltenen Obergeschosse aus, durch die durch die Bombenexplosionen weggefegten Fassaden konnte man in die Zimmer hineinsehen. Haberkorn erkannte ein Schlafzimmer, in dem die Betten noch standen und auch die Kleiderschränke weitestgehend unversehrt geblieben waren. Über einer Bruchkante des Wohnungsbodens hing eine Stehlampe über dem Abgrund, an einer Wand bewegte sich ein Bild leise im Luftzug des durch die Flammen verursachten Sogs. Er stellte sich vor, wie die Bewohner sich das Geld abgespart hatten, um sich wenigstens für die knappen Stunden der Freizeit nach der langen Arbeit etwas Gemütlichkeit schaffen zu können. Aber auch diese Zeit war nicht sorgenfrei, denn die an Intensität zunehmenden Luftangriffe setzten die Menschen nach den langen und harten Schichten in den Betrieben, nach ihren ständig schwieriger werdenden Bemühungen ausreichend Nahrung und Kleidung ergattern zu können noch mehr unter Druck, und zu der körperlichen Auslaugung kam nun auch noch die permanent vorhandene Lebensbedrohung aus der Luft dazu. Keiner der Leute machte sich allzu große Illusionen über die Wirksamkeit der Schutzbauten unter den Häusern, denn die Gefahr der Luftangriffe war viel zu lange unterschätzt worden und es gab kaum ausreichend bombensichere Bauwerke.
Auch das war für Haberkorn ein deutliches Zeichen der lange vorhandenen vollkommenen Unterschätzung des Gegners, und diese Arroganz hatten heute wieder etliche Hamburger mit ihrem Leben bezahlen müssen.
Günther Weber, 7. Juli 1943, vor Orel
Die kampftrainierten SS-Männer hatten sich immer nur sprungweise und unter Nutzung der Bombentrichter langsam Meter für Meter an die vier „Ferdinand“ heranarbeiten können. Die hinter ihnen stehenden eigenen Panzer und die noch weiter rückwärts postierten Nebelwerfer und Artilleriegeschütze feuerten in schneller Folge auf die russischen Stellungen, aber das war keineswegs als separate Unterstützung für die vorgehenden Infanteristen gedacht, sondern gehörte zum allgemeinen Angriffsplan. Beide Seiten hatten ohnehin erhebliche artilleristische Kräfte an diesem Abschnitt konzentriert und Günther Weber war von dem fast gar nicht pausierenden Beschuss selbst als erfahrener Frontkämpfer durchaus beeindruckt. Aus der Sicht der Russen, die in der defensiven Rolle waren und diese auch extra mit Vorbedacht eingenommen hatten, war dies ein Mittel, mit dem heftigen Beschuss dem Gegner möglichst hohe Verluste beibringen zu können, ohne die eigenen infanteristischen Einheiten der Angriffswucht der Deutschen direkt auszusetzen.
Im Vorfeld von „Zitadelle“ hatte es zwischen Hitler und dem deutschen Generalstab erhebliche Meinungsunterschiede zum weiteren Vorgehen im Osten gegeben. Während Hitler anfangs vor allem argumentierte, die Wehrmacht und die anderen Streitkräfte erst wieder auf eine angemessene Schlagkraft bringen zu müssen und bis dahin defensiv zu bleiben, wollten die Generäle die strategisch zu einem Angriff geradezu einladende Situation um Orel, Kursk und Belgorod herum mit einen offensiven Vorgehen ausnutzen. Ursprünglich bereits für das zeitige Frühjahr 1943 geplant, scheiterte diese Vorstellung aber an den Differenzen der Befehlshaber der einzelnen Heeresgruppen und Großkampfverbände, der langanhaltenden Schlammperiode und auch an den militärischen Entwicklungen auf anderen Kriegsschauplätzen. Hitler war über die Entwicklung in Afrika äußerst besorgt gewesen und hatte richtigerweise vermutet, dass mit einem Desaster zu rechnen war, welches am 12. Mai 1943 tatsächlich mit der Kapitulation der deutschen und italienischen Truppen eingetreten war. 150.000 deutsche und 125.000 italienische Soldaten gingen in Gefangenschaft, vor allem der Weigerung Hitlers geschuldet, diese Truppen rechtzeitig nach Italien zurückzunehmen. Damit war zu befürchten, dass die Alliierten den Sprung über das Mittelmehr nach Italien wagen würden, um dort eine zweite Front in Europa zu eröffnen. Der Führer war deswegen unschlüssig, die im Osten bereits zusammengezogenen Truppen in einer größeren Operation einzusetzen und stand dem Plan, Kursk in einer Zangenbewegung zu nehmen und die im Frontvorsprung befindlichen russischen Kräfte zu vernichten, zunächst ablehnend gegenüber, da er im Falle einer breit angelegten Offensive keine Möglichkeit sah, eventuell Truppen aus der Angriffsformation herauszulösen, die dann dringend in Italien benötigt werden würden. Vielmehr favorisierte Hitler ein im Süden räumlich begrenztes Vorgehen ohne die Gefahr, die Truppen in den weiten Räumen lang auseinanderziehen zu müssen und damit auch womöglich auch wieder offene oder nur schwach gesicherte Flanken zu schaffen. Das war keineswegs der große Wurf, den die Generalität erwartet hatte, aber das fortlaufende Opponieren der Militärs hatte Hitler letztendlich doch noch umgestimmt. Diese lange Entscheidungsfindung war für die Russen günstig gewesen, sie hatten ausreichend Zeit gehabt das Verteidigungssystem weitflächig und tief gestaffelt auszubauen.
Günther Weber lag schwer atmend bäuchlings platt auf der Erde und war blitzschnell vor einer ein Stück vor ihm hochgehenden Geschosssalve in Deckung gegangen. Das weitestgehend flache und unbewachsene Gelände war für den Panzerkampf wegen der weiten Sicht und der guten Manövriermöglichkeiten für die Fahrzeuge zwar ausgesprochen gut geeignet, für die Infanterie allerdings hochgefährlich. Neben dem Beschuss lauerten noch von den Russen vergrabene Minen, denn die Sowjets hatten vielfach ihnen in die Hand gefallene deutsche Minen vor ihren Stellungen kurzerhand wieder verwendet. Schon in den ersten Gefechten waren die Deutschen in Minenfeldern steckengeblieben, in denen sie ihre eigenen Explosivkörper ausgelöst hatten und die Pioniere waren zu Unrecht beschuldigt worden, die Einzeichnung dieser Gebiete nicht vorgenommen zu haben. Weber war durch das Pervitin hellwach, aggressiv gestimmt und vor allem trotz des Infernos um ihn herum leicht euphorisiert. Er zählte nicht zu denen, denen Töten zu einem Bedürfnis geworden war, die sich dem Rausch des Herrschens über Leben oder Tod durch die Krümmung des Zeigefingers am Abzug nicht mehr entziehen konnten, die Kerben für jedes Opfer in den Schaft ihres Karabiners schnitzten und Bilder erhängter Partisanen und von Hinrichtungen in ihren Brieftaschen mit sich trugen. Dennoch war er durch die vielen überstandenen Kämpfe ungewollt zu einem Spezialisten für staatlich sanktionierten Mord geworden und er würde auch heute voraussichtlich wieder einige Menschen töten, sofern sie ihn nicht vorher selbst umbrachten. Noch aber mühte er sich mit seinen Männern über das flache und gut einsehbare Gelände vorwärts und verfluchte erneut die Männer in den Jagdpanzern. Durch deren unbedachtes und taktisch überhaupt nicht begründetes Vorpreschen war der Flankenschutz der nahezu unbeweglichen und extrem schweren Fahrzeuge durch die leichteren und besser manövrierfähigen anderen Panzer nicht mehr gegeben. Etwas verstand er die Panzersoldaten schon, denn hinter der 200 Millimeter starken Frontpanzerung hätte er sich auch sicher gefühlt. Dazu kam noch, dass die „Ferdinand“ auch an den Seiten durch immerhin 80 Millimeter Panzerstahl geschützt waren, das entsprach der Frontpanzerung des Panzers IV in den Ausführungen G und H, die bei dieser Operation überwiegend zum Einsatz kamen. So gesehen waren die Panzerjäger gegen Artilleriebeschuss mit den üblichen russischen Waffen fast unverwundbar, aber durch Nahbekämpfer wegen der fehlenden leichten Abwehrbewaffnung äußerst gefährdet.
Nach der nächsten krachend in den Boden gefahrenen Artilleriesalve der russischen Geschütze sprangen Weber und seine Männer auf und gingen nach wenigen Metern wieder in Deckung. Günther Weber hatte den Drill in der Ausbildung damals nicht wie viele andere Männer abgrundtief gehasst, sondern er war mit seinem Denken schon soweit gewesen, dass er die Schleiferei als absolut notwendig angesehen hatte, denn er würde in späteren Gefechten keine Zeit mehr haben sein Handeln erst überdenken zu können, sondern es musste mehr oder weniger instinktiv und automatisiert erfolgen. Das bedeutete aber nicht, dass er sich gedanklich überhaupt nicht mehr mit der Ausführung von Befehlen beschäftigte, denn die Doktrin der deutschen Militärführung hatte – im Gegensatz zur russischen – den Soldaten und insbesondere den Unterführern durchaus eine eigenständige Handlungsweise im Rahmen ihrer Verantwortungen im Gefecht zugebilligt. Was er jetzt aber tat bedurfte aber keiner großen Überlegungen, er musste mit seinen Männern an die Jagdpanzer herankommen und diese vor russischen Infanteristen schützen. Erst wenn es um die Bekämpfung des Gegners gehen würde wären seine Entschlüsse je nach Lage gefragt. Noch trennten ihn ungefähr 200 Meter von den immer noch über das Gelände kriechenden Fahrzeugen, die ab und an auf die russischen Stellungen feuerten, sich aber im Rückwärtsgang buchstäblich nur schrittweise zurückzogen. Als er mit seinem Trupp die 8 Meter langen und 3 Meter hochaufragenden Kampffahrzeuge aus 80 Meter Entfernung schon greifbar nahe vor sich sah, bemerkte er einige kleinere Gruppen von Rotarmisten vor den Panzern. In ihren erdbraunen Uniformen hoben sich die gegnerischen Soldaten kaum von Gelände ab, aber die Deutschen in den Panzern mussten sie erkannt haben. Zwei der Fahrzeuge drehten sich wegen dem starren Aufbau mit der Waffe in eine günstigere Schussposition und senkten ihre Kanonen auf die maximale negative Rohrerhöhung ab. Weber verstand diese Handlungen erst dann, als die Geschütze losdonnerten und etwa 100 Meter vor den Panzern die Erde mit Sprengpilzen hochgeschleudert wurde, die „Ferdinand“ schossen mit ihren mächtigen und 6,35 Meter langen 8,8-Zentimeterkanonen auf die einzeln vorgehenden russischen Soldaten. Günther Weber als Infanterist hatte nur eine schwache Vorstellung von den ballistischen Leistungen dieser Waffe des „Ferdinand“ und er hätte nur ungläubig mit dem Kopf geschüttelt, dass die Panzerbesatzungen mit den 9,4 Kilogramm schweren Sprenggranaten 43, die eine Mündungsgeschwindigkeit von 750 Metern in der Sekunde erreichten, Jagd auf einzelne Russen machten. Die Artillerie beider Seiten hatte das Feuer auf den Bereich um die Panzer herum verringert, denn es war bekannt, dass sich Soldaten den Jagdpanzern näherten.