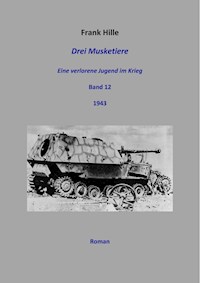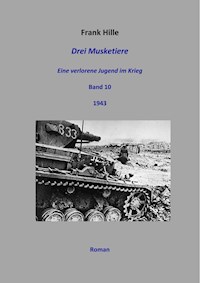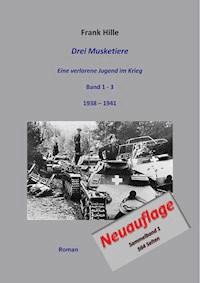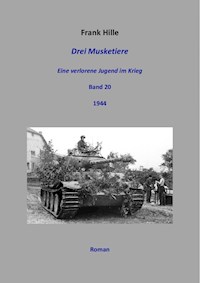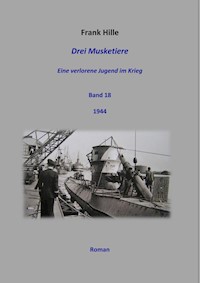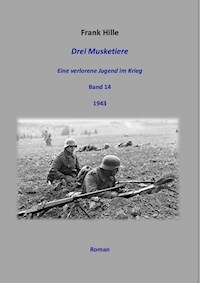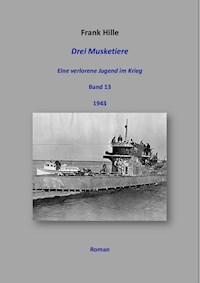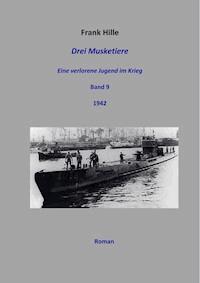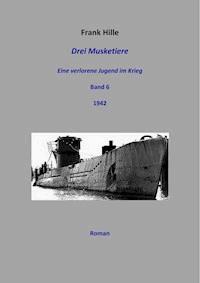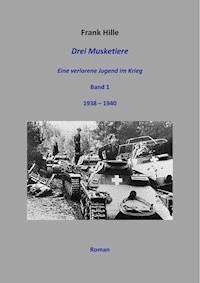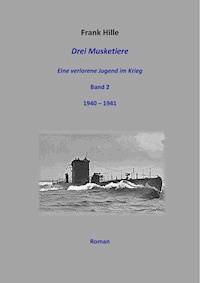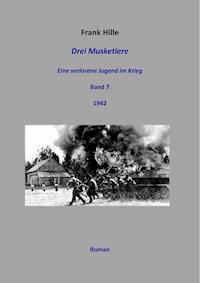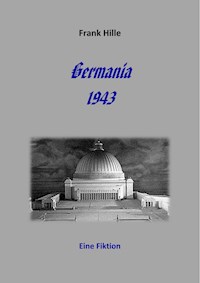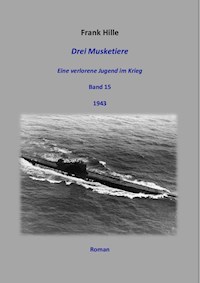
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Martin Haberkorn fährt als Kommandantenschüler auf einem Typ IX Atlantikboot und gerät in eine hartnäckige Attacke durch einen Zerstörer. Fast sieht es so aus, als müsste das Boot nach einer langen Wasserbombenverfolgung aufgeben, aber die Männer kommen noch einmal davon. Günther Weber und seiner Kompanie glückt der Ausbruch aus dem Kessel von Borissowka, aber die Sowjets treiben die Deutschen weiter vor sich her. Als Weber mit seinen Männern und anderen versprengten Einheiten in einem eigentlich unbedeutenden Ort Stellung beziehen müssen ahnt er, dass sie für den Schutz des Rückzuges anderer Einheiten geopfert werden sollen. Auch Fred Beyer muss feststellen, dass die Ostfront in ihrem Bereich ins Rutschen gekommen ist, und die Sowjets alle Kräfte auf die Wiedereroberung von Charkow konzentrieren. Während die Deutschen mit schwachen und zermürbten Truppen versuchen neue Auffanglinien zu organisieren, machen sich im Osten frische Einheiten der Russen auf den Weg ins Kampfgebiet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 153
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Impressum
Drei Musketiere
Eine verlorene Jugend im Krieg
Band 15
1943
Copyright: © 2018 Frank Hille
Published by: epubli GmbH, Berlin
www. epubli.de
Martin Haberkorn, 3. August 1943, Atlantik
Günther Weber, 4. August 1943, bei Borissowka/Gruzskoje
Fred Beyer, 4. August 1943, bei Tomarowka
Martin Haberkorn, 4. August 1943, Atlantik
Günther Weber, 4. August 1943, nach Veterinarne
Martin Haberkorn, 5. August 1943, Atlantik
Fred Beyer, 5. August 1943, bei Prudjanka
Günther Weber, 5. August 1943, Veterinarne
Martin Haberkorn, 5. August 1943, Atlantik
Fred Beyer, 5. August 1943, bei Prudjanka
Günther Weber, 5. August 1943, Veterinarne
Martin Haberkorn, 5. August 1943, Atlantik
Fred Beyer, 5. August 1943, bei Prudjanka
Martin Haberkorn, 5. August 1943, Atlantik
Günther Weber, 6. August 1943, Veterinarne
Fred Beyer, 6. August 1943, bei Prudjanka
Martin Haberkorn, 6. August 1943, Atlantik
Günther Weber, 6. August 1943, vor Charkow
Martin Haberkorn, 3. August 1943, Atlantik
Martin Haberkorn merkte, dass er am ganzen Körper zitterte. Aber nicht sein Körper, sondern seine Nerven drohten zu versagen. Er hatte schon einige gefährliche Unternehmungen im U-Boot und entsprechende belastende Erlebnisse hinter sich, aber diesmal war er fast so weit, mit seinem Leben abzuschließen. Es war jetzt 4 Uhr 28. Gestern war das Boot gegen 19 Uhr vor einem anlaufenden Zerstörer weggetaucht, und gegen 4 Uhr an diesem Morgen kurz aufgetaucht, um dem Gegner eventuell über Wasser entkommen zu können und die Batterien aufzuladen. Beides hatte nicht funktioniert, der ihnen mit Höchstfahrt folgende Zerstörer hatte sie schnell wieder unter Wasser gedrückt und die Verfolgung erneut aufgenommen. Die vom Boot über Wasser mit AK laufenden Dieseln zurückgelegte Strecke hatte ihnen 10 Minuten Ladezeit gebracht und wenigstens wieder etwas Batteriekapazität verschafft. So über den Daumen gepeilt schätzte Haberkorn, dass sie in Abhängigkeit von den gewählten Fahrtstufen vielleicht um die 45 Minuten mit den E-Maschinen fahren könnten. Erschwerend zu der ganzen Situation kam hinzu, dass es einige kleinere Leckagen gab, die ständig Wasser in den Bootskörper eindringen ließen. Selbst einem erfahrenen LI wie ihm wäre es unmöglich gewesen einen ordentlichen Trimm herzustellen, da der Kommandant auch häufig Kurs und Tiefe ändern ließ und sich das Boot wie auf einer Achterbahnfahrt bewegte. Noch schien diese Taktik aufzugehen und der Horcher war sich sicher, dass sie nur von einem Eskorter gejagt wurden. Das gab ihnen die Möglichkeit, wenn der Zerstörer nach dem Abwurf der Wasserbomben mit Höchstfahrt ablief, wieder den Versuch zu unternehmen, aus dessen Ortungsbereich herauszukommen. Einmal schien es so, als wäre es ihnen geglückt, aber dann rasselten die Asdicstrahlen wieder über den Bootsrumpf. Der Obersteuermann hatte seine Schiefertafel über dem Kartentisch vor ein paar Minuten mit einem Lappen abgewischt, die Fläche war vollständig mit Fünfer-Strichreihen und drei einzelnen Strichen bedeckt gewesen. 93 Wasserbomben. Haberkorn konnte nicht einschätzen ob der Mann tatsächlich so kaltblütig war, aber das Gesicht des Oberbootsmannes zeigte kaum eine Regung, auch wenn wieder wahnsinnig krachende Explosionen und Druckwellen auf das Boot eindroschen. Der Kommandant gab sich ähnlich gelassen, aber als Ältester und Erfahrenster an Bord musste er ganz genau wissen, wie schlecht die Dinge standen. So wie ihn Haberkorn einschätzte würde er sein Blatt wie ein Pokerspieler bis zum Äußersten ausreizen und erst dann, wenn es wirklich aussichtslos wäre, aufgeben. Sich auf den Grund bomben zu lassen hätte nur das Ergebnis, dass sie alle jämmerlich absaufen würden. Solange es keine weiteren gravierenden Schäden geben würde und falls sie nicht doch eine Bombe erwischte, würde der Mann mit immer wieder neuen Finten zu entkommen zu versuchen. Haberkorn wusste auch, welches Entscheidungskriterium der Kommandant gewählt hatte: die Batteriekapazität. Sie hatten sich während der Reise öfter unterhalten und der Kapitän hatte ihm einmal gesagt:
„Natürlich ist es vermutlich aus der Sicht von anderen nicht ehrenvoll sein Leben und das der Besatzung retten zu wollen und sich dem Feind zu ergeben. Was macht es aber für einen Sinn, zusammen mit 50 jungen Männern in den Orkus zu fahren, wenn es keine Chance mehr gibt? Keinen. Ich habe den Befehl, Schiffe des Gegners zu versenken. Man hat mir aber nicht befohlen, das Leben der Besatzung vorsätzlich aufs Spiel zu setzen, besonders dann, wenn es ohne Nutzen wäre. Das liegt in meiner Verantwortung. Und sollten wir in eine Situation kommen, in der wir wegen fehlender Batteriekapazität nicht mehr unter Wasser fahren können, werde ich anblasen lassen. Ich habe mit dem LI und dem Funker vertraulich besprochen, was in so einem Fall zu tun ist. Alle Schlüsselunterlagen und Codebücher vernichten, die sind ja wasserlöslich. Flutventile öffnen, Torpedo- und Kombüseluk auf. Sprengladungen anschlagen. Kriegstagebuch über Bord werfen, Enigma über Bord werfen. So was sollte man vorher klären bevor es ernst wird. Denn im Fall der Fälle, wenn die Leute dann die Nerven verlieren und nur noch raus wollen, klappt das dann nicht mehr. Ich bin immer noch davon überzeugt, dass der Gegner ein Boot von uns aufgebracht hat. Anders kann ich mir insbesondere die zielgerichtete Vernichtung unserer U-Tanker in der letzten Zeit nicht erklären. So was darf nicht passieren, dass man dann in so einer Situation unvorbereitet ist. Wissen Sie, im Vergleich mit unseren Leuten bin ich ein alter Mann. Aber ich bin auch noch nicht so alt, dass mir das Sterben egal wäre. Und die jungen Kerle haben doch grade erst mal ins Leben reingeschnuppert. Da ist es mir lieber, wir versenken das Boot, lassen uns hopp nehmen und ab nach Kanada zum Bäume fällen. Und nach dem Krieg geht’s wieder nach Hause zu Muttern.“
Die Luft im Boot war immer schlechter geworden und bei Haberkorn stieg auch die Sorge, dass sich die Bilge immer mehr mit Wasser füllen und dann für einen Kurzschluss der E-Maschinen sorgen könnte. Der LI hatte den Trick angewendet, denn er auch selbst früher genutzt hatte. Immer wenn die Bomben explodierten hatte er die Hauptlenzpumpe auf vollen Touren laufen lassen und nach dem Verebben der Detonationen sofort wieder ausschalten lassen. Noch waren die Schäden im Boot beherrschbar aber ihre Chancen auf ein Davonkommen nahmen so wie die Batterieladung minütlich ab.
„Zwotes Geräusch gehorcht“ meldete der Horcher erschrocken und aufgeregt „keine Turbinenmaschine! Sehr nah!“
Der Kommandant fuhr herum. Haberkorn sah auf seinem Gesicht ein ungläubiges Staunen und er wusste, was der Mann vermutete. Eigentlich konnte es nur eine Erklärung geben: ein deutsches U-Boot musste in der Nähe sein. Jetzt konnte sich die ganze Situation ins Gegenteil verkehren, nämlich so, dass das andere Boot den Zerstörer attackierte. Beim Auftauchen hatte Haberkorn einen Blick durchs Turmluk erhaschen können und gesehen, dass es helles Mondlicht gab. Wenn sich das Boot in eine günstige Position bringen und Torpedos losmachen könnte wäre das die Rettung aus ihrer schlechten Situation, vorausgesetzt, die Torpedos trafen.
„Wo steht der Zerstörer“ fragte der Kommandant drängend.
„Läuft ab. Dreht jetzt nach Steuerbord. 3.500 Meter. Geht auf 40 Grad. Wird lauter.“
Dann überschlugen sich die Ereignisse.
„Torpedogeräusche“ rief der Horcher „zwei Torpedos!“
20 Sekunden später gab es eine heftige Explosion, eine zweite folgte kurz darauf.
„Beide AK, 280 Grad“ befahl der Kommandant und gleich darauf „auf 30 Meter gehen. Rotlicht!“
Für die Männer im Boot war jetzt deutlich zu hören, dass über ihnen ein Krachen und Bersten eingesetzt hatte. Allen war klar, dass zwei Torpedos getroffen haben mussten und der Zerstörer sank.
„Was ist mit dem Schraubengeräusch?“
„Wandert nach 130 Grad aus, scheint schnell zu tauchen, Geräusch wird leiser.“
Haberkorn wusste, dass die G7-Torpedos ungefähr 40 Knoten schnell waren, das entsprach mehr als 70 Kilometern in der Stunde. In einer Sekunde schaffte so ein Geschoss um die 20 Meter. Das andere Boot musste die Torpedos also theoretisch bei zirka 400 Metern Entfernung vom Zerstörer losgemacht haben, ein Kamikazeangriff. Womöglich war die Entfernung doch größer gewesen, denn die Männer hatten keine Informationen über die Positionen der beiden Fahrzeuge und ihre Kurse zu diesem Zeitpunkt. Keiner von ihnen konnte wissen, dass das andere Boot zwei G7es abgefeuert hatte, die ersten Torpedos mit Akustiklenkung, die auf die Schraubengeräusche der Schiffe ansprachen. Der Horcher hatte auch richtig mitbekommen, dass das andere Boot schnell auf Tiefe gegangen war, denn das war Vorschrift, weil diese „Zaunkönig“ genannten Torpedos nur eine Sperrstrecke von 400 Metern, in denen die Geschosse noch nicht scharf waren, besaßen. Jeweils fast 300 Kilogramm Schießwolle waren durch die Aufschlagzünder an der Bordwand des Zerstörers hochgegangen und hatten diese aufgerissen.
Das Geräusch über ihnen hatte sich geändert. Durch den Kurs des Bootes blieb es hinter ihnen zurück aber es war klar zu hören, dass die Konstruktion des Schiffes jetzt kollabierte. Das typische Brechen der Schotten kannte Haberkorn von früheren Unternehmungen her, dieses Schiff war nicht mehr zu retten, es schien über den Achtersteven zu sinken. Der Kommandant hatte Sehrohrtiefe befohlen und nach der Horchpeilung fuhr er das Persikop aus.
„Schraubengeräusch ist wieder zu hören, 30 Grad. 800 Meter.“
„Auftauchen, Druckausgleich. Brückenwache aufziehen, ich gehe mit hoch, der Oberleutnant auch.“
Der II. WO hatte das Turmluk geöffnet. Ein Schwall kalter Luft stürzte in das Boot hinein. Haberkorn sog seine Lungen voll und sah auch, wie eine Wolke mit Partikel versetzter und ihm gelblich erscheinender Luft aus dem Boot aufstieg. Als er auf dem Turm stand sah er keine 1.000 Meter entfernt an Steuerbord ein brennendes Schiff im Wasser treiben. Es lag achtern tief im Wasser und ein Teil des Hinterschiffes schien abgeknickt zu sein. Er nahm das Glas vor die Augen und erkannte Gestalten, die sich noch auf dem Deck aufhielten und im Wasser treibende Punkte. Zwischen den Punkten sah er Flöße.
„Der bleibt nicht mehr lange oben“ sagte der Kommandant tonlos „dem hat es die Antriebs- und Ruderanlage total zerlegt und er liegt schon bis zum Mittelschiff fast unter Wasser. Hier gibt es nichts mehr zu tun. Wir sehen uns nochmal unseren Helfer in der Not an, dann setzen wir uns schnellstens hier ab. Die auf dem Zerstörer haben noch gefunkt oder können sogar noch funken, falls da noch Hilfsmaschinen in Betrieb sind.“
Das Boot nahm Fahrt auf, steuerte von dem sinkenden Schiff weg und nahm Kurs auf das andere Boot.
„Klappbuchs hoch!“
Als sich beide Boote in einem Abstand von 80 Metern befanden schickte der Kommandant eine Nachricht nach drüben.
„Rettung in höchster Not! Wir danken Ihnen.“
„Warum so förmlich, Dieter“ kam es zurück „war schon knapp. Aber man hilft doch gern.“
„Das ist Feldmann“ freute sich der Kommandant „verrückter Hund, ziemlich wagemutig, aber kein blinder Draufgängern.“
Dann blinkte er wieder hinüber.
„Danke, Werner. Wir versuchen jetzt wieder ranzukommen.“
„Braucht ihr Hilfe?“
„Nein, kriegen wir mit Bordmitteln hin.“
„Gute Jagd!“
„Euch auch!“
Wieder in der Zentrale zurück besprach der Kommandant mit dem LI die Liste der Reparaturarbeiten. Die Wassereinbrüche würde man zunächst provisorisch abdichten können, die anderen Schäden waren relativ schnell zu beseitigen. Jetzt kam es erst einmal darauf an die Batterien laden, das Boot gründlich durchzulüften, wieder an das Geleit heranzukommen und höchste Aufmerksamkeit auf Flugzeuge zu richten. Alles an Bord schien wieder einer gewissen Routine zu folgen, aber den Männern steckten noch die Schrecken der Wasserbombenverfolgung in den Knochen. Die Boote tauschten Kurzmeldungen aus, es war ohnehin bekannt, dass sie am Geleit standen. Die ersten Schiffe waren schon versenkt worden und niemand von den Männern an Bord der Boote und im Stab des BdU ahnte, dass man in Bletchley Park verzweifelt auf diese Meldungen der deutschen Boote wartete, um über die „Bomben“ genannten Entschlüsselungsmaschinen endlich wieder in der Code der Enigma einbrechen zu können. Die Alliierten waren sogar bereit den Verlust weiterer Schiffe in Kauf zu nehmen, denn aus den wenigen Meldungen konnten sie noch keine richtigen Schlüsse ziehen.
Etliche Meilen von Haberkorns Boot entfernt war der Zerstörer gesunken. Einige der Überlebenden hockten auf Flößen, viele trieben im kalten Wasser. Der Geleitzugführer wusste, dass mehr als 10 deutsche U-Boote in der Nähe des Konvois auf Beute lauerten und es würden garantiert noch mehr dazukommen. Wenn er die Sicherung jetzt weiter entblößen und ein Schiff zur Rettung der Männer des Zerstörers abstellen würde könnte das furchtbare Folgen für die Frachter haben. Der 50jährige Brite rang eine Weile mit sich, dann kommandierte er eine Korvette zur Rettung der Männer ab. Er würde es nie überwinden können, wenn er diesen Entschluss nicht so getroffen hätte und vielleicht mehr als 200 Seemänner ohne Hilfe ihrem Schicksal überlassen hätte.
Günther Weber, 4. August 1943, bei Borissowka/Gruzskoje
Er war ohne allzu große Hoffnungen auf ein einfaches Gelingen in den Kampf gegangen, aber erstaunlicherweise hatten die Russen weniger Kräfte als vermutet an der Ausbruchsstelle am Westrand des Kessels konzentriert, weil sie auch mit einem Angriff der Deutschen im Süden gerechnet hatten. Die vor Weber und seinen Männern vorgestürmten Einheiten hatten dem Gegner sogar einige empfindliche Schläge versetzen können, so dass dessen Attacken aus den Flanken schwach ausfielen und die deutschen Verluste so recht gering geblieben waren. Der Befehl hatte gelautet, nach der Überwindung der Sperren des Feindes in südlicher Richtung auf das etwa 15 Kilometer entfernte Gruzskoje vorzurücken, sich dabei an die dorthin verlaufende Eisenbahnstrecke anzulehnen und den Ort zu sichern. Nordöstlich von ihnen mussten aber auch noch deutsche Truppen stehen, denn er hatte seit früh an aus dieser Richtung heftigen Gefechtslärm gehört. Alles in allem waren die Russen ganz klar darauf aus, Charkow wieder einzunehmen. Vermutlich war jetzt mit ständig wechselnden Lagen zu rechnen, denn die deutsche Front war an vielen Stellen zerrissen worden und die Einheiten versuchten sich irgendwie wieder zu organisieren und eine geschlossene Abwehr aufzubauen. Gruzskoje lag auf einer senkrechten Linie mit Charkow und war von dort gut 100 Kilometer entfernt. Schnelle mechanisierte Einheiten sollten in der Lage sein, diese Strecke in kurzer Zeit zu überwinden. Der Ort selbst war eine Ansiedlung von einigen an einer gut 2 Kilometer langen schnurgeraden Straße liegenden Häusern und weiteren im Gelände verstreuten Bauernhöfen. Das Terrain an sich war gut zur Verteidigung geeignet, denn der ungefähr 100 Meter östlich neben dem Ort gelegene Bahndamm stellte einen kleinen Wall dar, auf dem sich die Infanterie eingegraben hatte. In bestimmten Abständen zwischen den Soldaten hatten sich auch Geschützbedienungen Stellungen geschaffen, so dass nur die Schutzschilde über den Boden ragten. Es waren in der Mehrzahl 7,5 Zentimeter PAK 40 die nach Osten hin freies Schussfeld hatten. Die Infanterie war mit etlichen MG 42 ausgestattet und in diesem Bereich gab es demzufolge eine ordentliche Feuerdichte. Das Vorfeld mit Minen zu sichern war nicht mehr gelungen. Einige Sturmgeschütze III hatten sich so positioniert, dass ihre Sturmkanonen nur knapp über die Gleisanlage emporragten. Zwei Batterien Artillerie hatten westlich des Ortes Stellung bezogen, ihre Beobachter lagen mit am Bahndamm. Telefonkabel waren keine gezogen worden, die Verbindung musste über Funk laufen. Im Norden des Örtchens hatten sich einige Panzer III und IV geschickt hinter Häusern aufgestellt. Im Süden gab es nur einen dünnen Schützenschleier, von dort erwartet man den Gegner nicht. Lediglich zwei PAK 40 waren dort postiert. Für Günther Weber sah das alles so aus, als würde die Truppenführung schon damit rechnen, sich wieder vor den überlegenen Kräften des Feindes zurückziehen zu müssen. Ob die knapp 400 deutschen Infanteristen und die wenigen schweren Waffen den Ort lange halten konnten war recht unwahrscheinlich. Noch konnten Verbände hin und her verschoben werden, aber sobald der Regen einsetzen und wieder alles im Schlamm versinken würde, würde eine Kampfpause eintreten. Die Russen würden die bis dahin verbleibende Zeit nutzen um noch möglichst große Geländegewinne erzielen zu können. Das war nur folgerichtig, lagen in dem jetzt umkämpften Gebiet doch wichtige Rohstoffe für die Rüstungsproduktion und das fruchtbare Schwarzerde Anbaugebiet.