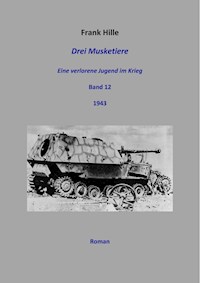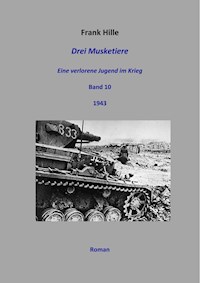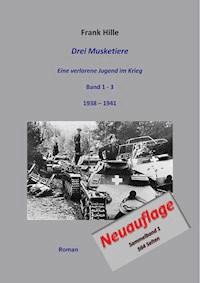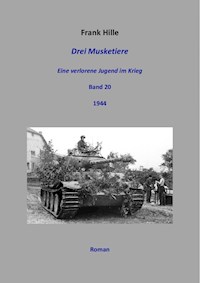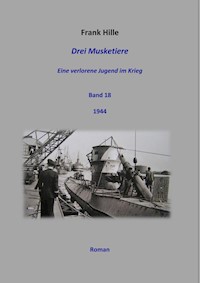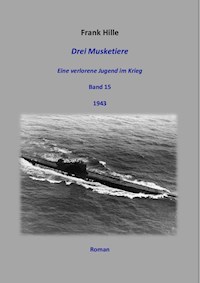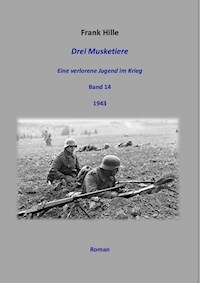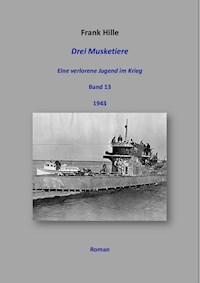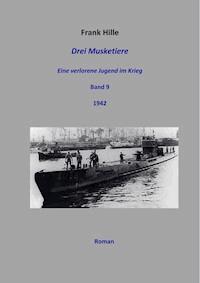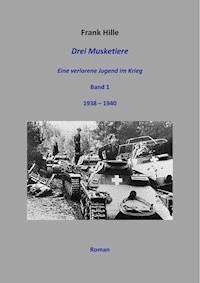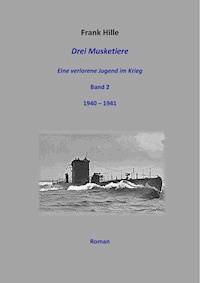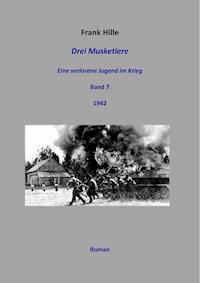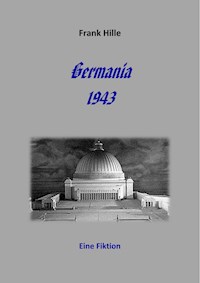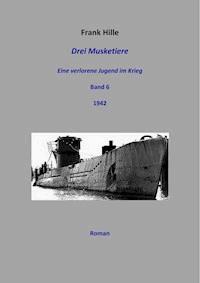
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Im Frühsommer 1942 hat sich die deutsche Wehrmacht von den Niederlagen des letzten Jahres erholt. Gerade im Bereich der Heeresgruppe Mitte, die die unter vielen Opfern errungenen Gebiete vor Moskau im Winter 1941 fluchtartig verlassen musste, ist es zu einer Stabilisierung der Lage gekommen. Deutschlands Wirtschaft ist nun endgültig vorrangig auf die Rüstungsproduktion eingestellt worden. Dennoch versteht die deutsche Führung nicht, dass eine Massenfertigung mit funktionellen Produkten das Gebot der Stunde wäre, sondern lässt weiterhin qualitativ hochwertige Waffen fertigen, deren geringe Stückzahlen aber nie den Bedarf der Truppe werden decken können. Fred Beyer und Günther Weber kämpfen weiterhin an der Ostfront. Ihre Einheiten werden zeitweise im Hinterland eingesetzt, um die Bedrohung durch Partisanen zu beseitigen. Martin Haberkorn ist an Bord seines Bootes, welches im Atlantik operiert. Die Rudeltaktik zeigt Erfolge und es scheint so, als könnten die Boote im Jahr 1942 die Initiative wieder zurück erlangen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 157
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Impressum
Drei Musketiere
Eine verlorene Jugend im Krieg
Band 6
1942
Copyright: © 2016 Frank Hille
Published by: epubli GmbH, Berlin
www. epubli.de
Martin Haberkorn, 15. April 1942, Bretagne
Fred Beyer, 27. Mai 1942, Russland
Günther Weber, 27. Mai 1942, Junkerschule Bad Tölz
Martin Haberkorn, 27. Mai 1942, Atlantik
Fred Beyer, 29. Mai 1942, Russland
Martin Haberkorn, 29. Mai 1942, Atlantik
Günther Weber, 30. Mai 1942, bei Brjansk
Fred Beyer, 1. Juni 1942, Russland
Martin Haberkorn, 1. Juni 1942, Atlantik
Günther Weber, 1. Juni 1942, bei Brjansk
Fred Beyer, 2. Juni 1942, Bjeloj, Russland
Martin Haberkorn, 2. Juni 1942, Atlantik
Günther Weber, 2. Juni 1942, Brjansk
Fred Beyer, 2. Juni 1942, Bjeloj, Russland
Martin Haberkorn, 3. Juni 1942, Atlantik
Günther Weber, 3. Juni 1942, bei Jatkowo, Russland
Fred Beyer, 2. Juni 1942, Bjeloj, Russland
Martin Haberkorn, 3. Juni 1942, Atlantik
Günther Weber, 3. Juni 1942, Jatkowo, Russland
Fred Beyer, 3. Juni 1942, Bjeloj, Russland
Martin Haberkorn, 3. Juni 1942, Atlantik
Günther Weber, 3. Juni 1942, Jatkowo, Russland
Martin Haberkorn, 3. Juni 1942, Atlantik
Fred Beyer, 3. Juni 1942, Bjeloj, Russland
Günther Weber, 3. Juni 1942, Jatkowo, Russland
Martin Haberkorn, 3. Juni 1942, Atlantik
Fred Beyer, 3. Juni 1942, Bjeloj, Russland
Günther Weber, 3. Juni 1942, Jatkowo, Russland
Martin Haberkorn, 15. April 1942, Bretagne
Als der LKW auf dem Weg nach Camaret-sur-mer war, musste Haberkorn in sich hinein lächeln. Der Flottilleningenieur hatte ihn sofort durchschaut. Natürlich interessierte ihn der Ort nur wenig, er hatte ihn bei seinem ersten Besuch ja schon erkundet und nach wenigen Stunden fast alles gesehen. Die per Brief ausgesprochene vorsichtige Einladung von Marie Hublot ließ ihn gespannt, aber auch nervös auf die Begegnung warten. Er wurde freundlich, aber mit einer gewissen Zurückhaltung empfangen und konnte wieder das bekannte Quartier beziehen. Es war jetzt kurz vor der Abendessenzeit und er und der Fahrer sollten dann doch in die Küche zum Essen kommen.
„So ein Zufall, Monsieur Leutnant“ sagte Antoine Hublot spöttisch „sind Sie jetzt zur Transportkompanie versetzt worden? Sie beehren uns ja schon das zweite Mal innerhalb von 4 Wochen.“
„Die Erklärung ist ganz einfach, Monsieur Hublot“ erwiderte Haberkorn freundlich „unser Boot liegt in der Werft und es wird einige Zeit dauern, bis die Schäden behoben sind. Also hat man mir den Befehl erteilt, wieder eine Lieferung von Ihnen abzuholen. Außerdem möchte ich mir die Landschaft noch mehr ansehen. Mir gefällt es hier, weil man hier am Meer die Kraft der Natur ganz deutlich spürt. Und als Seemann fühle ich mich ohnehin zum Wasser hingezogen. Außerdem habe ich bei meinem letzten Besuch Muscheln gegessen und die haben mir ganz hervorragend geschmeckt.“
„Sie sprachen von Schäden“ sagte Marie „es ist wohl sehr gefährlich auf so einem Boot?“
„Das kann man so sagen. Immerhin bewegen wir uns öfter tief unter der Oberfläche.“
„Wie tief“ fragte Maries Vater.
„Aber Monsieur Hublot“ antwortete Haberkorn lächelnd „Sie erwarten doch jetzt keine Antwort von mir. Ich werde Ihnen keine Geheimnisse verraten, das werden Sie doch wohl verstehen. Ja, es ist gefährlich, aber was ist im Krieg denn schon ungefährlich?“
„Na zum Beispiel ein Posten in der Schreibstube im Hafen“ erwiderte Antoine Hublot „geregelter Dienst, alles läuft in Ruhe ab, abends in die Stadt gemütlich einen Wein trinken und ein ordentliches Quartier. Da dürfte Ihr Tagesablauf doch ein bisschen anders aussehen, oder?“
„Das kann man so sagen. Es ist eng bei uns. Zwei Matrosen müssen sich jeweils eine Koje teilen. Frische Nahrungsmittel gibt es nur die ersten paar Tage. Je nach Klimazone ist es drückend heiß im Boot, oder kalt. Es riecht nach Diesel. Und eine geregelte Dienstzeit gibt es kaum.“
„Und warum tun Sie sich das an“ fragte Marie.
„Weil ich als Dieselmaschinist auf ein Boot kommandiert worden bin. Das war damals nicht meine eigene Entscheidung.“
„Aber dass Sie vom einfachen Matrosen so schnell zum Offizier aufgestiegen sind ist doch eine außergewöhnliche Sache, oder“ meinte Antoine Hublot.
„Das stimmt. Ich habe in einer gefährlichen Situation richtig gehandelt und so mitgeholfen, das Boot vor dem Untergang zu bewahren. Außerdem wollte ich nach dem Abitur ein technisches Fach studieren und so hat man mich auf die Seefahrtschule zur Ausbildung als LI kommandiert.“
„Tja“ sagte Marie „viele junge Männer haben sicher andere Pläne gehabt als in den Krieg zu ziehen. Und es ist kein Ende abzusehen. Wie lange soll das bloß noch gehen?“
„Bis wir im Osten einen Wall gegen die Bolschewisten geschaffen haben. Übrigens, auch Franzosen, Belgier, Norweger kämpfen in der Waffen-SS dafür. Das ist das was ich schon in unserem letzten Gespräch sagen wollte. Die westliche Kultur muss doch gegen diese Bedrohung zusammenstehen. Glauben Sie mir, ich kann mir ein geeintes Europa vorstellen, das wirtschaftlich prosperiert und stark ist. Mag sein, dass das in Ihren Ohren jetzt seltsam klingt, Sie haben mir ja schon gesagt, dass Sie die Deutschen als Besatzer empfinden. Aber in 5 Jahren wird das ganz anders aussehen, dann werden Deutsche und Franzosen als gleichberechtigte Partner zusammen leben.“
„Ihre Hoffnung kann ich nicht teilen, Monsieur Leutnant“ erwiderte Antoine Hublot „erst einmal müsste der Krieg zu Ende sein, und danach sieht es im Moment ja nicht aus. Aber wechseln wir das Thema. Wir werden den Auftrag iübermorgen fertig haben. Was wollen Sie in der Zeit hier unternehmen? Marie könnte Ihnen vielleicht ein paar schöne Stellen an der Küste zeigen.“
„Sehr gern, vielen Dank. Wann passt es Ihnen denn?“
„Morgen Nachmittag.“
„Gut. Ich freue mich. Vielen Dank für das Essen und Ihnen noch einen schönen Abend.“
Haberkorn und der Fahrer gingen, dann rauchten sie auf dem Hof noch eine Zigarette und gingen in ihre Quartiere.
Am nächsten Nachmittag war passables Wetter, und Haberkorn und die junge Frau liefen an einem Weg oberhalb des Meeres entlang. Nach einer Weile erreichten sie eine Stelle, wo mächtige Gesteinsbrocken vielleicht 20 Meter von der Küste entfernt standen. Die Felsen hatten durch die ständig anbrandenden Wellen skurrile Formen angenommen, aber sie gaben ein Bild der Stärke ab.
„Wer weiß, wie es hier vor 50 Millionen Jahren ausgesehen hat“ sagte Haberkorn nachdenklich „vielleicht war damals alles noch eine Steinwüste. Aber nach und nach hat sich das Meer Platz geschaffen und über diese wahnsinnig lange Zeit diese skurrilen Formen erzeugt. Der linke Felsen erinnert mich an einen auf den Hintertatzen stehenden Bären. Was denken Sie?“
„Ich dachte Sie sind Ingenieur“ sagte Marie Hublot spöttisch „aber Sie reden wie ein Poet. Das hatte ich von Ihnen nicht erwartet. Die Leute hier im Ort nennen diesen Felsen allerdings die Bäuerin, weil die scheinbare Gestalt so aussieht, als würde sie Obst von einem Baum ernten wollen.“
„Na ja, das ist eben eine Frage der Phantasie. Das kann jeder für sich selbst entscheiden. Darf ich Sie später zum Essen einladen?“
„Warum nicht. Ich kenne ein kleines Restaurant, wo es wirklich gute Muscheln gibt.“
„Äh, Marie, wird es für Sie Probleme geben, wenn Sie sich dort mit einem Deutschen zeigen? Und noch einem in der Uniform der Kriegsmarine?"
„Die Leute dort kennen mich. Und warum sollte es Probleme geben? Es gibt schon einige Freundschaften zwischen einheimischen Frauen und deutschen Soldaten. Das muss ja nichts Schlechtes sein. Machen Sie sich da mal keine Sorgen.“
Das Essen begeisterte Haberkorn erneut. Der kleine Gastraum war nur schwach besetzt und er und Marie hatten einen Tisch mit zwei Stühlen an einer Wand gefunden. Marie wurde von der Kellnerin freundlich begrüßt, Haberkorn nickte sie freundlich zu und nahm die Bestellungen entgegen.
„Sie sprechen ganz gut Französisch“ sagte sie anerkennend „wo haben Sie die Sprache gelernt?“
„An Bord, in meinen Freiwachen.“
„Gefällt Ihnen die Bretagne?“
„Ja, sehr. Ich liebe diese raue Landschaft mit ihren schroffen Felslandschaften. Auf der anderen Seite habe ich auch stille Buchten gesehen, da kann man im Sommer sicher gut baden. Und was ich nicht verschweigen will, ich bin ein großer Freund der bretonischen Küche. Erst hier habe ich erkannt, wie vielfältig das Angebot an Meerestieren sein kann. Insgesamt finde ich diesen Landstrich sehr schön.“
„Aber Sie werden bald wieder an Bord gehen“ sagte Marie „freuen Sie sich darauf?“
„Freuen ist das falsche Wort. Ich bin gern auf dem Boot, aber ich habe es Ihnen schon gesagt, lieber würde ich im Frieden auf einem Dampfer fahren. Aber es sind nun eben andere Zeiten.“
Die beiden verbrachten noch einen angenehmen Abend miteinander und unterhielten sich über alle möglichen Themen, bloß nicht über den Krieg. Am Morgen darauf fuhr Martin Haberkorn mit dem LKW und den Ersatzteilen zurück zum Stützpunkt. Sie wollten sich Briefe schreiben.
Bei der Reparatur des Bootes hatte es doch noch erhebliche Probleme gegeben, so dass statt der geplanten 4 Wochen fast 6 vergingen. Vor allem der Austausch der Batterieanlage war kompliziert gewesen und offensichtlich von den französischen Werftarbeitern, mit Vorsatz oder aus Unkenntnis, auch nicht ordnungsgemäß ausgeführt worden. Falsche Polungen, locker eingesetzte Batteriezellen, die Liste der Mängel war lang und führte zu erheblichen Nacharbeiten. Am 25. Mai lief das Boot zur Abnahmefahrt aus. Der Tieftauchversuch verlief ohne Beanstandungen. Haberkorn achtete genau auf die Reaktionen des Bootes und lauschte auf verdächtige Geräusche. Bei 180 Metern fing der Druckkörper an sirrende Klänge zu erzeugen und ein Knacken drang durch das Boot. Er wusste, dass dies nur die Reaktionen der hölzernen Einbauten waren. Als das Boot langsam wieder stieg war die Erleichterung der Männer deutlich zu spüren. Allen war bekannt, dass sie in dieser Tiefe noch nichts befürchten mussten, oft waren sie bei Verfolgungen schon tiefer gewesen. Haberkorn war immer noch beeindruckt, dass der nur 2 Zentimeter dicke Druckkörper diesen enormen Belastungen in der Tiefe standhielt. In 40 Meter pendelte er das Boot durch und der Horcher überprüfte das Gruppenhorchgerät. Alles funktionierte tadellos. Dann befahl der Kommandant, eine 2 Meilen Strecke mit E-Maschinen Höchstfahrt zu laufen.
„Mal sehen, ob die neue Batterie uns ein bisschen schneller macht“ sagte er.
Der Fahrtmesser zeigte 8,4 Knoten an, 7,6 waren der Normwert.
„Fast einen Knoten schneller als üblich“ stellte Haberkorn fest „aber es sind ja auch die Schalttafeln und die E-Maschinen gründlich überholt worden.“
„Gibt es sonst noch etwas zu bemängeln?“
„Paar Kleinigkeiten. Der Funkpeiler leckt leicht, eine Abgasklappe muss justiert werden. Dürfte die Werft in einem halben Tag geschafft haben.“
„Dann könnten wir übermorgen ausrüsten?“
„Wenn alles nach Plan läuft, ja.“
Am 26. Mai 1942 legte das Boot am frühen Vormittag voll ausgerüstet ab und begann den Marsch in das Operationsgebiet. Wegen der immer mehr zunehmenden Luftbedrohung ließ der Kommandant sofort nach Erreichen der Tiefwasserlinie tauchen. Mit halber E-Maschinenfahrt und damit knapp 4 Knoten Geschwindigkeit, also ungefähr 7,5 Kilometer pro Stunde, bewegte sich das Boot langsam unter Wasser vorwärts.
„Wie lange bleiben wir unten, Obersteuermann“ fragte der Kommandant.
„5 Stunden würde ich sagen. Dann haben wir 20 Seemeilen geschafft. Das dürfte reichen, um aus der unsicheren Zone herauszukommen.“
„Na gut. Schmutt, mal ne Kanne Negerschweiß aufsetzen. Da können wir uns ja jetzt mal n Weilchen in die Messe zurückziehen. I WO, Sie fahren.“
Der Kommandant, Haberkorn und der II WO saßen an der Back und tranken Kaffee. In der Geborgenheit der Tiefe waren die Männer entspannt und plauderten über dies und das. Haberkorn war nicht ganz bei der Sache, er musste an Marie denken. Dass er 40 Meter unter der Wasseroberfläche in einer Stahlröhre saß und vor kurzem darin Kaffee getrunken hatte, nahm er gar nicht mehr wahr.
Fred Beyer, 27. Mai 1942, Russland
Die Panzerkompanie hatte Stellungen westlich von Suchinitschi bezogen und war in den letzten Tagen nicht in Gefechte verwickelt gewesen. Andere motorisierte deutsche Einheiten hatten einen Vorstoß auf Kirow unternommen, und waren gut vorangekommen. Die zwischen Wjasma und Spas Demenskoje eingeschlossenen Kavalleriedivisionen der Russen waren von Norden und Süden her erfolgreich angegriffen worden und den Deutschen fielen mehrere Orte in die Hand. Das zum Teil unwegsame Gelände sowie das wechselhafte Wetter mit Regenschauern an diesem Frontabschnitt begünstigten den Einsatz von Kavallerie, und die oft vollkommen unberechenbaren Vorstöße der Russen ließen auch hinter der Front der Deutschen keine Ruhe aufkommen. Demzufolge lag momentan ein Schwerpunkt der deutschen Handlungen in der Vernichtung dieser Kräfte, und die offensiven Bemühungen weiter nach Osten vorzudringen, mussten dem Rechnung tragen, und wurden weitestgehend zurückgestellt. Beide Seiten tasteten sich nur mit örtlich begrenzten Aktionen ab. Fred Beyer und seine Männer hatten die relativ ereignislosen letzten Tage dafür genutzt, ihre persönliche Ausrüstung auf Vordermann zu bringen und sich auszuruhen. Gestern waren aber Gerüchte aufgekommen, dass die Panzerkompanie südlich von Wjasma unterstützend bei der Einkesselung der russischen Kavallerieeinheiten mithelfen sollte, um diese unschädlich zu machen.
„Panzer gegen Pferde“ hatte Bergner gemault „was soll der Unfug? Die sind doch x-Mal schneller als wir. Die können wir doch gar nicht kriegen.“
„Du musst da schon ein bisschen weiterdenken“ erwiderte Lahmann „wir werden doch nicht allein mit den Panzern antreten. Unsere eigenen Reiter werden die Iwans treiben und wir haben die Aufgabe, zusammen mit anderen Infanterieeinheiten und den motorisierten Verbänden den Sack dann zu zumachen.“
„Kavallerie“ meinte Müller „die ist doch vollkommen überholt. Damit konnte man früher sicher was ausrichten, aber heute?“
„Täusch dich mal nicht“ sagte Beyer „ist unsere Infanterie durchgehend motorisiert? Überhaupt nicht. Da stehen wir erst ganz am Anfang, und deswegen brauchen wir auch noch Unmassen an Pferden. Und auch taktisch haben berittene Einheiten ihren Sinn. Sie sind viel schneller und beweglicher als die Fußlatscher. Die zukünftige Kriegsführung wird aber auf Motorisierung setzen. Wenn wir mit unseren Panzern vorpreschen bleibt die Infanterie doch meist zurück, weil sich die Männer zu Fuß bewegen müssen. Ich stelle mir vor, dass die Infanterie in leicht gepanzerten Fahrzeugen den beweglichen schweren Waffen folgt und damit unterstützen kann, wenn es erforderlich ist. Die jetzt noch wenigen Halbkettenfahrzeuge sind der Anfang dafür. Aber unsere Industrie liefert einfach zu wenig.“
„Das können die Russen besser“ erwiderte Müller „wir schießen Massen an T 34 ab, aber die ersetzen die im Nu. Vielleicht hat die Führung die ganze Sache doch ein wenig unterschätzt.“
„Selbst wenn so sein sollte, wir werden und müssen sie schlagen“ war Bergners Entgegnung „denn falls wir scheitern würden kann sich doch wohl jeder vorstellen, was dann mit Deutschland passieren würde.“
Die Männer saßen vor ihren Zelten auf dem Boden und rauchten. Es waren angenehme 18 Grad und der Boden war vom letzten Regen gut abgetrocknet. Die Panzer standen rechts und links neben einem durch den Wald führenden Weg und waren durch das dichte Blätterdach gut getarnt. Insgesamt machte alles fast einen friedensmäßigen Eindruck. Der Tross hatte ebenfalls Deckung im Wald gesucht und die Männer konnten an der Feldküche warmes Essen fassen. Eine Latrine war gegraben worden und Fred Beyer machte sich auf den Weg dorthin. Eigentlich kannte er es seit Beginn des Krieges gar nicht mehr anders, als seine Notdurft im Freien zu verrichten. Auch an das Schlafen in allen möglichen und unmöglichen Quartieren oder im Zelt hatte er sich gewöhnt, es war selbstverständlich geworden, dass sie meist nie lange an einem Ort blieben. Wir sind moderne Nomaden dachte er sich, immer in Bewegung, Sesshaftigkeit kennen wir gar nicht mehr. Sein Lebensrhythmus und der der anderen Männer war an verschiedenen Tagen sehr unterschiedlich. Wenn sie im Gefecht standen waren alle angespannt, schließlich konnten sie getötet oder verwundet werden. Dann gab es aber Phasen, in denen sie in einem Bereitstellungsraum oder einer Stellung herumsaßen und viel Zeit hatten, die sie versuchten einigermaßen sinnvoll zu füllen. Früher in der Kaserne hatten die Männer gebastelt oder gelesen. Jetzt nutzten sie die Zeit, um Briefe zu schreiben oder Karten zu spielen. Gerade dieser Gegensatz zwischen höchster Nervenanspannung und relativer Ruhe rief bei einigen Soldaten bestimmte Marotten hervor, weil sie zwischen diesen sehr unterschiedlichen Zuständen nicht schnell genug wieder umschalten konnten. Beyer sah es bei seinen Männern deutlich. Müller, der Fahrer, hatte kein Interesse am Kartenspiel und schrieb nur aller 2 Wochen nach Hause. Auch heute hatte er wieder am Panzer dieses und jenes unter die Lupe genommen und einen Auspufftopf gerichtet. Er musste sich wie zwanghaft dauernd beschäftigen, und was lag da näher, als sich um das Fahrzeug zu kümmern, auch wenn eigentlich gar nichts zu tun war. Lange richtig ruhig sitzen konnten die anderen auch nicht, nur Anton Häber schien in sich zu ruhen. Beyer hatte den schweigsamen und knorrigen Mann immer mehr schätzen gelernt, denn er erfüllte seine Aufgaben ohne viel Aufhebens. Wenn sie im Kampf standen konnte Beyer, da er links und erhöht von Häber saß erkennen, wie scheinbar mühelos der Mann die 7,5 Zentimeter Granaten in das Rohr schob. Immerhin wog so ein Geschoß fast 7 Kilogramm und auch wenn sie das Fahrzeug aufmunitionierten zeigte der Ladeschütze keine Schwäche.
„Was machen wir jetzt mit dem angefangenen Abend“ fragte Lahmann in die Runde.
„Geh doch Holz sammeln, dann machen wir uns später ein schönes Feuerchen, stecken Bratwürste auf Stöcke und trinken alle gemütlich Bier“ schlug Bergner spöttisch vor.
„Wir könnten ja auch ins Kino gehen“ meinte Müller „mal wieder n paar hübsche Puppen ankucken. Oder in den Tanzsaal. Oder in den Biergarten. Wenn ich mir das so überlege, vor fast einem Jahr sind wir losgezogen, und jetzt hocken wir hier in einem Wald rum und können uns nicht wie die Burschen zu Hause vergnügen. Das ist doch ungerecht!“
„Was ist daran ungerecht“ erwiderte Lahmann „jeder hat seine Aufgabe. Die in der Heimat liefern uns die Waffen, und wir kämpfen damit, das ist doch ganz einfach, oder? Und hat dich überhaupt einer gefragt, ob du zur Truppe willst oder lieber in deinen Betrieb gehen würdest? Na also.“
Fred Beyer dachte über Lahmanns Worte nach. Tatsächlich war er bis auf die zwei kurzen Urlaube seit Beginn des Russlandfeldes dabei. Davor in Frankreich. Nochmals davor in Polen. Ganz zum Anfang in der Ausbildung zum Panzerfahrer. Für diese lange Zeit hatte er bis jetzt erstaunlich viel Glück gehabt und war nur leicht verwundet worden. Tatsächlich war es so, dass der Soldatenalltag sein Leben vollständig bestimmte und er sich nicht einmal mehr fragte, ob er jetzt nicht in einem Hörsaal sitzen müsste um ein Studium zu absolvieren. Eher war es so, dass er in den klaren Befehlsstrukturen der Truppe ein Regelwerk sah, dessen Forderungen er bereitwillig ausführte. Dass er bald befördert werden würde stand für ihn außer Frage, bis jetzt konnte er 17 bestätigte Panzerabschüsse auf seinem Konto verbuchen. Mit dem neuen Fahrzeug waren seine Chancen gestiegen, im Gefecht weiter erfolgreich zu sein.