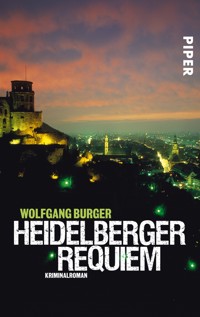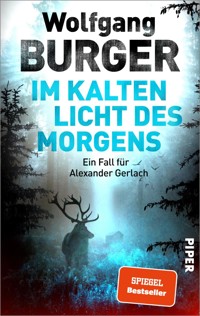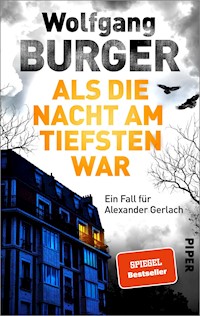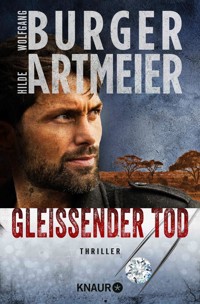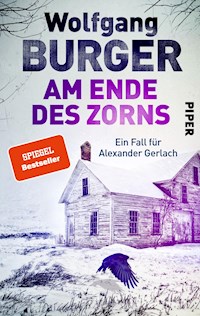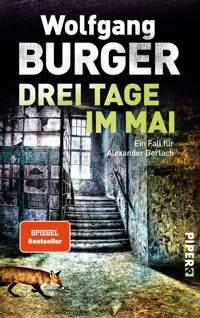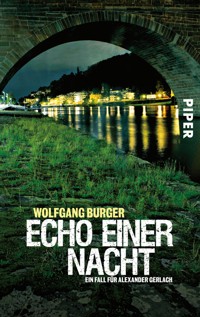
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Schon seit Wochen ist der kleine Gundram wie vom Erdboden verschluckt. Kein Wunder, dass der Heidelberger Kriminalrat Gerlach unter Druck steht – die Eltern und die Medien erwarten endlich Erfolge, und auch die Staatsanwaltschaft wird immer nervöser. Da passt es ihm eigentlich gar nicht, dass seine Töchter ihm von einem weiteren möglichen Entführungsfall erzählen: In der Nachbarschaft einer Freundin soll ein kleiner Junge verschwunden sein. Immer mehr deutet darauf hin, dass es sich um einen Serientäter handelt. Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe
5. Auflage Februar 2012
ISBN 978-3-492-95461-7
Deutschsprachige Ausgabe: © Piper Verlag GmbH 2009 Umschlag: semper smile, München Umschlagfoto: Michael Cich
1
Wie uns zum Hohn schien zu allem die Sonne.
Ein verlogener, farbenglühender Oktobernachmittag, milde, würzige Waldluft, überall am Boden dieses schreiend bunte Laub und um mich herum eine kleine Ansammlung schwitzender Menschen, von denen keiner einen Blick für die Schönheit der Szenerie hatte. Über uns, in der Krone einer mächtigen Buche, randalierte ein Schwarm aufgekratzter Stare, die sich vermutlich über ihren Reiseweg in den Süden nicht einig wurden.
»Und?«, fragte ich den hünenhaften Chef der Spurensicherung, der eben in weißem Schutzanzug und gelben Stiefeln den nicht allzu steilen Hang zu uns heraufstapfte. »Kann man schon irgendwas sagen?«
Er stieß eine Mischung aus Fluch und Seufzer aus. Auch er hatte Kinder, hatte er mir vorhin im Auto erzählt. Ein Mädchen von siebzehn Jahren und einen Jungen. Der war zwölf, ein Ass im Fußball und sein großer Stolz. Bis vor wenigen Wochen hatte der Kollege, dem der Ruf vorauseilte, einer der Besten seines Fachs zu sein, noch beim Landeskriminalamt in Stuttgart gearbeitet. Seine Versetzung nach Heidelberg war ein ziemlicher Karriereknick gewesen. Dennoch hatte er im Sommer auf eigenen Wunsch zu uns gewechselt. Seine Frau, eine eingefleischte Kurpfälzerin, hatte auch nach fünfzehn Jahren im Schwabenland immer noch gefremdelt.
»Hätte ich damals bloß auf meine Mutter gehört«, knurrte er augenrollend und wischte sich mit einem zerknüllten Papiertaschentuch den Schweiß von der Stirn, »und was Gescheites gelernt. Nein, man kann noch nichts sagen.«
Etwa dreißig Meter von uns entfernt, am Fuß des Abhangs, gruben zwei seiner Männer in den gleichen weißen Anzügen vorsichtig, Schicht um Schicht den Waldboden auf. Die beiden arbeiteten wie in Zeitlupe, jede Bewegung wirkte einstudiert und tausendfach geübt, und für nicht Eingeweihte hatte das Ganze sicherlich viel Ähnlichkeit mit absurder Pantomime. Dort, wo sie gruben, war der Boden weich. Zu weich. Hin und wieder bückte sich einer von den beiden, um etwas aufzuheben, vorsichtig von loser Erde zu befreien und mit spitzen Fingern auf einer müllsackblauen Plane abzulegen.
Es waren Knochen.
Kleine Knochen.
Das verschüchterte junge Paar, welches das Grab entdeckt hatte, hielt sich in meiner Nähe, als fühlte es sich hier sicherer. Der Mann rauchte Kette, seit er vor wenigen Minuten verlegen um Erlaubnis gefragt hatte. Ich hatte ihm eingeschärft, dass er hier wegen eventueller Spuren weder Asche noch Kippen verstreuen durfte. Seine kleine und ein wenig pummelige Frau zerrte an ihrer möglicherweise sogar echten Perlenkette herum, als wollte sie sich das altmodische Ding vom Hals reißen. Und natürlich musste ich bei dem Anblick an Theresa denken. Auch sie besaß ein solches Schmuckstück, ein Erbstück von irgendeiner Urgroßmutter. Wann hatte sie die eigentlich zum letzten Mal getragen?
Schon wieder bückte sich einer der Männer dort unten. Diesmal schien es ein etwas längerer Knochen zu sein, den er aus der dunklen, fruchtbaren Erde zog. Für mich als Laien sah es nach Oberschenkel aus. Aber wer weiß schon, wie lang der Oberschenkelknochen eines Sechsjährigen ist? Die Fläche, die sie aushoben, hatte exakt die Maße eines Kindergrabs.
Die Frau mit der Halskette wandte sich ab und erbrach sich, ohne zuvor auch nur eine Sekunde zu würgen, in einen herbstbunten Laubhaufen.
»Passen Sie auf, dass Ihre Jacke nicht Feuer fängt«, sagte ich zu ihrem überschlanken Mann, als er seine halb gerauchte Zigarette an einem Baumstamm ausdrückte und brav in der Tasche seines grauen Leinensakkos versenkte, nur, um sich anschließend sofort eine neue anzustecken. Der zementfarbene Pudel des Paares, der vorhin eine halbe Ewigkeit lang hysterisch herumgekläfft hatte, schlief jetzt friedlich zu Füßen seines Herrchens. Der Hund war der Einzige hier, der die Sonne genoss.
»Wenn sich Ernesto nicht so aufgeführt hätte«, stieß der Mann zwischen zwei hektischen Lungenzügen hervor, »wir hätten doch im Leben nicht gemerkt, dass da unten was ist! Wer rechnet denn auch mit so was?«
Neben Ernesto stand ein helles Weidenkörbchen, halb voll mit Pilzen, von denen man nur hoffen konnte, dass alle essbar waren. Die Frau hörte endlich auf zu würgen. Ich reichte ihr ein Päckchen Papiertaschentücher.
»Wann kommt denn jetzt endlich der Medizinmann?«, maulte der Chef der Spurensicherung, der sich inzwischen ebenfalls eine angesteckt hatte.
»Professor Hültner sollte längst hier sein«, antwortete die Erste Kriminalhauptkommissarin Klara Vangelis an meiner Stelle. Sie hatte sich in der Nähe umgesehen und gesellte sich eben wieder zu uns. »Er wird sich verfahren haben.«
Irgendwo, nicht allzu weit entfernt, begann ein Glöckchen zu bimmeln.
Es war später Nachmittag, wir standen in einem lichten Buchenwald unweit von Beerfelden, und in Gedanken war ich schon bei der Pressekonferenz, an der ich als Chef der Heidelberger Kriminalpolizei am nächsten Vormittag wieder einmal würde teilnehmen dürfen. »Entführter Junge nach über zwei Monaten tot aufgefunden« würde noch die harmloseste Schlagzeile sein. »Heidelberger Kripo versagt auf der ganzen Linie« vielleicht nicht einmal die schlimmste.
Obwohl ich seit zwanzig Jahren nicht mehr rauchte, überfiel mich plötzlich eine fast übermächtige Lust auf eine Zigarette.
Anfang August war es gewesen, als die Eltern von Gundram Sander ihr einziges Kind als vermisst meldeten. An einem hitzeflirrenden Sonntagnachmittag hatte der Junge draußen gespielt, wie er es schon oft getan hatte. In einem wohlhabenden Viertel Sandhausens, eines Städtchens etwa zehn Kilometer südlich von Heidelberg, wo abgesehen von gelegentlichen Einbrüchen oder handgreiflichen Ehestreitigkeiten seit Jahren nichts Erwähnenswertes vorgefallen war. Am Tag seines Verschwindens war Gundram sechs Jahre und zehn Monate alt gewesen. Ein aufgewecktes Kind, das von niemandem Süßigkeiten annahm und niemals, niemals, niemals freiwillig in ein fremdes Auto steigen würde, wie die Mutter ein ums andere Mal beteuert hatte.
Wie in solchen Fällen üblich, hatten die zuständigen Kollegen die Angelegenheit zunächst mit gebremstem Schaum behandelt und versucht, erst einmal die aufgelösten Eltern zu beruhigen. Nahezu stündlich verschwand irgendwo in Deutschland ein Kind, nur um kurze Zeit später mehr oder weniger vergnügt und mehr oder weniger fern von zu Hause aufgefunden zu werden. Nahezu jeden Jungen übermannte früher oder später der Drang, die Welt zu entdecken. Mädchen machten gern irgendwann ihren ersten Einkaufsbummel auf eigene Faust. Ein pfiffiger Knirps von dreieinhalb Jahren hatte es letzten Sommer mit dem Intercity bis nach Hannover geschafft, indem er sich einfach neben ein älteres Paar setzte und so tat, als gehörte er zur Familie.
Aber Gundram tauchte nicht wieder auf. Nicht nach vier Stunden und nicht nach sechs und auch nicht am nächsten Tag. Das Handy, das er auf Wunsch seiner Eltern immer bei sich trug, war etwa eine Viertelstunde, nachdem er das Haus verlassen hatte, aus dem Netz verschwunden und nicht mehr zu orten gewesen. Es gab keine Spuren, keine Zeugen, nichts. So gerieten unsere Ermittlungen bald ins Stocken, und ebenso bald waren die Eltern nicht mehr gut auf mich und meine Mitarbeiter zu sprechen.
Erst gab es einige unerfreuliche Anrufe, und schon am dritten Tag warfen sie der Polizei öffentlich Untätigkeit und später Schlimmeres vor. Was hatten sie erwartet? Dass wir gleich mit Hundertschaften jeden Winkel der Umgebung absuchten? Mit Lautsprecherwagen durch die Straßen fuhren? Hundestaffeln durchs Gelände scheuchten? All das war selbstverständlich geschehen, aber erst in den folgenden Tagen und Wochen.
Und leider erfolglos. Gundram Sander blieb verschwunden.
Auf der Suche nach Zeugen läuteten die Mitarbeiter der zunächst kleinen, später großen Sonderkommission an jedem Haus im Viertel. Mit allen erdenklichen Mitteln versuchten sie, Menschen aufzutreiben, die zur fraglichen Zeit etwas beobachtet oder wenigstens einen kleinen Jungen auf seinem Rad gesehen hatten. Gleichzeitig steigerten sich die Eltern immer weiter in ihren Zorn auf die Polizei hinein. Eine Woche nach dem Verschwinden ihres Kindes begannen sie mit Inbrunst und leider auch beachtlichem Erfolg, die Presse auf uns zu hetzen.
Die Stare flogen auf und schwirrten in einem wirbelnden Schwarm davon. Ich beneidete sie. Einfach fortfliegen dürfen, einfach alles hinter sich lassen: den Stress mit ernstlich besorgten Staatsanwälten und den Ärger über neunmalkluge Zeitungsschreiber, die Sorgen um einen verschwundenen Jungen, der nach aller Erfahrung und Wahrscheinlichkeit längst nicht mehr lebte.
Wieder ein Knochen. Ein kleiner, diesmal. Auch mir wurde allmählich übel.
»Bisschen arg verwest für zehn Wochen«, meinte Vangelis leise zu mir. »Da ist ja praktisch schon nichts mehr dran!«
Spätestens morgen Abend würde ich mich wieder einmal im Fernsehen bewundern dürfen. Kriminalrat Alexander Gerlach: nicht der Held des Tages, sondern der Versager des Jahres. Der Mann, der es mit seinen vielen Beamten und modernster Technik nicht schaffte, in zweieinhalb Monaten auch nur eine winzige Spur eines vermissten Sechsjährigen zu finden. Nein, eines Siebenjährigen, denn vor zwei Wochen, am siebten Oktober, hatte Gundram Sander Geburtstag gehabt. Hätte er Geburtstag gehabt, musste man nach so langer Zeit wohl sagen, auch wenn sich alles in mir gegen diesen Gedanken sträubte.
Auf dem gut ausgebauten Waldweg, der etwa zwanzig Meter hinter uns fast schnurgerade von Süden nach Norden führte, bremste ein grauer Mercedes und kam hinter unseren Fahrzeugen schlingernd zum Stehen. Ein älterer und offensichtlich sehr wütender Mann warf die Tür zu und marschierte zu uns herüber. Da er die falschen Schuhe trug, rutschte er mehr, als er ging. Mehrmals rettete ihn nur ein rascher Griff nach dem nächsten Baum vor dem Sturz ins trockene Laub. Seine Laune wurde dadurch nicht besser.
Mit grimmigem Nicken grüßte er in die Runde, reichte mir die Hand.
»Hültner mein Name, Tag allerseits. Sorry, aber mein Navi hat mal wieder seine Tage. Ich habe mich mindestens fünf Mal verfahren.«
Professor Hültner mochte zehn Jahre älter sein als ich, Mitte fünfzig, trug einen silbergrauen Dreitagebart zu Designerbrille, Bluejeans und einem eisblauen Poloshirt von René Lezard. Sein Händedruck war schmerzhaft kräftig. Vermutlich spielte er Golf mit gutem Handicap.
Gundrams Eltern waren nicht unvermögend, weshalb wir anfangs von einer Lösegelderpressung ausgegangen waren. Der Vater war Inhaber und Chef einer kleinen Werbeagentur und schien damit nicht schlecht zu verdienen. Ich hatte das Übliche veranlasst: lückenlose Überwachung aller Festnetzanschlüsse und Handys, zwei Beamte, immer ein Mann und eine Frau, die den Eltern rund um die Uhr Gesellschaft leisteten. Nebenbei hatten wir diskret das Umfeld durchleuchtet. Gab es Angestellte der Werbeagentur, die Grund hatten, auf ihren Chef sauer zu sein? Entlassene Angestellte? Nachbarn, mit denen man im Streit lag? Missgünstige Verwandte? Aber natürlich auch: bekannte Pädophile in der näheren oder weiteren Umgebung?
Es kam jedoch keine Lösegeldforderung. Stattdessen die üblichen Briefe und Anrufe von Witzbolden und Trittbrettfahrern – kein Wunder in Anbetracht des Aufsehens, das die Eltern erregten. Als Fachmann für Marketingangelegenheiten verfügte Mike Sander über vorzügliche Kontakte zu den Medien. Und zu meinem Leidwesen machte er in den Wochen nach dem Verschwinden seines Sohnes überreichlich Gebrauch davon.
Der Gerichtsmediziner hangelte sich auf seinen glatten Ledersohlen weiter von Baum zu Baum den Hang hinab. Endlich war er bei den beiden Spurensicherern angekommen, die einen Schritt zurücktraten, und ging neben der blauen Plane in die Hocke. Wir hörten ihn eine Weile maulen und schimpfen, konnten jedoch nichts verstehen.
Das Grab war aufgewühlt gewesen, als das Paar mit dem Pudel es vor etwa drei Stunden fand. Wer immer es angelegt hatte, hatte nicht tief genug gegraben. Wildtiere hatten sich daran zu schaffen gemacht, vermutlich auch schon das eine oder andere daraus verschleppt.
Mit der Achtlosigkeit des Profis kramte der Professor in den schmutzigen Knochen herum. Schließlich richtete er sich auf, drückte stöhnend sein Kreuz durch und begann, den Hang wieder hinaufzusteigen, den er vor kaum zwei Minuten hinabgeschlittert war.
Wenn nach einer Kindesentführung kein Lösegeld gefordert wird, dann bleiben erfahrungsgemäß zwei Möglichkeiten: Bei der Entführung ist etwas furchtbar schiefgegangen, und das Kind ist tot. Oder aber wir hatten es mit einem Sexualdelikt zu tun. Auch im zweiten Fall war nach so langer Zeit die Wahrscheinlichkeit gering, dass Gundram noch lebte. Längst waren die Alibis aller einschlägig Vorbestraften im Umkreis von zweihundert Kilometern überprüft. Es war nichts dabei herausgekommen.
Aber all diese Überlegungen waren letztlich Spekulation. Noch immer wussten wir nicht einmal, ob wir es tatsächlich mit einer Entführung zu tun hatten. Noch immer bestand die Möglichkeit, dass Gundram einen Unfall gehabt hatte und wir aufgrund irgendwelcher seltsamer Umstände seine Leiche nicht finden konnten. Wir wussten im Grunde nichts, außer dass das Kind am Abend des fünften August nicht nach Hause gekommen war.
Und das war das Schlimmste, nicht nur für die Eltern: die Ungewissheit.
»Was soll das?«, brüllte der Professor mit rotem Kopf, als er zehn Schritte von mir entfernt war. »Wollen Sie mich verarschen, oder was?«
Er brauchte noch einige Sekunden, bis er schwer atmend vor mir stand.
»Ein Hund!«, blaffte er. »Da unten hat einer seinen toten Hund verbuddelt! Das sieht doch jeder halbwegs intelligente Mensch, dass das keine Kinderknochen sind! Und für so einen Quatsch lassen Sie mich durch den halben Odenwald gurken und meinen Lack ruinieren?«
Klara Vangelis stieß einen abgrundtiefen Seufzer aus. Vermutlich dachte sie dasselbe wie ich: Lieber tausend Hundegräber als ein einziges für ein Kind. Lieber das Gespött der Boulevardpresse, als am Tod eines Jungen mitschuldig zu sein, der vor wenigen Wochen seinen ersten Schultag hätte erleben sollen.
Ich hätte den wutschnaubenden Professor am liebsten an mich gedrückt. Plötzlich war wieder Hoffnung. Wahrscheinlichkeit nicht, aber Hoffnung. Es hatte Fälle gegeben, da waren Kinder nach Monaten oder Jahren wieder aufgetaucht. Selten, ja, aber es hatte sie gegeben.
Solange wir Gundrams Leiche nicht hatten, war noch alles möglich.
2
Natascha Sander, geborene Dobroljubowa, gab noch am selben Abend in der üblichen, perfekt dosierten Mischung aus Verzweiflung, Empörung und Erleichterung ein Fernsehinterview. Einmal mehr wurde die Frage gestellt, ob bei der hiesigen Polizei die richtigen Leute an den wichtigen Stellen säßen. Ob es nicht an der Zeit wäre, den einen oder anderen verantwortlichen Herrn gegen jemanden auszutauschen, der seiner Aufgabe besser gewachsen war.
Mehr aus Pflichtgefühl als aus Interesse hatte ich die Flimmerkiste eingeschaltet und hörte mir an, wie ich, meine Leute und unsere Arbeit schlechtgeredet wurden. In ihrem Schlussstatement erklärte die schöne Mutter mit großen Augen, sie und ihr Mann hätten das Vertrauen in die Behörden nun endgültig verloren. Man würde ab sofort die Zusammenarbeit mit der Polizei verweigern und auf eigene Faust Nachforschungen anstellen. Wer sachdienliche Hinweise zu machen habe, möge sich bitte über die eingeblendete Telefonnummer an sie wenden. Ich notierte die Nummer auf dem Rand der Zeitung.
Gundrams Eltern spielten die Klaviatur der Medien perfekt. Schon am dritten Tag hatte es eine Internetseite gegeben: »Rettet unser Kind!«, die es bald auf tausend Klicks am Tag brachte. Mike Sander konnte es sich offenbar erlauben, seine Firma vorübergehend im Stich zu lassen und sich mit aller ihm zur Verfügung stehenden Energie auf die Rettung seines Sohnes zu stürzen.
Seine Frau, vor Jahren einmal beinahe zur Miss Sankt Petersburg gekürt, wie man bald in jeder Zeitung lesen durfte, hatte bis zur Geburt ihres Kindes ebenfalls in der Werbebranche gearbeitet. Als ehemaliges Fotomodel den kalten Blick der Kameras gewohnt, unterstützte sie ihren Mann nach Kräften. Das eine Mal gab sie die verzweifelt um Fassung ringende Mutter in kühlem Grau, dann wieder die flammend Empörte in apartem Bordeauxrot. Einmal brach sie telegen schluchzend zusammen, ein anderes Mal setzte sie mit steinerner Miene und nur ganz leicht bebender Stimme eine Belohnung von fünfzigtausend Euro aus für denjenigen, der ihr geliebtes Kind zurückbrachte.
Zumindest in einem Punkt hatten die Eltern erreicht, was sie wollten: Nie zuvor war die Heidelberger Polizei einem Fall mit mehr Aufwand und Personal nachgegangen. Und nie zuvor hatte es auch nur halb so viele aufgeregte Anrufe, anonyme Hinweise, abstruse Zeugenaussagen, irrwitzige Selbstanzeigen und getürkte Lösegeldforderungen gegeben. Bald hatten wir aufgehört, sie zu zählen, all die Gundrams, die angeblich in Eppelheim oder Verona, auf Mallorca, Zypern oder Hawaii gesichtet worden waren. All die Zeugen, die nächtliche Kinderschreie im Nachbarhaus gehört haben wollten, wo dieser unsympathische Kerl hauste, der niemals duschte und dafür umso mehr trank. Die Zahl der vermeintlichen Kindesentführungen war in ungeahnte Höhen geschnellt. Eltern wählten schon die Hundertzehn, wenn sie ihren Sprössling länger als zehn Minuten nicht mehr gesehen hatten. Und niemand unter meinen Leuten wagte noch, irgendetwas davon auf die leichte Schulter zu nehmen.
Mike Sander hatte während des Fernsehauftritts mit finster entschlossener Miene schräg hinter seiner schönen Frau gestanden, die Rechte auf ihre schmale Schulter gelegt, als müsste er sie stützen oder ihr Mut machen.
Nun trat er vor und verlas mit tonloser Stimme eine Erklärung: »Wir haben beschlossen, die ausgesetzte Belohnung noch einmal zu erhöhen. Wer uns, gleichgültig auf welchem Wege, unseren Sohn zurückbringt, erhält von uns eine Million Euro.« Er faltete das Blatt sorgfältig zusammen, von dem er die paar Worte abgelesen hatte, und blickte dann direkt in die Kamera. »Das ist alles, was wir aufbringen können. Mehr haben wir nicht. Wir werden unser Haus verkaufen müssen und unsere Firma. Aber das Leben Gundrams ist uns mehr wert als alles andere.«
Er senkte den Blick, und ich dachte schon, das wäre alles gewesen. Da sah er noch einmal auf und fügte mit rauer Stimme hinzu: »Dieses Angebot gilt übrigens auch für den Täter selbst. Wir werden Sie nicht anzeigen. Wir wollen Ihren Namen nicht wissen und nicht die Gründe für Ihr Tun. Wir wollen keine Rache. Wir wollen nur eines: unser Kind zurück.«
Ich schaltete den Fernseher aus und legte die Füße auf den Couchtisch. Am nächsten Morgen würde die Hölle über mich hereinbrechen. Nicht wenige Menschen würden für eine Million ohne zu zögern ihre Mutter ins Gefängnis oder ihren Großvater ins Grab schicken.
Eigentlich hätte ich jetzt gar nicht zu Hause sitzen und mich ärgern, sondern neben Theresa liegen sollen, meiner Geliebten. Dienstag war unser Tag. Heute hatte meine Göttin jedoch überraschend abgesagt. Sie hatte nicht einmal Zeit gefunden für Erklärungen. Ihre knappe SMS hatte nervös geklungen, als bahnte sich ein Problem an. Ich konnte nur hoffen, dass die plötzliche Aufregung nichts mit der Tatsache zu tun hatte, dass sie verheiratet war.
Ich nahm das oberste Buch vom Stapel, der auf dem Couchtisch lag, und versuchte, ein wenig zu lesen. Theresa hatte mir schon vor Monaten Albert Camus ans Herz gelegt und mir alles geliehen, was sie von ihm besaß. Außer »Die Pest« hatte ich zuvor nichts von ihm gelesen. Camus war ein hartes Brot, hatte ich bald festgestellt. Ein Viertel fand ich genial, drei Viertel unverständlich.
Plötzlich hörte ich aufgekratzte Mädchenstimmen im Treppenhaus, ein Schlüssel wurde ins Schloss geschoben, die Wohnungstür flog auf.
Ich nahm die Füße vom Tisch.
Meine Zwillinge wirbelten herein, küssten mich achtlos links und rechts auf die Wangen, »Abend, Paps«, und plumpsten atemlos in die Sessel.
Ich klappte das Buch zu.
»Ihr wart bei Silke?«
»Hm.«
»Und habt Französisch gelernt?«
Ihr Nicken geriet nicht ganz überzeugend.
»Ihr müsst das ernster nehmen, Kinder.«
»Wie sind keine Kinder mehr!«
»In der ersten Arbeit habt ihr eine Sechs geschrieben. Demnächst schreibt ihr die zweite. Und wenn das so weitergeht …«
»Ja, ist ja gut!«
»Wir haben ja auch gelernt.«
»Echt! Ganz ehrlich!«
Sie hatten etwas auf dem Herzen. Wäre es nicht so gewesen, dann wären sie längst in ihrem Zimmer verschwunden, an den neuen PC. Der stand dort erst seit wenigen Wochen, seit ihrem fünfzehnten Geburtstag, und in beängstigend kurzer Zeit hatte das Gerät sich zum Lebensmittelpunkt meiner Töchter entwickelt. Nahezu jeden Abend hockten sie davor und kicherten und alberten und schienen sich dabei so prächtig zu amüsieren, dass mir von Tag zu Tag mulmiger wurde.
»Paps«, fing Louise an. »Stell dir vor, es ist schon wieder ein Kind entführt worden!«
»Fangt ihr jetzt auch noch mit dem Unsinn an? Eine Kindesentführung reicht mir vollkommen.«
»Hab ich’s nicht gesagt?« Sarah warf Louise einen vielsagenden Blick zu. »Er schimpft.«
»Ich schimpfe nicht«, widersprach ich. »Ich kann das Wort Entführung nur nicht mehr hören.«
»Du bist in letzter Zeit so …« Louise traute sich plötzlich nicht weiter.
»Nervös bist du«, vervollständigte Sarah ihren Satz kühl. »Richtig total nervös.«
Louise zwirbelte eine Strähne ihres langen, gerstenblonden Haars um den Zeigefinger.
Ich atmete zweimal tief durch. »Mädels, ihr habt keine Ahnung, was bei uns zurzeit los ist. Fast jeden Tag gibt es neue Entführungen. Heute Vormittag zum Beispiel, da hatte ich wieder mal so eine völlig verzweifelte Mutter am Telefon. Sie hat ihre kleine Tochter vermisst. Das Mädchen ist keine drei Jahre alt, und überall hatte sie schon gesucht. Im Garten, im ganzen Haus, auf der Straße, einfach überall. Natürlich habe ich sofort eine Streife losgeschickt. Und wisst ihr, wo die Kollegen das Kind dann am Ende gefunden haben?«
Meine Töchter sahen mich mit runden Augen an.
»Es hat die ganze Zeit keine fünf Meter vom Telefon entfernt auf dem Klo gesessen. Das arme Mädchen hat überhaupt nicht begriffen, wieso seine Mutter so aufgeregt war, bloß weil es zum ersten Mal in seinem Leben allein zur Toilette gegangen war.«
»Wir haben gedacht, du solltest es vielleicht wissen, wenn ein Kind verschwindet«, versetzte Sarah patzig. »Du würdest es vielleicht wichtig finden, haben wir gedacht.«
»Okay, dann schießt los«, seufzte ich ergeben. »Woher wisst ihr von dieser … Entführung?«
»Von Silke«, gestand Louise. »Und wir wissen eigentlich auch gar nicht, ob es wirklich eine Entführung ist. Wir wissen nur, dass ein Kind verschwunden ist.«
»Silke jobbt nämlich manchmal als Hundesitterin.« Sarah klang immer noch verstimmt. »Bei einer Kollegin von ihrer Mutter. Sie wohnt in Handschuhsheim draußen.«
»Und jetzt ist das Kind dieser Kollegin verschwunden?«
»Nein.« Sie schüttelten absolut synchron die Köpfe. »Das Kind von einer Nachbarin von der Kollegin.«
»Es ist ein Junge. Er heißt Tim.«
Ich blickte auf die Uhr. Eigentlich hatte ich vorgehabt, noch eine Runde mit dem Rad zu drehen, bevor es dunkel wurde. Das würde meinen Nerven guttun, und nicht nur denen. Aber daraus würde heute wohl nichts mehr werden.
»Und wieso wenden sich die Eltern nicht einfach an die Polizei? Wäre das nicht das Nächstliegende?«
»Genau.« Sarah nickte eifrig. »Das ist ja das Komische dabei.«
Ich zog die Zeitung wieder heran, drückte den Knopf meines Kugelschreibers und notierte den Namen: Tim.
»Nachname?«
»Jörgensen. Tim Jörgensen.«
»Was wisst ihr sonst über die Familie?«
»Ein ziemlich großes Haus haben sie«, sagte Louise langsam. »Und einen großen Garten.«
»Also, ich glaube, die Eltern werden erpresst«, spekulierte Sarah mit fachmännischer Miene. »Und die Erpresser haben ihnen natürlich verboten, mit der Polizei zu reden.«
Louise nickte. »Das machen die ja immer so.«
Um ein Haar hätte ich erwidert, sie sähen zu viel fern. Aber das stimmte ja seit Neuestem nicht mehr. Seit der PC im Haus war, blieb der Fernseher kalt.
»Und wie heißt diese Nachbarin mit Hund? Vielleicht rede ich lieber erst mal mit der, bevor ich mich bei Tims Eltern mit dummen Fragen blamiere.«
Sven Balke sprach bei der Fallbesprechung am Mittwochmorgen in seiner norddeutsch kühlen Art aus, was ich bisher nur gedacht hatte.
»Sie haben doch bestimmt gestern Abend auch den Fernsehauftritt der Eltern verfolgt, oder?«, begann er, als alle saßen.
»Um ehrlich zu sein«, seufzte ich, »ich fange an, die Leute zu hassen.«
»Ich finde es zum Kotzen, was die für eine Show abziehen. Die geilen sich ja regelrecht auf an ihrem Unglück!«
»Mir ist das alles zu glatt«, meinte Vangelis mit düsterer Miene. »Viel zu perfekt. Jedes Wort, das ich bisher von denen gehört habe, klang nach Hollywood. Man könnte auf den Gedanken kommen, sie nutzen das Verschwinden ihres Kindes aus, um Werbung für ihre Firma zu machen.«
»Worauf wollen Sie hinaus?«, fragte ich.
»Überlegen Sie mal, Herr Gerlach.« Vangelis beugte sich vor und sah mir aufmerksam ins Gesicht. »Wenn Sie in der Situation der Eltern wären. Wenn eine Ihrer Töchter entführt würde, würden Sie dann auch alles, was Sie besitzen, als Belohnung aussetzen?«
»Vermutlich ja. Aber ich lege keinen Wert darauf, es herauszufinden.«
»Ich verstehe, worauf du hinauswillst, Klara.« Balkes Augen wurden schmal. »Wovon wollen die zwei ihren wiedergefundenen Knirps eigentlich ernähren, wenn sie alles hergeben, was sie besitzen?«
Vangelis nickte. »Mir fallen mehrere denkbare Erklärungen für das Verhalten der Sanders ein. Entweder sie sind jetzt völlig durchgedreht …«
»Was man verstehen könnte.«
»Oder sie sind reicher, als uns bekannt ist …«
»Was kein Verbrechen wäre.«
Balke führte ihre Überlegungen zu Ende: »Oder sie sind absolut sicher, dass sie nicht in die Verlegenheit kommen werden, die Belohnung auszuzahlen.«
Und damit war es heraus.
»Ein schwerwiegender Verdacht«, gab ich zu bedenken.
»Unsere Fernsehstars wären nicht die Ersten, die die Entführung ihres Kindes vortäuschen, um etwas Schlimmeres zu vertuschen.«
»Wir haben nicht einen Hinweis gefunden, der in diese Richtung deutet.« Ich nahm die Brille ab und legte sie vor mich auf den Schreibtisch. »Die Geschichte, die die Eltern erzählen, ist schlüssig. Es gibt Zeugen, die den Jungen am fraglichen Nachmittag auf der Straße gesehen haben.«
Vangelis wiegte den Kopf. »Okay, der italienische Eisverkäufer und diese kurzsichtige alte Nachbarin. Aber wer sagt uns, dass Gundram nicht später wieder heimgegangen ist? Weil er Durst hatte, zum Beispiel? Oder mit dem Rad gestürzt ist und sich das Knie aufgeschlagen hat?«
»Und dann hätte die Mutter ihn einfach so kaltgemacht?«, meinte Balke belustigt. »Der Vater kommt ja nicht infrage. Der war ja nicht zu Hause.«
Er trug heute eine dünne, rehbraune Lederjacke zum obligatorischen T-Shirt und einer nicht mehr ganz sauberen Jeans. An seinem linken Ohrläppchen entdeckte ich einen neuen Ring. Insgesamt zählte ich jetzt neun. Sechs rechts und drei links. Seine weißblonden Haare waren millimeterkurz geschnitten. Und seine Miene war finster entschlossen.
»Behauptet er.« Vangelis, wie üblich im selbst geschneiderten Designerkostüm, schob konzentriert eine ihrer dunklen Locken hinters Ohr. »Aber niemand hat gesehen, wie Herr Sander von seiner Radtour zurückgekommen ist. Wir haben die Aussagen zweier Zeugen, die das Kind gegen drei Uhr ungefähr gleichzeitig auf der Straße gesehen haben. Und die Aussagen der Eltern. Und das ist alles. Punkt. Wir wissen nicht, was zwischen drei, halb vier und dem Zeitpunkt passiert ist, als der Vater wieder heimkam.«
»Das soll gegen acht gewesen sein«, warf Balke ein.
»Stopp!« Ich setzte meine ungeliebte Sehhilfe wieder auf die Nase, weil mir ohne sie die feineren Gefühlsregungen meiner Mitarbeiter entgingen. »Das ist mir alles zu spekulativ. Soweit wir wissen, gab es keinen Streit, bevor der Junge verschwand. Soweit wir wissen, ist er nicht geprügelt worden und nicht vernachlässigt. Die Mutter ist zwar eine – nun ja – eitle Zicke, aber sie soll immer gut für ihren Sohn gesorgt haben.«
»Soweit wir wissen.« Balke betrachtete seine breiten Fingernägel aus wechselnden Perspektiven. »Vielleicht wissen wir ja das eine oder andere nicht?«
Ich wandte mich an Vangelis. »Sie haben in den Tagen nach Gundrams Verschwinden stundenlang mit der Mutter gesprochen. Ihren Protokollen habe ich nichts entnommen, was einen solchen Verdacht stützen würde.«
Sie schlug ihre sehenswerten Beine in weiß schimmernden Strümpfen übereinander. »Einen wirklichen Verdacht habe ich auch heute nicht. Nur das unbestimmte Gefühl, dass die Frau uns etwas verschweigt. Und dass sie sich schuldig fühlt.«
»Würde das in ihrer Situation nicht jede Mutter der Welt tun?«
Nach kurzer Denkpause ergriff Balke wieder das Wort: »Was könnte das denn sein, was sie verschweigt?«
Vangelis hob die Schultern im Nadelstreifenblazer. »Diese Frau ist extrem kontrolliert. Von der hörst du kein unüberlegtes Wort. Und sie neigt – vorsichtig ausgedrückt – nicht zu emotionalen Ausbrüchen.«
Durch die Tür zum Vorzimmer hörte ich Sonja Walldorf telefonieren, meine treue Sekretärin, die enormen Wert darauf legte, Sönnchen genannt zu werden. Schon als Kind hatte sie diesen Spitznamen gehabt und später auch, und damit basta. Ihr helles Lachen kam mir heute deplatziert vor, geradezu unanständig.
Der Gedanke, Gundram Sander sei gar nicht entführt worden, war mir natürlich auch schon gekommen. Aber ich hatte die Idee bisher immer verworfen. Zugegeben, ich konnte Natascha Sander nicht ausstehen. Aber war sie tatsächlich zum Mord am eigenen Kind fähig? Andererseits – wie viele Menschen hatten mir im Lauf meiner Karriere schon gegenübergesessen und mit tränennassem Gesicht Verbrechen gestanden, die ich ihnen nie und nimmer zugetraut hätte? Warum eigentlich hatte ich es bis heute für undenkbar gehalten, dass die Mutter ihren kleinen Gundram selbst auf dem Gewissen hatte?
»Es muss ja nicht gleich Mord oder Totschlag sein.« Vangelis’ Gedanken gingen offenbar in dieselbe Richtung wie meine. »Ein Unfall, an dem die Mutter sich die Schuld gibt. Anschließend eine Kurzschlussreaktion, vielleicht aus Angst vor der Reaktion des Vaters oder dem Gerede der Nachbarn, und plötzlich gibt es kein Zurück mehr, sondern nur noch die Flucht nach vorn.«
Ich legte den Kopf in den Nacken. »Wenn wir uns da rantrauen«, sagte ich, »dann betreten wir ein Minenfeld, in dem wir alle unseren Hals riskieren.«
Balke grinste breit. »No risk, no fun, Chef.«
»Mit allen Nachbarn haben wir gesprochen.« Die schwarze Locke war Vangelis schon wieder ins Gesicht gerutscht. »Und mit allen Bekannten der Familie ebenfalls. Von familiären Problemen oder gar Misshandlungen des Jungen war nicht einmal gerüchteweise die Rede.«
»Das sind doch gerade die Schlimmsten!«, meinte Balke. »Diese Typen aus der Zahnpastareklame, die hab ich so was von gefressen! Von früh bis spät nur Liebe, Sonnenschein und frisch gebackene Brötchen. Aber hinter der Fassade …«
»Die Sanders wohnen in einem dieser Viertel, wo niemand jemals schlecht über seine Nachbarn reden würde«, überlegte ich laut. »Man tratscht unter seinesgleichen, aber nach außen hin hält man dicht.«
»Dann müssen wir eben in dieses geschlossene System eindringen.« Balke schlug sich auf die Oberschenkel, dass es knallte. »Und falls da überhaupt einer reinkommt, dann ja wohl Sie, Chef.«
»Wenn ich die Akten richtig im Kopf habe«, erwiderte ich langsam, »dann gibt es noch eine Quelle, die wir bisher nicht angezapft haben.«
3
Ein kurzer Anruf hatte genügt, um noch am selben Vormittag bei der Leiterin des Kindergartens in Sandhausen, den Gundram Sander besucht hatte, einen Termin zu bekommen. Die junge Frau sah aus wie eine etwas zu groß und zu breit geratene Edith Piaf und hieß Alina Schächele. Ihr Blick war warm und wach.
Sie führte mich in ihr winziges, quietschbunt eingerichtetes Büro gleich neben dem Eingang. Hinter einer breiten Doppeltür am anderen Ende des langgestreckten Flurs tobte jener Radau, den zwanzig, dreißig Kinder machen können, wenn sie gute Laune haben. Jeder Sicherheitsbeauftragte einer deutschen Fabrik würde seinen Job verlieren, ließe er zu, dass Menschen unter solchen Bedingungen ohne Gehörschutz arbeiteten.
Frau Schächele schloss sorgfältig die Tür hinter uns, und der Krach wurde deutlich leiser. Die Wände des Büros waren bis unter die Decke mit Kinderzeichnungen gepflastert, soweit sie nicht von Regalen voller Ordner verstellt waren. Sie nahm hinter ihrem Naturholzschreibtisch mit bunten Schubladen Platz. Ich setzte mich auf einen wenig vertrauenerweckenden rot-gelb-blauen Klappstuhl. Es roch streng nach Putzmittel.
»Sie kennen die Familie Sander«, begann ich.
»Kennen wäre zu viel gesagt. Die Mutter hat ihn morgens gebracht und mittags geholt, mit ihrem …« Ihr Blick wurde für eine Sekunde unsicher. »Na ja, mit diesem Mega-BMW.«
»Aber Sie mögen sie nicht besonders?«
»Es ist nicht mein Job, die Eltern unserer Kinder zu mögen«, erwiderte sie tapfer. »Ich finde, es reicht, wenn ich ihre Sprösslinge mag.«
»Aber eine Meinung werden Sie vermutlich haben.«
»Was wollen Sie von mir hören? Gundram war gewaschen, wenn er morgens kam. Er hatte gefrühstückt, er hatte immer saubere Sachen an.«
»Ich versuche nur, mir ein Bild davon zu machen, wie die Eltern mit ihrem Kind umgehen.«
»Korrekt.«
»Das ist ein merkwürdiges Wort in diesem Zusammenhang.«
Frau Schächele schlug die dunklen Augen nieder und sah auf ihre wie zum Gebet gefalteten Hände.
»Den Vater kenne ich gar nicht. Den habe ich in den drei Jahren, die Gundram jetzt bei uns ist, nicht ein einziges Mal gesehen. Aber die Mutter: Schätzelchen, mach dich nicht schmutzig, denk an das neue Auto. Lieber, vergiss bitte den Schal nicht, wenn ihr draußen spielt. Süßer, hast du auch brav deine Milch getrunken und deine Hände gewaschen?«
»Hatten Sie den Eindruck, dass sie ihr Kind liebt?«, fragte ich vorsichtig.
Sie musterte mich, als hätte ich etwas selten Dämliches gesagt. »Jede Mutter liebt ihre Kinder. Irgendwie.«
»Ich komme jetzt zu einer etwas heiklen Frage. Sie müssen sie natürlich nicht beantworten.«
Sie sah mir aufmerksam ins Gesicht.
»Hat sich Gundram normalerweise gefreut, wenn er abgeholt wurde? Hat sie sich gefreut? Hat sie ihn in den Arm genommen, zum Beispiel?«
Dieses Mal musste ich einige Sekunden auf die Antwort warten. In der Ferne lärmten die Kinder. Eines davon weinte und tobte abwechselnd in einem Wutausbruch, der sich gewaschen hatte.
»In den Arm genommen hat sie ihn nur, wenn er sich vorher ordentlich die Nase geputzt hat«, sagte die Leiterin des Kindergartens schließlich, als schämte sie sich für den Satz.
Der Lärm in der Ferne schwoll plötzlich zum Orkan. Kurz vor zwölf, Zeit, sich anzuziehen und für den Heimweg fertig zu machen. Frau Schächele sprang sichtlich erleichtert auf. Vor dem kleinen, bunt bemalten Fenster des Büros bremsten die ersten Wagen.
»Wissen Sie was?« Plötzlich strahlte sie. »Reden Sie doch mit der Frau Berger. Die hat mal eine Weile bei den Sanders den Haushalt gemacht.«
Von einer Haushaltshilfe hatte ich in den Akten nichts gelesen.
Alma Berger war eine der Mütter, die ihre Kinder auch an sich drücken, wenn sie von oben bis unten voller Rotz und Dreck sind. Eine lebensstarke Frau mit rustikalem Gesicht und etwas verschlossener Miene. Verwirrt sah sie zwischen der Erzieherin und mir hin und her, als diese sie in ihr Büro bat. Ihren kleinen Sohn hielt sie an der Hand. Er sei schon vier, erklärte mir Josef Berger bereitwillig und mit neugierigen Blicken. Er trug eine Jeans mit zahllosen bunten Flicken und einen dunkelblauen Pulli, der ihm schon ein wenig zu klein war. Als ich mich zu ihm hinunterbeugte, um ihm die Hand zu reichen, lächelte er. Und als ich mich wieder aufrichtete, lächelte auch seine Mutter.
»Sie können aber mit Kindern, das muss ich schon sagen. Unser Josef ist nämlich nicht zu jedem so.«
Als sie hörte, ich hätte Fragen an sie, wurde ihre Miene unsicher. Nervös sah sie auf die Uhr. »Das ist aber jetzt grad schlecht. Mein Mann kommt um halb eins, und dann will er was auf dem Tisch haben.«
»Sie sind mit dem Wagen hier?«
»Nein, mit dem Rad. Wieso?«
»Ich könnte Sie ein Stück begleiten.«
Josef packte meine Hand und zog mich in Richtung Ausgang.
»Sonst ist er wirklich nicht so.« Frau Berger folgte uns kopfschüttelnd. »Zum Glück, muss man ja heutzutage leider sagen.«
»Ja, ja, die Sanders«, seufzte Alma Berger, als wir die Straße vom Kindergarten in Richtung Ortszentrum hinuntergingen. Sie schob ihr robustes und schon etwas in die Jahre gekommenes Dreigangrad mit Kinderanhänger, Josef tippelte tapfer neben mir her und ließ meine Hand nicht los.
»Die Mama vom Gundi hat einen ganz tollen BMW-Geländewagen!« Er sah mit leuchtenden Augen zu mir auf. »Und der Gundi hat sogar eine eigene Schaukel im Garten! Und eine Rutsche! Und im Keller haben sie ein Schwimmbad.«
»Du bist schon mal da gewesen?«
Er nickte eifrig. »Schon ziemlich oft. Aber jetzt nicht mehr. Seit die Mama nicht mehr für die Mama vom Gundi arbeitet.«
Frau Berger nickte. »Ich bin ein paar Jahre bei den Sanders gewesen. Bis letzten April. Dann … na ja, es hat ein bisschen Krach gegeben, und da hab ich gekündigt. Man kann’s ihr nicht leicht recht machen, der Frau Sander.«
»Ich würde gern ein wenig mehr darüber erfahren, wie es in der Familie zugeht. Die Dinge, die sonst nicht nach außen dringen.«
Eine Weile gingen wir schweigend nebeneinanderher. Josef zählte munter und ohne Neid auf, was es in Gundram Sanders großem Kinderzimmer an sensationellen Spielsachen zu entdecken gab. Die Sonne schien, als hätten wir Anfang September und nicht Ende Oktober. Trotz unseres gemächlichen Tempos kam ich bald ins Schwitzen.
Endlich öffnete auch Josefs Mutter den Mund. »Sie will halt immer alles perfekt«, sagte sie leise. »Alles muss immer perfekt sein, wenn Sie verstehen, was ich meine.«
»Und wie ist das Verhältnis zwischen Herrn und Frau Sander?«
Wieder zögerte sie lange mit der Antwort. »Wissen Sie, ich hab schon in manchen Familien geputzt und gekocht. Und es gibt weiß Gott Schlimmere als die Sanders. Aber Schlimmere gibt’s ja eigentlich immer.«
Sie hustete und wischte sich die Nase mit dem Ärmel ihres schon ein wenig zerschlissenen Norwegerpullovers ab.
»Und das Kind?«
»Was soll man sagen …«
Wir erreichten die Hauptstraße und blieben an der Fußgängerampel stehen. Josef durfte den Knopf drücken und wollte gar nicht mehr damit aufhören. Ein dunkler Mercedes fuhr vorbei. Vom Rücksitz winkte ein rothaariges Mädchen mit Sommersprossen. Josef winkte zurück. Die Ampel schaltete auf Grün.
»Ich will’s mal so sagen«, fuhr Frau Berger fort, als wir die andere Straßenseite erreichten und der Fahrradanhänger auf den Gehweg rumpelte. »Ich möcht bei denen kein Kind sein.«
»Haben Sie je gesehen oder gehört, dass Gundram geschlagen wurde? Dass jemand von den Eltern aufbrausend war?«
»Der Mann, der kann schon mal grob werden. Aber welcher Mann kann das nicht. Er ist ja meistens in der Arbeit gewesen oder mit seinem tollen Rad unterwegs. Aber wenn er ausnahmsweise mal daheim war und es gab Streit, dann hat seine Frau ihm ordentlich Kontra gegeben. Und das ist eine richtige Giftspritze. Aber nach Backpfeifen hat’s eigentlich nie gerochen, wenn Sie verstehen, was ich meine. Die Sanders, das sind so Leute, die können sich wehtun, ohne die Hände zu benutzen.«
Wir gingen die Hauptstraße entlang in Richtung Süden. Frau Berger fuhr sich wieder mit dem Ärmel über die Nase. Die Gangschaltung ihres Fahrrads tickerte leise.
»Wer hat nach Ihrer Kündigung die Stelle übernommen?«
»Weiß ich nicht. Nur dass es eine Ausländerin sein soll, hab ich später mal gehört. Eine Illegale, nehm ich an. Da hat die Frau Sander auch noch fein was gespart. Ein bisschen geizig ist sie nämlich auch, wenn Sie verstehen, was ich meine.«
Ein voll beladener Kieslaster rumpelte an uns vorbei. Josef sah ihm interessiert nach. Es roch nach Dieselabgasen.
»Früher ist der Gundi oft bei uns gewesen.« Frau Berger lächelte plötzlich. »Wenn die Frau Sander mal wieder zum Friseur gemusst hat oder das Auto in die Werkstatt. Dann hat sie mich angerufen und gefragt, ob ich den Gundi vom Kindergarten mit heimnehmen könnt und auf ihn aufpassen, bis sie ihn holen kommt.«
Josefs kleine Hand klebte inzwischen in meiner. Allmählich wurde er müde, wir mäßigten das Tempo. Frau Berger nickte ihm aufmunternd zu.
»Und wenn sie ihn dann später geholt hat«, fuhr sie in einer Lautstärke fort, dass Josef es nicht hören konnte, »dann hat sich der arme Bub eigentlich nie so richtig gefreut. Der wär viel lieber bei uns geblieben, hab ich oft gedacht. Auch wenn wir kein so tolles Haus haben und nur ein kleines Auto statt zwei große und keinen Fernseher, so groß wie eine halbe Schrankwand.«
»Der Gundi hat nämlich auch einen eigenen Fernseher im Zimmer.« Offenbar hatte Frau Berger das Gehör ihres Söhnchens unterschätzt. »Und seine Mama hat einen in der Küche!«
Ich wagte mich noch ein wenig weiter vor: »Hatte Gundram vielleicht manchmal merkwürdige Verletzungen? Blaue Flecken? Kratzer im Gesicht?«
»Welcher Bub in seinem Alter hat keine Kratzer und Beulen? Sie meinen, ob er Schläge gekriegt hat? Ich … Nein, ich weiß nicht.«
Der letzte Satz war eine Spur zu zögernd gekommen.
Bevor wir die Heidelberger Straße überqueren konnten, mussten wir eine Weile warten. Josef hüpfte nervös von einem Fuß auf den anderen. Offenbar musste er mal. Ein wenig Wind war aufgekommen und kühlte mein Gesicht.
»Frau Berger«, sagte ich sanft, »Ihre ausweichende Antwort bringt mich eher ins Grübeln, als dass sie mich beruhigt.«
Einige Zeit durchquerten wir schweigend ein Wohnviertel. Es ging um einige Ecken, und bald hatte ich die Orientierung verloren. Dann erreichten wir den südlichen Ortsrand. Vor uns lagen die Umgehungsstraße und jenseits davon umgepflügte Felder. Der Wind roch nach Herbst. Ein Rettungshubschrauber ratterte in geringer Höhe über uns hinweg in Richtung Autobahn und machte eine Unterhaltung für einige Sekunden unmöglich.
Vor einem schmalen Reihenhaus blieb Frau Berger stehen. Das in den Fünfzigern eilig hochgezogene, zweistöckige Häuschen war frisch gestrichen, und überall standen noch Farbeimer und Gerüstteile herum. Offenbar war man mitten in einer umfassenden Renovierung. Neben der ebenfalls erst kürzlich gestrichenen Eingangstür verblühte ein prächtiger Busch voller lachsfarbener Rosen. Mit routinierten Bewegungen öffnete Josefs Mutter das Garagentor, schob Rad samt Anhänger hinein, wozu mir der Junge aufgeregt etwas erklärte, das ich nicht verstand. Das erbärmlich quietschende Tor wurde geschlossen, verriegelt, der Schlüssel verstaut. Und dann gab es kein Ausweichen mehr.
Frau Berger sah mir in die Augen. »Mal, da hat er so Striemen auf der Backe gehabt. Vier, hübsch nebeneinander. Von scharfen Fingernägeln, wenn Sie verstehen, was ich meine. Und ein anderes Mal, letztes Jahr ist das gewesen, da war das mit seinem Arm. Er sei mit dem Rad hingefallen, hat’s geheißen.«
»War der Arm gebrochen?«
»Direkt gebrochen nicht. Mehr verrenkt. Aber so was kommt ja schon mal vor, bei wilden Kindern.«
»Gundram ist ein wildes Kind?«
Sie senkte den Blick, spielte mit dem Saum ihres Pullovers. »Aber nein. Der Gundi ist ein Braver. Trotzdem, jeder kann mal vom Rad fallen, oder nicht?«
»Sie wissen nicht zufällig, bei welchem Arzt Gundram damals war?«
»Doch, das kann ich Ihnen sagen. Die Sanders gehen immer zum Professor Schaaf. Der hat seine Praxis in Leimen drüben.« Frau Berger streckte ihrem Söhnchen die Hand hin. »Komm jetzt, Josef. Der Onkel muss gehen.«
Als ich schon einige Schritte entfernt war, rief sie mir nach: »Der Professor Schaaf sei der teuerste Arzt in der ganzen Kurpfalz, hat mir die Frau Sander mal erklärt.«
Josef winkte mit der freien linken Hand und strahlte übers ganze Gesicht.
Ich winkte ebenfalls, und erst in diesem Moment wurde mir bewusst, dass mein Wagen beim Kindergarten stand und ich den ganzen Weg zurück zu Fuß gehen musste.
Am Empfangstresen der Praxis begrüßte mich ein empörtes Rauschgoldengelchen in frisch gestärktem weißem Kittel und mit rosafarbenen Segeltuchschuhen an den Füßen.
»Der Herr Professor empfängt eigentlich Patienten ohne Termin nur im Notfall. Sind Sie denn ein Notfall?«
Ihre großen graublauen Augen musterten mich von oben bis unten auf der Suche nach Blutflecken oder Spuren von Gewaltanwendung. Ihr Make-up war dezent, das wild kringelnde Haar vermutlich frisch vom Stylisten.
Ich schob ein Visitenkärtchen über den blank polierten Tresen aus dunklem Granit, und ihre Augen wurden noch eine Spur größer.
»Vielleicht macht der Herr Professor bei mir ja eine Ausnahme?«
Sie duftete nach Röschen, die ich mir unwillkürlich in der Farbe ihrer Schuhe vorstellte.
»Kripo?« Ihre Stimme klang plötzlich ratlos. »Wieso denn Kripo?«
»Das würde ich Ihrem Chef gern selbst sagen«, erwiderte ich liebenswürdig.
Fünfzehn Minuten später saß ich Professor Schaaf gegenüber. Niemand hatte in der Zwischenzeit seinen saalähnlichen Behandlungsraum betreten oder verlassen. Vermutlich gehörte es einfach zum Stil des Hauses, dass man nicht sofort vorgelassen wurde. Die Stimme des großen Mannes war angenehm ruhig und voller mitfühlender Zuversicht. Der herzliche Händedruck reichte bei manchem Patienten vermutlich schon aus, ihn auf den Weg der Besserung zu bringen. Bereits in der ersten Sekunde hatte ich das angenehme Gefühl, dass der teuerste Arzt weit und breit immerhin sein Handwerk verstand. Sein volles weißes Haar wirkte wie getönt.
»Um die Sanders geht es«, sagte er mit strahlendem Lächeln, nachdem ich ihm in wenigen Sätzen den Grund meines Besuchs geschildert hatte. Ohne hinzusehen spielte er mit meinem Kärtchen.
Hinter ihm blühten vor Gesundheit strotzende Orchideen auf der breiten Fensterbank. Auch hier, im Sprechzimmer, roch es nicht etwa nach Desinfektionsmitteln, sondern nach einem Blumengarten. Außer einer Furcht einflößenden Sammlung medizinischer Fachbücher gab es nichts zu sehen, was an eine Arztpraxis erinnert hätte. Nicht einmal einen Kittel trug mein Gesprächspartner, sondern einen hellgrauen zweireihigen Anzug.
»Genauer, es geht um den kleinen Sohn der Sanders und einen verstauchten Arm«, korrigierte ich ihn freundlich.
Er nickte. »Ich erinnere mich. Das war letzten Sommer, richtig?«
Plötzlich gab er sich einen Ruck, tippte etwas in seine metallisch glänzende Designertastatur, schob die Hornbrille in die Stirn und starrte eine Weile kurzsichtig auf seinen Flachbildschirm.
»Hier, ja. Letztes Jahr im Juli. Ausgekugelte Schulter. Nichts weiter Schlimmes.« Die Brille rutschte ganz von allein wieder auf die Nase herunter. »Was ist in Ihren Augen interessant daran?«
»Die Umstände. Ist der Junge wirklich mit dem Rad gestürzt? Oder eher vom Baum gefallen?«
»Vom Rad gestürzt. Sagte mir die Mutter.«
»Und das klang glaubwürdig für Sie?«
»Ich hatte keinen Grund, daran zu zweifeln.« Neugierig musterte er mich. »Worauf wollen Sie hinaus?« Ein bemerkenswert unauffälliger Blick auf die Visitenkarte. »Herr Gerlach?«
»Auf gar nichts. Ich möchte lediglich Ihre Meinung als Arzt hören. Klang die Begründung der Mutter glaubhaft? Wenn jemand vom Rad fällt, dann hat er in der Regel noch andere Verletzungen. Hautabschürfungen an den Händen, eine Beule am Kopf.«
Professor Schaaf nickte langsam. »Prellungen, Blutergüsse, ausgeschlagene Zähne …«
Wieder sah er auf seinen Bildschirm, dann offen in mein Gesicht und schließlich auf den Tisch. »Wissen Sie, Herr Gerlach, das ist nicht so einfach, wie Sie zu denken scheinen.«
»Sie möchten sich nicht festlegen.«
»Die Frage ist nicht, ob ich möchte, sondern ob ich kann. Ich bin Internist, kein Forensiker. Der Junge hat damals alle möglichen Blessuren gehabt. Die konnten durchaus von einem Sturz stammen oder …« Er nahm die Brille ab, blinzelte mich an und sprach langsam weiter: »… oder auch von etwas völlig anderem. Ich ahne, worauf Sie anspielen. Aber mehr kann ich und werde ich nicht dazu sagen. Ich sehe auch heute keinen Grund, an den Worten der Mutter zu zweifeln.«
4
»Wir haben leider ein Problem, Alexander«, sagte Theresa am Abend.
Ganz außer der Reihe trafen wir uns am Mittwoch in der kleinen Wohnung ihrer Busenfreundin Ingrid, die sich praktischerweise nun schon seit über einem Jahr in Sydney aufhielt. Theresa hatte es übernommen, während ihrer Abwesenheit hier ein wenig nach dem Rechten zu sehen und die vor sich hin kümmernden Pflanzen zu gießen. Davon, dass wir Ingrids etwas achtlos, aber hübsch eingerichteten beiden Zimmer samt Bad, Kühlschrank und Bett als Liebesnest missbrauchten, hatte die Gute keinen Schimmer. Hoffte ich zumindest.
Meine Geliebte war das, was man vor fünfzig Jahren als Prachtweib bezeichnet hätte. Groß, dunkelblond, selbstbewusst und, wie sie nicht aufhören wollte zu behaupten, vor allem oben herum ein wenig zu füllig, was mich keineswegs störte. Außerdem war sie intelligent, eloquent, rauchte zu viel und war süchtig nach Sex mit mir, was mir ebenfalls nicht unangenehm war. Dieses wunderbare Weib hatte im Grunde nur einen Nachteil: Sie war verheiratet. Und zwar zu allem Elend mit Polizeidirektor Dr. Egon Liebekind, meinem Chef.
Es war nicht so, dass ich mich ständig davor fürchtete, aufzufliegen. Das hatte ich anfangs getan, in den ersten zwei, drei Monaten unserer Beziehung. Später hatte ich mich an die Gefahr gewöhnt, wie man sich früher oder später an nahezu alles gewöhnt. Lediglich eine gewisse Anspannung war geblieben, wenn ich persönlich mit meinem Dienstvorgesetzten zu tun hatte. Feuchte Hände und ein wenig Herzklopfen, wenn ich auf dem Weg zu seinem Büro war. Was jedoch zum Glück nicht allzu oft vorkam.
Ich schenkte Wachenheimer Sekt in die Champagnerkelche. Wenn wir uns trafen, dann gab es Sekt oder – zu besonderen Anlässen – Champagner. Mal brachte ich eine Flasche mit, mal Theresa und hin und wieder auch wir beide. Das hatte sich in den dreizehn Monaten so eingebürgert, die wir uns nun kannten und mehr oder weniger innig liebten.
»Es wäre nett, wenn du das Wort Problem in meiner Gegenwart vermeiden könntest«, seufzte ich und reichte ihr eines der Gläser. Wir stießen an und tranken. Dann stellte sie ihres beiseite und begann kommentarlos, sich zu entkleiden. Das war es, was ich an unserer Beziehung immer wieder aufs Neue liebte: Zwischen uns gab es kein Herantasten, keine augenzwinkernden Andeutungen oder verzwickten Rituale. Wenn wir uns trafen, dann wollten wir miteinander schlafen. Zeit zum Reden und Trinken war später. Meist geschah das am Dienstag, weil Liebekind an diesem Abend zu seinen Rotariern musste, und freitags, weil er da als Alter Herr zu seiner Studentenverbindung geladen war.
Aber heute verriet Theresas Miene nichts Gutes. Inzwischen trug sie nur noch Unterwäsche und fummelte ungeduldig an meinem Gürtel herum.
»Es ist aber leider wirklich ein Problem«, sagte sie zwischen zwei feuchten Küssen. »Ingrid kommt zurück.«
»Ing …« Ich hustete und half ihr nebenbei aus ihrem Slip, der vermutlich so viel gekostet hatte, wie manche Menschen für einen Anzug ausgeben. »Du willst doch nicht andeuten, wir können nicht mehr in unsere Wohnung?«
Ihre heißen Arme umschlangen meinen Hals. Wir plumpsten ziemlich unelegant aufs Bett, und es dauerte eine Weile, bis wir das Gespräch fortführten.
»Das ist heute unser letzter Abend hier«, erklärte Theresa nach einigen tiefen Zügen an der unvermeidlichen Zigarette danach. »Sie landet am Samstagmorgen in Frankfurt. Und vorher muss ich hier ein wenig Ordnung schaffen und Spuren beseitigen.«
Das konnte man nun in der Tat ein Problem nennen. Die Frage »zu dir oder zu mir« verbot sich bei uns. Zu Theresa konnten wir nicht wegen der Nachbarn und der Gefahr eines zu früh heimkehrenden Gatten. Zu mir konnten wir nicht wegen der Nachbarn und der Gefahr unerwartet hereinplatzender Töchter.
»Und jetzt?«
»Jetzt gucken wir erst mal dumm«, erwiderte sie ruhig. »Und dann lassen wir uns etwas einfallen.«
»Warum kann sie nicht bei ihren Kängurus bleiben?«
»Irgendeine Krise in der Zentrale der Firma, für die sie arbeitet. Und nun muss die arme Ingrid her und alle retten.«
»Aber wie ich dich kenne, hast du natürlich längst eine Idee, wie wir nicht obdachlos werden.«
Theresa schnippte die Asche in den gläsernen Aschenbecher, der zwischen ihren sehenswerten Brüsten balancierte.
»Ganz einfach: Wir suchen uns eine eigene Wohnung.«
»Wie sollen wir denn zu einer Wohnung kommen?«
»Wohnungen kann man in unseren Breiten entweder mieten oder kaufen.« Sie blies mir den Rauch ins Gesicht. »Wir mieten uns irgendwas Kleines, Schnuckeliges, und die Kosten teilen wir uns.«
»Käme mich vermutlich immer noch billiger als zweimal die Woche ins Bordell«, überlegte ich und entging haarscharf einer schweren Kopfnuss.
»Den Mietvertrag musst natürlich du unterschreiben. Stell dir vor, mir flattert eine Nebenkostenabrechnung ins Haus, und Egonchen bekommt sie in die Finger!«
Dieser Satz beantwortete ganz nebenbei die Frage, die mich beschäftigte, seit wir uns kannten: ob ihr Mann etwas von unserem Verhältnis ahnte oder gar wusste. Offenbar ahnte und wusste er nichts.
Ende der Leseprobe