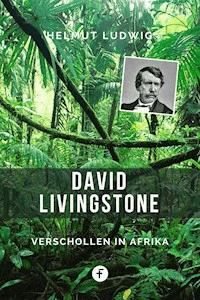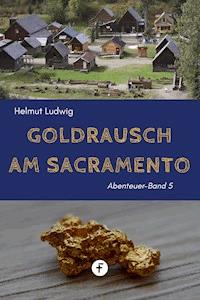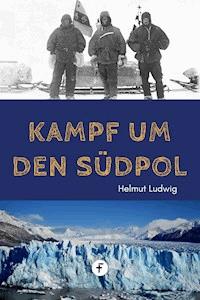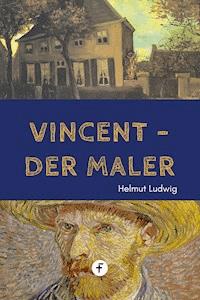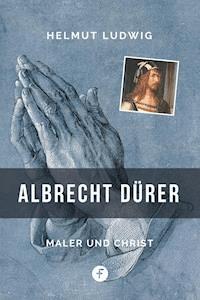Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Folgen Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Kurzgeschichten eines Pfarrers
- Sprache: Deutsch
Dieses eBook versammelt eine fesselnde Auswahl an Geschichten, die das Leben selbst geschrieben hat – Erlebnisse voller Spannung, Dramatik und tiefgehender Reflexion. Es sind wahre Begebenheiten, die erschüttern, nachdenklich machen und zugleich Hoffnung schenken. Im Mittelpunkt stehen Menschen, die sich in Extremsituationen wiederfinden – an den Grenzen des Möglichen, in Momenten tiefster Not oder großer Unsicherheit. Doch gerade dann, wenn alles verloren scheint, geschieht das Unerwartete: Gott greift ein. Oft antwortet er schneller, kraftvoller und auf wundersame Weise umfassender, als es sich die Betroffenen je hätten vorstellen können. Diese aufrüttelnden Tatsachenberichte zeugen von einer unerschütterlichen Wahrheit: Gott ist nicht tot! Er lebt und antwortet! Jede Geschichte ist ein Beweis dafür, dass göttliche Führung und Hilfe real sind – manchmal in stiller Gewissheit, manchmal in überwältigenden Wundern. Dieses eBook ist mehr als nur eine Sammlung bewegender Erzählungen – es ist eine Einladung, über das eigene Leben nachzudenken, den Glauben neu zu entdecken und sich von der Kraft Gottes berühren zu lassen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 123
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ehe sie rufen, will ich antworten
Berichte über Schuld und Gnade in unserer Zeit
Helmut Ludwig
Impressum
© 2017 Folgen Verlag, Langerwehe
Autor: Helmut Ludwig
Cover: Eduard Rempel, Düren
ISBN: 978-3-95893-071-1
Verlags-Seite: www.folgenverlag.de
Kontakt: [email protected]
Dieses eBook darf ausschließlich auf einem Endgerät (Computer, eReader, etc.) des jeweiligen Kunden verwendet werden, der das eBook selbst, im von uns autorisierten eBook-Shop, gekauft hat. Jede Weitergabe an andere Personen entspricht nicht mehr der von uns erlaubten Nutzung, ist strafbar und schadet dem Autor und dem Verlagswesen.
Inhalt
Auf der Leiter
»Feuer, Feuer!« Irgendwo in Manhattan brennt es wieder.
Mit schrillen Alarmsignalen bahnt sich ein Löschzug mühsam den Weg durch die abendlich verstopften Avenues zwischen dicht dahinfahrenden Reihen von Wagen. Unter der zuckenden, tausendfach bunt aufleuchtenden Lichtreklame flutet der schier undurchdringbare Manhattan-Verkehr durch die himmelhoch sich türmenden Wolkenkratzerschluchten, deren Fahrbahnen um diese Zeit einer aufgeregten Ameisenprozession gleichen. Häufig brennt es irgendwo auf der schmalen Halbinsel zwischen dem Hudson und dem East-River.
Es ist ein Hotelbrand, zwölftes Stockwerk, Seitenstraße, schreiende, durcheinanderlaufende Menschen. Die hellen Flammen züngeln aus den zerborstenen Fenstern heraus und lecken zum letzten, dem 13. Stock empor. Ein wildgestikulierender Neger in einer admiralsähnlichen Uniform treibt die Neugierigen vom Hoteleingang weg. Als die Männer des Löschzuges sich endlich durchgekämpft haben, ist es schon allerhöchste Zeit. Kommandos, schnelle Handgriffe, Motorenlärm und das Knacken der hochtastenden Leiter.
Der zweite Löschzug trifft ein. Das Lokal an der Ecke ist überfüllt. Die schnell zusammengelaufenen Zuschauer benutzen das Schauspiel zu einem abendlichen Schnellimbiss. Polizei trifft ein und drängt die Kopf an Kopf stehende, emporstarrende Menge zurück, aus der unmittelbaren Gefahrenzone heraus.
Fieberhaft arbeiten die Männer der Wehr. Aus dem letzten Stockwerk fliegen Sachen herunter, flattert Wäsche, vom plötzlich kommenden Aufwind gepackt, auf- und abwärtspendelnd zu Boden.
Plötzlich zerreißt ein gellender Frauenschrei die stimmenerfüllte Atmosphäre am Brandort. Und dann sehen sie es alle: Eine farbige Mutter mit zwei Kindern hängt im 13. Stock im Fenster und brüllt, wild mit beiden Armen fuchtelnd, irgend etwas nach unten. Sie muss zurück, erscheint am Nebenfenster und jammert, immer wieder von der Hitze der sengenden Flammen zurückgetrieben.
Die Leiter tastet sich weiter aufwärts – Meter um Meter zittert sie an der Hauswand des brennenden Hotels empor.
Die Menge tief unten am Boden des Hochhauses hat begriffen: Der schreienden Frau mit ihren beiden Kindern ist der Rückweg abgeschnitten. Der Lift funktioniert nicht mehr. Sie kommt nicht mehr hinunter! Im Augenblick verstummt der Lärm der durcheinanderfliegenden Stimmen und Kommandos. Alle starren gebannt nach oben, wo die schwarze Mutter soeben wieder ins Innere des Zimmers zurückspringt, weil der vernichtende Atem der Glut zum 13. Stock emporschlägt.
Ein gellender, ohnmächtig-verzweifelter Schrei – die Leiter kommt näher. Zwei Feuerwehrmänner erklimmen die unteren Sprossen, während oben Meter um Meter sich hinaufschiebt, bis das letzte Leiterstück einrastet, dicht unterhalb des 13. Stockwerks, seitlich vorbei an den prasselnden Flammen. Wasser wird knallend hinaufgejagt. Die Motorspritze dröhnt auf vollen Touren. Peitschend zischt der Strahl ins 12. Stockwerk. Qualm, beißender Rauch, dazwischen wieder hell lodernde Zungen.
Es passiert alles blitzschnell. Eine dramatische Rettungsaktion nimmt ihren Anfang. So etwas geschieht selbst in Manhattan nicht jeden Tag.
Wird der aufwärtsklimmende Feuerwehrmann das letzte Stück bis zum dritten Fenster der dreizehnten Etage, in dem jetzt die aufgeregte, irr um sich schlagende Farbige mit beiden Kindern hängt, überbrücken können? Es fehlt ein Stück! Die Leiter ist zu kurz! Eineinhalb Meter nur oder zwei …
Die Zuschauermenge erstarrt, als sie erkannt hat, dass die Leiter nicht ganz ausreicht. Was nun? Dichter heranfahren? Die Leiter steiler ansetzen? Es geht nicht. Dem Einsatzleiter der Wehr bricht der kalte Schweiß aus. Er vermag die Lage nüchtern abzuschätzen und kennt die Möglichkeiten seiner Männer und Maschinen, und er weiß: Es reicht nicht! Nichts mehr rauszuholen!
Von der breiten Avenue kommen neue Zuschauergruppen. Es hat sich herumgesprochen in den wenigen Minuten … Und über allem Getümmel hängt eine farbige Mutter, eine Negerin mit ihren beiden Kindern, die wimmernd in die schreckliche Tiefe starren. Springen ist ganz ausgeschlossen, völlig hoffnungslos! Kein Sprungtuch hält das aus!
Der zuoberst kletternde Rettungsmann erkennt: Es reicht nickt! Sie müssen verbrennen, wenn wir der Flammen nicht rechtzeitig Herr werden. Qualmschwaden dringen aus dem Fenster des 13. Stockwerks, in dem die Frau zuerst erschien … Es geht um Sekunden. Ein Wettlauf mit dem Tode …
Dem Mann auf der himmelhoch schwebenden Leiter krampft sich das Herz zusammen. Er hat schon viel erlebt. Aber wie er auf den letzten Sprossen, auf der winzigen obersten Plattform der Leiter der völlig verzweifelten Frau gegenübersteht und in die angstweit verzerrten Augen der Kinder schaut, da überläuft es ihn eiskalt. Krampfhaft überlegt er … Springen lassen und auf fangen? Geht nicht! Selbst wenn er fangen würde, die Leiter bebt leicht und flattert oben ein wenig! Das würde der federnde Mechanismus nicht abfangen können. Der Mann reckt sich empor, streckt die Arme hoch hinauf! Es fehlt noch etwa ein Meter, oder ist es mehr? Alle Möglichkeiten versagen … Aber da gibt es noch eine Lösung, schießt es dem Mann auf der winzigen Plattform durch den Kopf: Ich müsste auf den Rand der vibrierenden Plattform klettern, mich an die Hauswand lehnen, eine Brücke bilden, freistehend ohne Schutz und Sicherung.
Der zweite Mann ist oben angekommen. Er sieht: Aussichtslos! Es fehlt zu viel, als dass man sie springen lassen könnte. Lind dann erstarrt der vielgewöhnte, abgehärtete Wehrmann, als er die Absicht seines Kollegen erkennt. Er will warnen, sagen, dass sich das Opfer für eine Schwarze nicht lohnt, dass es schiefgehen wird, dass er hinunterstürzen muss, frei, ohne Sicherung auf schwankendem Plattformrand …
Die Angst und die Fassungslosigkeit über das Opfer seines Kameraden pressen dem zweiten Mann die Kehle zu. Wahrhaftig, er hat schon harte Situationen erlebt. Aber dies hier geht zu weit! Der Retter setzt sein Leben aufs Spiel! Er riskiert alles um einer schwarzen Mutter willen. Tief unten steht schweigend und entsetzt die Menschenmenge und verfolgt das atemraubende Geschehen auf dem Gipfel der Leiter!
Vom Hudson dröhnt der dumpfe Lärm einer Schiffssirene herüber. Da hat der Mann auf der obersten Plattform sich endgültig entschieden: Das Opfer muss gebracht werden. Es ist eine Mutter mit zwei Kindern. Sie werden verbrennen, wenn nicht einer die Kluft überbrückt. Einer muss sich opfern und eine lebendige Brücke zum Fenster des 13. Stockwerks bilden. Sonst sind diese drei Menschen verloren: Einer für drei! Es kann gut gehen, wenn ihn die Kräfte nicht verlassen und die drei Menschen schnell reagieren. Die Leiter schwankt leicht, als der Mann auf der Plattform sich auf den Rand der Sicherheitsstrebe schwingt, sich aus der Hocke langsam, Millimeter um Millimeter an der rauen Hauswand emportastet. Die Fingerkuppen brennen, weil die heiße Lohe drüben, seitlich der Leiter, ihren vernichtenden Atem zu ihm herüberschickt.
Die schwarze Mutter hat begriffen. Ihre Augen quellen angstvoll weit hervor. Die rettenden Hände kommen näher, noch näher und erreichen schließlich bei ausgestreckten Armen das heiße Holz am Fensterbrett, krallen sich daran fest, so dass eine Brücke des Menschenkörpers sich vom Fenster zur Umzäunung der Plattform wölbt.
Keine Kommandos kommen mehr von unten herauf. Der zuckende Flammenschein beleuchtet gespenstig die Szene, als der Neger junge, von der zitternden Mutter unterstützt, sich aufs Fenstersims schwingt … Drüben knattert nur geräuschvoll das Wasser in die Flammen und übertönt das spannungsdichte Ringen der vier Menschen um ihr Leben im Angesicht des drohenden Todes. Der farbige Junge klettert auf die Schultern der Menschenbrücke.
Nur nicht nach unten sehen! Nur nicht die Nerven verlieren! Der Retter beißt die Zähne zusammen. Wird er seine Kräfte zwingen?
Der Kamerad steht auf der Plattform und fasst zu, stützt, hilft, umklammert die Fußgelenke des Brückenbauers. Der Junge rutscht behände und mutig tiefer, der rettenden Plattform zu. Dann hat er sie erreicht. Die atemlose Spannung weit da unten zerreißt, bricht sich in zustimmenden Rufen Luft, Bahn und brandet empor. Der Brückenbauer fühlt das Weichen der Kraft.
Das zweite Kind, ein lockenhaariges Mädchen mit der aschgrauen Angst im Gesicht, klettert dem geretteten Bruder nach, zitternd, fiebernd vor Angst und Entsetzen und vor Grauen … Es erreicht nach zwei nervenzerreißenden Minuten die rettende Plattform.
Die Kinder sind in Sicherheit. Jetzt die Mutter!
Der Retter spürt seine Hände nicht mehr, als die Frau auf seine Schultern steigt und über ihn hinweg dem neugeschenkten Leben zuklimmt …
Dann ist es vollbracht. Der Retter hört nicht mehr die Jubelschreie der Menge. Er versucht den Rückweg, langsam, loslassen, die Wand – tiefer, abwärts greifen. – Die Hände, sie wollen nicht mehr gehorchen … Die Leiter schwankt leicht … Festklammern an der Wand … Drei Menschen sind gerettet, am Leben … Der Retter zittert, greift nach, da … er rutscht, fasst noch einmal zu, packt ins Leere, stürzt … Ein grässlicher Schrei aus der Menge … Aus!
Drei Menschen sind gerettet. Der Retter ließ sein Leben. Das Feuer wütete weiter.
Wenn menschliche Hilfsbereitschaft so weit geht, dass sie das Opfer des Lebens nicht scheut, wird sie dann nicht zum Gleichnis für die größte Rettungsaktion aller Zeiten, die den Retter das Leben am Kreuz von Golgatha gekostet hat?
Alle Gleichnisse und Beispielfälle aber reichen nicht aus, um Gottes Rettungswerk zu verdeutlichen. Eine Schriftstelle sei zum Nachdenken oder zur Diskussion angefügt:
Lukas 18,7: »Sollte aber Gott nicht auch retten seine Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen, und sollte er’s mit ihnen verziehen?« Gott hat ]a mit seinem Erlösungswerk nicht gewartet, bis wir riefen. Er hat mit dem Geschehen auf Golgatha geantwortet für alle Zeiten und das Opfer aller Opfer drangegeben, bevor wir ihn darum bitten konnten.
Wenn alte Schuld erwacht
»Herr Pfarrer, Sie müssen mir helfen! Ich habe solche Angst. Vor Jahren kam durch meine Aussagen ein Mann ins Gefängnis, der nun bald entlassen wird. Damals hat er mir gedroht: Wenn ich herauskomme, dann … Nun habe ich Angst. Manchmal erwache ich nachts vom Alpdruck und kann nicht wieder einschlafen. Dann laufe ich zur Tür und sehe nach, ob der Schlüssel noch von innen steckt …« Die wahren Geschichten unserer Tage werden in den Sprechzimmern der Pfarrer und Psychiater erzählt. Es sind Geschichten, die das Leben diktiert. Gequälte, verzweifelte, geängstigte Menschen sind auf der Suche nach Hilfe. Ihre Fragen lauten: »Wer hört mich an? Wer hilft mir tragen?« Schuld, Versagen, Ringen gegen das Abgründige, das sind nur einige der Treibkräfte, die einen Menschen »fertigmachen« können. Da sind zum Beispiel die Fragen jener Frau: Muss ich jetzt die Wahrheit sagen? Oder gibt es eine barmherzige Lüge? Darf ich einer Mutter in Holland verschweigen, was wirklich geschah? Ahnt sie nicht längst, wenn sie schreibt?
Das alles liegt nun hinter ihr. Aber da kommt die Angst vor der Rache des Mannes, der durch das Entdecken der Wahrheit ins Gefängnis kam …
»Ich dachte, Sie wüssten das alles, Herr Pfarrer. Es war damals die Sensation. Es stand in der Zeitung.«
»Ich komme kaum zum Zeitunglesen. Ich weiß nichts von der Sache. Aber erzählen Sie doch, wenn Sie wollen. Vielleicht erleichtert es, hilft klären. Wenn ich Ihnen helfen kann, selbstverständlich …«
»Bitte, hören Sie mich an! Ich muss mir das alles einmal im Zusammenhang vom Herzen reden. Jahrelang habe ich es allein mit mir herumgetragen und gehofft, der Tag der Entlassung bliebe aus.
Es fing in den bösen Tagen des Kriegsendes an. Es ging damals manches drunter und drüber. Bombenteppiche zerstörten ganze Teile unserer Stadt. Audi im Lager der Fremdarbeiter und Kriegsgefangenen waren Bomben gefallen. Weil viele Baracken abbrannten, quartierte man die Fremdarbeiter, jene Menschen, die man aus ihrer Heimat verschleppt hatte, um sie in deutschen Rüstungswerken arbeiten zu lassen, weil alle gesunden Männer unseres Volkes an den Fronten kämpften, aus dem Lager aus und wies sie zwangsweise in stehengebliebene Wohnräume unserer Stadt ein. Sie wurden ohnehin erst nachts spät von der Arbeit entlassen. Die morgendlichen Kontrollen waren verschärft worden, um keine Fluchtgedanken aufkommen zu lassen. Ich bekam einen jungen Holländer zugewiesen. Er war noch fast ein Kind, lang aufgeschossen, blond und auf eine beinahe rührende Weise schüchtern. In den wenigen Stunden, die er in meinem Hause verbrachte, erzählte er mir von seiner Heimat, die er über alles liebte, und von seiner Mutter, die er zurücklassen musste, als sie ihn nachts aus dem Haus holten, auf einen Lastwagen verluden und mit vielen anderen Männern des holländischen Ortes nach Deutschland brachten. Sein Vater war schon früh gestorben. Vielleicht hing er darum so sehr an seiner Mutter, von der er durch die Verschleppung jäh getrennt worden war.
Eines Tages kam er schon nachmittags von der Arbeit zurück. Ich hörte, dass er in seinem Zimmer verschwand. Und dann erschreckte mich ein wildes Stöhnen. Ich klopfte an. Er antwortete nicht. Da trat ich ein. Er lag auf seinem Bett mit verunstaltetem Gesicht, das bis zur Unkenntlichkeit geschwollen war. Sein Hemd wies Blutflecken auf. Ich war so erschrocken, dass ich im ersten Augenblick keines Wortes mächtig war. Dann lief ich hinaus, um kaltes Wasser zum Kühlen zu holen. Ich fragte ihn, was, um Gottes willen, denn passiert sei. Da weinte er wie ein Kind, erschütternd heftig und bis ins tiefste hinein gekränkt. Es dauerte lange, bis er, noch immer von Weinkrämpfen geschüttelt, berichten konnte:
Im Werk, in dem er zu arbeiten hatte, schafften viele Fremdarbeiter verschiedener Nationalitäten: Ukrainer, Russen, Polen, Franzosen und Holländer. Sie kannten einander vom täglichen Sehen und Werken. Nun war das deutsche Wehrmachts-Aufsichtspersonal für das Arbeitstempo verantwortlich. Ein junger Offizier verfolgte hin und wieder bestimmte Arbeitsgänge mit dem Sekundenzeiger seiner goldenen Taschenuhr. An jenem Tag hatte er die Uhr auf eine Werkbank gelegt, als er ans Telefon nach draußen gerufen wurde. Nach einer Weile erschien der junge Offizier wieder. Da lag die Uhr nicht mehr dort. Sie war und blieb verschwunden. Jemand musste sie in einem unbewachten Augenblick an sich genommen und versteckt haben. Vielleicht ein Racheakt gegen den unbarmherzigen Antreiber, vielleicht wollte der Dieb die goldene Uhr auch zu Geld machen. Wie dem auch sei …
Nur drei Fremdarbeiter kamen in Frage. Sie waren in der Nähe der Werkbank beschäftigt. Eine sofortige Körpervisitation brachte nichts zutage. Also musste der Dieb die Uhr versteckt haben.
Unter den drei Verdächtigten befand sich Jan, der bei mir einquartierte Holländer. Als die Uhr nicht zum Vorschein kam, ordnete der junge Leutnant wutentbrannt an, dass alle drei, neben Jan noch ein Italiener und ein Ukrainer, so lange verprügelt und geschlagen werden sollten, bis einer der drei den Diebstahl eingestehe und das Versteck verrate.
Zwei Männer vom Wachpersonal schlugen mit Koppeln auf die drei Arbeiter, deren Oberkörper entblößt wurden, ein. Der Italiener schrie aus Leibeskräften, während Jan die Zähne zusammenbiss, um die Schmach herunterzuschlucken. Sie sollten ihn, den jüngsten der Arbeiter, der ohnehin ob seiner Bartlosigkeit oft gehänselt wurde, nicht wimmern und heulen sehen. Er war unschuldig, absolut unschuldig. Er wusste auch nicht, wer von den beiden andern der Schuldige war, dem sie diese Tortur zu verdanken hatten.