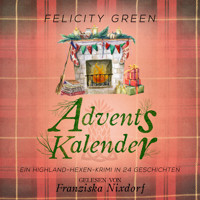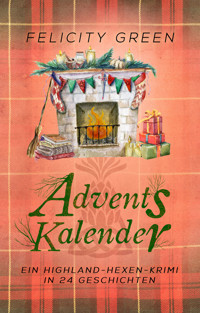4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Dunkle keltische Mythen, wilde irische Landschaften und eine unsterbliche Liebe …
In der spannenden Romantic-Fantasy-Saga DAS GEHEIMNIS VON CONNEMARA erfährt Alice, dass ihr Schicksal mit dem eines alten irischen Volkes verwoben ist.
Alice erwacht aus dem Koma – und mit ihr eine fremde Stimme. Sie spricht eine Sprache, die sie nie gelernt hat, und trägt Erinnerungen an ein anderes Leben in sich – an eine längst vergangene Zeit und eine verbotene Liebe.
Als Alice nach Irland reist, um den Spuren von Ciara zu folgen, dem Mädchen, das nun ein Teil von ihr ist, wird ihr bewusst: Keltische Mythen sind keine Märchen, sondern Realität. In Connemara, wo Nebel über moosbewachsene Hügel zieht, beginnt für sie eine lebensgefährliche Reise in eine Welt, die zwischen Licht und Schatten schwebt.
Welche Rolle spielt Dylan, Ciaras große Liebe, der ihren tragischen Tod auf dem Gewissen hat? Er will Alice um jeden Preis beschützen, doch jetzt droht er auch ihr zur Gefahr zu werden. Am Ende steht Alice vor einer Entscheidung: Wird sie ihr Herz und ihr Leben verlieren – oder liegt ihr einziges Heil in der Liebe?
Wenn du geheimnisvolle Mythen, Feenwelten voller Magie und eine unsterbliche Liebe über die Zeiten hinweg liebst, dann wird dich die CONNEMARA-SAGA verzaubern.
Für Fans von YA Romantic Fantasy und Romantasy von Autorinnen wie Sarah J. Maas, Marah Woolf, Juliane Maibach und Karen A. Moon.
»Ich LIEBE dieses Buch!! Ich konnte es keine Sekunde aus der Hand legen, weil es so packend war. Vergesst Bella, Katniss und Tris. Hier kommt Alice!« – Lovelybooks Leserunde
»Die Geschichte hat mich von Anfang an total fasziniert, die Mythen und Sagen und das Setting in Irland haben in mir Fernweh und Reiselust geweckt. (…) Unbedingt lesen!« – Süchtig nach Büchern
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
EICHENWEISEN
DAS GEHEIMNIS VON CONNEMARA
FELICITY GREEN
Felicity Green
EICHENWEISEN
Das Geheimnis von Connemara
Buch 1
2. Auflage, 2018
© Felicity Green
www.felicitygreen.com
Veröffentlicht durch:
A. Papenburg-Frey
Schlossbergstr. 1
79798 Jestetten
Umschlaggestaltung: CirceCorp design–Carolina Fiandri, circecorpdesign.com Coverbild: Depositphotos ©heckmannoleck, FlexDreams, DanFLCreativo
Korrektorat: Wolma Krefting, bueropia.de
Alle Rechte, einschließlich dem des vollständigen oder teilweisen Nachdrucks in jeglicher Form, sind vorbehalten.
Personen und Handlungen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden und verstorbenen Personen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
www.felicitygreen.com
INHALT
Kapitel Eins
Kapitel Zwei
Kapitel Drei
Kapitel Vier
Kapitel Fünf
Kapitel Sechs
Kapitel Sieben
Kapitel Acht
Kapitel Neun
Kapitel Zehn
Kapitel Elf
Kapitel Zwölf
Kapitel Dreizehn
Kapitel Vierzehn
Kapitel Fünfzehn
Kapitel Sechzehn
Kapitel Siebzehn
Kapitel Achtzehn
Kapitel Neunzehn
Kapitel Zwanzig
Kapitel Einundzwanzig
Kapitel Zweiundzwanzig
Kapitel Dreiundzwanzig
Kapitel Vierundzwanzig
Kapitel Fünfundzwanzig
Epilog
Leseprobe EFEURANKEN
I and Pangur Ban my cat
'Tis a like task we are at:
Hunting mice is his delight
Hunting words I sit at night
Irisches Gedicht, 9. Jahrhundert, aus dem Irischen von Robin Flowers
Für Yannic und seinen unerschütterlichen Glauben
KAPITEL EINS
Ich kam langsam zu mir und war völlig desorientiert. Meine Lippen formten die Worte, die in meinem Kopf entstanden. Das war schwer genug und ich hatte nicht die Energie, darüber nachzudenken, was ich sagte oder wie es sich anhörte. Heraus kam ein krächzendes: »Wo bin ich?«
Meine Eltern schauten mich mit sorgenvollen Mienen und Tränen in den Augen an. Ich lag in einem Bett, das nicht meins war. Das Zimmer, in dem ich mich befand, war weiß gestrichen und spartanisch eingerichtet. Ich sah alles nur undeutlich und mein Kopf schmerzte dumpf.
»Alice«, flüsterte meine Mutter. Weitere aufgeregte Worte folgten, die ich nicht verstehen konnte. Als ich auf ihre Hand hinunterblickte, die meine umschloss, sah ich Schläuche an meinem Handgelenk. Alles um mich herum wurde noch verschwommener. Wieder sagte meine Mutter etwas, diesmal mit Nachdruck. Dann schwand mein Bewusstsein. Erschöpft ließ ich mich gerne von der Dunkelheit übermannen und versank in einen traumlosen Schlaf.
Als ich wieder aufwachte, konnte ich klarer sehen. Meine Eltern und ein Mann im weißen Kittel schauten auf mich herunter. Der dumpfe Schmerz in meinem Kopf war zu einem leichten Pochen mutiert und meinem Verstand gelang es nun, Schlussfolgerungen darüber zu ziehen, wo ich war.
»Was ist passiert?«, rief ich panisch.
Meine Mutter schüttelte den Kopf und fing an zu weinen. Mein Vater wandte sich dem Arzt zu und sprach mit gerunzelter Stirn. Der Arzt schaute mich mit ernsten Augen an, sagte auch etwas in der fremden Sprache und deutete auf seine Lippen.
»Ich höre Sie gut«, rief ich laut, als ob er der Schwerhörige wäre. Und dann leiser, frustrierter: »Ich verstehe einfach nicht, was Sie sagen.«
Wir starrten uns alle schweigend an. Obwohl ich die Worte nicht verstehen konnte, so gelang es mir doch, in den Augen des Arztes und meiner Eltern die verschiedenen Emotionen zu lesen. Besorgnis, Verwirrung … Angst. Doch Angst vor was – vor mir? So kam es mir einen flüchtigen Augenblick lang vor. Ich warf den Kopf auf dem Kissen hin und her, als ob ich so abschütteln könnte, was sich anscheinend wie Spinnenweben um meinen Verstand gelegt hatte.
Der Arzt redete in beruhigendem Ton auf meine Eltern ein und begleitete sie aus dem Zimmer. Ich schaute ihnen hilflos nach, dann richtete ich mich auf und bewegte meine Gliedmaßen. Nichts tat wirklich weh, abgesehen von meinem Kopf und dem rechten Oberschenkel, der sich wund anfühlte. Ich wollte hier nicht bleiben, ahnungslos, was mit mir geschah, nicht wissend, wo meine Eltern hingegangen waren. Ich wollte nach Hause, in meinem Bett schlafen, und dann zu der Vertrautheit eines gemeinsamen Frühstücks mit meiner Familie wieder aufwachen, wo diese Episode mit einer einfachen Erklärung lachend als schlechter Traum abgetan wurde.
Als ich gerade meine zittrigen Beine über den Rand des Bettes manövriert hatte, kam eine Krankenschwester in mein Zimmer. Sie redete auf mich ein, und ich schaute sie nur fragend an, begriff aber schließlich, dass sie mir dabei behilflich sein wollte, mich in den Rollstuhl zu setzen. In den folgenden Stunden sah ich meine Eltern nicht, sondern ließ etliche Untersuchungen über mich ergehen. Man schob mich in eine Röhre, die ich schon einmal im Fernsehen gesehen hatte, und ich daher eine vage Ahnung hatte, dass dieses Gerät Aufnahmen von meinem Gehirn machte. Immer wieder versuchten Ärzte und Krankenschwestern sich verständlich zu machen, indem sie langsam sprachen und ihre Worte mit Handgesten unterstrichen. Die Verwirrung, welche die fremde Sprache in meinem Hirn auslöste, war einfach zu groß. Ich musste immer wieder an die Redewendung »im falschen Film« denken, denn genauso kam ich mir vor. Nur hatte jemand vergessen, die Untertitel anzuschalten. Bei dem absurden Gedanken fing ich laut an zu kichern. Die Krankenschwester, die mir gerade dabei half, mich wieder anzuziehen, warf mir einen komischen Blick zu. Schnell legte ich die Hand auf den Mund. Oh Gott, vielleicht war ich dabei, den Verstand zu verlieren. Ich gewann wieder Kontrolle über mich, doch sofort fing mein Kopf stärker an zu schmerzen. Der Schmerz wurde immer schlimmer, je mehr ich Krankenschwestern und Ärzten angestrengt lauschte, versuchte ihre Lippen zu lesen, und immer frustrierter mit dem Kopf schütteln musste, also begann ich die Stimmen auszublenden. Während ich die Untersuchungen wie eine Puppe über mich ergehen ließ, versuchte ich mich daran zu erinnern, wieso ich hier war und was geschehen war. Als ich von Raum zu Raum geschoben wurde, erkannte ich das Krankenhaus wieder, in dem ich auch geboren wurde. Vor ein paar Jahren hatten wir hier meine Oma nach ihrem ersten Schlaganfall besucht und gerade erst vor ein paar Monaten mussten wir meine Mutter in die Notaufnahme bringen, weil sie sich beim Brotschneiden beinahe die Fingerkuppe abgeschnitten hatte.
Das Letzte, woran ich mich erinnerte, war die große Erleichterung darüber, dass ich meine letzte Abiturklausur gerade hinter mich gebracht hatte. Lisa, Melinda und ich waren total aufgekratzt und sind aus dem Schulgebäude gerannt wie die kleinen Kinder.
Ich hielt mich an der Erinnerung fest wie an einem Anker. Wann war das gewesen? Es kam mir wie gestern vor, doch wie lange lag ich wohl schon im Krankenhaus? Angesichts der Gedächtnislücke überkam mich die Panik und ich spürte, wie es schwieriger wurde, Luft in meine Lungen zu bekommen. Also schloss ich die Augen und versetzte mich wieder in diesen glücklichen Moment zurück. Nachdem ich ein paarmal tief ein- und ausgeatmet hatte, spielte sich tatsächlich vor meinem inneren Auge ab, was als Nächstes passiert war.
Wir wollten zum Supermarkt um die Ecke gehen, eine Flasche Sekt kaufen, uns in den Park setzen und darauf anstoßen, dass der Abi-Stress endlich vorbei war. Schnell rannten wir über die Straße, um zum Supermarkt zu gelangen. Dann: quietschende Reifen. Ein Schrei. Wer war das? Lisa, Melinda? Oder ich? Ich konnte im Kopf die Geräusche hören, doch die Richtung nicht orten. Alles geriet auf einmal durcheinander, als ob ich in einem Wirbelsturm gefangen wäre, der sich immer schneller um mich herum drehte, bis undurchdringliche, undifferenzierte Dunkelheit mich übermannte. Es wurde erst wieder Licht, als ich in meinem Krankenhausbett aufwachte.
Ich riss erschrocken die Augen auf, beim Gedanken daran, wie viel Zeit wohl wirklich dazwischen vergangen sein mochte. Ich schaute mich um, während mich eine Krankenschwester durch den Flur schob. Am Ende des Korridors konnte ich das Zeichen für die Toiletten sehen. Ich zeigte darauf und machte der jungen Schwester, die ein sonniges Gemüt zu haben schien und durch nichts aus der Ruhe zu bringen war, deutlich, dass ich dorthin wollte. Sie half mir mit dem Rollstuhl in die Behindertentoilette und ich gab ihr zu verstehen, dass ich ohne ihre Hilfe klarkam. Als sie die Tür hinter sich zufallen ließ, beugte ich mich näher zum Spiegel, der sich auf Augenhöhe befand. Ich konnte spüren, wie Erleichterung in Wellen über meinen Körper rollte, als ich mein Gesicht im Spiegel wiedererkannte. Es war etwas blasser, etwas abgezehrter vielleicht, aber doch immer noch dasselbe Gesicht, das mich auch in meiner Erinnerung im Spiegel zurück angeschaut hat. Meine glatten dunkelbraunen Haare waren zu derselben schulterlangen Frisur geschnitten, die ich mir ein paar Wochen vor dem Abi zugelegt hatte. Blaugrüne Augen, eine kurze, gerade Nase, ein kleiner Mund mit vollen Lippen. Ich war noch immer ich, Alice Lohmann, achtzehn Jahre, Fast-Abiturientin. Zumindest sah ich so aus. Ich führte meine Hand zum Gesicht und tastete es ab, erleichtert, warme Haut zu spüren und noch erleichterter, als mein Spiegelbild es mir nachtat. Ich konnte beobachten, wie mir eine Träne aus dem rechten Auge lief und spürte dann, wie sie auf meine Hand tropfte, die ich immer noch an die Wange hielt.
Es kam mir nun alles etwas weniger unwirklich vor. Aber wieso nur konnte ich mich mit niemandem verständigen? Meine Gedanken übersetzen sich mühelos in Sprache, meine Lippen formten die Worte, ich konnte alle akustisch verstehen … Ich stoppte mich selbst, als ich merkte, wie meine Überlegungen sich im Kreis drehten und das Pochen in meinem Kopf wieder lauter wurde. Ich versuchte, mich mit handfesten Tatsachen zu beruhigen und untersuchte meinen Oberschenkel, der leicht schmerzte. Die Hautabschürfungen an der Seite waren mit dunklem Schorf verkrustet, der an manchen Stellen schon abgefallen war und neue rosa glänzende Haut zeigte. Ich atmete etwas befreiter ein und aus – lange konnte es nicht her sein, dass ich den Unfall gehabt hatte.
Als ich wieder aus der Toilette kam, wartete die Krankenschwester geduldig auf mich. Sie schob mich etwas weiter und stellte mich dann allein in einem Korridor ab, sagte etwas, das ich – natürlich – nicht verstand, und verschwand dann um die Ecke. Ein paar Minuten vergingen und sie kam nicht wieder. Jetzt wurde ich langsam wütend. Ich wollte wissen, was mit mir geschehen war. Das Gefühl der Ohnmacht stieg in mir hoch, je mehr ich über meine letzten Erinnerungen nachdachte und desto unverständlicher mir mein »Sprachproblem« erschien. Ich wollte einfach nur, dass mir jemand meine Situation erklärte, wie auch immer wir uns verständigen würden. Stattdessen ließ man mich hier allein. Heiße Wuttränen stiegen in mir hoch und sammelten sich in meinen Augen. Gerade als ich meine Eltern um die Ecke biegen und auf mich zukommen sah, gerade als ich im Begriff war, auf sie zuzustolpern, mich in ihre Arme zu werfen und sie lautstark anzuflehen, mir doch zu helfen, gerade in dem Moment drang ein Gesprächsfetzen zu mir durch.
»… Sie bitten, etwas vorsichtig …«
In meinem Kopf machte es klick. Ich sprang auf und taumelte in die Richtung, aus der die Worte kamen. Mit wackligen Beinen tastete ich mich, so schnell ich konnte, an der Wand entlang. Aus dem Augenwinkel sah ich, wie meine Eltern ihre Schritte beschleunigten und mir etwas zuriefen. Ich verstand sie immer noch nicht. Aber ich hörte eine männliche Stimme, die ich auf keinen Fall verlieren durfte, gleich hier um die Ecke sagen: »… reisen können Sie leider noch nicht.«
Die Stimme hatte einen ganz anderen Klang als die in meinem Kopf, und doch verstand ich sie. Mir wurde heiß. Jetzt sah ich einen Arzt, der mit einem alten Mann im Bademantel redete. In meiner Aufregung stürzte ich vornüber und wäre hingefallen, wenn mich der Arzt nicht aufgefangen hätte. Er redete auf mich ein, wieder in der Sprache, die ich nicht verstand. Dem älteren Mann, offensichtlich ein Patient, entfuhr es jedoch: »Junge Frau!« Mir wurde bewusst, dass diese seine Sprache nicht meine Muttersprache war, sondern eine Sprache, die ich vor längerer Zeit gelernte hatte und gut verstehen konnte. Die Synapsen in meinem Gehirn knüpften eine weitere Verbindung, während ich mich aufrichtete. Englisch! Der Mann sprach nicht Deutsch, sondern Englisch. Ich kramte hektisch in meinem Gedächtnis herum und formte die Worte, die mir in den Sinn kamen, mit meinem Mund. Erst schien es schwierig, doch dann wurde es immer leichter.
»Bitte helfen Sie mir«, sagte ich auf Englisch. »Mich versteht keiner. Ich muss wissen, was los ist, bitte!«
Mittlerweile hatten meine Eltern zu uns aufgeschlossen, hielten mich bei den Armen und redeten mir zu.
»Nein, ich verstehe doch nicht«, rief ich aufgeregt und wandte mich an Arzt und Patienten. »Ich verstehe keinen, aber Sie beide verstehe ich. Bitte, bitte, so helfen Sie mir doch.« Mir liefen die Tränen über das Gesicht.
Der alte Mann schaute mich verwirrt an.
»Bitte entschuldigen Sie«, sagte der Arzt zu ihm. »Ich komme später noch mal zu Ihnen, wenn das in Ordnung ist.«
»Ja, kümmern Sie sich doch erst mal um die junge Dame, die ist ja ganz außer sich«, murmelte dieser bestürzt.
Jetzt war auch der Arzt zu uns gestoßen, der bei mir gewesen war, als ich im Krankenbett aufgewacht war. Die Ärzte tauschten sich aus, während meine Mutter mich in den Arm nahm und mir über das Haar streichelte. Ich lehnte mich gegen sie, denn das Stehen strengte mich an und ich war völlig erschöpft.
»Setzen wir uns doch erst mal«, sagte der Arzt, der Englisch sprach, zu mir. »Mein Name ist Doktor Moor. Das ist Doktor Brandt.« Er deutete auf eine nahe Sitzgruppe. Wir nahmen Platz und ich verwendete nun all meine Energie darauf, jetzt kommunizieren zu können.
»Bitte, bitte, sagen Sie mir doch, was mit mir passiert ist!«, unterbrach ich die Ärzte ungeduldig, die wohl weiter Informationen austauschten.
Doktor Brandt erklärte mir in gebrochenem Englisch, dass ich drei Wochen lang im Koma lag, nachdem ich einen Verkehrsunfall überlebt hatte.
»Aber warum kann mich niemand verstehen?«
Die beiden Ärzte wechselten einen langen, unmissverständlichen Blick. Jetzt fing meine Mutter an zu weinen und mein Vater nahm ihre Hand.
»Anscheinend verstehen und sprechen Sie kein Deutsch mehr«, antwortete Dr. Moor. »Doktor Brandt sagt mir, dass Sie, seit Sie aufgewacht sind, eine Sprache sprechen, die keiner verstehen oder gar zuordnen kann. Ein Kauderwelsch, womöglich. Man nahm an, durch den Unfall hätten Sie eine Kopfverletzung erlitten, die das Sprachzentrum in Ihrem Gehirn beeinträchtigte. Doch jetzt sind wir überrascht, denn Englisch scheinen Sie gut zu verstehen und zu sprechen. Erklären Sie uns doch bitte, wie Sie sich dabei fühlen, wenn Sie Deutsch sprechen wollen.«
»Es ist schwer zu erklären«, sagte ich und musste mich sehr anstrengen, um das Wirrwarr in meinem Kopf zu analysieren und den anderen verständlich zu machen. »Ich dachte, dass ich Deutsch spreche. Zumindest bis ich merkte, dass mich niemand versteht … Und jetzt, wo ich Englisch spreche, da wird mir bewusst, ich dachte bloß, es wäre Deutsch, weil ich nicht über die Worte nachgedacht habe. Sie kamen sozusagen ungefiltert, wie … wie meine Muttersprache. Wenn ich jetzt bewusst deutsche Worte formulieren soll, dann ist mein Verstand blank. Die deutschen Wörter wollen mir nicht einfallen. Kein Wunder, denn ich kann euch, die ihr Deutsch sprecht, auch nicht verstehen. Wenn ich diese Sprache spreche, hingegen …«, und nun fing ich an, in der Sprache zu sprechen, die mir ganz natürlich über die Lippen kam, »dann fühlt es sich einfach ganz normal an, ich muss nicht darüber nachdenken.« Ich wiederholte den letzten Satz auf Englisch, und fügte verzweifelt an: »Ich kann aber nicht definieren, welche Sprache es ist.«
Dr. Moor hatte auf einmal ein paar hektische kreisrunde rote Flecken auf den Wangen. »Ich bin mir fast sicher, das ist wirklich kein Kauderwelsch, sondern eine Sprache, und ich glaub, ich weiß auch welche, aber das würde mich doch sehr wundern …« Er legte seine Stirn in Falten. »Bitte entschuldigen Sie mich doch kurz«, sagte er schließlich und stand auf. »Ich versuche, einen Bekannten zu erreichen, der uns vielleicht helfen kann.«
Dr. Brandt sagte etwas zu Dr. Moor. Dieser nickte und ging den Korridor hinunter, während er sein Handy aus der Tasche zog.
Dr. Brandt schaute auf einige Dokumente, die er in der Hand hielt. Ich nahm an, dass es sich dabei um meine Krankenakte handelte.
»Alice, es gibt keine körperliche Ursache, die wir für diese … hmm … Sache verantwortlich machen können. Wir würden Sie gerne noch für einen Tag zur Beobachtung hierbehalten, und sicherstellen, dass Sie wieder ganz zu Kräften kommen, aber abgesehen davon … geht es Ihnen rein körperlich gut.« Er sagte etwas zu meinen Eltern, und ich nahm an, dass er dasselbe auf Deutsch für sie wiederholte. Dr. Brandt mochte einige Fachausdrücke auf Englisch mehr können als sie – seine Aussprache war miserabel –, aber meine Eltern hatten ihn bestimmt genauso gut verstanden wie ich. Sie sagten nichts, doch ich musste mich zurückhalten, ihm vor lauter Ungeduld nicht ins Wort zu fallen. Meine Eltern nickten eifrig, sichtlich erleichtert, dass es mir gut genug ging, um bald nach Hause zu kommen.
»Ich möchte keine Vermutungen anstellen, bevor wir Untersuchungsergebnisse haben, die etwas aufschlussreicher sind, aber ich habe schon von Fällen gehört, wo Kopftrauma- oder Schlaganfallpatienten plötzlich eine andere Sprache sprechen«, fuhr Dr. Brandt fort, nachdem mein Vater ihm versichert hatte, dass sie sein Englisch verstanden. »Man nennt das Aphasie. Es handelt sich jedoch meist um eine Sprache, die der Patient in der Kindheit gesprochen hat, oder zumindest eine Sprache, die der Patient durch Großeltern, andere Verwandte oder Bekannte sozusagen miterlebt und unbewusst gelernt hat.«
Meine Eltern schauten mich verwirrt an. Ich war mein ganzes Leben hier in Deutschland, hier in dieser Stadt gewesen, von ein paar Ferienreisen und einem Schulaustausch mal abgesehen. Ich hatte Englisch und Französisch in der Schule gelernt, aber sonst … meine Eltern und Großeltern waren deutsche Muttersprachler. Wann hätte ich eine andere Sprache lernen sollen – bewusst oder unbewusst?
Bevor wir uns weiter damit beschäftigen konnten, wurden wir von Dr. Moor unterbrochen, der eiligen Schrittes auf uns zukam, das Handy in der Hand. »Ich habe hier einen Bekannten am Apparat«, rief er uns aufgeregt zu. »Ich möchte gerne, dass Sie mit ihm auf … also, in der Sprache sprechen, die Ihnen natürlich über die Lippen kommt.«
Ich nahm das Telefon in die Hand. »Guten Tag«, sagte ich ohne nachzudenken. »Mein Name ist Alice. Mit wem spreche ich, bitte?«, fügte ich etwas zögerlicher hinzu, da mir nicht einfiel, was ich sonst zu meinem unbekannten Gesprächspartner sagen sollte. Eine kleine Pause entstand.
»Guten Tag, hier spricht Professor Heany«, antwortete mir eine männliche Stimme in meiner Sprache. Mit starkem Akzent und sehr gebrochen zwar, aber zweifelsohne in meiner Sprache! Ich jauchzte innerlich. Ein warmes Gefühl breitete sich in mir aus, der Gegenpol zu dieser befremdlichen, beklemmenden Situation, in der ich mich seit dem Aufwachen befunden hatte. Es fühlte sich an wie … wie zu Hause. Das kann nicht sein, dachte ich mir, du irrst. Doch das Bauchgefühl blieb. Ich fing an, drauflos zu plaudern. »Woher kommen Sie, wo befinden Sie sich gerade?«
»Einen Moment, bitte, ich spreche nicht so gut«, sagte Professor Heany radebrechend und fuhr dann auf Englisch fort: »Bitte geben Sie mir doch wieder Doktor Moor, Alice.«
Enttäuscht überreichte ich das Handy wieder Doktor Moor. Dieser sprach kurz mit Professor Heany.
»Alles, klar, wir telefonieren später wieder, nachdem ich das hier besprochen habe«, beendete er das Gespräch und legte auf. Er schaute in unsere fragenden Gesichter und schwieg einen Moment. Dann sagte er: »Alice spricht fließend Irisch.«
KAPITEL ZWEI
Am nächsten Tag holten mich meine Eltern aus dem Krankenhaus ab. Sie waren sichtlich froh, dass es mir wieder gut genug ging, um nach Hause zu kommen, aber trotzdem wirkte ihre gute Laune etwas aufgesetzt. Die Anspannung in ihren Gesichtern ließ sich nicht ganz verstecken. Es war nur eine Nacht vergangen, aber es fühlte sich eher so an, als ob wir uns Jahre nicht gesehen hätten – Jahre, in denen wir uns fremd geworden waren.
Diese seltsame Unvertrautheit, die zwischen uns stand, ging aber nicht nur von ihnen aus. Gestern noch waren wir alle so aufgewühlt gewesen. Bei ihnen hatte sicherlich die Erleichterung überwogen, dass mir körperlich nichts fehlte. Ich war so mit meiner Unfähigkeit beschäftigt gewesen, mich verständlich zu machen und andere zu verstehen. Nachdem wir gehört hatten, welche Sprache ich redete, als wir das Problem, wenn nicht erklären, dann zumindest näher definieren konnten, war uns wohl allen ein Stein vom Herzen gefallen. Als wir uns voneinander verabschiedeten, hatten meine Eltern sicher genauso gedacht wie ich, dass wir und die Ärzte schon bald darauf kommen würden, wieso ich Irisch sprach und wie man dieses »Leiden« wieder heilen könne. Doch die Verwirrung über meinen Zustand wurde nicht weniger, je länger man darüber nachdachte, im Gegenteil. Es gab keine logische Erklärung dafür. Und so wurde mein Verhalten für meine Eltern befremdlich, nehme ich an. Aber auch ich fühlte mich immer fremder, je mehr ich mich damit auseinandersetzte.
Dass sich etwas zwischen uns geschoben hatte, war im Krankenhaus noch zu überspielen gewesen. Wir hatten noch eine Besprechung mit den Ärzten. Formalitäten waren zu erledigen gewesen. Doch jetzt im Auto war das betretene Schweigen unerträglich. Mein Vater schaltete das Radio ein. Ich dankte dem Himmel, dass es anfing zu regnen. Die leise Musik und das Trommeln der Regentropfen auf die Scheiben verschmolzen zu einer Geräuschkulisse, die diese ungemütliche Stille zwischen uns zumindest ein wenig maskierte.
Ich sah aus dem Fenster und nahm meine Heimatstadt, die an mir vorbeizog, wie ein mit Wasserfarben gemaltes Bild in Grautönen war. Je näher wir unserem Haus kamen, desto weniger freute ich mich darauf, wieder daheim zu sein. Meine Vorahnung bekräftigte sich, als wir in unsere Einfahrt einbogen. Auch das Haus, in dem ich aufgewachsen war, kam mir vor, als ob ich es mit den Augen einer Fremden sehen würde.
Stillschweigend gingen wir hinein. Zögerlich legte mein Vater die Schlüssel auf die Anrichte im Flur. Für einen Moment standen wir dort unschlüssig herum. Ich kam meiner Mutter zuvor, die, wie ich mir denken konnte, im Begriff war, geschäftig in die Küche zu eilen und uns an den Küchentisch zu scheuchen.
»Ich leg mich etwas hin«, sagte ich auf Englisch und deutete die Treppe hoch zu meinem Zimmer.
»Magst du nicht erst was essen?«, fragte meine Mutter enttäuscht. »Ich hab dir deine Lieblings-Muffins gebacken. Schokolade und Himbeeren«, fügte sie hinzu, als ob ich im Koma vergessen hätte, welche Muffins ich am liebsten mochte.
»Danke, später vielleicht, ich habe jetzt keinen Hunger«, murmelte ich und ging die Treppe hoch, um mich in mein Zimmer zu flüchten.
Dort angelangt lehnte ich mich erleichtert gegen die Tür, nachdem ich sie fest hinter mir zugemacht hatte, und schloss die Augen. Ich atmete ein paar Mal tief ein und aus. Hier, in meinem eigenen Reich, fühlte ich mich schon etwas befreiter.
Ich wollte die Augen gar nicht wieder aufmachen, um die Illusion nicht zu zerstören, zwang mich aber trotzdem dazu. Langsam schritt ich durch das Zimmer und sah mich um, als ob ich es zum ersten Mal betrat. Es war gemütlich, hier unter dem Dach, mit der holzvertäfelten Decke und den weiß verputzten Wänden. Meine Mutter hatte mein Bett mit der lilafarbenen Garnitur bezogen, die mir am besten gefiel, hatte es aber nicht lassen können, aufzuräumen, weshalb mein Zimmer ungewohnt ordentlich aussah.
Einzig die Bilder, die an der Wand hingen und die ich um den großen Wandspiegel geklebt hatte, lösten in mir ein beklemmendes Gefühl aus. Sie zeigten eine lachende Alice inmitten ihrer Freunde und ihrer Familie, mit der es mir schwerfiel, mich zu identifizieren. Wieder konnte ich dieses Gefühl nicht abschütteln, dass Jahre, nicht nur Wochen, vergangen waren, seit ich diese Fotos das letzte Mal betrachtet hatte. Die nostalgische Melancholie, die sich in mir breitmachte, veranlasste mich fast dazu, die Bilder abzuhängen. Doch ich verdrängte diesen Impuls. Ich wollte schließlich, dass es mir wieder besser ging, dass ich mich wieder wie die fröhliche Alice auf den Fotos fühlen würde. Es half sicher nichts, mich davon abzukapseln.
Ich schaute aus dem Mansardenfenster. Der Ausblick auf unseren Garten war mir so schmerzhaft vertraut, dass mir fast die Tränen kamen. Der Rasen war länger nicht gemäht worden, aber die Blumenbeete sahen so ordentlich aus, wie ich sie in Erinnerung hatte. Im Garten stand immer noch meine alte Schaukel, für die ich schon seit Jahren zu groß war. Jedes Jahr nach meinem Geburtstag sprach mein Vater davon, sie endlich mal abzubauen. Ich widerstand dem Drang, die Treppe hinunterzulaufen, um ihn zu bitten, die Schaukel stehen zu lassen. Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass ich es nicht ertragen könnte, aus dem Fenster zu schauen und die Schaukel auf einmal nicht mehr zu sehen. Jetzt gab sie mir Antrieb dazu, mich nicht dieser Melancholie hinzugeben, sondern dafür kämpfen zu wollen, dass mein Leben wieder so werden würde wie vor dem Koma.
Entschlossen trat ich vom Fenster weg und sah mich wieder im Zimmer um – diesmal suchte ich etwas Bestimmtes. Auf meinem Schreibtisch lagen noch Schulbücher, mit deren Hilfe ich mich auf die letzte Abi-Klausur vorbereitet hatte. Englisch. Das würde mir jetzt nicht helfen, denn die Sprache sprach ich schließlich gut. Wie schon vor dem Koma. Das brachte mich auf eine andere Idee.
Ich ging zu meinem überfüllten Bücherregal rüber. Ich las gerne und viel, deshalb waren mir die meisten Bücher auch vom Umschlag her bekannt, ohne dass ich jetzt Autorennamen und Buchtitel wirklich lesen konnte. Das war ein so surreales Gefühl, dass mir fast schwindlig wurde davon. Ich nahm einen oft gelesenen Harry-Potter-Band aus dem Regal und schlug ihn auf. Die mir fremden deutschen Buchstaben verschwammen vor meinen Augen, als mir die Tränen kamen. Mir wurde auf einmal richtig bewusst, dass ich nicht mehr lesen konnte. Zumindest keine Bücher in deutscher Sprache, in meiner Sprache! Wahrscheinlich würde ich Irisch lesen können, kam mir dumpf der Gedanke. Doch ich war noch nicht bereit, meinen Laptop anzumachen, und das herauszufinden. Denn das würde mein Zimmer, meine Bücher, mein Leben nur noch wieder ein kleines bisschen fremder machen.
Ganz unten im Regal standen die Kinderbücher, die ich nie übers Herz gebracht hatte wegzugeben. Mein Blick fiel auf ein Buch, das eine ganz besondere Bedeutung für mich hatte, und ich wusste auf einmal, dass es mir helfen würde, wieder zu mir zurückzufinden. Heidi von Johanna Spyri.
Als ich noch ein kleines Kind war und gerade dabei war, lesen zu lernen, hatte mir meine Mutter jeden Abend aus diesem Buch vorgelesen. Immer wieder hatte ich sie dazu angehalten, die Geschichten über Heidi, die zu ihrem Großvater, dem Alm-Öhi, auf die Alp kommt, und die Abenteuer, die sie zusammen mit ihrem Freund, dem Geißenpeter erlebt, vorzulesen. Ich konnte zu dem Zeitpunkt zwar schon die Buchstaben aneinanderreihen, aber es dauerte mir einfach zu lange, bis sich das Wort für mich erschloss und die Wörter sich flüssig zu Sätzen zusammenfügten. Meine Mutter konnte hingegen so schön erzählen.
Doch eines Abends waren meine Eltern nicht da. Ich brannte darauf, zu wissen, wie es mit der Geschichte weiterging. Vor lauter Ungeduld schnappte ich mir das Buch und strengte mich ganz besonders an. Wie durch ein Wunder machte der Buchstabensalat auf einmal Sinn, und ganz natürlich wurden daraus Wörter und Sätze. Ich konnte lesen!
Das Buch begeisterte mich so sehr, dass ich es im Laufe der Jahre immer wieder las. Mittlerweile kannte ich es fast auswendig. Jetzt nahm ich es also wieder zur Hand und schlug es auf. Nicht am Anfang, sondern an der Stelle, an der ich als kleines Kind, das nicht lesen konnte, auch weitergelesen hatte. Ich konnte mich immer so gut daran erinnern, weil es eine Ausgabe war, die Schwarz-weiß-Fotos enthielt. Die Stelle, die ich suchte, war genau auf der gegenüberliegenden Seite des Fotos, auf dem Heidi auf den Heuboden klettert, der in der Hütte ihres Großvaters ihre Schlafstelle sein wird.
Wenn ich mich sehr anstrengen würde, könnte ich mich erinnern, was dort stand. Ich legte mich auf mein Bett und versuchte zu lesen. Anfänglich kam ich mir wieder vor, als ob ich wie eine Erstklässlerin mühselig die Buchstaben aneinanderfügte. Eine sehr frustrierende Angelegenheit. Mehrmals war ich drauf und dran, das Buch ungeduldig in die Ecke zu schmeißen. Aber ich musste es doch schaffen können, die deutsche Sprache, die laut den Ärzten irgendwo in meinem Hirn vergraben war, wieder an die Oberfläche meines Bewusstseins gelangen zu lassen. Ich wollte einfach bloß, dass alles wieder so war wie vor dem Unfall, und ich war mir sicher, dass sich das bewerkstelligen ließe, wenn ich nur wieder meine Muttersprache zurückgewinnen und mit allen kommunizieren könnte.
Ich verlor jegliches Zeitgefühl; keine Ahnung, wie lange es dauerte, bis ich endlich den ersten Abschnitt zusammenbrachte und die Worte wieder etwas Sinn ergaben.
In der Ecke vorüber des Großvaters Lagerstätte war eine kleine Leiter aufgerichtet; Heidi kletterte hinauf und langte auf dem Heuboden an. Da lag ein frischer, duftender Heuhaufen oben, und durch eine runde Luke sah man weit ins Tal hinab.
»Hier will ich schlafen«, rief Heidi hinunter, »hier ist's schön! Komm und sieh einmal, wie schön es hier ist, Großvater!«
»Weiß schon«, tönte es von unten herauf.
Irgendwann muss ich erschöpft eingeschlafen sein, denn als ich wieder die Augen aufmachte, war es in meinem Zimmer dämmrig. Zwischenzeitlich musste meine Mutter hereingekommen sein, denn das Buch lag nicht irgendwo aufgeschlagen im Bett, sondern geschlossen auf meinem Nachttisch. Sie hatte einen Zettel zwischen die Seiten gesteckt, vermutlich dort, wo es aufgeschlagen war. Neben dem Buch stand ein Glas Milch und ein Teller mit einem Schoko-Himbeer-Muffin darauf. Ich nahm einen Schluck aus dem Glas, um den schlechten Geschmack aus meinem Mund zu vertreiben und biss dann vom Muffin ab. Er schmeckte köstlich; genauso, wie ich ihn in Erinnerung hatte. Zum ersten Mal, seit ich im Krankenhausbett aufgewacht war, spürte ich einen Funken Hoffnung in mir aufkeimen. Hungrig nahm ich noch einen Bissen und beschloss, dass der Muffin sogar noch besser schmeckte als früher. Kauend stand ich auf und schaute aus dem Fenster. Mit einem Lächeln musste ich feststellen, dass die Schaukel immer noch im Garten stand. Mit einem Mal wusste ich, dass alles wieder gut werden würde.
KAPITEL DREI
»Ich bin einfach nur froh, dass unserem Mädchen nichts Schlimmes passiert ist, Anne. Sie ist dabei, wieder Deutsch zu lernen und bald wird alles sein wie früher. Dann können wir zur Normalität zurückkehren und den Unfall und die schreckliche Zeit hinter uns lassen.«
»Aber Frank, man kann doch nicht einfach ignorieren, dass Alice plötzlich eine Sprache spricht, mit der sie noch nie zuvor in Kontakt gekommen ist …«
Meine Eltern stritten sich schon wieder. Ich saß oben auf der Treppe und hörte ihnen zu. Mittlerweile verstand ich auch wieder, worüber sie sich stritten. Ich war jetzt schon einige Wochen wieder zu Hause, und anfänglich hatte ich nur anhand ihrer Tonlage und der Lautstärke ihrer Unterhaltung vernommen, dass sie sich nicht einig waren. Dass es um den Umgang mit meiner Krankheit und meine Genesung ging, dass es meine Schuld war, dafür brauchte ich die Sprache nicht zu verstehen.
Vor meinem Unfall waren die beiden ein Herz und eine Seele gewesen. Fast schon zu harmonisch war mir unser Familienleben vorgekommen. Als Kind fand ich das natürlich gut, aber später hat es mich genervt. Meine Freundinnen fanden meine Eltern immer klasse und waren gern zu Besuch hier gewesen. Ich hatte dahingegen darüber gestöhnt und gejammert, dass wir alles zusammen machen mussten, Familienabende einplanten und dergleichen, und hatte mir mehr Freiraum gewünscht. Besonders in den letzten Jahren war ich jedoch insgeheim froh darüber gewesen, dass sich meine Eltern nicht dauernd Gemeinheiten an den Kopf warfen, wie Melindas Eltern zum Beispiel, die mittlerweile geschieden waren. Aber, gemäß dem Klischee, merkt man immer erst, was man an etwas hat, wenn man es nicht mehr hat.
In den ersten Tagen nach meinem Krankenhausaufenthalt hatte ich also wie heute auf der Treppe gesessen und mir gewünscht, dass mir nie etwas passiert wäre. Nicht, weil es mir schlecht ging, sondern weil mich die Schuldgefühle plagten, für den Bruch in der Beziehung meiner Eltern verantwortlich zu sein. Wenn ich doch wenigstens verstehen würde, was sie sagten, so hatte ich zu dem Zeitpunkt noch gedacht, dann könnte ich mich am Gespräch beteiligen und ihnen versichern, dass doch alles in Ordnung war und es keinen Grund dafür gab, sich zu streiten. Seit einiger Zeit nun verstand ich wieder Deutsch. Trotzdem konnte ich nicht aufstehen und meine Eltern beruhigen. Etwas war dazwischengekommen in den letzten Wochen, in denen die Kommunikation so schwierig gewesen war, das es mir unmöglich machte, sie einfach in die Arme zu nehmen und zu sagen: Es wird alles wieder gut.
Ich hätte am Anfang nicht gedacht, dass es so schwierig werden würde. Kommunikation an sich fand ja schließlich statt. Meine Eltern konnten Englisch sprechen – beide hatten es in der Schule gelernt und meine Mutter musste es in ihrem Beruf als Industriekauffrau öfter anwenden. Mein Vater hatte während des Studiums ein Jahr in Amerika verbracht. Aber es war doch schwierig für sie, immer nach den richtigen Worten zu suchen und sich nicht ungezwungen mit ihrer Tochter unterhalten zu können. Und ich verlor leicht die Geduld, wenn ich etwas umständlich umschreiben musste. Dass mein Englisch viel besser war, als ich es in der Schule gelernt hatte, darüber verlor niemand ein Wort. Vielleicht konnten meine Eltern es nicht beurteilen, vielleicht wollten sie sich auch damit nicht beschäftigen, wo es schon genug noch sonderbarere Dinge gab, mit denen wir uns auseinandersetzen mussten.
Lisa und Melinda, die mit mir im Englisch-Leistungskurs gewesen waren, hatten es aber gemerkt. Das schien ihnen komischer vorzukommen als meine Irisch-Kenntnisse, von denen sie ja nichts verstanden. Auf einmal war da eine ungewohnte Barriere zwischen meiner Umwelt und mir. Da meine sonderbare »Krankheit« auch meine Eltern entzweite, kam es mir vor, als ob wir seit dem Tag, an dem ich im Krankenhaus aufgewacht war, uns alle drei immer weiter voneinander entfernen würden.
Anfänglich war ich davon überzeugt gewesen, dass sich doch alles wieder zum Alten wenden würde, sobald ich meine Muttersprache wieder erlernt hatte. Deshalb stürzte ich mich förmlich in die Sprachtherapiestunden. Mir wurde erklärt, dass ich die deutsche Sprache nicht neu lernen müsste wie eine Fremdsprache, weil ich sie nie wirklich verlernt hatte, sondern dass es lediglich darum ging, meine Sprachkenntnisse aus dem Unterbewusstsein förmlich wieder auszugraben. Und so begann ich in relativ kurzer Zeit wieder Deutsch zu verstehen. Als ich mein Heidi-Buch erneut ohne große Mühe in einem durchlesen konnte, freute ich mich wie ein Schneekönig. Mit dem Sprechen tat ich mich noch etwas schwer. Zuerst waren es die, so schien es mir, ungewohnten Silben, die ich einfach nicht aussprechen konnte. Mit viel Übung gelang mir auch das bald einigermaßen. Trotzdem kam es mir wie eine fremde Sprache vor.
Seit ich Deutsch wieder sprach, unterhielt ich mich mit meinen Eltern natürlich auch wieder in meiner Muttersprache. Beide waren so erleichtert gewesen, endlich normal mit mir reden zu können; ich konnte ihre Gesichtszüge entspannen sehen, wenn wir uns unterhielten. Doch unsere Gespräche waren trotzdem nicht wie früher. Die Barriere war unsichtbar, und obwohl wir sie alle fühlten, wollte keiner wahrhaben, dass es sie immer noch gab. Was auch immer zwischen uns stand, es wuchs stetig weiter. Und deshalb konnte ich jetzt auch nicht aufstehen und zu meinen Eltern in die Küche gehen, sondern saß stattdessen wie angewurzelt auf der Treppe.
»Vielleicht sollten wir es doch mal mit dieser Rückführungstherapie versuchen …«, fing meine Mutter wieder an. Ich zuckte zusammen, denn ich wusste, dass mein Vater explodieren würde. Und die befürchtete Reaktion ließ nicht lange auf sich warten.
»Rückführungstherapie, so ein Humbug! Nach vorne schauen, das sollten wir! Alice macht großartige Fortschritte und darauf sollten wir uns konzentrieren. Du glaubst doch wohl nicht im Ernst, dass unsere Tochter in einem früheren Leben Irisch gesprochen hat und dass das jetzt durch das Trauma wieder irgendwie zu ihr zurückgekommen ist. Als Nächstes kommst du mir noch damit, dass sie von einem irischen Geist besessen ist, der durch sie in Zungen spricht, und den wir ihr mittels eines Exorzismus austreiben müssen. Das ist nämlich auch so eine hanebüchene Theorie, die manche Leute bei Fällen wie Alices aufstellen. Dabei gibt es viele mögliche wissenschaftliche und rationale Erklärungen dafür, die einfach nicht bewiesen sind, weil Hirnforschung noch so ein junges Forschungsgebiet ist. Ich kann dir da wissenschaftliche Artikel zeigen …«
»Aber Frank«, versuchte meine Mutter ihn zu unterbrechen. »Man muss der Sache doch auf den Grund gehen. Und wir können doch wirklich die Möglichkeit ausschließen, dass Alice die Sprache als Kind irgendwo aufgeschnappt und intuitiv gelernt hat, eine Hypothese, von der deine Artikel ausgehen. Dieser Professor Heany bestätigt doch, dass Alice Irisch fließend spricht, und das besser als manche seiner Landsleute, die es in der Schule gelernt haben. Und wir hatten noch nie selber Kontakt mit Iren oder der irischen Sprache. Wir waren dort noch nie im Urlaub und es ist doch sehr unwahrscheinlich, dass sie hier bei uns mit einer solch seltenen Sprache mal über längeren Zeitraum in Berührung gekommen ist. Es ist mir völlig egal, ob es sich wissenschaftlich schimpft oder nicht, wir müssen doch von der Realität ausgehen …«
»Genau Anne, bei der Realität sollten wir bleiben und nicht irgendwelche esoterischen …«
Ich hatte genug gehört, stand auf und legte mich in meinem Zimmer aufs Bett. Ich zog meinen Laptop heran und stellte ihn an. Früher hatte ich ihn hauptsächlich dafür gebraucht, um mit meinen Freunden zu chatten. Es war eine meiner Lieblingsbeschäftigungen gewesen. Mein Vater hatte immer scherzend gefragt, was wir uns denn am Abend noch zu sagen hätten, wo wir uns doch den ganzen Tag schon sahen. Und wenn man schon noch etwas zu besprechen hatte, ob man dann nicht einfach kurz telefonieren könnte. Meine Mutter hatte dann immer lachend abgewinkt und gesagt: »Du bist zu alt, um das zu verstehen, Frank.« Das war ein Insiderwitz zwischen den beiden, weil mein Vater ganze acht Jahre älter war als meine Mutter. »Und außerdem, als junges Mädchen habe ich mit meinen Freundinnen nie ›kurz‹ telefoniert. Sei froh, dass es all diese neumodische Technik gibt, wie du sie nennst, dass sie uns nicht andauernd die Leitung blockiert.«
Jetzt hatte ich gar keine Lust mehr mit Lisa, Melinda oder anderen aus meiner Klasse zu chatten. Ich hatte meinen Chat sogar so eingestellt, dass andere nicht sehen konnten, wenn ich online war. Melinda fragte die ganze Zeit, wie es mir ging, und ob ich über den Unfall reden wollte, so als ob sie ständig Einfühlsamkeit beweisen müsste. Das war ja sehr nett, aber lästig, denn ich wollte auch mal an etwas anderes denken. Lisa hingegen tat so, als ob nichts vorgefallen wäre. So auch einige andere meiner Freunde. Sie gaben sich betont normal. Das war mir grundsätzlich lieber, wenn ich nicht häufig merken würde, dass es nur aufgesetzt war. Die meisten von ihnen meinten es wirklich gut, das wusste ich ja. Aber trotzdem kam keine ungezwungene Unterhaltung zustande. Andere behandelten mich, als hätte ich durch den Unfall meinen Verstand komplett verloren und redeten mit mir, als ob ich schwachsinnig sei. Und während direkt nach meinem Unfall meine exotische Krankheit Thema in allen Netzwerken gewesen war – was ich einfach nur peinlich fand – und ich unzählige Fragen hatte beantworten müssen, so war das Interesse an mir seitdem zurückgegangen. Das war mir lieber so und ich zog mich ganz zurück. Es gab nichts Neues zu berichten, denn ich erlebte ja nicht viel. Abgesehen von meinen Therapiestunden machte ich keine neuen Erfahrungen. Erst dachte ich, es wäre spannend und ablenkend, wenn ich von meinen Freundinnen den neuesten Klatsch und Tratsch hören würde. Doch es langweilte mich bald und schien mir unbedeutend.
Also öffnete ich jetzt nicht mehr die Seiten, die früher zu meinen Favoriten gehört hatten, sondern gab stattdessen ein paar Suchbegriffe in Google ein. Nachdem ich etwas über Rückführungstherapie gelesen hatte, schaute ich mir einige Bilder von Irland an. Die grünen Landschaften lösten ein unbeschreibliches Gefühl in meinem Inneren aus. Eine Sehnsucht, gekoppelt mit innerer Ruhe und Entspannung. Doch bildete ich mir das vielleicht nur ein? Wer war schließlich nicht angetan von grasgrünen Hügeln, und auf wen wirkten solche Naturbilder nicht beruhigend? Konnte ich mich auf solche Bauchgefühle überhaupt noch verlassen? Wahrscheinlich hatte mein Vater recht. Wer wusste schon, was es für eine wissenschaftliche Erklärung dafür gab, was in den Tiefen meines Gehirns so durcheinandergeraten war. Wahrscheinlich würde ich es nie erfahren und das Beste wäre es, nach vorne zu schauen.
Frustriert klappte ich meinen Laptop zu und schaltete das Licht aus. Doch während ich mit offenen Augen im Dunkeln lag und den gedämpften Stimmen meiner Eltern lauschte, konnte ich den Gedanken nicht abschütteln, dass der Unfall etwas in mir geweckt hatte, das alles verändern sollte. Dass ich es in Wirklichkeit nicht einfach so abschütteln durfte, sondern daran festhalten sollte. Dass die neue alte Sprache erst ein Anfang war, und dass es viel mehr zu entdecken gab.
KAPITEL VIER
In Gedanken zählte ich rückwärts von 300. So richtig entspannen konnte ich nicht, auch wenn Dr. Zucker sich noch so viel Mühe gab, meinen Körper durch Suggestion in den Zustand der Tiefenentspannung zu versetzen. Zumindest hatte ich auf Wikipedia gelesen, dass das wohl richtig war, was er hier machte. Allerdings glaubte ich auch nicht wirklich daran, dass er mich in einen Trancezustand bringen konnte, und noch weniger überzeugt war ich davon, dass ich mich dabei an ein früheres Leben erinnern würde, in dem ich Irisch sprach.
Doch mein Vater hatte sich zähneknirschend auf den Vorschlag meiner Mutter eingelassen, es doch wenigstens einmal mit der Rückführungstherapie zu versuchen. Nachdem er sich ausführlich über Dr. Zucker informiert und mit dessen akademischer Laufbahn auseinandergesetzt hatte, räumte er ein, dass eine Sitzung mit einem solch renommierten Psychiater sicher nicht schaden könnte, Rückführung hin oder her. Schließlich war ihm auch aufgefallen, dass ich mich mit der Zeit nicht wohler zu fühlen schien, mich immer mehr in mein Zimmer zurückzog und wenig Kontakt mit Freunden hatte. Was ihm am meisten Sorgen machte, so hörte ich ihn eines Abends zu meiner Mutter sagen, war, dass ich nicht mehr, wie vor dem Unfall, begeistert von meinen Zukunftsträumen berichtete: an einer Uni in einer größeren Stadt, Freiburg, vielleicht sogar Hamburg oder Berlin, zu studieren. Ich hatte es kaum abwarten können, von zu Hause auszuziehen, mit Lisa und Melinda eine WG aufzumachen … Davon redete ich nun gar nicht mehr.
Und so war ich zu Dr. Zucker gekommen, der mir bei unserem ersten Gespräch ganz vernünftig vorgekommen war. Doch nun, während ich mit geschlossenen Augen dalag und versuchte, mich zu konzentrieren, war ich mir längst wieder unsicher. Dann sag ich eben nach dieser Sitzung, dass das hier keinen Sinn und Papa recht hat, dachte ich mir und gab auf, mich so anzustrengen. Dr. Zuckers angenehme Stimme driftete an mir vorbei. Ich hätte gar nicht sagen können, wie viel Zeit von dem Moment an verstrichen war, doch mit einem Mal wurden meine Sinne wieder wach. Ich nahm Dr. Zuckers Stimme nur noch als ein Flüstern war, und hatte stattdessen den unverwechselbaren Duft von salziger Meeresluft in der Nase. Der Geruch kam mir so vertraut vor, dass er mich erst mal völlig aus dem Gleichgewicht brachte und ich alles um mich herum vergaß. Dr. Zuckers Stimme trat nun ganz in den Hintergrund. Als ich mich wieder auf sie besinnen wollte, konnte ich sie nicht vom Geräusch der wogenden Wellen unterscheiden, die am Strand brachen – der Rhythmus schien derselbe zu sein. Je mehr ich mich darauf fokussierte, desto mehr gewannen die Wellen Oberhand. Dann drang doch eine Stimme zu mir durch. Sie hatte einen ganz anderen Klang als die von Dr. Zucker.
»Ciara«, rief sie mich. Eine männliche Stimme, sie hörte sich jung an und irisch. Mein Herz machte einen Sprung. Ich erkannte sie; sie schien so vertraut.
Ich schaute mich um. Sandstrand, Felsen, ein blauer Himmel, der sich im Meer spiegelte.
Die Stimme rief nun lauter. »Ciara!«
Es war mir sofort klar gewesen, dass er mich mit diesem Namen rief. Eine Tatsache, die ich in diesem Moment nicht einmal infrage stellte, und über die ich mich erst später wundern würde. Ich drehte mich zu ihm um.
Er stand jetzt vor mir. Seine grünen, leicht schräggestellten Augen blickten liebevoll in meine. Ich hatte das mir so wohlbekannte Verlangen, ihm das sandblonde Haar aus der Stirn zu streichen. Im hellen Licht der hochstehenden Sonne konnte ich blasse kleine Sommersprossen auf der geraden Nase erkennen. Er lächelte, sodass sich zwei Grübchen auf seiner linken Wange bildeten, die sein Grinsen etwas schief aussehen ließen und es damit noch unwiderstehlicher machten. Mir wurde ganz warm ums Herz, als mir dieses Lächeln (zum hundertsten, tausensten Mal?) vor Augen führte, dass sein sonst so perfekt proportioniertes Gesicht damit einen Makel hatte, der es für mich einfach noch perfekter machte. Er stand so dicht vor mir, dass ich dem Impuls nachgab, ihn zu umarmen. Doch als ich es versuchte, da rückte er von mir fort, als würde er von einem unsichtbaren Band gezogen. Seine grünen Augen verdunkelten sich und seine Stirn legte sich sorgenvoll in Falten. »Ciara« rief er. »Tu es nicht, komm zurück. Komm zu mir zurück.«
Ich versuchte ihm zu folgen, aber ich kam nicht von der Stelle. »Bleib hier«, rief ich, doch er entfernte sich immer weiter, immer schneller, bis er ein kleiner Punkt am Horizont war. Ich schlug um mich, in der Anstrengung, mich von der unsichtbaren Macht zu befreien, die mich festhielt.
»Nein«, schrie ich nun, so laut ich konnte: »Dylan!«
KAPITEL FÜNF
Bedacht stellte ich die Auflaufform mit der Gemüselasagne auf den Tisch. Papa lächelte glücklich und griff nach dem Glas Rotwein, das ich ihm eingeschenkt hatte. Auch meine Mutter strahlte, als sie mir zusah, wie ich die Portionen auf unseren Tellern verteilte.
»Wie schön, dass du mal wieder gekocht hast, Alice«, sagte sie. »Wir freuen uns so.«
Mein Vater sprach einen Toast aus: »Auf die Zukunft, auf dass wir sie gemeinsam glücklich und gesund verbringen können.«
Es war das erste Mal seit meinem Unfall, dass ich gekocht hatte, ja das erste Mal, dass ich überhaupt Interesse am gemeinsamen Abendessen zeigte. Bisher hatte ich mein Essen auf dem Teller herumgeschoben, ab und zu einen Alibi-Happen in den Mund gesteckt, und war sofort wieder aufgestanden und wieder hoch in mein Zimmer gegangen, sobald meine Eltern fertig waren.
»Ich muss sagen, dass ich äußerst skeptisch war, was diese Rückführungstherapie anging«, plauderte mein Vater, auch zum ersten Mal seit Wochen wieder in ungezwungenem Ton. »Aber anscheinend hilft es ja doch irgendwie.«
Ich steckte eine Gabel voll Lasagne in den Mund. »Achtung, heiß«, warnte ich sie. Ich hatte zwar immer noch keinen Appetit, doch das sollten meine Eltern nicht merken.
»Genau«, sagte meine Mutter. »Erzähl doch mal von den Therapiestunden. Habt ihr schon etwas herausgefunden, das deine Irisch-Kenntnisse erklären könnte?«
Mein Vater runzelte die Stirn und kaute langsamer. Ich ahnte, dass er es eigentlich gar nicht so genau wissen wollte, sondern nur froh war, dass es mir augenscheinlich wieder besser ging und dass ich in naher Zukunft – in seinen Augen – wieder ganz die Alte sein würde.
»Och, eigentlich nicht viel«, sagte ich beschwichtigend. »Es sind praktisch immer dieselben zwei Orte, an denen ich mich wiederfinde, nachdem Dr. Zucker mich in Trance versetzt hat. Einmal an einem felsigen Strand – es ist eine Art Bucht, nicht weit weg von einem kleinen Hafen, und gegenüber sehe ich eine Bergformation. Dann stehe ich noch inmitten einer grünen Landschaft vor einem Hügel.«
»Und, sieht es aus wie Irland?« fragte meine Mutter aufgeregt.
Sie tat mir in diesem Moment noch mehr leid als Papa. Sie wollte unbedingt eine Erklärung finden, weil sie wohl spürte, dass es wichtig für mich war. Ich kannte meine Mutter gut genug, um zu wissen, dass sie glaubte, nur wenn ich mit dem Grund für meine Krankheit konfrontiert werden würde, könnte auch die Heilung eintreten. Dabei konnte ich ihr die volle Wahrheit nicht sagen: dass ich nicht geheilt werden wollte. Papa hörte ganz auf zu kauen und legte verärgert das Besteck zur Seite.
»Kann schon sein«, sagte ich betont unbekümmert. »Vielleicht, aber dummerweise werde ich in den Therapiestunden niemals an ein Ortsschild zurückgeführt«, versuchte ich einen Witz zu machen. Keiner lachte, aber wenigstens griff mein Vater wieder zur Gabel. »Doktor Zucker hat mich Zeichnungen anfertigen lassen, wartet kurz, ich zeige sie euch.«
Ich stand auf, ging zu meinem Rucksack im Wohnzimmer und zog die Zeichnungen heraus. Die Bilder ließen nicht erahnen, wo die Orte waren, die darauf abgebildet waren. Wahrscheinlich könnte es jeder erdenkliche Küstenstreifen sein. Ich war mir sicher, sie würden auch meinen Eltern nichts sagten. Für mich hatte nicht die Landschaft an sich Bedeutung, sondern mehr das Gefühl, das ich hatte, wenn ich da war – die Luft, die Gerüche, der Wind. Das war es, das mich innerlich aufwühlte. Es war unbeschreiblich und nicht auf Papier zu bannen.