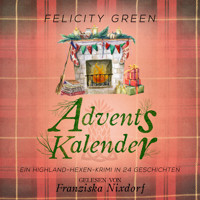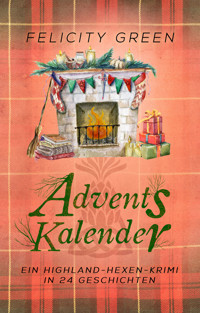4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Ihr Selkie-Herz schlägt für die gefährliche Welt unter dem Meer. Ihre wahre Liebe zieht sie an Land.
Isla kehrt ungern auf die einsame Orkney-Insel zurück, die ihr Zuhause war, bis ihre Mutter vor acht Jahren dort spurlos verschwand. Sie wird von verdrängten Erinnerungen geplagt, von denen sie nur ihr Kindheitsfreund Jasper ablenken kann.
Bis der mysteriöse Kass nackt und mittellos am Strand auftaucht. Isla gerät völlig in seinen Bann. Sie tut alles für ihn – auch wenn sie damit einen Keil zwischen sich und ihre Freunde und Familie treibt. Nach einem sagenhaften Kuss verschwindet Kass. Verlassen und verraten von allen, die sie liebte, fällt Isla in eine dunkle Depression.
Erst als sie das Geheimnis ihrer Mutter aufdeckt, versteht Isla auch, wer Kass ist. Verzweifelt sucht Isla in alten Mythen und Legenden nach einer Möglichkeit, Kass zu sich zurückzurufen. Doch die fremdartige Unterwasserwelt, der Kass und ihre Mutter angehören, ruft auch sie. Dabei gerät Isla in Gefahr, ihre Menschlichkeit zu verlieren und sich ganz auf das andere Herz zu verlassen, das in ihrer Brust schlägt: ihr Selkie-Herz.
Wird Isla ihren Weg zurück in ihre Heimat und zu ihrer wahren Liebe finden?
Lob für Selkie-Heart:
»Felicity Green ist für mich die unangefochtene Meisterin, wenn es darum geht, mythologische Aspekte eines Landes in eine wirklich glaubhafte Fantasy Geschichte zu verpacken.« – Blog WUNDERBAR IM NORDEN
»Die Autorin hat ein wunderbares Händchen, die Szenerie bildhaft wirken zu lassen, und auch ihre Ideen zu den Mythologien, oder dem Übernatürlichen, haben mich auch hier wieder begeistert. (…) Ein Top Titel, den ich uneingeschränkt weiterempfehlen kann.« – Blog BÜCHER AUS DEM FEENBRUNNEN
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Selkie Heart
Tochter des Meeres
Felicity Green
Selkie Heart
Tochter des Meeres
© Felicity Green, 1. Auflage 2019
www.felicitygreen.com
Veröffentlicht durch:
A. Papenburg-Frey
Schlossbergstr. 1
79798 Jestetten
© Covergestaltung: Laura Newman – design.lauranewman.de
Korrektorat: Wolma Krefting, bueropia.de
Alle Rechte, einschließlich dem des vollständigen oder teilweisen Nachdrucks in jeglicher Form, sind vorbehalten.
Personen und Handlungen sind frei erfunden oder wurden fiktionalisiert. Ähnlichkeiten mit lebenden und verstorbenen Personen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Website: www.felicitygreen.com
Twitter: FeliGreen
Facebook: Felicity Green
Inhalt
Die Autorin
Kapitel eins
Kapitel zwei
Kapitel drei
Kapitel vier
Kapitel fünf
Kapitel sechs
Kapitel sieben
Kapitel acht
Kapitel neun
Kapitel zehn
Kapitel elf
Kapitel zwölf
Kapitel dreizehn
Kapitel vierzehn
Kapitel fünfzehn
Kapitel sechzehn
Kapitel siebzehn
Kapitel achtzehn
Kapitel neunzehn
Kapitel zwanzig
Kapitel einundzwanzig
Kapitel zweiundzwanzig
Kapitel dreiundzwanzig
Kapitel vierundzwanzig
Kapitel fünfundzwanzig
Kapitel sechsundzwanzig
Kapitel siebenundzwanzig
Kapitel achtundzwanzig
Kapitel neunundzwanzig
Kapitel dreißig
Kapitel einunddreißig
Kapitel zweiunddreißig
Kapitel dreiunddreißig
Kapitel vierunddreißig
Kapitel fünfunddreißig
Epilog
Danke & gratis Buch
Das Buch
Ihr Selkie-Herz schlägt für die gefährliche Welt unter dem Meer. Ihre wahre Liebe zieht sie an Land.
Isla kehrt ungern auf die einsame Orkney-Insel zurück, die ihr Zuhause war, bis ihre Mutter vor acht Jahren dort spurlos verschwand. Sie wird von verdrängten Erinnerungen geplagt, von denen sie nur ihr Kindheitsfreund Jasper ablenken kann.
Bis der mysteriöse Kass nackt und mittellos am Strand auftaucht. Isla gerät völlig in seinen Bann. Sie tut alles für ihn – auch wenn sie damit einen Keil zwischen sich und ihre Freunde und Familie treibt. Nach einem sagenhaften Kuss verschwindet Kass. Verlassen und verraten von allen, die sie liebte, fällt Isla in eine dunkle Depression.
Erst als sie das Geheimnis ihrer Mutter aufdeckt, versteht Isla auch, wer Kass ist. Verzweifelt sucht Isla in alten Mythen und Legenden nach einer Möglichkeit, Kass zu sich zurückzurufen. Doch die fremdartige Unterwasserwelt, der Kass und ihre Mutter angehören, ruft auch sie. Dabei gerät Isla in Gefahr, ihre Menschlichkeit zu verlieren und sich ganz auf das andere Herz zu verlassen, das in ihrer Brust schlägt: ihr Selkie-Herz.
Wird Isla ihren Weg zurück in ihre Heimat und zu ihrer wahren Liebe finden?
Die Autorin
Felicity Green schreibt Urban Fantasy und Paranormal Mystery-Serien für Leserinnen, die Mythen und Magie, unerwartete Wendungen, Gänsehaut und große Gefühle lieben.
Felicity wurde in der Nähe von Hannover geboren und zog nach dem Abitur nach England. In Canterbury studierte sie Literatur und Schauspiel. Später tingelte Felicity mit diversen Theatergruppen durch England, Irland und Schottland – eine Inspiration für die Schauplätze ihrer Romane. An der University of Sussex schloss sie einen MA in Kreativem Schreiben ab.
Mit ihrem Mann Yannic, Tochter Taya und Kater Rocks lebt sie jetzt an der Schweizer Grenze.
www.felicitygreen.com
Kapitel eins
Mein Herz klopfte so laut, dass ich glaubte, sie müsste mich hören. Aber sie drehte sich nicht um, als ich ihr auf leisen Sohlen folgte. Ich hielt so viel Abstand wie möglich, ohne Gefahr zu laufen, sie aus den Augen zu verlieren.
Nackt ging sie den schmalen Trampelpfad über die Klippen entlang, der schließlich in Serpentinen zum Strand hinunterführte. Der Wind, der hier auf Eday ohne Unterlass wehte, peitschte ihre langen dunklen Haare hin und her. Über dem Arm trug sie einen Mantel.
Warum zog sie sich ihn nicht an? Spürte sie die herbstliche Kälte nicht, weil sie womöglich schlafwandelte? Ich konnte keine andere Erklärung dafür finden, warum sie mitten in der Nacht splitterfasernackt das Haus verließ. Ich zog meinen eigenen Bademantel, den ich mir schnell vom Haken hinter meiner Zimmertür geschnappt und übergestreift hatte, enger um mich.
Anmutig und grazil hüpfte sie offensichtlich vergnügt den Pfad entlang bis zu den großen Felsblöcken, die die schroffen Klippen vom schmalen Sandstrand der Sealskerry Bay trennten.
Sie blieb vor den dunklen Steinen stehen und hob das Gesicht in den Wind, so als hätte sie einen Laut vernommen.
Ich erstarrte.
Sollte ich schnell kehrtmachen und zum Cottage zurücklaufen? Aber bevor ich die Entscheidung treffen konnte, tauchten ein paar Köpfe aus den Wellen in der Bucht auf. Glitzernde Augen schauten genau in meine Richtung.
Der Anblick war so unheimlich, dass mir das Blut in den Adern gefror. Es fühlte sich zumindest so an. Ich brauchte ein paar Sekunden, bis ich verstand, dass es keine Menschen waren, die in der tosenden und schäumenden Nordsee badeten.
Nein, es waren Robben. Als ich die Augen etwas zusammenkniff und sie länger anstarrte, sah ich, dass es sich um Kegelrobben handelte. Die großen Tiere, massiger als Seehunde, waren an dem eher spitz zulaufenden Kopf erkennbar, die mehr der Nase eines Pferdes als der eines Hundes glich.
Das graue Fell ihrer Köpfe glitzerte silbern im Mondlicht, und die großen, runden Augen wirkten schwarz und glänzend wie Onyxe. Ich kannte sie und ihre Artgenossen gut, denn auf der Insel Seal Skerry gegenüber dieser Bucht tummelten sie sich zu Hunderten. Überhaupt bekam man sie hier, auf den Orkney-Inseln, oft zu Gesicht.
Aber ich hatte sie noch nie in der Nacht gesehen, und im unwirklichen Mondlicht, das sich auf der rhythmisch wogenden Meeresoberfläche brach, wirkten sie noch … aufmerksamer als sonst. Noch wissender und irgendwie menschlicher.
Ich sah plötzlich meine Heimat mit der kargen Landschaft, dem rauen Klima, dem wilden Meer und der unverwechselbaren Fauna in einem anderen Licht, dem Licht der mystischen Nacht. Und nun erschien alles, was ich sonst als alltäglich betrachtete, unwirklich und unheimlich.
Auch wenn ich mich von den Tieren beobachtet fühlte, so wusste ich, dass sie nicht mich anstarrten.
Sie sahen sie an.
Auch ihr Haar wirkte auf einmal silbern im Mondlicht, als sie ihnen zuwinkte.
Ich zuckte zusammen, als die Kegelrobben in der Brandung diese traurigen Laute von sich gaben, die ihnen so eigen waren, aber in der Nacht wie eine Mischung aus gespenstischer Musik und qualvollen Todesklängen erschienen.
Sie ließ die Arme sinken und stimmte ein in diesen Chor. Sie sang das Lied, das sonst für mich bestimmt war, und ich merkte, wie mir Tränen über die Wangen liefen.
Ich konnte mir nicht erklären, wieso mein Herz sich zusammenkrampfte, und brauchte einen Augenblick, um das dunkle, hässliche Gefühl als Eifersucht zu erkennen. Wieso sang sie mein Lied für die Robben? Wieso sang sie es hier, nachts, nackt im Mondlicht, für sie?
Ich verstand es nicht.
Doch ich blinzelte die Tränen schnell weg, weil ich sonst nicht sehen würde, was als Nächstes passierte. Wie sie sich den Mantel überstreifte, über die Steine zur Brandung tänzelte und …
»Isla? Isla?«
Megans Stimme drang zu mir durch.
»Isla, es ist Zeit. Wir müssen los.«
Mit einem Ruck setzte ich mich auf. Ich schüttelte den Traum ab. Die Realität wirkte wie eine kalte Dusche.
Heute war die Beerdigung.
Ich rieb mir die Augen und sah an mir herunter. Mein schwarzes Kleid war zerknittert, weil ich mich in der irrigen Annahme, ich könnte mich in den Schlaf flüchten, noch mal hingelegt hatte.
Megan folgte meinem Blick.
»Zieh es einfach aus. Mama kann es schnell überbügeln.«
Ich streifte das Kleid über den Kopf und ging ins Bad.
Dort ließ ich mir so lange eiskaltes Wasser über das Gesicht laufen, bis ich meine Wangen nicht mehr spürte. Dann trug ich sorgfältig Make-up auf, hauptsächlich, um die dunklen Ringe unter meinen Augen zu überdecken. Als ich wieder aus dem Bad kam, stand Megans Mutter schon mit dem Kleid da.
Ich nötigte mir ein Lächeln ab, um meine Dankbarkeit zu zeigen.
Megans Familie hatte wirklich viel für mich getan. Ich wüsste nicht, was ich ohne sie gemacht hätte. Wenn sie mir nach dem Verkehrsunfall, bei dem meine Großeltern ums Leben gekommen waren, nicht angeboten hätten, zu ihnen zu ziehen, würde ich jetzt ganz allein in der großen Villa sein, in der ich mit Oma und Opa gewohnt hatte. Und womöglich vor lauter Kummer den Verstand verlieren.
Hier, im Gästezimmer der McDougals, erinnerte mich nichts an sie. Und außerdem war meine beste Freundin dauernd für mich da. Ich war so dankbar dafür. Megan und ihre Familie gaben mir den Halt, den ich dringend brauchte.
Sie hatten mir großzügigerweise sogar angeboten, im kommenden Schuljahr, also nach den bevorstehenden Sommerferien, weiter bei ihnen zu wohnen. Danach würde ich volljährig sein, und mein Studium, das ich dann wohl antreten würde, war laut dem Anwalt meiner Großeltern voll finanziert. Ich war selbstverständlich froh, mir über Geld keine Sorgen machen zu müssen, aber momentan war mir das alles so ziemlich egal. Jetzt, in diesem Augenblick, bedeutete es mir überhaupt nichts und ich hätte es jederzeit gegen die Möglichkeit eingetauscht, einen weiteren Tag, nein, allein eine weitere Stunde mit meinen Großeltern verbringen zu dürfen.
Ich wollte ihnen so gerne ein letztes Mal sagen, wie lieb ich sie hatte und wie viel sie mir bedeuteten.
Oma Ingrid war Ersatz für die Mutter gewesen, die ich nicht mehr hatte, und mein Stief-Opa Alfred Ersatz für den Vater, der sich nicht sonderlich für mich interessierte.
Sie waren die lebenslustigsten, fürsorglichsten und großzügigsten Menschen, die ich kannte, und es war einfach nicht fair, dass sie dieses Schicksal ereilt hatte und sie so einfach aus dem Leben gerissen worden waren. Der Gedanke daran machte mich so wütend, dass ich mir auf die Unterlippe biss, um nicht loszuschreien.
Schnell streifte ich mir das schwarze Kleid über, das Megans Mutter mir hinhielt.
»Oh, Schatz, du blutest an der Lippe«, sagte Megans Mom, als ich mit dem Kopf wieder aus dem Halsausschnitt auftauchte. »Warte, ich hole dir ein Taschentuch.«
»Nicht nötig«, sagte ich so gefasst wie möglich. »Moment.«
Ich ging wieder ins Bad und wusch mir die Lippe ab. Dann trank ich einen Schluck aus dem Wasserhahn, um den ekligen Geschmack aus dem Mund zu vertreiben. Ich wusste nicht, ob es das Blut war oder einfach die bittere Galle, die mir seit dem Tod meiner Großeltern immer wieder aufstieß.
Nein, es war nicht fair, was Oma und Opa widerfahren war, aber was in meinem Leben war schon fair abgelaufen?
Gott sei Dank lenkte mich Megan von der deprimierenden Gedankenspirale ab, in die ich immer geriet, wenn ich mir solche Grübeleien erlaubte. »Ist alles okay? Wir sollten wirklich los.«
Ich nickte tapfer, ließ mich aber von meiner besten Freundin kurz in den Arm nehmen, bevor wir zusammen aus dem Bad gingen.
Dann ließ ich den zweitschrecklichsten Tag meines bisherigen Lebens über mich ergehen.
Kapitel zwei
Ich schob mich durch die Menge in Oma und Opas Lieblingspub. Am liebsten hätte ich die Schultern eingezogen und auf den Boden gestarrt, damit mir niemand ins Gesicht schauen konnte und die Leute vielleicht weniger geneigt waren, mir ihr Beileid auszusprechen.
Stattdessen reckte ich entschlossen das Kinn vor und nickte jedem freundlich zu, der mich ansprach. Manchmal gelang es mir sogar, ein »Danke« herauszupressen. Meine Großeltern hatten viele Freunde und Bekannte gehabt, die ihnen die letzte Ehre erweisen wollten. Sie meinten es alle gut, und die Atmosphäre im Pub gefiel mir um einiges besser als auf dem Friedhof und in der Kirche. Ich musste mir keine Sorgen mehr machen, dass ich in Tränen ausbrechen könnte – ich hatte tatsächlich das Gefühl, dass ich komplett leer geweint war.
Und hier, wo die Leute in kleinen Grüppchen zusammenstanden, mit einem Drink in der einen, einem Teller Häppchen in der anderen Hand, glich diese Zeremonie doch irgendwie einer Feier. Ich wollte so gerne, dass wir das Leben meiner Großeltern feierten, denn das hatten sie verdient. Es sollte nicht um meine Trauer, um meine Bitterkeit gehen. Ich zwang mich dazu, all diese Gefühle in der Leere versinken zu lassen, die in meinem Inneren nach so vielen Tränen und körperlicher wie seelischer Erschöpfung herrschte.
Megan hatte mir nahegelegt, etwas zu essen. Ich konnte mich gar nicht daran erinnern, wann ich das letzte Mal etwas in den Magen bekommen hatte. Aber als sie anbot, mir etwas zu holen, hatte ich abgelehnt. Ich beanspruchte ihre Hilfe schon mehr als genug. Ich konnte das wohl allein. Ich war nicht so schwach.
Also kämpfte ich mich zum Buffet durch. Kurz bevor ich dort ankam, wäre ich aber tatsächlich lieber wieder umgekehrt. Denn am Buffet stand mein Vater. Ich war mir nicht sicher, was schlimmer wäre: ein Gespräch mit Dad oder ein erneuter Spießrutenlauf durch die Menge der Trauergäste mit ihren mitleidigen Blicken.
Beim Anblick der Würstchen im Schlafrock krampfte sich allerdings mein Magen zusammen. Ich merkte, dass Nahrung dringend notwendig war, wenn ich nicht hier vor allen zusammenklappen wollte.
Es würde schon nicht so schlimm werden, dachte ich mir. Mein Vater war nicht unbedingt einer von der gesprächigen Sorte. Tatsächlich waren es gerade sein Hang zum Einsiedlertum und seine Wortkargheit, die dafür verantwortlich waren, dass wir uns in den letzten acht Jahren völlig entfremdet hatten.
Im gleichen Maße wie meine Großmutter Eday verabscheut hatte und deshalb kaum mit mir dorthin gefahren war, war Dad von der Insel kaum wegzukriegen. Und Telefongespräche mit ihm waren fast schmerzhaft zäh.
Ich nahm mir einen Teller und ging zu den Würstchen im Schlafrock, die mein Vater gerade eines nach dem anderen direkt von der Servierplatte in sich hineinstopfte. Ich räusperte mich, klang aber trotzdem heiser, als ich sagte: »Hi, Dad.«
Er wischte sich die Blätterteigkrümel vom Mund. »Isla.«
Wir hatten uns schon vorhin vor der Kirche gesehen und begrüßt. Doch ich war dort nicht wirklich in der Lage gewesen, ein paar Worte mit ihm zu wechseln. Und er wahrscheinlich auch nicht, fiel mir auf, als ich ihn musterte. Seine Augen waren rot umrandet und er sah außergewöhnlich blass aus.
Ich hatte meinen Vater zwar noch nie weinen sehen, aber wenn es einen Anlass dafür gab, dann vielleicht der unverhoffte Tod seiner Mutter. Die beiden standen sich zwar nicht besonders nahe, aber natürlich war er traurig. Eventuell bereute er sogar, die letzten Jahre nicht mehr aus seinem Schneckenhaus herausgekommen zu sein und sich nicht mehr Mühe gegeben zu haben, um die Beziehung zu Oma zu verbessern.
Einem Impuls folgend stellte ich den Teller auf dem Buffet ab und nahm ihn in den Arm. Da er drei Köpfe größer war als ich und etwa doppelt so breit, war das Ganze eher unbeholfen und es fühlte sich komisch an. Ich ließ schnell wieder los. Doch als er sich verstohlen eine Träne aus den Augen wischte, wusste ich, dass ich das Richtige getan hatte.
Da es mir auch schon wieder unter den Lidern brannte, brachte ich das Gespräch schnell auf den Termin mit dem Anwalt. Mein Vater war nicht anwesend gewesen, weil schon vor Jahren in seinem Beisein alles notariell so geregelt worden war, dass ich das Vermögen meiner Großeltern erben sollte. Trotzdem war ich mehr als ein wenig überfordert mit dem Papier- und Verwaltungskram. Opi Alfreds Schwester, die auch die Beerdigung organisiert hatte, hatte sich bislang mehr oder weniger vollständig um diese Sachen gekümmert. Doch ich nahm an, auch aufseiten meiner Familie gab es da noch was zu tun, und mein Vater würde sicherlich froh sein, sich auf irgendeine Art als nützlich zu erweisen. Er war der Typ, der in so etwas Trost fand.
Damals, als meine Mutter verschwunden war, hatte er wochenlang Suchtrupps organisiert, die Eday, die benachbarten Inseln und das Meer abklapperten. Mir wäre es lieber gewesen, er wäre bei mir zu Hause geblieben. Bis mich Oma dann von der Insel rettete.
»So, und du wohnst jetzt bei den McDougals und kannst da nächstes Schuljahr auch bleiben?«, brachte mein Vater das Gespräch auf ein anderes Thema.
Ich nickte bloß.
»Mr McDougal hat mich angerufen. Das Schulgeld und die Mittel für Kleider und dergleichen sind ja theoretisch vorhanden, aber es dauert natürlich noch eine Weile, bis da wirklich Geld fließt. Und er wollte sich einfach mit mir kurzschließen, glaube ich, wie das dann ablaufen soll.«
Ich wurde rot. Natürlich wollten die McDougals nicht alles für mich auslegen, auch wenn sie noch so freundlich und großzügig waren. Ich hatte gar nicht daran gedacht. Ich schalt mich innerlich dafür, so selbstmitleidig und egoistisch gewesen zu sein.
»Ich habe ihm jetzt erst mal einen Scheck mitgebracht«, murmelte mein Vater in seinen Bart hinein. Ihm war das Ganze offensichtlich unangenehm. »Für das Schulgeld und das Wohngeld richte ich dann wohl so einen … wie nennt man das … Dauerauftrag ein. Aber auf einen genauen Betrag kann man sich da ja noch einigen, wenn du nach den Ferien zurückkommst.«
»Äh …« Ein betretenes Schweigen zog sich in die Länge. Es kam eigentlich eher selten vor, dass mein Vater so viel mehr redete als ich. Aber ich wusste nicht, was ich sagen sollte.
Eigentlich hatte Megan so geklungen, als ob völlig klar sei, dass ich mit ihrer Familie nach Spanien ging, wo die McDougals ein Ferienhaus hatten und immer ihre gesamten Sommerferien verbrachten. Da mir Ferien, Sonne und Strand augenblicklich so richtig egal waren, hatte ich mich gar nicht dazu geäußert. Aber irgendwo musste ich ja hin und dass ich nicht allein in Edinburgh bleiben konnte, weder in der Villa meiner Großeltern, die ja auch verkauft werden sollte, noch im Haus der McDougals, war mir auch klar.
Dabei war mir nicht einmal die Möglichkeit in den Sinn gekommen, meinen Sommer auf Eday zu verbringen.
Für meinen Vater schien es allerdings selbstverständlich.
Und Megans Eltern hatten mich offensichtlich nicht wirklich eingeladen, egal, was Megan dachte, denn sonst hätten sie es Dad gegenüber sicherlich erwähnt. Klar, vielleicht würden sie sich aus Mitleid und Großzügigkeit bereit erklären, mich auch in den Ferien aufzunehmen, aber dafür war ich dann doch zu stolz.
Also fragte ich schließlich nur, wie lange mein Vater in Edinburgh bleiben wollte.
»Übermorgen fahre ich wieder. Ganz früh. Ich treffe mich morgen noch mit Alfreds Schwester wegen dem Haus. Da gibt es ja noch einiges zu regeln …«
»Ich muss natürlich noch alles packen. Was auch immer mit meinen Sachen passieren wird, vielleicht sollten wir sie irgendwo zwischenlagern.« Ich zog die Brauen zusammen. Wie so oft in den vergangenen Tagen hatte ich das Gefühl, ich würde an den kleinsten, unwichtigsten Dingen zerbrechen. Lähmende Hilflosigkeit breitete sich in mir aus, und mein Hals schnürte sich zu. Ich wandte mich schnell ab und füllte meinen Teller am Buffet, damit mein Vater mir nicht ansah, welch Panik ich wegen derartiger Belanglosigkeiten schob. Meine Großeltern waren tot. Was interessierten einen da schon die materiellen Dinge in meinem Zimmer?
»Wir besprechen es morgen. Und dann können wir auch schauen, dass wir dir einen Flug buchen.« Mein Vater legte seine große Pranke auf meine Schulter. Sie fühlte sich tröstend warm an. Am liebsten wäre ich ihm um den Hals gefallen, so wie ich es als kleines Mädchen getan hatte. Stattdessen türmte ich einen Berg von Häppchen auf meinen Teller, den ich niemals essen würde.
»Gut … äh … ich schätze, ich mache mal meine Runde«, sagte mein Vater schließlich und wischte sich die Finger an der Hose ab. Der Anzug war geliehen, nahm ich an. Mein Vater war Fischer. Ich hatte ihn noch nie zuvor im Anzug gesehen.
»Okay, alles klar«, sagte ich, und schob mir eine Mini-Frühlingsrolle in den Mund. Ich mochte gar keine Frühlingsrollen.
Kaum war mein Vater in der Menge »verschwunden« – so verschwunden, wie es für einen großen Wikinger-Typen mit zotteligen blonden Haaren eben möglich war – tauchte Megan neben mir auf.
Sie verzog das Gesicht. »Habt ihr geredet?«
Ich nickte und kaute weiter auf der Frühlingsrolle herum. Das Ding musste sich doch irgendwann mal runterschlucken lassen.
»Und? Schlimm?«
Ich nahm Megan ihr Glas Wasser aus der Hand, um die ekligen Sprossen herunterzuspülen. Dann sagte ich: »Es ging eigentlich. Wir müssen irgendwie lernen, miteinander klarzukommen, wenn wir die nächsten sechs Wochen zusammenleben sollen.«
»Was? Wovon redest du?« Megan sah mich an, als hätte ich eine andere Sprache gesprochen.
»Unser Haus ist ziemlich abgelegen. Und auf Eday leben gerade mal so um die hundertfünfzig Leute. Mit Sozialleben ist da nicht viel. Die meiste Zeit werden wohl nur mein Vater und ich zusammen sein. Da sollten wir ja schon irgendwie miteinander auskommen. Oder dafür sorgen, dass die Anschweigerei nicht ganz so unangenehm ist.«
»Wieso sprichst du so, als ob du die Ferien auf Orkney verbringst?« Megan klang sehr empört. »Du kommst doch mit uns nach Spanien.«
»Megs …«
»Das war doch schon abgemacht!«
»Erstens bin ich mir nicht so sicher, dass deine Eltern es für abgemacht halten.« Ich stoppte sie mit einer Handbewegung, weil sie drauf und dran war, mir zu widersprechen. »Deine Eltern sind wirklich sehr lieb. Und bestimmt würden sie mich nach Marbella mitfahren lassen. Aber ich nutze ihre Großzügigkeit schon genug damit aus, dass sie mich im nächsten Schuljahr aufnehmen. Aber es geht nicht nur darum.« Ich zog den Zahnstocher aus einem Mini-Lachssandwich und stocherte damit im weichen Toast herum. »Es ergibt Sinn für meinen Vater, dass ich jetzt, kurz vor dem Abschluss, nicht die Schule wechsle. Dass ich hier in Edinburgh weitermache. Und deshalb nimmt er das Angebot deiner Familie an. Aber er ist mein Erziehungsberechtigter und Eday ist mein Zuhause. Ich bin damals zu meinen Großeltern gekommen, weil meine Oma das Zepter in die Hand genommen hat. Weil sie fand, einem neunjährigen Mädchen ginge es besser in Edinburgh bei ihren wohlhabenden Großeltern als bei einem einsiedlerischen Vater in einem winzigen Cottage mitten im Nirgendwo.«
Ich fügte nicht hinzu, dass meine Oma meinem Vater vorgeworfen hätte, er wäre vom Verschwinden seiner Frau besessen und hätte offensichtlich keine Zeit für seine Tochter.
»Jetzt sieht die Sache anders aus. Ich bin fast erwachsen. Nächstes Jahr, nach dem Abschluss, kann ich an eine Uni gehen, in eine Stadt ziehen, in die ich will. Aber jetzt ist mein Vater noch … für mich verantwortlich. Das hier …« Ich machte eine Geste, die den Pub und die Trauerfeiergäste einschloss. Dabei meinte ich gar nicht genau diesen Ort, sondern den Tod meiner Großeltern. »… ist auch schwer für ihn. Ich hatte bisher keinen Gedanken daran verschwendet, wie es für ihn ist, seine Mutter zu verlieren. Und ich bin seine Tochter. Ich … ich sollte da sein. Bei ihm. Ich sollte zu Hause sein.« Ich stellte den Teller mit etwas zu viel Schwung auf den Buffettisch. Beim Anblick des zermalmten Lachssandwiches drehte sich mir der Magen um und ich schaute schnell weg. »Ach, ich weiß auch nicht, ich kann es schwer erklären. Es fühlt sich einfach wie das Richtige an.«
Was ich nicht aussprach, war der vage Gedanke, dass auch ich meinen Vater verlassen würde, wenn ich nicht nach Hause käme. Und ich wusste, wenn ich jetzt nicht nach Eday ging, dann würde ich es wahrscheinlich nie wieder tun. Dann hätten mein Vater und ich uns womöglich das letzte Mal gesehen. Klar, wir würden eine Weile noch telefonieren, all die finanziellen und rechtlichen Dinge besprechen. Aber dann würden die Telefonate immer seltener werden. Irgendwann würde ich ihn nicht mehr brauchen und es verginge immer mehr Zeit zwischen unseren Gesprächen, bis sie nach und nach ganz aufhörten.
Mein Vater war von seiner Frau verlassen worden und jetzt von seiner Mutter – auf ganz andere Weise zwar, aber trotzdem. Ich konnte nicht zulassen, dass er auch noch gänzlich von seiner Tochter verlassen wurde. Das hatte er nicht verdient. Nein, ich musste ihm den geben, diesen Sommer auf Eday.
»Was willst du denn da sechs Wochen machen?« Megan war immer noch ganz entsetzt. »Du erzählst doch immer, dass da absolut nichts los ist. Weißt du noch, als du das letzte Mal da warst?«
Ich nickte und zog eine Grimasse, als ich mich daran erinnerte. Ich war mit fünfzehn mit meiner Großmutter eine Woche lang dort gewesen. Ich hatte gedacht, ich müsste vor Langeweile sterben. Und das war in Gesellschaft von Oma. Bei nur sieben Tagen.
»Irgendwie werde ich es wohl überstehen.« Aber Megan hörte den Zweifel in meiner Stimme. Ich konnte meiner besten Freundin nichts vormachen.
»Dann komme ich eben mit«, sagte Megan entschlossen.
»Nein, du fährst doch nach Spanien. Deine Eltern haben sogar die Flüge schon gebucht.«
»Da lässt sich bestimmt was machen. Und ich kann dich dort nicht allein hinfahren lassen. Das kann ich dir nicht antun.«
»Wirklich? Das würdest du für mich machen? Und was ist mit dem Strand? Mit den heißen Jungs? Mit dem tollen Bikini, den du dir gekauft hast? Glaub mir, egal, was du von Stränden auf Orkney gehört hast, es ist nicht dasselbe. Einen Bikini kann man bei dem Wetter dort oben garantiert nicht gebrauchen.« Ich musste Megan die Realität vor Augen halten, aber ich konnte nicht anders, als sie hoffnungsvoll anzusehen. Der Gedanke, sie die ganze Zeit an meiner Seite zu haben, war einfach zu verlockend.
»Hey, für meine beste Freundin halte ich das alles aus. Du brauchst mich dort. Ich rede sofort mit meinen Eltern.«
Schon war sie verschwunden. Wenn Megan sich einmal etwas in den Kopf gesetzt hatte, dann konnte sie nichts aufhalten. Ich versuchte mir nicht allzu große Hoffnungen zu machen, dass ihre Eltern ihr so etwas erlauben würden.
Aber es wäre einfach so toll. Ich versuchte ja, eine ganz vernünftige, tapfere »Fast-Erwachsene« zu sein. Doch die Wahrheit sah ein bisschen anders aus.
Unschlüssig stand ich am Buffettisch herum. Erst als eine Gruppe darauf zukam, um sich neue Häppchen auf die Teller zu laden, entfernte ich mich. Ich wollte jetzt eigentlich mit niemandem reden. Am liebsten wäre ich nach draußen, an die frische Luft gegangen. Stattdessen holte ich mir ein Getränk an der Bar.
Dort fand mich Megan dann. »Wir haben einen Kompromiss gefunden«, sagte sie zerknirscht. »Wir können den Flug umbuchen, aber nicht stornieren. Und meine Eltern bestehen darauf, dass ich einen Teil meiner Ferien auch mit ihnen verbringe.« Megan rollte mit den Augen. »Also fliege ich für zwei Wochen mit meinen Eltern nach Marbella. Aber dann darf ich zu dir fahren und den Rest des Urlaubs auf Eday sein.«
Ich versuchte meine Enttäuschung nicht zu zeigen und umarmte sie. Die Fahrt dorthin, die ersten Tage, das würde das Schwierigste sein und da hätte ich sie gerne dabei gehabt.
Aber es war schon ein kleines Wunder, dass sie überhaupt bei mir sein würde, also konnte ich mich glücklich schätzen. Und zwei Wochen … das konnte ich schon aushalten.
Vierzehn Tage. Vierzehn Tage allein mit meinem Vater auf Eday.
Und dem Geist meiner abwesenden Mutter zwischen uns.
Irgendwie würde ich es überstehen.
Kapitel drei
Ich hatte schon verdrängt, wie lang die Reise von Edinburgh nach Eday war. Der Flug nach Kirkwall ging ja noch, aber dann musste ich auf die Fähre nach Eday warten. Eigentlich sollte mir als Fischertochter das Meer im Blut liegen, aber ich war den ruppigen Seegang nicht mehr gewohnt. Bestimmt war ich leicht grün im Gesicht, als ich die Fähre verließ. Da ich im Dunkeln ankam, musste ich diese Schmach nicht vor meinem Vater zugeben, der mich am Pier abholte. Ich zog mir einfach mein Cap tiefer ins Gesicht, während wir uns zur Begrüßung etwas zumurmelten.
Der Wind blies mir um die Ohren und hätte mein Cap beinahe davonfliegen lassen, bevor ich bei meinem Vater ins Auto einstieg.
Wir fuhren die knapp drei Kilometer vom Backaland Pier an der Ostküste der Insel, wo die Fähre angelegt hatte, zu unserem Haus an der Westküste. Eday war zwölf Kilometer lang, aber nur wenige Kilometer breit. Man nannte sie auch die Isthmus-Insel, da an der schmalsten Stelle nur wenige hundert Meter die Ost- von der Westküste trennten. Dort gab es sogar einen Flughafen, der ausgerechnet London Airport hieß.
Auch wenn der Weg rein von der Luftlinie her nicht lang war, dauerte er doch seine Zeit – auf der einzigen asphaltierten Straße kamen wir nicht weit, da wir bald auf einen schmalen, mit vielen Schlaglöchern gespickten Feldweg abbogen, der uns schließlich nach Skerbister führte. Skerbister war unser Croft, wie man hier die Grundstücke mit einem traditionellen Cottage und einem kleinen bewirtschafteten Stück Land drum herum nannte.
Ich war ziemlich gerädert. Also zog ich mich, nachdem ich mich im Bad frisch gemacht und ein von Dad zubereitetes Sandwich gegessen hatte, gleich auf mein Zimmer zurück.
Das Haus kam mir noch winziger vor als beim letzten Mal. Viel mehr als das Doppelbett hatte gar keinen Platz in diesem Raum, und das einzige andere Zimmer, in dem mein Vater schlief, war auch nicht viel größer.
In der Küche konnte sich eine Person gerade so umdrehen. Und im Wohnzimmer standen ein kleiner Esstisch, drei Stühle und zwei Ohrensessel, die in Richtung Fernseher ausgerichtet waren. Eine Anrichte fürs Geschirr, eine Truhe für Bettwäsche und Tischtücher sowie ein paar Regale mit Büchern und Schnickschnack. Das war’s.
Ich nahm an, mein Vater bewahrte einige Dinge in meinem Zimmer auf, wenn ich nicht da war, die jetzt in dem Container nebenan lagerten. Es war nicht unüblich, dass man auf Orkney einen für meine Begriffe hässlichen Schiffscontainer auf dem Grundstück stehen hatte. Der Grund für diesen etwas ungewöhnlichen »Schuppen« war, dass alles, was nicht niet- und nagelfest oder beschwert war, Gefahr lief, vom Wind ins Meer gepustet zu werden.
Das Bett in meinem Zimmer, auf das ich mich noch angezogen fallen ließ, hatte mein Vater sicher auch erst gekauft, nachdem ich zu meiner Oma gekommen war. In meinem alten Kinderbett, an das ich mich nur noch vage erinnerte, hätten Oma und ich bei unseren wenigen Besuchen keinen Platz gehabt.
Ich drückte mein Gesicht in das Kissen, schloss die Augen und stellte mir vor, meine Oma würde neben mir liegen. Aber das tröstliche Gefühl der Vertrautheit, dem ich nachspürte, wollte sich nicht ganz einstellen. Den Duft von Omas Parfum konnte ich einfach nicht heraufbeschwören, stattdessen sog ich den leicht muffigen Geruch des Kissenbezuges ein.
Bestimmt hatte mein Vater das Bettzeug gewaschen, aber er hatte keinen Trockner. Beim Eintreten hatte ich im für die Cottages auf Orkney typischen kleinen Windfang eine Wäschespinne gesehen. Ich erinnerte mich sehr gut daran, dass es bei regnerischem Wetter unheimlich klamm im Haus blieb, und konnte mir gut vorstellen, dass aus diesem Grund die Wäsche ebenfalls nicht richtig trocken wurde.
Ich nahm mir vor, morgen draußen eine Wäscheleine zu spannen und die Bettwäsche noch einmal zu waschen. Außerdem konnte ich das gesamte Cottage einem verspäteten Frühjahrsputz unterziehen. Es hatte zwar alles einigermaßen ordentlich ausgesehen, aber mein Dad war ein alleinstehender Mann, der viel arbeitete. Bestimmt stand gründliches Putzen nicht ganz oben auf seiner To-do-Liste.
Megan hatte mich die letzten Tage vor meiner Abreise immer wieder daran erinnert, dass ich auf Eday wahrscheinlich vor Langeweile sterben würde, sodass ein einfacher Plan, wie ich meinen ersten Tag hier verbringen würde, mich vor lauter Erleichterung einschlafen ließ.
Am nächsten Morgen war ich nicht mehr ganz so begeistert von meiner Idee. Als ich aufstand, hatte mein Vater schon das Cottage verlassen, um sich auf den Weg zu seinem Arbeitsplatz, einem Lachsaufzuchtbetrieb, zu machen. Er hatte mir eine kurze Nachricht hinterlassen, die mich darüber informierte, dass ich mir den Porridge auf dem Herd aufwärmen könnte.
Skeptisch schaute ich auf die gräuliche, klebrige Masse. Schließlich fand ich Brot, Butter und Marmelade und machte mir dazu einen Tee. Als ich dann endlich alle Putz- und Waschmittel entdeckt und verstanden hatte, wie die Waschmaschine funktionierte, legte ich schon nach einem Waschgang eine Pause ein.
So eklig war das Haus jetzt auch wieder nicht. Gemütlich genug, um den gesamten Vormittag in einem der Ohrensessel zu verbringen und ein spannendes Buch zu lesen.
Als gegen Mittag mein Magen grummelte, machte ich mir ein Sandwich. Ich erinnerte mich an die Wäsche und ging zum Container, in dem ich hoffte, eine Wäscheleine zu finden. Auf dem Weg dorthin fiel mir der wahre Grund ein, warum man vielleicht selten die Wäsche draußen trocknete: Bei dem Wind sah man sie wahrscheinlich nicht wieder.
Aber jetzt hatte mich der Ehrgeiz gepackt, wenigstens einen Teil meines Plans umzusetzen, statt nur faul im Cottage herumzuhängen. Ich stellte die Wäschespinne nach draußen, nahm einen Stuhl aus dem Haus und setzte mich daneben. Dann passte ich auf wie ein Luchs, damit mir nichts davonflog. Der Vorteil des Windes war, dass alles ziemlich schnell trocknete. Und hinterher roch die Bettwäsche herrlich frisch nach Wind und Meer.
Als ich mich leicht erschöpft von der ganzen Prozedur aufs neu bezogene Bett fallen ließ und die Augen schloss, hatte ich nichts Muffeliges mehr in der Nase. Stattdessen traf mich ganz unvorbereitet die Erinnerung an meine Mutter, wie sie mich zudeckte. Komischerweise konnte ich ihren Geruch sofort heraufbeschwören: wie eine Meeresbrise. Ich spürte beinahe ihre weichen Lippen auf meiner Stirn und das Kitzeln ihrer langen Haare auf meinem Gesicht, als ob sie sich über mich beugen und mir einen Gute-Nacht-Kuss geben würde.
Ich fragte mich, ob der für mich eher untypische Einfall gestern Nacht – ich war nicht gerade dafür bekannt, ein Putzteufel zu sein – irgendetwas damit zu tun hatte, dass ich unbewusst die Atmosphäre wieder herstellen wollte, die meine Mutter auf Skerbister geschaffen hatte.
Entschlossen stand ich auf und machte mich fast schon trotzig daran, die Küche zu schrubben. Nein, das hier würde nie wieder das Heim sein, das meine Mutter verlassen hatte. Es war jetzt das Zuhause meines Vaters, der sein Bestes gab.
Und für diesen Sommer wenigstens würde es auch mein Heim sein. Ich würde es einfach dazu machen.
Als mein Vater nach Hause kam, zeigte er sich beeindruckt von meinen Putzkünsten. Ich hatte vielleicht etwas zu viel von dem Zitronenreiniger verwendet, aber wenigstens roch es jetzt frisch und sauber im Haus.
Dad machte ein frühes Abendessen. Hausmannskost: Würstchen, Spiegeleier, Kartoffelbrei und Erbsen. Der Kartoffelbrei kam aus der Fertigpackung und die Erbsen aus der Dose (bei meiner Oma wäre so etwas nicht auf den Tisch gekommen), aber die Wurst war regional, ein echtes Orkney-Produkt, und schmeckte wirklich gut.
Wir hatten während des Essens geschwiegen, aber beim Abwaschen fragte mich mein Vater: »Was hast du heute so gemacht, außer zu putzen? Hast du dich in der Nachbarschaft umgesehen?«
»Äh. Nein. Nein, ich war nur hier.« Es war mir gar nicht in den Sinn gekommen, spazieren zu gehen. Schließlich war es nicht so, als ob es irgendwas zu sehen gab, wie es bei einem Stadtbummel der Fall wäre. Irgendwo in meinem Unterbewusstsein wusste ich natürlich, dass das Blödsinn war, und dass es einen anderen Grund gab. Deshalb zuckte ich auch zusammen, als mein Vater meinte: »Bist du nicht mal zum Strand runter?«
Ich schüttelte nur den Kopf und gab vor, völlig vertieft in das Abtrocknen meines Tellers zu sein.
»Hm. Wir können ja einen Spaziergang zum Strand machen, was meinst du?«
»Okay.« Was sollte ich auch sagen? Außerdem ließ es sich langfristig wahrscheinlich nicht vermeiden, auf Eday einen Abstecher zum Strand zu machen.
Stumm zogen wir uns nach dem Abwasch unsere Jacken und Stiefel an und machten uns auf den Weg. Unser Haus lag etwas südlich der Sealskerry Bay, die sich wie ein Piratenhaken in die Westküste Edays grub. Die Bucht säumte ein malerischer flacher Sandstrand, umschlossen von Klippen. Am nördlichen Ende der Bay, sozusagen an der Spitze des Enterhakens, erhoben sich steile Felsriffe, die sich dann in gerader Linie nördlich bis zum Fers Ness Point zogen. Diesen kleinen, westlichen Vorsprung der Insel nannte man West End.
Es war noch hell und daher hatte die in goldenes Sonnenlicht getauchte Szenerie überhaupt nichts mit den Träumen gemein, die mich des Öfteren heimsuchten. Ich war trotzdem froh, dass Dad an meiner Seite war und ich nicht allein hierhergekommen war. Wir gingen ein paar Meter den Strand entlang und blieben dann stehen, um den Vögeln zuzuschauen, die mit dem Wind über die weißen Schaumkronen segelten. Rechts konnte man gerade noch Seal Skerry Island sehen, ein Felsen voller Seehunde und Robben. Links erblickte man bei gutem Wetter, wie heute, die kleine Insel Egilsay. In der Ferne glaubte ich große Flossen aus dem Wasser auftauchen zu sehen. Womöglich ein Schwarm Orkas. Die hier zu sehen war nichts Ungewöhnliches. Aber die Sonne blendete, sodass ich die Augen zusammenkniff … und dann waren die Flossen verschwunden. Ich war mir nicht mehr sicher, ob ich sie mir lediglich eingebildet hatte.
Das war das Problem, hier auf Orkney. Die Inseln hatten so etwas an sich, dass man sich immer an der Grenze zum Übernatürlichen, zum Mystischen wähnte. Das hört sich ein bisschen esoterisch an, aber nur so konnte ich es beschreiben.