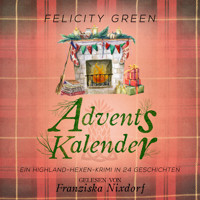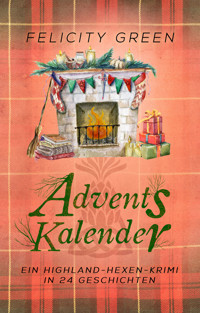8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Troll-Chroniken – Die komplette Trilogie + Bonus-Novelle
Nordische Sagen. Unbändige Kräfte. Eine Apokalypse, die alles verändert.
• Eine mysteriöse Klinik für aggressive Jugendliche auf einer einsamen Shetland-Insel.
• Eine 18-jährige Kämpferin, die sich ihrer Wolfskraft stellt.
• Kreaturen aus der zweiten Ragnarök, deren Ziel das Ende der Menschheit ist.
Kann Tierkriegerin Alannah die Troll-Apokalypse verhindern – oder wird sie selbst zu ihrer größten Bedrohung?
Dieses exklusive E-Book-Bundle vereint alle drei Teile der Nordic-Fantasy-Saga sowie die Novelle Tochter der Tierkriegerin – und spart dir über 50 % gegenüber dem Einzelkauf!
Enthaltene Bände:
1. Band 1: Die Tierkriegerin und das Ende der Menschheit
Als Alannah in eine Klinik für aggressive Jugendliche eingewiesen wird, glaubt sie an eine zweite Chance. Doch dann entdeckt sie die Wahrheit: Man will sie nicht heilen – sondern die uralte Bestie in ihr entfesseln. Während dunkle Mächte die zweite Ragnarök vorbereiten, muss Alannah sich entscheiden: Mensch bleiben – oder kämpfen?
2. Band 2: Die Tierkriegerin und das Erbe der Trollwesen
In einer Welt, in der Freund und Feind nicht zu unterscheiden sind, zählt nur, wer dein Herz wirklich berührt. Wem kann Alannah noch vertrauen?
3. Band 3: Die Tierkriegerin und die Rückkehr der Elfen
Liebe oder Freundschaft? Menschen oder Trolle? Das magische Finale der Troll-Chroniken wird alles verändern.
Bonus-Novelle: Die Tochter der Tierkriegerin
16 Jahre nach der Gründung von Havnheim begibt sich Alannahs Tochter Linn auf die gefährliche Suche nach ihren Eltern.
„Actionreich, fesselnd und tiefgründig – eine Fantasy-Reihe, die dich nicht mehr loslässt!“ – ★★★★★ Leserbewertung
Für Fans von Jennifer L. Armentrout, Neil Gaiman, Liza Grimm, Mira Valentin, Bianca Iosivoni, Helen Hawk und Leser*innen, die starke Heldinnen, Gestaltwandler, nordische Mythologie und Urban-Fantasy-Jugendromane lieben.
Greif jetzt zum Sparpaket und erlebe eine actionreiche Nordic-Fantasy-Reihe voller Magie, Dystopie-Feeling, Berserker-Kraft und düsterer Götter!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
TROLL-CHRONIKEN
TIERKRIEGERN-SAMMELBAND
FELICITY GREEN
INHALT
Die Tierkriegerin und das Ende der Menschheit
Prolog
Kapitel eins
Kapitel zwei
Kapitel drei
Kapitel vier
Kapitel fünf
Kapitel sechs
Kapitel sieben
Kapitel acht
Kapitel neun
Kapitel zehn
Kapitel elf
Kapitel zwölf
Kapitel dreizehn
Kapitel vierzehn
Kapitel fünfzehn
Kapitel sechzehn
Kapitel siebzehn
Kapitel achtzehn
Kapitel neunzehn
Kapitel zwanzig
Kapitel einundzwanzig
Kapitel zweiundzwanzig
Kapitel dreiundzwanzig
Kapitel vierundzwanzig
Kapitel fünfundzwanzig
Kapitel sechsundzwanzig
Kapitel siebenundzwanzig
Kapitel achtundzwanzig
Kapitel neunundzwanzig
Kapitel dreißig
Kapitel einunddreißig
Kapitel zweiunddreißig
Kapitel dreiunddreißig
Kapitel vierunddreißig
Epilog
Die Tierkriegerin und das Erbe der Trollwesen
Teil I
Kapitel eins
Kapitel zwei
Kapitel drei
Kapitel vier
Kapitel fünf
Kapitel sechs
Kapitel sieben
Kapitel acht
Kapitel neun
Kapitel zehn
Teil II
Kapitel elf
Kapitel zwölf
Kapitel dreizehn
Kapitel vierzehn
Kapitel fünfzehn
Kapitel sechzehn
Kapitel siebzehn
Kapitel achtzehn
Kapitel neunzehn
Kapitel zwanzig
Kapitel einundzwanzig
Kapitel zweiundzwanzig
Kapitel dreiundzwanzig
Kapitel vierundzwanzig
Kapitel fünfundzwanzig
Kapitel sechsundzwanzig
Kapitel siebenundzwanzig
Kapitel achtundzwanzig
Teil III
Kapitel neunundzwanzig
Kapitel dreißig
Kapitel einunddreißig
Kapitel zweiunddreißig
Kapitel dreiunddreißig
Epilog
Die Tierkriegerin und die Rückkehr der Elfen
Prolog
Kapitel eins
Kapitel zwei
Kapitel drei
Kapitel vier
Kapitel fünf
Kapitel sechs
Kapitel sieben
Kapitel acht
Kapitel neun
Kapitel zehn
Kapitel elf
Kapitel zwölf
Kapitel dreizehn
Kapitel vierzehn
Kapitel fünfzehn
Kapitel sechzehn
Kapitel siebzehn
Kapitel achtzehn
Kapitel neunzehn
Kapitel zwanzig
Kapitel einundzwanzig
Kapitel zweiundzwanzig
Kapitel dreiundzwanzig
Kapitel vierundzwanzig
Kapitel fünfundzwanzig
Kapitel sechsundzwanzig
Kapitel siebenundzwanzig
Kapitel achtundzwanzig
Kapitel neunundzwanzig
Kapitel dreißig
Kapitel einunddreißig
Kapitel zweiunddreißig
Kapitel dreiunddreißig
Kapitel vierunddreißig
Kapitel fünfunddreißig
Kapitel sechsunddreißig
Epilog
Die Tochter der Tierkriegerin
Kapitel eins
Kapitel zwei
Kapitel drei
Kapitel vier
Kapitel fünf
Kapitel sechs
Kapitel sieben
Kapitel acht
Kapitel neun
Kapitel zehn
Kapitel elf
Kapitel zwölf
Danke & gratis Buch
TROLL-CHRONIKEN
Tierkriegerin-Sammelband
1: Die Tierkriegerin und das Ende der Menschheit
2: Die Tierkriegerin und das Erbe der Trollwesen
3: Die Tierkriegerin und die Rückkehr der Elfen
Novelle: Die Tochter der Tierkriegerin
© Felicity Green, 1. Auflage 2021
www.felicitygreen.com
Veröffentlicht durch:
A. Papenburg-Frey
Schlossbergstr. 1
79798 Jestetten
© Covergestaltung: Laura Newman – design.lauranewman.de
Verwendete Stockgrafiken: © Andrew Poplavsky / 123RF.com
Korrektorat: Wolma Krefting, bueropia.de
Alle Rechte, einschließlich dem des vollständigen oder teilweisen Nachdrucks in jeglicher Form, sind vorbehalten.
Personen und Handlungen sind frei erfunden oder wurden fiktionalisiert. Ähnlichkeiten mit lebenden und verstorbenen Personen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
DIE TIERKRIEGERIN UND DAS ENDE DER MENSCHHEIT ist erstmals 2019 erschienen.
DIE TIERKRIEGERIN UND DAS ERBE DER TROLLWESEN ist erstmals 2020 erschienen.
DIE TIERKRIEGERIN UND DIE RÜCKKEHR DER ELFEN ist erstmals 2020 erschienen.
DIE TOCHTER DER TIERKRIEGERIN ist erstmals 2021 erschienen.
DAS BUCH
Würdest du dich in ein hässliches, blutrünstiges Biest verwandeln, um die Menschheit zu retten?
Alannah lebt in einem Käfig im Keller ihrer Eltern, denn sie ist eine Gefahr für andere.
Als ihre Familie sie aufgibt, setzt sie alle Hoffnung auf eine mysteriöse Klinik für aggressive Jugendliche auf einer einsamen Shetland-Insel.
Hier findet Alannah zwar Freunde, aber ihr wird nicht geholfen, ein normales Leben zu führen. Im Gegenteil: Sie soll genau das werden, wovor sie sich am meisten fürchtet.
Denn Alannah ist geboren, um zu kämpfen.
Und sie kann ihrem Schicksal nicht entkommen, denn die Zeit der Menschheit läuft ab. Eine geheime Organisation, die nordische Mythen und Magie wieder auferstehen lässt, setzt alles darauf, dass Alannah und die anderen Tierkrieger die bevorstehende Apokalypse abwenden.
Doch wer sind die schrecklichen Kreaturen, die an der zweiten Ragnarök aus der Erde kriechen werden – und was haben sie mit Alannah gemein?
Für meinen Mann und meine Tochter, denen es nichts ausmacht, dass unsere Familienurlaube meist Romanrecherchetrips werden.
PROLOG
Die Insel strahlte eine trügerische Ruhe aus.
Der einlullende, stete Rhythmus der Wellen, die über die Kiesstrände schwappten und sich an den Felsklippen brachen.
Das fahle Mondlicht, in dem das gefrorene Gras auf den sanften Hügeln beinahe mystisch silbern glänzte.
Der gleichmäßige Takt der Schwingungen unzähliger lautloser Flügelschläge in der Luft.
Bei unserer Ankunft auf Mousa hatten wir zuerst das Schild gesehen, das uns Respekt vor den Bewohnern der Insel einbläuen wollte: Die Vögel, die in diesem Naturreservat beheimatet waren, konnten manchmal aggressiv reagieren, wenn sie ihre Brutstätten nahe am Klippenweg bedroht sahen.
Wir hatten die Insel mit Ehrfurcht betreten, aber wir hatten keine Angst vor der Natur. Die wahre Bedrohung kam nicht von dieser fast quälend idyllischen Welt.
Als der Turm nach zwanzig Minuten Fußmarsch endlich in unser Sichtfeld kam, traf mich die Energie, die er verströmte, wie eine Druckwelle. Ich hatte imposantere Gebäude und höhere Türme gesehen. Doch den massiven, alten Steinen wohnte eine unheimliche Kraft inne.
Und auch wenn ich nicht gewusst hätte, welch höllisches Grauen der Turm barg, hätte ich seine Magie wahrscheinlich gespürt. Sie musste der Grund dafür sein, dass Touristen auf diese Insel kamen, um den besterhaltenen Broch auf Shetland zu besichtigen, und weshalb diese Wehrtürme aus der Eisenzeit überhaupt eine solche Faszination ausübten.
Vor dem Turm angekommen sahen wir uns unschlüssig an.
Calixta räusperte sich. »Gehen wir rein?«
Ich warf einen skeptischen Blick auf den jetzt helleren Streifen am Horizont. Wir hatten noch ein bisschen Zeit. »Warum nicht.«
Im Wissen, die letzten Menschen zu sein, die den Broch von Mousa betreten würden, gingen wir der Reihe nach durch den engen, niedrigen Eingang. Bosse, der vor mir eintrat, musste richtig den Kopf einziehen. Aus einem Schränkchen nahmen wir große Taschenlampen, schalteten sie an und leuchteten umher.
Calixta, Ran, Bosse und ich kraxelten ein paar der unebenen Steinstufen hoch, damit die anderen nach uns überhaupt noch Platz hatten.
Auf den Illustrationen, die uns General Darktower gezeigt und die ich im Museum gesehen hatte, war der Innenraum größer erschienen. Natürlich war das, was auf den Zeichnungen abgebildet war, reine Spekulation. Niemand wusste genau, was die Menschen, die die Brochs gebaut hatten, darin gemacht hatten. Oder was der genaue Zweck der Brochs gewesen war.
Niemand außer einer kleinen Gruppe von Menschen, die das Geheimnis jahrhundertelang gehütet hatte. Und wir.
Die Illustrationen hatten einen Haushalt gezeigt, mit Feuerstelle und Tieren. Eine zweite Ebene auf halber Höhe des Turms, die mehr Raum bot. Geräucherte Fische, die an Stangen an der Decke hingen. Das Leben im Broch hatte fast heimelig gewirkt.
Hier, jetzt, in unserer Gegenwart, war der Turm weit von gemütlich entfernt. Nichts als nackte, dunkle, kalte Steine. Die kreisrunde Öffnung oben, auf die man ein Gitter gelegt hatte, damit sich keine Vögel in den Turm verirrten, ließ etwas Dämmerlicht ein, trug aber zur beklemmenden, ominösen Atmosphäre bei.
Wir gingen der Reihe nach die enge Treppe mit ihren winzig kleinen, gefährlich unebenen Stufen hinauf.
Wir blieben stehen, um die kleinen Hohlräume in der doppelten Wand des Turms zu begutachten, von denen man annahm, dass sie als Schlaf- und Vorratsräume gedient hatten.
Oben angekommen, öffneten wir die Gitterluke und betraten den schmalen Gang am Rande des Dachs.
Wir genossen schweigend die schmerzhaft schöne Aussicht, bis Adira sagte: »Wir sollten gehen.«
Auf dem Weg nach unten rutschte ich aus und Nic, der vor mir ging, ergriff mein Handgelenk. Ich schüttelte seine Hand ab. Ich hatte mich am Eisengeländer festgehalten. Ich brauchte seine Hilfe nicht.
Unten legten wir die Lampen zurück in den Schrank, auch wenn sie vermutlich nie wieder jemand brauchen würde.
Erst als ich wieder draußen stand, bemerkte ich, dass ich im Turm nicht einen richtig tiefen Atemzug getan hatte. Ich ließ kalte, frische Luft in meine Lungen strömen.
Eine Hand legte sich auf meine Schulter und ich zuckte zusammen.
»Alles in Ordnung?« Es war Hilda. Sie hatte besorgt die Brauen zusammengezogen, was der schönen Symmetrie ihres Gesichtes keinen Abbruch tat.
Ich zwang mich zu einem Lächeln. »Ja, so in Ordnung, wie alles eben sein kann, wenn das Ende der Welt kurz bevorsteht«, versuchte ich zu witzeln.
Doch Hilda zeigte ihre Grübchen nicht. Nur die Furche auf ihrer Stirn wurde tiefer. »Aber das tut es ja nicht. Deshalb sind wir hier.«
Gott, Hilda war so was von idealistisch. Kein Wunder, war sie doch jahrelang schon Dr. Isbisters Gehirnwäsche unterzogen worden. Nicht zu vergessen, der Einfluss ihrer Eltern – die jetzt in einem Bunker saßen, um auf das Ende der Welt zu harren.
Ich schaute mich um. War ich die Einzige, die ihre Zweifel hatte, ob unsere Wahnsinnsmission gelingen würde? Nein, Bosse sah derart blass aus, dass ich befürchtete, er würde sich gleich übergeben. Und die Geschwister Ran, Adira und Calixta hatten sich an der Hand genommen.
Nur Nic wirkte so zuversichtlich wie eh und je. Na, dann muss ich mir ja keine Sorgen machen, dachte ich bitter. Wir anderen mussten schließlich auch nicht wissen, wie genau das hier ablaufen würde. Wie wir die Menschheit retten würden. Solange Nic es wusste. Er war der Held. Wir nichts als seine Bodyguards.
Nic trat neben Hilda und sah uns erwartungsvoll an, so als wollte er uns auffordern, ihn in unser Gespräch einzuweihen. Die beiden passten wirklich sehr gut zusammen, mit ihren goldblonden Haaren und den attraktiven Gesichtszügen.
Schnell wandte ich mich ab.
Es war sowieso egal.
Entweder gingen wir gleich mit dieser verdammt schönen Insel unter. Die Zeit der Menschheit war abgelaufen, und damit auch unsere.
Oder Nic, der Auserwählte, würde die Kreaturen besiegen, deren Zeit gleich anbrach. Dann konnte er sich jede aussuchen, die er haben wollte. Und ich bezweifelte, dass er mich oder Hilda aussuchen würde. Denn Hilda war wie ich. Trotz all ihrer Schönheit verwandelte sie sich am Ende in ein Biest, wie es hässlicher und unweiblicher nicht hätte sein können.
Als der Tag heraufdämmerte, machten wir uns bereit. Und dann warteten wir.
Nichts geschah. Alle wurden merklich unsicher. Sollte die alte Alannah, die davon überzeugt gewesen war, in einen Weltuntergangskult geraten zu sein, doch recht behalten?
Doch die Zeichen der zweiten Ragnarök waren alle da gewesen. Der Winter, so bitterkalt wie drei. Die Sonnenfinsternis, dann der Blutmond. Und wenn ich im Laufe des Tages noch Zweifel hegte, so wurden diese am Nachmittag immer weniger. Man merkte es an der Luft. Es braute sich etwas zusammen.
Ich konnte überhaupt keine Vögel mehr sehen. Waren sie geflüchtet wie Ratten vom sinkenden Schiff? Bestimmt hatten sie das tiefe Brummen gespürt, das jetzt vom Turm ausging.
Wir nahmen unsere Positionen um Nic ein. Nic zog sich nahezu ganz aus und rieb sich mit einer Paste ein. Dann war das bei Magni und Martin, den anderen Auserwählten, die uns ihre Magie gezeigt hatten, nicht nur Show gewesen. Nic schien ganz konzentriert und sah aus, als ob er die Kälte nicht spürte.
Doch dann fing er meinen Blick auf und zwinkerte mir zu.
Ich wurde rot und schaute schnell weg. Jetzt dachte er, ich hätte seinen muskelgestählten Körper bewundert. Nur ein selbstgefälliger Schönling wie Nic konnte sich einbilden, dass ich in diesem Moment an so etwas dachte. Arschloch.
Das Brummen wurde lauter und der Boden unter unseren Füßen fing an zu beben. Der starke, Ehrfurcht erweckende Wehrturm, der jahrhundertelang jedem Wetter getrotzt hatte, begann zu zittern. Die ersten Steine lösten sich oben und fielen herunter. Gleich würde er zusammenbrechen wie ein Turm aus Holzklötzen.
Ich schloss die Augen und zehrte von der Wut, von der ich genug in meinem Inneren angestaut hatte. Die Verwandlung ging schnell. Ohne es zu sehen, wusste ich, dass die anderen um mich herum dasselbe taten.
Wir waren bereit, das zu tun, wofür wir geschaffen worden waren.
Die Türme, die Tore zu der Welt, in der das Böse vor vielen, vielen Jahren verbannt worden war, würden aufbrechen. Die Kreaturen würden aus der Erde kriechen und die Menschheit auf grausame Weise vernichten, um sich das, was einmal ihnen gehört hatte, wieder anzueignen.
Es sei denn, wir konnten sie aufhalten.
KAPITEL EINS
Die paar Sekunden nach dem Aufwachen jeden Morgen war die Welt für mich in Ordnung. Dieser kurze Moment, bevor mir bewusst wurde, wo ich war. Ja, eigentlich, wer ich war.
Einen glückseligen Augenblick lang trieb ich auf dem weiten Ozean des ahnungslosen Seins.
Dann zog sich mein Herz zusammen und meine Welt schrumpfte ebenso, als mir schlagartig einfiel:
Ich lebte in einem Käfig im Keller meiner Eltern.
Mein Atem ging schneller und mein Puls beschleunigte sich. Die Atemübungen, die verhindern sollten, dass ich außer Kontrolle geriet, waren mir mittlerweile schon in Fleisch und Blut übergegangen. Ich machte sie, seit ich vierzehn war, und mittlerweile gehörten sie zu meiner täglichen Routine. Wie Zähneputzen.
Routine war wichtig, wenn man völlig isoliert lebte. Man durfte sich nicht die Gelegenheit geben, zu lange zu grübeln. Sonst bekam man einen Hüttenkoller. Oder in meinem Fall wäre Käfigkoller wohl die treffendere Bezeichnung.
Wie auch immer, Koller war schlecht.
Damit ich keinen Koller kriegte, war ich schließlich hier eingesperrt.
Ich wusste, dass es zu meinem Besten war. Aber manchmal fiel es mir schwer, das zu akzeptieren.
Gott sei Dank war meine Mutter sehr gut darin, mir Beschäftigungsmöglichkeiten zu bieten. Sie hatte mir einen Stundenplan erstellt, bei dem sich Lernen für die Abi-Prüfungen mit Sport abwechselte. Eine Hälfte meines Käfigs sah nämlich aus wie ein Fitnessstudio. Neben dem Fernseher stapelten sich Yoga-DVDs und auf Knopfdruck schallten Hörbücher mit Meditationsübungen durch den Keller. Auf dem Stundenplan standen sogar Chatten in Online-Foren mit Gleichaltrigen, Computerspiele und Bücherlesen. Alles war genau reglementiert.
Ich fügte mich dem total. Nicht nur, weil es einfacher für mich war, sondern auch, weil ich glaubte, dass es meiner Mutter half. Sie klammerte sich an ihre Rolle als Managerin meines Lebens, weil die völlige Hilflosigkeit sie sonst runtergezogen hätte.
Ich wollte nicht, dass meine Mutter mich aufgab, denn mein Vater hat es schon getan, und das brach mir das Herz.
Dabei war er derjenige gewesen, der am Anfang am meisten hinter mir gestanden hatte.
Ich konnte mich noch genau daran erinnern, wie ich kurz nach meinem vierzehnten Geburtstag vor der angelehnten Tür des Rektorenzimmers auf einem Stuhl saß und meinen Vater sagen hörte: »Alannah lässt sich eben nicht gefallen, gemobbt zu werden. Natürlich war die gewalttätige Reaktion nicht angemessen, aber wie sehr muss sie gereizt worden sein, dass sie sich zu etwas hat hinreißen lassen? Hat da keiner etwas vorher gemerkt?«
Wozu ich mich »habe hinreißen lassen«? Drei meiner Mitschülerinnen krankenhausreif zu schlagen. Ja, sie hatten mich gehänselt, und die angestaute Wut, die seit Anbeginn der Pubertät in mir getobt hatte, war nicht länger kontrollierbar gewesen.
Meinem Vater hatte ich es zu verdanken, dass der Rektor sich schuldig fühlte, das Mobbing nicht bemerkt zu haben. Man ging den Kompromiss ein, mich in eine Parallelklasse zu versetzen und mich einmal die Woche zum Anti-Aggressionstraining zu schicken. Ein Jugendarbeiter, der immer auf eine etwas verzweifelte Weise cool wirken wollte, versuchte dort mir und anderen gewaltbereiten Jugendlichen beizubringen, ruhig zu bleiben und sozialkompetent mit Gewaltimpulsen umzugehen – so nannte er das.
Das Problem war, dass es seit dem ersten Vorfall einen Teil in mir gab, der gar nicht ruhig bleiben, sondern die Gewaltimpulse wollte. Sicher, ich schämte mich und ich hatte auch etwas Angst vor mir selber – vor dem, wozu ich fähig war. Aber ich hatte auch eine Art … Selbstachtung und vor allem Selbsterkenntnis gewonnen, die mich mit Stolz und Ehrfurcht erfüllten. Das konnte ich ja vor keinem zugeben. Ich wusste doch, dass der Gewaltausbruch falsch gewesen war.
Aber es hatte sich so richtig angefühlt … es war befreiend gewesen, die innere Anspannung, die aufgestaute Aggression endlich loslassen zu können. Diese Energie freizusetzen war keine … Anstrengung gewesen. Es war mir gut und richtig vorgekommen. Ich hatte gar keinen Schmerz gespürt. Die Prügelei hatte ich wie einen Traum erlebt, indem Schwerkraft und Zeit aussetzten und ich stark und anmutig war. Wie in den Filmen mit Kampfsequenzen in Zeitlupe.
Die Prügelei mit den drei Mitschülerinnen war ein bisschen so gewesen, als hätte ich vom Apfel des Baums der Erkenntnis gekostet. Und es dauerte nicht lange, bis ich bei einem der Rollenspiele in Anti-Aggressionstraining einen Jungen, der doppelt so groß und schwer wie ich war, an die Wand warf.
Da begann mein Vater mich mit anderen Augen zu sehen. Das bisschen Respekt, das er nach der ersten Prügelei mit den mobbenden Mädchen noch aufgebracht hatte, verwandelte sich schnell in Furcht. Eine Art irrationale Angst vor dem, wozu ich körperlich in der Lage war.
Ich war nicht mehr sein kleines Mädchen.
Als ich nach der dritten Schlägerei von der Schule flog, begann er sich von mir zu distanzieren. Es tat weh, aber ich konnte es ihm nicht verübeln.
Meine Mutter nahm die Sache in die Hand, nachdem ich auch die nächste Schule verlassen musste – in Rage hatte ich ein ganzes Klassenzimmer auseinandergenommen. In Absprache mit dem Jugendamt machte ich erneut eine Anti-Aggressionstherapie. Die ständige Auseinandersetzung mit dem Thema ließ mich in etwa so fühlen wie ein Stier, dem man andauernd mit einem roten Tuch vor der Nase herumwedelte. Es wurde nur noch gereizter.
Meine Mutter recherchierte nach Internaten für schwererziehbare Jugendliche, und vor lauter Panik richtete ich die Gewalt gegen mich selbst. Auf der Akutstation der psychiatrischen Klinik, in die man mich einlieferte, gab ich endlich zu, wie ich mich während der befreienden Attacken fühlte.
»Würden Sie den Zustand wie eine Art Trance beschreiben?«, fragte der Oberarzt mit gerunzelter Stirn, ohne mich anzusehen.
»Ja, genau.«
Er schrieb etwas auf seinen Notizblock.
»Würden Sie sagen, Sie stehen neben sich und beobachten sich selber, oder fühlt es sich eher so an, als ob Sie von einer fremden Kraft getrieben werden, als wenn jemand anders Ihren Körper bewegt?«
»Hmm. Eher so, als wenn mein Körper weiß, was zu tun ist. Als ob ich mich ganz auf ihn verlassen kann.« Unsicher schielte ich zu ihm rüber, als er sich noch mehr Notizen machte.
Leider erhielt ich nicht die ersehnte logische Erklärung für mein Verhalten. Stattdessen überließ der Oberarzt alles Weitere dem Assistenzarzt, der mir Medikamente verschrieb.
Die Medikamente halfen und die »Beschäftigungstherapien«, wie ich den Stundenplan nannte – Malen, Gesprächskreis, Spazierengehen und so weiter –, waren eine Erleichterung, weil ich die Verantwortung für mein Tun auf andere abschieben konnte.
Ich war eine Musterpatientin. Meine Mutter kam täglich, weil sie mit dem Plan, mich besser zu machen, voll in ihrem Element war. Mein Vater kam seltener und wurde immer stiller. Er kämpfte damit, dass seine Tochter offensichtlich psychisch krank war. Dissoziative Identitätsstörung lautete eine erste, vorsichtige Diagnose.
Leider war es nur eine Illusion. Die Medikamente halfen nicht, sie machten alles nur noch schlimmer. Sie unterdrückten meine Aggressivität auf eine solche Weise, dass ich sie nicht bemerkte, sodass ich schließlich völlig die Kontrolle verlor.
Eines Nachts kam ich zu mir, wie ich mitten in meinem Zimmer in der psychiatrischen Einrichtung auf dem Fußboden saß. Ich war von Kopf bis Fuß mit Blut bedeckt.
Panisch tastete ich meinen Körper nach Wunden ab, bis ich erkannte, dass das Blut nicht meins war.
Ich war so geschockt, dass ich beinahe laut losgeschrien hätte. Aber ich biss mir auf die Zunge, bis ich endlich den eisenhaltigen Geschmack meines eigenen Blutes schmecken konnte.
Mein Blick irrte im Zimmer umher. Am Fenster entdeckte ich blutige Handabdrücke. Ich stürzte hinüber. Das Fenster ließ sich öffnen.
Normalerweise waren die Fenster abgeschlossen. Die Institution war kein Gefängnis und es war nicht völlig unmöglich, von hier abzuhauen. Aber die Fenster und Türen waren immer verriegelt und die Pfleger passten auf. Dann erinnerte ich mich an die Reinigungskraft, die gestern in meinem Zimmer gewesen war und unter anderem auch Fenster geputzt hatte. Hatte sie vergessen abzuschließen? Hatte ein Teil meines Unterbewusstseins das mitbekommen – der Teil, der nach Gewalt suchte und sofort die Chance ergriffen hatte?
Ich versuchte nicht darüber nachzudenken, was das bedeutete. Dass dieser aggressive Teil von mir eine gewisse … Intelligenz in sich trug. Entscheidungskraft. Wieso konnte ich nicht hier in der Klinik ausrasten und einem Mitpatienten Gewalt antun? Wieso ausbrechen und irgendwem irgendwo etwas antun, das in so viel Blut resultierte?
Ich fing an zu hyperventilieren, als mir bewusst wurde, dass ich mich überhaupt nicht erinnerte. Es erschien mir nicht mal wie ein vager Traum. Ich wusste nicht, was ich getan hatte.
Alles, was ich wusste, war, dass ich das Blut loswerden musste, um wieder klar denken zu können. Der Geruch, das klebrige Gefühl, die Flecken … ich musste alles loswerden.
Ich torkelte ins Bad und schrubbte meinen Körper, bis meine Haut rot und wund war. Dann beseitigte ich die Flecken auf dem Fußboden und an den Wänden.
Nur die Reste unter den Fingernägeln wollten einfach nicht weggehen – es war nicht sehr hilfreich, dass man Patienten in dieser Klinik natürlich keine Nagelscheren und Feilen erlaubte. Ich stand gerade vor dem Waschbecken im Bad und riss mir vor Verzweiflung beinahe die Nägel von den Fingern, als die Nachtwache ins Zimmer kam.
»Alles klar, Alannah?«
»Ja«, rief ich aus dem Bad. Ich hörte selber, wie meine Stimme zitterte. Mein Blick wanderte zu den blutigen Kleidern und den Handtüchern, die ich zum Saubermachen benutzt hatte, und die auf einem Haufen in der Wanne lagen. »Ich … ich habe geduscht. Ich habe so geschwitzt.«
»Okay.« Wie erstarrt stand ich da, während die Nachtwache einen Moment lang zögerte. Doch dann machte sie die Tür wieder zu. Gut, dass mir die Pfleger vertrauten.
Meine Knie waren so weich, dass ich mich auf die Toilette sinken ließ.
Dann gab ich mir einen Ruck und wusch die blutigen Sachen aus. Sie wurden nicht mehr ganz sauber, aber man konnte nicht mehr erkennen, dass die Flecken vom Blut gekommen waren. Nach und nach ließ ich sie in den folgenden Tagen verschwinden.
Niemand hat je herausgefunden, dass ich in der Nacht aus der Klinik ausgebrochen war.
Ich spielte weiter die Musterpatientin, hatte nur meine Medikamente heimlich nicht mehr genommen, bis ich schließlich entlassen wurde.
Ich weiß bis heute nicht, was ich in der Nacht getan hatte. Meine Nachforschungen ergaben nichts: In den Zeitungen und Polizeiberichten stand nichts von getöteten oder schwer verletzten Menschen oder Tieren. Aber von irgendwem musste das viele Blut stammen. In meinen Albträumen sah ich noch lange danach meinen braun verkrusteten Körper, spürte immer noch das schiere Entsetzen und die Panik.
In meinen Albträumen hatte ich Angst vor mir selbst, vor dem … Tier in mir, das zu so etwas fähig war.
Diese Nacht war ein Wendepunkt für mich gewesen. Ich verstand, dass mir niemand … die Verantwortung abnehmen konnte, für das, was ich tat. Dass mir niemand wirklich helfen konnte.
Ich musste selber dafür sorgen, dass ich niemandem etwas antat.
Ich hatte meine Eltern davon überzeugen können, dass die beste Lösung für mich war, so wenig Kontakt wie möglich mit anderen zu haben und dass ich das Abitur besser per Fernstudium zu Hause machen sollte.
Außer zum stundenlangen Joggen hatte ich das Haus danach selten verlassen – Bewegung war ein Muss, denn Sport war der einzige Weg, mich abzureagieren und meine Wutanfälle in Schach zu halten.
Knapp zwei Jahre lang war alles gut gegangen. Ein paar Mal hatten mich meine Eltern in meinem Zimmer einsperren müssen, wo ich dann die gesamte Inneneinrichtung zerlegte. Aber ich hatte niemandem mehr etwas angetan.
Bis zu der Nacht, in der ich zwei Männer umbrachte.
KAPITEL ZWEI
Meine Mutter kam zweimal am Tag. Sie schaute mittags vorbei, um mir das Mittagessen und Einkäufe durch die Luke zu schieben, die jeweils von einer Seite geschlossen sein musste, um die andere öffnen zu können. Damit ich nicht Mamas Hand packen, sie durch die Luke ziehen und in Stücke reißen konnte.
Nicht, dass ich das je auch nur versuchsweise getan hätte. Aber nach dem, was vor sechs Monaten passiert war, konnten meine Eltern nicht vorsichtig genug sein. Das verstand ich.
Mittags hielt sich meine Mama nicht länger im Keller auf, weil sie auch für meinen Vater und sich gekocht hatte und mein Papa oben wartete.
Mein Vater, ein erfolgreicher Bauunternehmer, hatte mich hier unten nicht mehr besucht, seit er den teuren Käfig für mich fertiggestellt hatte. Es war sozusagen sein letztes Geschenk an mich gewesen, eine letzte väterliche Liebesbezeugung. Aber mehr konnte er für mich nicht tun, hatte meine Mutter gesagt. Es war zu viel für ihn, mich hier unten zu besuchen.
Am Nachmittag kam sie immer um 16 Uhr und nahm sich mehr Zeit für mich. Ich freute mich immer sehr auf das »Kaffeekränzchen« mit Mama, wie ich es nannte. Denn sie brachte für gewöhnlich selbst gebackenen Kuchen mit und wir tranken Kaffee dazu. Dann gingen wir die Schularbeiten durch und besprachen den Plan für den nächsten Tag. Ich war es zwar gewohnt, allein zu sein, aber trotzdem sehnte ich mich natürlich danach, mich mit anderen Menschen auszutauschen. Die halbe Stunde am Nachmittag mit meiner Mama war sozusagen meine einzige Möglichkeit dazu, wenn man mal vom Chatten in Foren absah, aber das war ja nicht ganz dasselbe.
Am heutigen Tage war etwas anders, das spürte ich sofort, als meine Mutter den Keller betrat. Sie schien nervös. Meine Mama war sonst so souverän. Sie war eine praktisch veranlagte Frau, die immer eine Antwort wusste. Meine Ahnung bestätigte sich, als sie eine Tüte vom Bäcker in die Luke steckte. Mama stand Martha Stewart in nichts nach, wenn es um den Haushalt ging. Dass sie Kuchen in der Bäckerei kaufte, statt selber zu backen, kam äußerst selten vor.
Fragend sah ich von der Tüte, die ich mittlerweile in den Händen hielt, durch die Gitterstäbe zu ihr auf.
»Ja, ich hatte keine Zeit zu backen, ich musste mich heute Mittag um etwas kümmern.« Sie fuhr sich zerstreut durch die sonst immer so perfekt sitzenden kurzen Haare. »Setz dich erst einmal.« Sie deutete auf den kleinen Tisch, den ich wie gewohnt an den Rand des Käfigs gezogen hatte, und auf dem schon mein Kaffee parat stand. Ich machte meinen immer selber in meiner kleinen Mini-Küche im Käfig, während Mama ihren von oben auf dem Tablett mitbrachte.
Ich zog einen Stuhl heran und zog ein Puddingteilchen aus der Tüte. Sonst wurde ziemlich penibel darauf geachtet, dass ich nicht zu viel Zucker zu mir nahm. Meine Mutter glaubte, dass sich das negativ auf meine »Schübe« auswirken würde, ein bisschen so, als ob ich ADHS hätte. Ich glaubte nicht, dass es da einen Zusammenhang gab, war aber gewillt, alles zu versuchen.
Das Gebäckstück lachte mich an – wenn ich’s mir recht überlegte, hatte ich seit sechs Monaten nur Mamas gesunden, zuckerfreien Vollkornkuchen gegessen. Beherzt biss ich hinein. Während ich kaute, sah ich meine Mutter an ihrem Puddingteil herumzupfen.
Sie saß mir gegenüber auf der anderen Seite der Gitterstäbe, wo ein identischer kleiner Beistelltisch stand, und ihre Hände zitterten so sehr, dass sie Kaffee verschüttete, als sie die Tasse zum Mund führte.
Das leckere Gebäckstück blieb mir fast im Hals stecken. So hatte ich meine Mutter selten erlebt. Irgendetwas stimmte überhaupt nicht.
Ich nahm selber einen Schluck Kaffee, um den Kuchen herunterzuspülen, und fragte leise: »Was ist los, Mama?«
Vorsichtig stellte sie ihre Tasse wieder ab. Dann schaute sie mich an.
»Ich habe jemanden gefunden, der dir vielleicht helfen könnte, Alannah.«
Ich sagte nichts, sondern starrte sie nur weiter erwartungsvoll an. Diese Nachricht war nichts, was mich vom Hocker haute. Meine Mutter wurde es nicht müde, nach einer Heilmethode für meine Krankheit zu suchen. Und auch ich recherchierte häufig und besprach meine Ergebnisse mit ihr. Wir hatten schon öfter gedacht, einen Lösungsansatz gefunden zu haben, der immer in einer Sackgasse geendet war.
»Ein Arzt, der sich auf dein Problem spezialisiert hat. Ich habe fast den ganzen Mittag mit ihm telefoniert und alles von dir erzählt. Er möchte dir sehr gerne einen Therapieplatz anbieten.«
»Okay«, antwortete ich. Es war mir nicht ganz klar, wieso meine Mutter diese Nachricht nicht mit ihrem gewöhnlichen, beschwingten Optimismus überbrachte. Warum war sie so nervös?
Ich ließ mir ihre Worte noch einmal durch den Kopf gehen. »Er hat sich auf mein Problem … spezialisiert? Wir wissen doch gar nicht genau, was mein Problem ist.« Der Bissen Gebäck in meinem Magen fing an, sich wie ein großer, harter Stein anzufühlen. Mir schwante, was genau meine Mutter dem Arzt erzählt haben könnte. Alles erzählt … Ich schluckte. »Mama, du hast doch nicht … Du hast doch nicht von der Sache berichtet, oder?«
Ich konnte meiner Mutter nicht ins Gesicht sehen, sondern starrte auf die Tischplatte und schob ein paar Krümel darauf hin und her.
»Doch, das habe ich. Er hat gespürt, dass da etwas war, das mich sehr beunruhigt hat und er hat mich schließlich davon überzeugt, ihm die Wahrheit zu sagen. Was du getan hast.«
Ich erstarrte.
»Wir mussten es irgendwann jemandem erzählen, wenn wir Hilfe in Anspruch nehmen wollen.« Meine Mutter klang jetzt wieder resoluter und selbstbewusster. »Und du musst dir keine Sorgen machen. Es gibt schließlich die ärztliche Schweigepflicht.«
Ich zog die Brauen zusammen und schaute vorsichtig unter meinem Pony zu ihr hoch. »Stimmt das? Du hast ja nur mit ihm telefoniert und ich bin nicht … offiziell seine Patientin, also …«
»Doch, das bist du. Wir haben die Papiere schon unterschrieben. Seine Klinik hat alles gefaxt und wir haben es soeben unterschrieben zurückgefaxt.«
Ich schaute meine Mutter mit offenem Mund an. »Ohne es mit mir zu besprechen?«, fand ich schließlich meine Sprache wieder. »Was ist das denn überhaupt für ein Arzt? Ich bin immerhin fast volljährig, ich sollte selber darüber entscheiden können … Oder wenigstens gefragt werden …« Ich brach ab. Tränen standen in meinen Augen und ich wischte sie eilig weg, bevor sie über meine Wangen kullern konnten.
Tief ein und wieder aus. Tief ein und wieder aus. So sagte ich mir still mein Mantra auf. Meine Atemübungen sollten mich davon abhalten, zu emotional zu werden.
»Ich glaube, dass diese Klinik das Richtige ist für dich, Alannah. Wir … wir wissen nicht, was wir sonst mit dir machen sollen. Dieser …«, sie zeigte auf meinen Käfig, »… Raum kann doch kein Dauerzustand werden. Wir müssen etwas tun. Auch wenn es uns schwergefallen ist, und wenn es uns noch schwerer fallen wird, dich gehen zu lassen …«
»Gehen zu lassen?«, unterbrach ich sie verwirrt. »Wo … wo ist denn diese Klinik?«
»Tja. Das ist die Sache.« Sie trank schnell noch einen Schluck Kaffee, um ihren Gesichtsausdruck zu verbergen, und ich wusste jetzt, warum sie so nervös gewesen war. »Die Klinik ist ein bisschen weiter weg. Und wir können erst einmal keinen Kontakt haben.«
»Wo ist sie? Wo wollt ihr mich hinschicken?«
»Auf eine abgelegene Shetland-Insel.«
»Shetland? Das ist … vor der schottischen Küste, richtig?« Verwirrt legte ich die Stirn in Falten. »Ich soll in eine Klinik nach Schottland? Geht das überhaupt? Bezahlt das die Krankenkasse?«
Meine Mutter atmete tief durch. »Die Shetland-Inseln gehören zu Schottland und liegen zwischen Schottland und Norwegen. Und … ähm. Es ist eine Privatklinik.«
»Das kostet doch bestimmt ein Vermögen?«
»Eigentlich nicht. Dr. Isbister entwickelt gerade eine neue Therapie und nimmt deshalb einige Jugendliche mit demselben Krankheitsbild, wie du es hast, in ein Programm auf, um diese therapeutischen Maßnahmen auszutesten.«
Ich blinzelte. »Ich soll ein medizinisches Versuchsobjekt werden?«
»Nein, so kann man das nicht nennen.« Mama fuhr sich wieder durch die Haare. »Es ist einfach eine Chance für dich, Alannah. Dr. Isbister ist überzeugt davon, dir helfen zu können. Was für andere Optionen haben wir?«
Ich atmete langsam aus.
Meine Mutter hatte recht. Unseren Recherchen zufolge gab es für das, was ich durchmachte, bisher keine Therapie. Auch wenn mich das Gefühl, ein Versuchskaninchen zu sein, nicht loslassen wollte, musste mein Verstand zustimmen: Ich sollte alles versuchen, und wenn dieser Dr. Isbister glaubte, mir helfen zu können, wieso der Sache nicht eine Chance geben?
»Okay, versuchen wir es«, sagte ich. »Wenn es mir nichts bringt, dann kann ich ja immer noch abbrechen und wieder nach Hause kommen.«
»Vorerst nicht.« Mama stand schnell auf. »Wir haben erst einmal keinen Kontakt, wie gesagt, und wir haben zugesagt, dass du sechs Monate im Programm bleibst. Es ist ein langfristiger Lösungsansatz …«
Ich riss die Augen auf. »Sechs Monate?«, fiel ich ihr ins Wort. »Und ich kann nicht nach Hause, wenn ich das Gefühl habe, es bringt nichts oder alles noch schlimmer macht?«
»Wenn es tatsächlich gar nicht anschlägt oder schlimmer wird, dann wird der Doktor sicher Vernunft walten lassen und die Versuchsreihe abbrechen«, beschwichtigte meine Mutter mich. »Es ist ja kein Gefängnis, sondern eine Klinik.«
Ihre Worte sollten mich beruhigen, aber ich konnte mein schneller schlagendes Herz einfach nicht wieder in den Griff bekommen.
Panisch stand ich auf. »Ich muss jetzt ein bisschen Sport machen, Mama.«
Meine Mutter nickte und war schon fast auf der Treppe. Sie wusste, was meine Worte bedeuteten.
Ich stand auf meinem Laufband, als sie sich noch mal umdrehte.
»Alannah, wenn nur die geringste Chance besteht, dass der Arzt dir helfen kann, müssen wir sie ergreifen. So etwas wie in Hamburg… Das darf nicht noch mal passieren.«
Ich biss mir auf die Lippen. Ich musste nicht antworten. Meine Mutter wartete auch nicht darauf, sondern verließ den Keller.
Ich machte das Laufband an und rannte, als wenn der Teufel hinter mir her wäre. Nur konnte ich das Gefühl nicht loswerden, dass ich ihn nicht abschütteln würde, so schnell ich auch lief.
KAPITEL DREI
Als meine Mutter am nächsten Nachmittag kam, war ich um einiges gefasster. Ich hatte die letzten vierundzwanzig Stunden über nichts anderes nachgedacht als über meine Situation.
Es gefiel mir nicht, dass meine Eltern über meinen Kopf hinweg entschieden hatten, aber ich konnte es ihnen nicht verübeln. Ich konnte froh sein, dass sie bisher überhaupt hinter mir gestanden hatten – statt mich den Behörden zu überlassen.
Vor sechs Monaten hatte ich meine Cousine Lynn in Hamburg besucht. Wir wohnten in einem Vorort und ich unternahm eigentlich solche Ausflüge in die Stadt schon lange nicht mehr. Aber ich hatte mich besonders isoliert und einsam gefühlt und als Lynns Einladung für ihre Buchvernissage kam, wollte ich ihr nicht absagen.
Lynn hatte einen erfolgreichen Gesundheitsblog und gerade ihr erstes Buch veröffentlicht. Ich besprach es lange mit meinen Eltern, und schließlich stimmten sie mir zu, dass nicht viel passieren konnte, wenn meine Eltern mich zur Vernissage fuhren. Sie konnten nicht bleiben, weil sie für den Abend selber etwas abgemacht hatten. Ich überzeugte meine Eltern davon, dass ich allein klarkommen und mit dem Taxi heimfahren würde, sodass sie ihre Pläne nicht ändern mussten. Es war schließlich nicht zu erwarten, dass mich in dem Reformhaus, in dem die Buchpräsentation stattfand, und mit den Leuten, die zu einer solchen Veranstaltung kamen, etwas zu aggressiven Handlungen provozieren würde.
Es lief auch alles gut, bis Lynn mich nach der Vernissage fragte, ob wir noch etwas trinken gehen wollten. Sie hatte sich so gefreut, mich zu sehen. Ich konnte es nicht übers Herz bringen, Nein zu sagen. Ein Getränk, das würde ich ja wohl hinbekommen.
Wir wollten eine trendige Bar besuchen, von der Lynn gehört hatte und die in der Nähe des Reformhauses sein sollte. Leider stellte sich heraus, dass sie doch einige Straßen weiter war. »Wir hätten fahren sollen«, meinte ich.
»Ach was, so ein Abendspaziergang ist doch nett.« Lynn hakte sich bei mir ein. Ich ließ mich von ihrer unbekümmerten Art anstecken. Sie hatte ja recht. Vielleicht übertrieb ich völlig mit meiner Isolation. Womöglich stand es gar nicht so schlimm um mich. Dass ich mir solche Erlebnisse, die ein anderes Mädchen in meinem Alter als völlig normal empfinden würde, selber versagte, war vielleicht nicht nur schade, sondern auch unnötig. Ich hatte auch Freunde verdient!
Schließlich fanden wir die Bar. Weil ich minderjährig war, hatte ich eine gute Ausrede, bei alkoholfreien Getränken zu bleiben. Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, was Alkohol für einen Effekt haben würde. Aber alles, was mir die Kontrolle über mich selbst entzog, war wahrscheinlich eine schlechte Idee.
Die Bar war gemütlich, mit warmem Licht, Ledersofas und angenehmer Musik, sodass nichts mir Stress verursachte. Ich begann mich in der trügerischen Sicherheit zu wiegen, dass alles okay war.
Obwohl Lynn ein paar Jahre älter war, hatten wir als Kinder oft zusammen gespielt, und wir verloren uns in nostalgischen Kindheitserinnerungen. Dabei vergaßen wir ganz die Zeit.
Als ich auf die Uhr schaute, stellte ich erschrocken fest, wie spät es schon war. Meine Eltern waren bestimmt längst wieder zu Hause und würden sich Sorgen machen.
Wir verließen die Bar und gingen durch die mittlerweile dunklen Straßen. »Ich muss mich echt beeilen«, sagte ich zu Lynn. »Meine Eltern machen mir die Hölle heiß.«
Meine Cousine rollte mit den Augen. »Ich finde, deine Eltern übertreiben es echt. Es ist ja nicht so, als ob wir bis drei Uhr morgens durch die Clubs ziehen würden. Und selbst wenn. Du bist alt genug.«
»Du verstehst das nicht. Ich habe … ihnen genug Anlass zur Sorge gegeben.«
»Nur weil du früher mal ein paar Probleme in der Schule hattest? In der Pubertät spinnt doch jeder mal ein bisschen. Und das ist ja auch schon ewig her.«
Ich korrigierte sie nicht. Meine Eltern hatten meine Aggressionsprobleme immer für sich behalten und mir eingebläut, niemandem davon zu erzählen. Weder Lynn noch andere Familienmitglieder oder Freunde wussten davon, noch nicht mal von meinem Klinikaufenthalt.
Keine Ahnung, warum es meinen Eltern so wichtig war. Ich hatte immer angenommen, sie schämten sich. Mittlerweile glaubte ich, es steckte mehr dahinter, auch wenn ich nicht wusste, was. Bevor ich in die Klinik gekommen war, hatte ich ein Gespräch meiner Eltern belauscht.
Es war darum gegangen, ob man meiner Patentante von meinen Problemen berichten sollte. Ich hatte Tante Alannah, nach der ich benannt worden war, schon länger nicht mehr gesehen. Sie lebte in Schottland und war eine Freundin meiner Mutter, die Englisch auf Lehramt studiert und ihr Auslandsjahr in Glasgow gemacht hatte. Dort hatte sie sich mit Lannie, wie alle meine Patentante nannten, eine Wohnung geteilt.
Ich konnte mich gut erinnern, dass Tante Lannie uns öfter besucht hatte, als ich kleiner war, aber mit der Zeit war der Kontakt weniger geworden.
Bei dem belauschten Gespräch hatte mein Vater aber aus irgendeinem Grund insistiert, dass Tante Lannie unbedingt von meiner »Verfassung« erfahren musste.
Meine Mutter war strikt dagegen. »Du weißt, was dann passiert. Man wird sie uns wegnehmen.« Offensichtlich glaubte meine Mutter, dass Tante Lannie sich beim Jugendamt dafür einsetzen würde, dass man mich … was, in eine Klinik steckte? Warum sollte sie das tun? Und warum schien meine Mutter tatsächlich Angst davor zu haben, dass ich ihnen weggenommen werden würde? Mir wäre nie in den Sinn gekommen, dass man meine Eltern für mein Verhalten verantwortlich machen oder irgendwie bestrafen könnte … Ich wurde in meinen Gedanken unterbrochen, als mein Vater etwas Schockierendes sagte. »Vielleicht ist es für sie das Beste.«
»Wie kannst du so etwas sagen, Michael!«
»Sie hat genau die Symptome, vor denen man uns gewarnt hatte und auf die wir achten sollten. Die Bedingungen waren, dass wir sie kontaktieren, sobald Alannah dieses Verhalten zeigt. Hast du schon darüber nachgedacht, dass sie ihr womöglich helfen können?«
Meine Mutter schluchzte. Ich hatte sie noch nie so außer Fassung erlebt. »Mach dir doch nichts vor, Michael. Das ist nicht der Grund, warum wir von ihrem aggressiven Verhalten berichten sollten. Es würde ihnen nur bestätigen, dass Alannah ein hoffnungsloser Fall ist. Dass die Resozialisierung gescheitert ist. Du glaubst, die können ihre letzte Rettung sein?« Mama versuchte offensichtlich, nicht laut zu werden, und so kamen die Worte heiser und heftig heraus. »Wir waren ihre letzte Rettung. Es liegt an uns, dass sie kein hoffnungsloser Fall ist. Wenn sie davon erfahren … ich gebe sie nicht wieder her.« Meine Mutter weinte jetzt und mein Vater sagte nichts. Dann hörte ich ihn tröstende Worte murmeln. Ich nahm an, er hatte meine Mama in den Arm genommen.
»Du hast recht«, sagte er schließlich. Er hörte sich so traurig an. »Wir geben sie nicht wieder her. Wir ziehen das durch. Wir sind eine Familie, komme, was wolle. Und wir sagen niemandem etwas davon.«
Ich war völlig verwirrt wegen dem, was meine Eltern besprochen hatten. Es hörte sich so an, als ob jemand erwartet hätte, dass ich mich aggressiv verhalte und dass meine Eltern diesem Jemand einen Bericht schuldig waren. Tante Lannie hatte wohl etwas damit zu tun. Und was sollte das überhaupt heißen, Resozialisierung? Auch wenn ich nicht genau verstand, was sie da redeten, tat es mir in der Seele weh, dass sie von mir als hoffnungslosem Fall sprachen. Jemand, für den die letzte Rettung schon zu spät war. Stand es denn so schlimm um mich? War etwas so Schlechtes in mir, dass meine Eltern darüber stritten, ob sie mich an was oder wen auch immer weggeben sollten?
Mehrere Male war ich kurz davor, sie auf das anzusprechen, was ich mitangehört hatte. Aber ich hatte zu viel Angst vor ihren Antworten. Ich konnte gar nicht darüber nachdenken, was die sonderbaren Anspielungen bedeuteten, die sie gemacht hatten, zu sehr war ich beschäftigt mit den Selbstzweifeln, die wie ein hässlicher Tumor in meinem Inneren wucherten.
Nicht lange danach hatte ich den Suizidversuch unternommen, der mich auf die Akutstation der psychiatrischen Klinik brachte.
Und seitdem lebte ich mit der Angst, dass meine Eltern sich umentscheiden würden. Dass sie mich doch aufgeben würden, was immer das bedeutete.
Wenn ich jetzt länger wegblieb als verabredet, dann … Panik machte sich in meinem Inneren breit.
»Meine Eltern sind bestimmt schon daheim und machen sich Sorgen …«, murmelte ich.
»Okay, okay, ich glaube, ich kenne eine Abkürzung, dann sind wir gleich beim Parkplatz hinter dem Reformhaus, wo mein Auto steht. Ruf doch deine Eltern einfach an und sag, die Vernissage hat länger gedauert.«
»Gute Idee, vielleicht können sie mich abholen«, sagte ich erleichtert. Ich zog das Handy aus der Tasche, während ich Lynn in eine dunkle Gasse folgte. Auf einer Seite gab es eine bröckelige Mauer, die andere Seite grenzte an die fensterlosen Rückseiten von Geschäften. Es roch übel und eine einzige Straßenlampe flackerte im Sekundentakt und ging an und wieder aus. Man konnte gar nicht das andere Ende der Gasse sehen. »Bist du sicher, dass man hier entlanggehen kann?«, fragte ich skeptisch.
»Ziemlich sicher«, antwortete Lynn. »Wir sollten eigentlich direkt hinter dem Reformhaus rauskommen. Sonst drehen wir einfach um.« Sie ging einen Schritt schneller, wahrscheinlich, um rasch festzustellen, ob es sich nicht doch um eine Sackgasse handelte.
Ich war damit beschäftigt, das Handy zu bedienen und die eingespeicherte Nummer meiner Eltern zu finden. Als ich mit dem Telefon am Ohr wieder aufschaute, war Lynn weit vor mir. Sie verschwand gerade im dunklen Schatten einer Biegung. Ich beschleunigte meine Schritte, um zu ihr aufzuschließen.
Nach nur einmal Klingeln nahm meine Mutter schon ab. »Wo bist du?«, fragte sie ohne Begrüßung.
»Sorry, es ging etwas länger …«
Die Umrisse dreier Personen tauchten vor mir auf. Eine davon musste Lynn sein. Ihre blonden Haare wirkten wie ein heller Fleck im Dunkeln. Wer waren die anderen zwei?
Erschrocken blieb ich stehen. Eine der Gestalten – der Größe nach zu urteilen waren es Männer – drängte sich an Lynn. Niemand machte ein Geräusch.
»Alannah? Alannah? Bist du da?«, fragte meine Mutter.
Ich machte zwei vorsichtige Schritte. Die beiden Männer schienen so fixiert auf Lynn zu sein, dass sie mich noch nicht bemerkt hatten.
»Alannah, wo bist du?«, rief meine Mama frustriert.
»In einer Gasse hinter dem Parkplatz des Reformhauses«, sagte ich schnell, ohne nachzudenken. »Lynn wird von zwei Männern angegriffen. Ich muss gehen.«
Die Männer hatten meine Stimme gehört und drehten sich zu mir um. Aber ich rannte schon auf sie zu.
Als ich näher kam, konnte ich sehen, dass der eine Mann eine behandschuhte Hand auf Lynns Mund gelegt hatte. Deshalb hatte sie nicht um Hilfe schreien können.
Die Klinge des Messers, das er an Lynns Kehle hielt, blitzte auf. Ich konnte das Weiße in Lynns Augen sehen, als sie mir den Kopf zuwandte. Der Mann hatte ihr schon die Hose heruntergerissen.
Der andere Mann machte sich bereit, sich auf mich zu stürzen.
Ich wusste, was passieren würde, aber zum ersten Mal in meinem Leben war kein Teil in mir, der mich zurückhalten wollte. Der Angst vor mir selber hatte. Denn ich würde nicht zulassen, dass diese Männer Lynn das Unsägliche antaten, was sie vorhatten.
Als ich rotsah, war ich nicht blind vor Wut, wie sonst. Nein, es war, als ob ich durch den roten Filter alles viel schärfer wahrnahm.
Ich flog durch die Luft auf den Mann zu, der mich abfangen wollte. Ich war so leicht und agil und gleichzeitig schwer und voller Kraft. Ich riss den Mann einfach um. Es schien, als ob ich jede Bewegung seiner Muskeln unter den schwarzen Klamotten sehen und damit jede seiner Aktionen schon im Voraus erahnen konnte. Ich blockte alle Schläge ab. Es war wie ein wunderschöner Tanz. Mein Körper reagierte ganz automatisch, wie konditioniert. Es dauerte nicht lange, bis der Mann leblos am Boden lag.
Sofort wandte ich mich dem anderen Angreifer zu, der von Lynn abgelassen hatte und nun das Messer abwehrend hochhielt. Ich schlug es ihm mühelos aus der Hand und hatte auch ihn innerhalb kürzester Zeit außer Gefecht gesetzt.
Als alles vorüber war, wandte ich mich Lynn zu, die gegen die Wand gepresst stand und deren Atem stoßweise ging.
Ihre Augen waren vor Entsetzen geweitet.
»Es ist alles gut«, sagte ich, als ich wieder sprechen konnte, als ich … wieder ich war. »Sie können dir nichts mehr tun.« Ich ging auf Lynn zu, aber die Panik in ihren Augen wuchs. Ich verstand, dass sie vor mir Angst hatte und blieb abrupt stehen.
»D… d… du hast sie umgebracht«, stotterte Lynn. »Wie hast du … wie kannst du …«
»Nein, sie sind nur bewusstlos, ich habe sie nur bekämpft. Komm, wir sollten schnell hier weg.« Ich wollte Lynns Hand nehmen, aber sie zuckte zurück. Ein Geräusch am Rande meiner Wahrnehmung wurde lauter. Ein Klingeln. Mein Handy.
»Guck sie dir an, Alannah«, keuchte Lynn. »Du hast sie … zerfleischt.«
Meine Cousine musste wirklich sehr traumatisiert sein. Ich zog das Handy aus der Tasche. Meine Eltern. »Alannah?«
»Uns ist was passiert, Lynn wurde angegriffen. Ich habe sie beschützen können, aber sie ist ganz verschreckt und wir müssen hier weg, bevor die …«
Ich drehte mich um und mein Blick fiel auf die Männer. Die Stimme blieb mir im Hals stecken. Bei dem einen Mann standen die Gliedmaßen in unnatürlichen Winkeln in alle möglichen Richtungen vom Körper ab. Sein Gesicht war bis zur Unkenntlichkeit zerschlagen worden. Es war ein einziger Mansch aus Blut, Fleisch und zertrümmerten Knochen.
So schrecklich dieser Anblick war – der andere Mann, der mit dem Messer, sah schlimmer aus. Er lag körperlich relativ unversehrt in einer Lache aus Blut. Blut strömte immer noch aus der Wunde am Hals, wo ein großes Stück einfach herausgerissen worden war.
Die Stimme meiner Mutter drang dumpf zu mir durch, als ich die Hand zu meinem Mund hob. »Wir sind sofort losgefahren. Wir sind auf dem Weg zu dir. Bleib, wo du bist, wir kommen dich holen.«
Meine Finger berührten meine klebrigen Lippen. Plötzlich konnte ich den metallenen Geschmack des Blutes in meinem Mund spüren.
Mir wurde schlecht.
»Mami, kommt schnell. Ich habe etwas Schreckliches getan«, brachte ich noch hervor, bevor ich mich übergeben musste.
Meine Eltern waren fast zur gleichen Zeit da wie Lynns Vater, den sie von unterwegs benachrichtigt hatten.
Lynn beharrte später darauf, dass ich die Männer umgebracht hatte, aber ihr Vater glaubte mir, als ich behauptete, meine Cousine müsse sehr traumatisiert sein. Ein dritter Mann sei beteiligt gewesen, der getürmt war. Ich war ganz offensichtlich physisch nicht in der Lage, zwei große starke Männer so zuzurichten.
Aber bei meinen »Jugendsünden«, wie mein Vater sie seinem Bruder gegenüber nannte, und dann noch Lynns Aussage … bestand durchaus die Gefahr, dass man mir irgendetwas anhängen würde.
Man einigte sich darauf, dass es besser war, wenn ich offiziell nichts mit der Sache zu tun hatte.
Nach einer Weile ließ Lynns Hysterie nach und sie war mehr in sich gekehrt. Am Ende stimmte sie zu. »Du hast mich gerettet«, sagte sie nur, sah mich aber nicht mehr an.
Meine Eltern hatten mir gar nicht mehr erzählt, wie die ganze Sache weiter verlaufen war, was genau der Polizei berichtet wurde und wie es ausging. Sie hatten mich nach Hause gebracht und in mein Zimmer eingeschlossen, bis der Käfig fertig war.
Dann war ich freiwillig dort hineingegangen. Ich hatte mich nie gewehrt. Ich hatte mich glücklich geschätzt, dass meine Eltern sich nicht von mir abwandten, dass sie anderen nichts von meinen Taten erzählten. Auch wenn mein Vater nicht mehr mit mir sprach, so hatte er mich doch nicht ganz aufgegeben – obwohl er es durchaus hätte tun können.
Als meine Mutter jetzt wieder vor mir saß, mit Kaffee und selbst gebackenem Kuchen, sagte ich ihr, dass ich mit ihrem Plan einverstanden war. Schließlich wusste ich eines: Meine Mutter wollte mich nicht hergeben. Sie würde für mich kämpfen. Und wenn ich deshalb für einen überschaubaren Zeitraum in eine Klinik musste, dann würde ich das tun. Ich würde alles tun, solange meine Familie hinter mir stand. Sie war das Einzige, was ich hatte.
Meine Mutter wirkte sehr erleichtert. »Gut«, sagte sie. »Ich habe schon alles arrangiert. Wir bringen dich zum Flughafen und ich werde mit dir nach Aberdeen fliegen. Dort wirst du von Tante Lannie abgeholt und ich fliege gleich wieder retour. Tante Lannie bringt dich zur Klinik.«
»Tante Lannie?« Auf einmal wurde alles um mich herum sehr unscharf. Meine Hand zitterte und ich versuchte, meine Kaffeetasse abzusetzen, ohne dass sie überschwappte. Es gelang mir nicht.
»Warum bringst du mich nicht bis zur Klinik? Wieso Tante Lannie?«
»Sie hat mir von der Klinik und von dem Programm erzählt. Es war ihre Idee.«
Ich zwang mich, meine Mutter direkt anzuschauen, doch sie wich meinem Blick nervös aus.
»Dann … habt ihr Tante Lannie von meinem … Problem erzählt?« Ich musste die Worte regelrecht aus dem Hals würgen.
»Ja«, sagte Mama leise. »Das haben wir. Wir mussten uns jemandem anvertrauen. Wir dachten, dass sie uns mit ihren Verbindungen helfen kann.«
Der Keller wurde trotz der grellen Neonröhren auf einmal etwas dunkler.
»Okay«, flüsterte ich nur, aber in meinem Inneren zerriss etwas.
Die Klinik, wo ich hin sollte, das waren »die«. »Die«, an die meine Eltern mich hergeben würden, wo ich hingebracht werden sollte, wenn ich ein hoffnungsloser Fall war.
Was auch immer dort mit mir passieren würde, sie erwarteten nicht, dass ich zu ihnen zurückkehrte.
Meine Eltern hatten mich aufgegeben.
KAPITEL VIER
In Aberdeen begegnete ich Tante Lannie mit gemischten Gefühlen. Ich hatte sie immer gern gemocht, so wie man seine Patentante eben ein kleines bisschen extra gern hatte. Auch weil wir denselben Namen trugen, fühlte ich mich mit ihr verbunden. Dass sie selten zu Besuch kam und in Schottland wohnte, machte sie noch faszinierender. Als Kind hatte ich mir vorgestellt, dass ich sie in ihrer Heimat besuche oder gar bei ihr wohne.
Die Beziehung mit ihr entglitt mir auf die gleiche Art und Weise wie meine Kinderfreundschaften, nachdem ich die Pubertät erreicht hatte, »meine Probleme« immer schlimmer wurden und ich mich mehr und mehr abkapselte. An Geburtstagen hatte ich immer ein Geschenk und eine Karte mit ein paar lieben Zeilen erhalten, aber zu Besuch war sie schon seit Jahren nicht mehr gekommen.
Unter anderen Umständen hätte ich mich tierisch über das Wiedersehen gefreut und wäre meiner Patentante sicher freudig in die Arme gefallen.
Aber die Begrüßung war verhalten. Tante Lannie sah so aus wie immer, aber auch irgendwie ganz anders. Es war, als ob ich sie zum ersten Mal richtig sehen würde; nicht mit Kinder-, sondern mit Erwachsenenaugen. Früher hatten mir die roten Locken Lebenslust und die glitzernden Augen Abenteuer signalisiert. Heute wirkten ihre Haare wild und chaotisch, und irgendwo in den Tiefen ihres ausweichenden Blickes war ein gefährliches, dunkles Geheimnis verborgen.
Ihre Finger fühlten sich kalt an, als sie mich umarmte. Die Wärme, die ich immer mit ihr verbunden hatte, war wie ausgelöscht.
Tante Lannie lächelte: »So schön, dich zu sehen.« Sie sprach wie immer Englisch mit mir und hörte sich an wie früher.
Vielleicht lag es gar nicht an Tante Lannie. Ich wusste ja noch nicht mal, wie sie in die Sache verwickelt war … in was sie involviert war. Ich hatte keine Ahnung, was mit mir passieren würde. Nur konnte ich das Gefühl nicht loswerden, dass es etwas Schlimmes war. Dass ich hier von meiner Mutter abgeliefert wurde … nein, an Tante Lannie ausgeliefert wurde.
Ich drehte mich zu ihr um. »Mama …«
Meine Mutter nahm mich in die Arme.
»Komm doch mit, Mama«, flüsterte ich. »Du kannst mich doch bis zur Klinik bringen.«
»Jetzt haben wir es so abgemacht, es ist einfacher so …«, erwiderte sie mit brüchiger Stimme.
Einfacher vielleicht für sie, dachte ich verzweifelt.
»Halt dich daran fest, dass dir endlich geholfen wird«, fuhr meine Mutter fort. »Und bald kommst du ganz gesund wieder zu uns zurück.«
Ich löste mich von ihr und zwang mich, ihr in die Augen zu sehen. »Wirklich? Glaubst du daran? Dass ich bald wieder heimkomme?«
»Ja!« Aber sie schaute weg und hatte Tränen in den Augen.
Ich nickte nur. Dann gab ich ihr einen Kuss auf die Wange.
»Tschüss, Mama.«
Dann ging ich mit Tante Lannie, ohne noch einmal zurückzuschauen.
Tante Lannie machte Smalltalk, aber ich antwortete nur einsilbig. Wir gingen an Bord einer kleinen Maschine, die uns nach Sumburgh auf Shetland brachte. Im Flieger machte ich die Augen zu und tat, als ob ich schlafen würde.
Bei unserer Ankunft war es grau und regnerisch. »Typisches Shetland-Wetter«, stellte Tante Lannie mit einem etwas zu angestrengt fröhlichen Grinsen fest.
Na toll. An einen deprimierenderen Ort hätte man mich wohl nicht bringen können.
Es kam noch schlimmer. Ich erfuhr, dass wir unser Reiseziel noch gar nicht erreicht hatten. Die Klinik, so erklärte mir Tante Lannie, befand sich nicht auf der Hauptinsel, sondern auf einer ganz kleinen Insel namens South Havra.
Ich spürte Panik in mir aufsteigen. »Wie klein ist die Insel?«
»Etwas mehr als einen halben Quadratkilometer groß.«
»Da gibt es nur diese … Klinik?«
»Genau, die Hevera-Klinik.«
Oh Gott, ich würde völlig abgeschieden von der Welt sein. Sie konnten dort mit mir anstellen, was sie wollten … Warum und wie war mir immer noch nicht klar, aber dass ich meine Angst verstandesmäßig nicht völlig erfassen und die Gefahr überhaupt nicht einschätzen konnte, machte es noch entmutigender.
Bis zu dem Zeitpunkt hatte ich wenig an mich herangelassen und auch entsprechend wenige Fragen gestellt. Das lag einerseits daran, dass ich mich hilflos und meinem Schicksal ausgeliefert fühlte, aber auch daran, dass es mir besser ging, wenn ich mich sozusagen innerlich betäubte. Ich regte mich nicht auf und die Gefahr, dass ich ausrastete, war geringer.
Aber jetzt sprudelten die Fragen nur so aus mir heraus. Auf einmal hatte ich das Bedürfnis, so viel wie möglich darüber zu erfahren, was mit mir passieren würde, bevor … bevor … es zu spät war. So fühlte es sich an. Wie der lange Gang zur Guillotine.
Während wir im Flughafengebäude auf den Helikopter warteten, der uns abholen und zur Insel bringen würde, tigerte ich vor der Sitzreihe auf und ab und fragte Tante Lannie aus. Sie erklärte mir ganz ruhig, dass alle Patienten Jugendliche in meinem Alter waren, dass knapp vierzig Patienten, die von überall auf der Welt kamen, in der Klinik behandelt wurden.
»Wieso fliegen wir mit einem Helikopter? Kann man da nicht mit dem Boot hinfahren?«
»Doch, jeden Tag fährt ein Boot zur Insel mit Lebensmitteln und so weiter. Aber das haben wir schon verpasst. Außerdem werden die Patienten meist mit dem Heli gebracht.«
»Wer zahlt das? Meine Eltern?«
»Die Klinik.«
Wieso würde die Klinik so viel Geld für mich ausgeben?
Lannie zog die Brauen zusammen. »Setz dich doch mal. Geht es dir gut?« Es war die erste Anspielung auf meine »Krankheit«.
Ich blieb stehen und sah sie direkt an. »Ich bekomme keinen Wutanfall, wenn du das meinst. Ich will nur genau wissen, wohin man mich verfrachtet.« Die Worte kamen heftiger heraus, als ich beabsichtigt hatte.
»Ich hol dir heißes Wasser. Ich habe einen Tee dabei, der dir helfen wird, dich etwas zu beruhigen …«
Tante Lannie stand auf und ging zum Heißgetränkeautomaten. Kurz darauf kam sie mit einem Pappbecher dampfender Flüssigkeit zurück und kramte mit einer Hand in ihrer Tasche nach einem Teebeutel, den sie dann ins Wasser tauchte. Sie reichte mir den Becher und setzte sich.
Ich beobachtete sie. Dann stellte ich die Frage, vor deren Antwort ich mich so fürchtete.
»Tante Lannie, was hast du mit dieser Klinik zu tun? Woher weißt du davon?«
»Ach, ich bin mit Dr. Isbister bekannt. Ich habe früher für ihn gearbeitet.« Ihr Lächeln wirkte bemüht.
»Ist das der Grund, warum meine Mutter meinte, sie hätte dir schon früher von meiner … Krankheit erzählen sollen?« Ich musste ja nicht erwähnen, dass meine Eltern so etwas nicht direkt zu mir gesagt hatten.
»Genau«, meinte Lannie.
»Aber warum denn nicht?« Ich setzte mich neben sie.
»Wie meinst du das?«
»Warum hat meine Mutter nicht früher etwas zu dir gesagt? Wenn sie doch wusste, dass du mir helfen könntest? Wenn diese Klinik so toll und die Therapie so vielversprechend ist? Wieso haben meine Eltern so lange gewartet?«
»Ich weiß nicht, vielleicht wollten sie nicht wahrhaben …«
Ich schüttelte wild den Kopf. »Nein. Wir haben verzweifelt nach Hilfe gesucht«, unterbrach ich sie. »Es kommt mir eher so vor, als ob sie alles tun wollten, damit es nicht hierzu kommt. Als ob sie verhindern wollten, es dir zu sagen, damit ich nicht hierherkommen muss. Warum? Was erwartet mich in dieser Klinik?«
Nachdem ich die Worte ausgesprochen hatte, vor denen ich mich so gefürchtet hatte, trank ich einen Schluck Tee. Er war noch viel zu heiß. Sich die Zunge zu verbrennen war schmerzhaft, aber irgendwie tat mir das Gefühl gerade gut. Ich nahm noch einen großen Schluck.
»Ich wünschte mir auch, dass deine Eltern es nicht so lange vor mir verheimlicht hätten«, seufzte Tante Lannie. »Glaub mir. Es wäre besser für dich gewesen, wenn du früher in die Hevera-Klinik gekommen wärst. Aber …«, sie sah mich traurig an, »ich kann sie auch verstehen. Sie wollten dich bei sich behalten, wollten selber für dich sorgen.« Tante Lannie legte eine Hand auf meinen Arm. »Du warst immer etwas Besonderes für mich. Ich wollte auch nicht, dass du … dass es dir so schlecht geht. Vielleicht habe ich deshalb nicht genug nachgefragt, mich darauf verlassen, dass deine Eltern es mir schon berichten würden. Mir wäre es lieber gewesen, du wärst eine von denen gewesen …« Lannie wischte sich mit dem Handrücken über die Augen. »Aber jetzt ist es so. Und du gehörst in diese Klinik, keine Frage. Sie ist der richtige Ort für dich. Deine Eltern haben das Richtige getan.«
»Was meinst du damit …« Tante Lannies Handy klingelte. Sie entschuldigte sich, nahm ab und unterhielt sich kurz.
»Komm, der Helikopter steht bereit für uns.« Sie stand auf, griff ihre Tasche und lief los.
Ich hechtete mit meinem Rollkoffer hinterher und warf den halbvollen Becher Tee in den Mülleimer.
Was Tante Lannie gesagt hatte, bestätigte meine Ängste irgendwie, aber andererseits wusste ich immer noch nichts Konkretes. Im Gegenteil, das Gespräch hatte nur noch mehr Fragen aufgeworfen.
Es klang so, als hätten meine Eltern mich nicht bei sich behalten dürfen, wenn sie Tante Lannie von meinen Problemen erzählt hätten. Was sollte das heißen? Sie waren schließlich meine Erziehungsberechtigten, und ein Arzt in Schottland hatte doch keinerlei Befugnis, einem Ehepaar in Deutschland ein Kind wegzunehmen. Und was meinte Tante Lannie damit, wenn sie sagte, sie wünschte, ich wäre eine von denen gewesen … eine von welchen? Es hörte sich so an, als ob sie viele Jugendliche kannte, denen es so erging wie mir … wohl die anderen Patienten in der Klinik. Aber ich war etwas Besonderes … weil ich ihr Patenkind war. So überlegte ich es mir. Wenigstens schien sie ehrlich um mich besorgt und glaubte wohl tatsächlich, dass mir in der Klinik geholfen werden würde.
Nur hatte das, was sie erzählt hatte, meinen Eindruck bestätigt, dass ich meine Eltern nicht wiedersehen würde. Dass unser Abschied ein endgültiger war. Ich verstand das nicht. Wieso sollte ich denn nicht nach Hause gehen können, in sechs Monaten oder wann immer die Therapie vorbei war. Dann war ich volljährig und konnte sowieso machen, was ich wollte. Wenn diese Klinik doch tatsächlich das einzig Richtige für mich war, dann erschloss sich mir einfach nicht, wieso meine Eltern so lange gewartet hatten.
Aber ich kam nicht dazu, weitere Fragen zu stellen.
Im Hubschrauber war es laut und ich hatte genug damit zu tun, die neuen Eindrücke zu verarbeiten. Als der Heli durch die dunkle Wolkendecke tauchte und ich die mit Nebelschwaden verhangene Insel sah, musste ich meine Atemübungen machen.