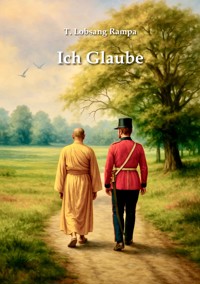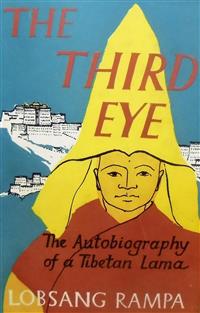0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Ein weiterer autobiografischer Einblick in das außergewöhnliche Leben von T. Lobsang Rampa: Nach seinem Studium als Arzt und Lama in Tibet setzt er sein Medizinstudium in Chungking, China, fort. Dort entdeckt er seine Leidenschaft - das Fliegen. Er lässt sich zum Piloten ausbilden und dient bei den chinesischen Streitkräften als fliegender Arzt. Im Krieg zwischen Japan und China gerät sein Flugzeug unter Beschuss und stürzt ab. Er überlebt als Einziger und wird von den Japanern gefangen genommen. Als Gefangenenarzt in den Konzentrationslagern versucht er fortan, mit bescheidenen Mitteln die Leiden seiner Mithäftlinge zu lindern. Dabei beschreibt er, wie man mithilfe von Geisteskontrolle und Atemtechniken Schmerzen erträglicher machen kann, um Hunger und Folter zu überstehen. Doch seine Erzählungen gehen weit über das persönliche Leid hinaus - er berichtet von verborgenen Höhlen in seiner Heimat und enthüllt die faszinierende Entstehungsgeschichte Tibets und der frühen Erde.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
T. Lobsang Rampa
Ein Arzt aus Lhasa
Klappentext
Ein weiterer autobiografischer Einblick in das außergewöhnliche Leben von T. Lobsang Rampa: Nach seinem Studium als Arzt und Lama in Tibet setzt er sein Medizinstudium in Chungking, China, fort. Dort entdeckt er seine Leidenschaft - das Fliegen. Er lässt sich zum Piloten ausbilden und dient bei den chinesischen Streitkräften als fliegender Arzt. Im Krieg zwischen Japan und China gerät sein Flugzeug unter Beschuss und stürzt ab. Er überlebt als Einziger und wird von den Japanern gefangen genommen. Als Gefangenenarzt in den Konzentrationslagern versucht er fortan, mit bescheidenen Mitteln die Leiden seiner Mithäftlinge zu lindern. Dabei beschreibt er, wie man mithilfe von Geisteskontrolle und Atemtechniken Schmerzen erträglicher machen kann, um Hunger und Folter zu überstehen. Doch seine Erzählungen gehen weit über das persönliche Leid hinaus - er berichtet von verborgenen Höhlen in seiner Heimat und enthüllt die faszinierende Entstehungsgeschichte Tibets und der frühen Erde.
Anmerkung des englischen Herausgebers
Als das erste Buch von Lobsang Rampa, «Das dritte Auge», publiziert wurde, brach eine äußerst hitzige Kontroverse aus, die immer noch andauert. Der Autor behauptet, «durch ihn» würde ein tibetischer Lama sein Leben niederschreiben. Er hätte sogar nach einem Unfall mit einer leichten Gehirnerschütterung von seinem Körper völlig Besitz ergriffen. Diese Aussage erweist sich nicht gerade als förderlich, die vielen Leser im abendländischen Kulturkreis einfach so davon zu überzeugen. Einige, die sich an ähnliche Fälle in der Vergangenheit erinnerten, wenn auch nicht in Tibet, zogen es vor, unvoreingenommen zu bleiben. Andere dagegen, und diese bilden gewiss die Mehrheit, machten aus ihren Zweifeln keinen Hehl und blieben sehr skeptisch.
Trotz der Kontroverse fanden viele Leser, ob Kenner des Ostens oder nicht, Gefallen an diesem ungewöhnlichen Buch. Sie waren erstaunt, mit welchem offensichtlichen Können der Autor sein Thema beherrscht und einen tiefen Einblick in einen faszinierenden, kaum bekannten Teil der Welt gewährt. Verblüffend war auch das völlige Fehlen früherer schriftstellerischer Erfahrungen des Autors. Ungeachtet aller Zweifel konnte bis heute niemand seine Behauptungen widerlegen.
Die jetzigen Herausgeber sind der Meinung, dass es richtig ist, «Das dritte Auge», «Ein Arzt aus Lhasa» und die Fortsetzung «Die Rampa Story» der Öffentlichkeit zugänglich zu machen – unabhängig davon, wie die Wahrheit tatsächlich aussehen mag und ob darüber jemals Gewissheit erlangt werden kann, und sei es nur deshalb, weil die Lektüre dieser Bücher einen hohen Lesegenuss bieten. Über die grundlegenden und tieferen Fragen, die sie aufwerfen, muss sich jeder Leser selbst eine Meinung bilden. «Ein Arzt aus Lhasa» erscheint so, wie Lobsang Rampa es geschrieben hat. Es muss für sich selbst sprechen.
Vorwort des Autors
Als ich in England lebte, schrieb ich «Das dritte Auge», ein Buch, das wahr ist, aber viele Kommentare hervorrief. Von überall her auf der ganzen Welt erreichten mich Briefe. Als Antwort auf die zahlreichen Anfragen habe ich dieses Buch geschrieben: «Ein Arzt aus Lhasa».
Meine Erfahrungen, über die ich in einem dritten Buch noch berichten werde, übersteigen bei weitem alles, was die meisten Menschen jemals erdulden müssen. Erfahrungen, für die es in der Geschichte nur in ganz, ganz wenigen Fällen Parallelen gibt. Doch das ist nicht das Thema dieses Buches, sondern es ist die Fortsetzung meiner Autobiografie.
Ich bin ein tibetischer Lama, einer, der in die westliche Welt kam, um seiner Bestimmung zu folgen – genauso, wie es mir vorausgesagt wurde. Ich erduldete all die Mühsale, wie prophezeit. Leider betrachteten mich die Menschen im Westen als Kuriosität, als ein Exemplar, das man in einen Käfig sperren und als Sonderling aus dem Unbekannten ausstellen sollte. Das gab mir Anlass, mich zu fragen, was wohl mit meinen alten Freunden, den Yetis, geschehen würde, wenn sie in die Hände westlicher Menschen fielen – was diese ja auch versuchen.
Zweifellos würden sie die Yetis abschießen, ausstopfen und in einem Museum in einer Vitrine ausstellen. Doch selbst dann würden die Leute noch argumentieren und behaupten, dass es so etwas wie die Yetis gar nicht gibt. Es ist für mich kaum zu glauben, dass man im Westen an das Fernsehen und an Weltraumraketen glaubt, die vielleicht den Mond umkreisen und zur Erde zurückkehren, aber dann wiederum Yetis oder «unbekannte Flugobjekte» leugnet. Die Menschen wollen immer alles in den Händen halten und in Stücke reißen, um zu sehen, wie es funktioniert.
Doch nun stehe ich vor der großen Herausforderung, auf nur wenigen Seiten das zusammenzufassen, wofür ich zuvor ein ganzes Buch gebraucht habe: die Einzelheiten meiner frühen Kindheit.
Ich stamme aus einer sehr hochrangigen Familie, eine der führenden Familien in Lhasa, der Hauptstadt von Tibet. Meine Eltern hatten einen großen Einfluss auf die Regierung des Landes, und weil ich von hohem Rang war, wurde mir eine sehr strenge Erziehung zuteil, damit ich, so wie es vorgesehen war, bereit sei, meinen Platz im Leben einzunehmen. Noch bevor ich sieben Jahre alt war, wurden gemäß unserer Tradition die Astrologenpriester zurate gezogen, um festzustellen, welche Art von Laufbahn mir offenstand. Tage zuvor begannen die Vorbereitungen für ein großes Fest, zu dem alle führenden Bürger und wichtigen Persönlichkeiten von Lhasa eingeladen waren, um mein Schicksal zu erfahren.
Schließlich brach der Tag der Prophezeiung an, und unser Anwesen war von Menschenmengen überfüllt. Die Astrologen erschienen, ausgerüstet mit Papierbögen, Sternenkarten und allem Notwendigen, was sie für ihren Beruf brauchten. Als der passende Augenblick gekommen war und alle Anwesenden aufs äußerste gespannt waren, gaben die Astrologen ihre Ergebnisse bekannt. Feierlich wurde verkündet, dass ich mit sieben Jahren einem Lamakloster beitreten und zum Priester und priesterlichen Arzt und Chirurgen ausgebildet werden sollte.
Es wurden über mein Leben sehr viele Prophezeiungen gemacht. Eigentlich wurde mir mein ganzer Lebensweg aufgezeichnet. Zu meinem großen Bedauern ist alles, was sie gesagt hatten, wahr geworden. Ich sage «Bedauern», weil der größte Teil der Prophezeiungen nur Unglück, Mühsale und Leid beinhaltete. Das machte es einem nicht leichter, wenn man das ganze Leid kennt, das einem bevorsteht.
Im Alter von sieben Jahren trat ich dem Chakpori-Lamakloster bei. Ich machte mich ganz allein auf den Weg. Am Eingang wurde ich zurückgehalten und musste mich einer sehr harten Aufnahmeprüfung unterziehen, um zu sehen, ob ich stark genug und widerstandsfähig war, um dieser Ausbildung gerecht zu werden. Diese Prüfung bestand ich, und ich wurde aufgenommen und mir wurde gestattet einzutreten. Ich durchlief alle Stufen. Angefangen hatte ich als völlig unwissender Anfänger. Am Ende wurde ich Lama und Abt. Meine besonderen Schwerpunkte aber lagen auf dem Gebiet der Medizin und Chirurgie. Ich studierte mit Eifer, und man gab mir jede Gelegenheit, Leichname zu untersuchen. Im Westen herrscht die Meinung vor, dass tibetische Lamas ihre Patienten nur medizinisch versorgen und keine Operationen durchführen. Man glaubt offenbar auch, dass die tibetische medizinische Wissenschaft wenig entwickelt sei, weil die Medizinlamas nur äußere Behandlungen vornahmen und das Innere des Körpers nicht behandelten. Das ist jedoch nicht zutreffend. Ich gebe zwar zu, dass gewöhnliche Lamas nie Operationen durchführen, da dies gegen ihre Glaubensüberzeugungen verstößt. Doch es gab einen besonderen Kreis von Lamas, dem auch ich angehörte, der dafür ausgebildet wurde, Operationen durchzuführen. Operationen, die möglicherweise sogar über den Rahmen der westlichen Wissenschaft hinausgingen.
In diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass im Westen fälschlicherweise geglaubt wird, die tibetische Medizin lehre, das Herz des Mannes befinde sich auf der einen und das der Frau auf der anderen Seite. Nichts könnte lächerlicher sein als das. Solche Informationen stammen von westlichen Autoren, die keinerlei Wissen über das haben, worüber sie schreiben. Sie haben dabei Bezug auf einige unserer grafischen Darstellungen genommen, die sich mit den Astralkörpern auseinandersetzen. Das aber ist etwas ganz und gar anderes. Wie auch immer, das ist nicht das Thema dieses Buches.
Meine Ausbildung war wirklich sehr intensiv. Ich musste nicht nur über meine Spezialgebiete Medizin und Chirurgie Bescheid wissen, sondern auch über alle unsere Heiligen Schriften. Ich musste Prüfungen sowohl in Medizin als auch in Religion ablegen. Nach bestandenen Prüfungen war ich ein voll ausgebildeter Medizinlama und Priester. Da ich beide Gebiete gleichzeitig studierte, bedeutete es, doppelt so hart zu lernen wie der Durchschnitt.
Das gefiel mir nicht immer! Aber natürlich war nicht alles nur Mühsal. Ich unternahm auch viele Reisen in die höher gelegenen Landesteile, um Kräuter zu sammeln. Unsere medizinische Ausbildung beruhte auf der Behandlung mit Heilpflanzen aus der Natur. Im Chakpori lagerten ständig mindestens sechstausend verschiedene Arzneipflanzen. Wir Tibeter sind der Ansicht, dass wir mehr von Naturheilkräuterbehandlungen verstehen als die meisten Menschen in anderen Teilen der Welt. Diese Ansicht hat sich bei mir noch verstärkt, nachdem ich mehrfach um die Welt gereist bin.
Auf mehreren meiner Reisen in die höher gelegenen Gebiete Tibets flog ich mit manntragenden Flugdrachen. Ich segelte über den schroffen Gipfeln der Bergketten und konnte dabei kilometerweit über das Land blicken. Ich nahm auch an einer unvergesslichen Expedition in eines der unzugänglichsten Gebiete Tibets teil. Wir stiegen in die höchste Region des Chang-Tang-Hochgebirges hinauf. Hier fanden wir, die Expeditionsteilnehmer, zwischen Felsklüften verborgen, ein tief nach unten führendes, abgelegenes Tal, das vom ewig brennenden Erdfeuer erwärmt wurde. Heißes Wasser sprudelte aus dem Boden und floss in einen Fluss. Wir entdeckten auch eine riesige Stadt. Die eine Hälfte der Stadt war der warmen Luft des abgeschiedenen Tals ausgesetzt, während die andere Hälfte unter klarem Gletschereis begraben lag. Eis, das so klar war, dass der andere Teil der Stadt durch das gefrorene Wasser deutlich sichtbar war. Der aufgetaute Teil der Stadt war fast unversehrt. Die Jahre waren wirklich sanft mit den Gebäuden umgegangen. Die ruhige Luft und das Fehlen von Wind hatten die Gebäude vor der Verwitterung bewahrt. Wir gingen durch die Straßen, die ersten Menschen, die nach Tausenden von Jahren diese Straßen betreten haben. Wir schlenderten ziellos durch die Häuser, die so aussahen, als würden sie jeden Moment ihre Bewohner erwarten. Erst bei näherem Hinsehen entdeckten wir seltsame versteinerte Skelette. Dann realisierten wir, dass wir hier auf eine ausgestorbene Stadt gestoßen waren. Wir entdeckten viele fantastische Geräte, die darauf schließen ließen, dass dieses verborgene Tal einst die Heimat einer hochentwickelten Zivilisation war – weit fortschrittlicher als jede, die heute auf der Erde existiert. Es bewies uns eindeutig, dass die Menschen dieses vergangenen Zeitalters uns heute als unterentwickelt betrachten würden. Doch in diesem zweiten Buch werde ich noch mehr über diese Stadt berichten.
Als ich noch ziemlich jung war, wurde eine spezielle Operation an mir durchgeführt. Sie wurde «Das Öffnen des dritten Auges» bezeichnet. Dabei wurde mir ein Hartholzspan, den man in einer besonderen Kräuterlösung getränkt hatte, in der Mitte der Stirne eingeführt, um so eine Drüse anzuregen, die meine hellsichtigen Kräfte noch weiter verstärken sollte. Ich war bereits mit einer beträchtlichen Hellsichtigkeit geboren worden, doch nach der Operation nahm diese in außergewöhnlichem Maße zu. Ich konnte die Menschen mit ihrer sie umgebenden Aura sehen, so als wären sie von züngelnden, farbigen Flammen umgeben. In diesen Auren konnte ich ihre Gedanken lesen und ersehen, was ihnen fehlte, sowie ihre Hoffnungen und Ängste erkennen.
Seit ich Tibet verlassen habe, versuche ich, westliche Ärzte und Chirurgen davon zu überzeugen und sie für ein Gerät zu gewinnen, das es ihnen ermöglichen würde, die menschliche Aura so zu sehen, wie sie wirklich ist. Ich weiß, dass sie, wenn sie dazu in der Lage wären, die genaue Ursache von Krankheiten klar erkennen könnten. Ein Aura-Spezialist könnte dann durch die Beobachtung der Farben und Bewegungen der Bänder genau feststellen, unter welcher Krankheit eine Person leidet. Darüber hinaus ließe sich in der Aura eine Krankheit erkennen, noch bevor der physische Körper irgendwelche sichtbaren Symptome zeigt. Die Aura zeigt Krankheiten wie Krebs, Tuberkulose und andere Leiden bereits mehrere Monate an, bevor sie den physischen Körper befallen. Durch diese frühe Warnung könnte der Arzt die Krankheit rechtzeitig erkennen und erfolgreich behandeln. Doch zu meinem Entsetzen und tiefsten Bedauern zeigen westliche Ärzte überhaupt kein Interesse daran. Sie scheinen zu glauben, dass es sich hierbei um Magie handelt. Dabei geht es um ganz einfachen, gesunden Menschenverstand. Jeder Ingenieur weiß, dass eine Hochspannungsleitung von einer Korona umgeben ist. Dasselbe trifft auch auf den menschlichen Körper zu. Es ist nichts anderes als eine ganz gewöhnliche physikalische Angelegenheit, die ich den Spezialisten aufzeigen möchte. Aber sie lehnen es ab, und das ist eine Tragödie. Doch es wird mit der Zeit kommen. Die Tragik ist nur, dass bis dahin so viele Menschen unnötig leiden und sterben müssen.
Der Dalai Lama, der dreizehnte Dalai Lama, war mein Schirmherr. Er ordnete an, dass mir jede erdenkliche Unterstützung bei der Ausbildung und in der Sammlung von Erfahrungen geboten werden sollte. Er verfügte, dass mir alles gelehrt werden sollte, was ich in mich aufnehmen konnte. Ich sollte nebst den gewöhnlichen Methoden auch mittels Hypnose und durch verschiedene andere Arten unterrichtet werden, die an dieser Stelle nicht erwähnt werden. Einige von ihnen werden in diesem Buch behandelt oder im «Das dritte Auge». Wieder andere Methoden sind so neuartig und so unglaublich, dass die Zeit noch nicht reif ist, um auf sie einzugehen.
Dank meiner hellsichtigen Begabung konnte ich Seiner Heiligkeit, dem Dalai Lama, bei vielen Gelegenheiten eine große Hilfe sein. Oft hielt ich mich in seinem Audienzzimmer verborgen, um aus der Aura der Besucher deren wahre Gedanken und Absichten zu lesen. Dies wurde veranlasst, um festzustellen, ob die Worte mit den tatsächlichen Gedanken der Besucher übereinstimmten, besonders wenn es sich um ausländische Staatsmänner handelte, die den Dalai Lama besuchten. Ich war auch als unsichtbarer Beobachter anwesend, als eine chinesische Delegation vom «Großen Dreizehnten» empfangen wurde und auch, als ein Engländer den Dalai Lama besuchte. Doch im letzteren Fall hätte ich beinahe in meiner Pflicht versagt, aufgrund meines Erstaunens über die bemerkenswerte Kleidung, die der Mann trug. Ich sah zum ersten Mal eine europäische Kleidung!
Meine Ausbildung war langwierig und anstrengend. Sowohl tagsüber als auch nachts fanden Tempelandachten statt. Weiche Betten gab es für uns nicht. Wir wickelten uns in unsere einzige Wolldecke und schliefen auf dem Fußboden. Die Lehrer waren äußerst streng. Wir mussten ständig studieren und lernen und uns alles merken. Notizbücher hatten wir nicht – alles musste auswendig gelernt werden.
Ich studierte auch die Fächer der Metaphysik. Ich befasste mich eingehend und intensiv mit dem Hellsehen, dem Astralreisen und der Telepathie. Ich durchlief alle Bereiche. Bei einer meiner Einweihungszeremonien besuchte ich die geheimen Grotten, Tunnel und Höhlen unter dem Potala – Orte, von denen die meisten Menschen nichts wissen. Sie sind Relikte aus einer uralten Zivilisation, die sich beinahe schon jenseits der Erinnerungen und beinahe schon jenseits der Rassenerinnerung befinden. An den Wänden befanden sich Zeichnungen und bildliche Darstellungen von Vehikeln, die sich durch die Luft bewegten, und andere, die in die Erde eintauchten. Bei einer weiteren Einweihungszeremonie sah ich die sorgfältig konservierten und einbalsamierten Körper von Riesen, drei Meter bis fünf Meter groß. Auch wurde ich auf die andere Seite des Todes geschickt, um zu erfahren, dass es keinen Tod gibt. Nach meiner Rückkehr galt ich als anerkannte Inkarnation im Range eines Abtes.
Doch ein Abt, der an ein Lamakloster gebunden ist, wollte ich nicht sein. Ich wollte ein freier Lama bleiben, damit ich kommen und gehen konnte, wie es mir beliebte. Ich wollte die Freiheit haben, anderen zu helfen, wie es die Prophezeiung vorhersagte. So wurde mir vom Dalai Lama persönlich der Rang «Lama» verliehen. Durch ihn war ich mit dem Potala in Lhasa verbunden. Selbst danach setzte sich meine Ausbildung fort. Ich erhielt Unterricht in verschiedenen westlichen Wissenschaften, darunter Optik und andere verwandte Fachgebiete. Schließlich rückte der Zeitpunkt heran, an dem ich erneut zum Dalai Lama gerufen wurde, um von ihm neue Weisungen zu erhalten.
Er eröffnete mir, dass ich alles gelernt hätte, was ich in Tibet lernen konnte, und dass die Zeit für mich nun gekommen sei, weiterzuziehen. Ich müsse alles hinter mir lassen, was ich liebte und woran mein Herz hing. Er sagte mir, dass Sondergesandte nach Chungking gereist seien, um mich dort in dieser chinesischen Stadt als Student der Medizin und Chirurgie einzuschreiben.
Mit überaus schwerem Herzen verließ ich den Erhabenen. Niedergeschlagen suchte ich meinen Mentor auf und berichtete ihm, was beschlossen worden war. Anschließend besuchte ich meine Eltern, um ihnen mitzuteilen, dass ich Lhasa verlassen würde und welche Pläne für mich gemacht worden waren. Die Tage vergingen wie im Flug, und schließlich kam der letzte Tag. Ich verließ das Chakpori. Zum letzten Mal sah ich den Lama Mingyar Dondup in Fleisch und Blut. Ich machte mich auf den Weg, ließ Lhasa, die Heilige Stadt, hinter mir und stieg die hohen Bergpässe hinauf. Als ich zurückschaute, war das Letzte, was ich sah, ein tibetisches Symbol: Über den goldenen Dächern des Potala flog einsam ein Drachen.
Kapitel 1Hinaus ins Unbekannte
Nie zuvor war mir so kalt gewesen. Nie zuvor hatte ich mich so hoffnungslos und so elend gefühlt. Selbst in der kargen Einöde des Chang-Tang-Hochgebirges, sechstausend Meter über dem Meeresspiegel, wo eisige Winde scharfkantigen Sand mit sich führten und bei Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt jede ungeschützte Hautstelle blutig schlugen, war mir wärmer gewesen als jetzt. Dort war die Kälte nicht so bissig gewesen wie jetzt, diese angsteinflößende Eiseskälte, die ich in meinem Herzen spürte. Ich verließ mein geliebtes Lhasa. Als ich mich umdrehte und noch einmal zurückblickte, sah ich winzige Gestalten auf den goldenen Dächern des Potala, über denen ein einsamer Drachen im sanften Wind hüpfte und tanzte. Es war, als würde er mir zurufen: «Lebe wohl, deine Tage des Drachenfliegens sind nun vorbei. Auf zu weit ernsteren Dingen.»
Für mich hatte dieser Drachen eine symbolische Bedeutung: Ein Drachen, hoch oben in der unendlichen Weite des blauen Himmels, der nur durch eine dünne Schnur an sein Haus gebunden war. Auch ich begab mich hinaus in die unendliche Weite der Welt jenseits von Tibet, nur gehalten durch die dünne Schnur meiner Liebe zu Lhasa. Ich zog hinaus in die fremde, furchteinflößende Welt jenseits meines friedlichen Heimatlandes. Mir war schwer ums Herz, als ich meinem Zuhause den Rücken kehrte und zusammen mit meinen Begleitern in das mir große Unbekannte ritt. Auch sie waren unglücklich, doch ihr Trost lag in der Gewissheit, dass sie den Heimweg antreten konnten, sobald sie mich im tausendsechshundert Kilometer entfernten Chungking (alter Name für Chongqing, Anm. d.Ü.) zurückgelassen hatten. Sie kehrten zurück mit dem tröstlichen Wissen, dass jeder Schritt sie der Heimat wieder ein Stück näherbrachte. Ich hingegen musste immer weiterziehen, in mir unbekannte Länder, zu fremden Menschen und noch fremdartigeren Erfahrungen.
Die Prophezeiung, die in meinem siebten Lebensjahr über meine Zukunft gemacht worden war, besagte, dass ich in ein Lamakloster eintreten und zunächst als Chela, dann im Rang eines Trappas und schließlich weiter ausgebildet werden sollte, bis ich die Prüfung zum Lama bestehen konnte. Danach, so hatten die Astrologen errechnet, würde ich Tibet, mein Zuhause und alles, was ich liebte, verlassen und, wie wir es bezeichneten, in das «barbarische China» ziehen. Mein Weg würde mich nach Chungking führen, wo ich studieren sollte, um Arzt und Chirurg zu werden. Laut den Astrologenpriestern würde ich in Kriege verwickelt und in die Gefangenschaft fremder Völker geraten. Ich müsste mich gegen alle Versuchungen und alles Leid behaupten, um denjenigen zu helfen, die in Not waren. Sie hatten mir geweissagt, dass mein Leben hart sein würde, dass Leid, Schmerzen und Undankbarkeit meine ständigen Begleiter sein würden. Wie recht sie doch hatten!
Mit diesen keineswegs frohen Gedanken gab ich das Zeichen, weiterzureiten. Kurz nachdem Lhasa aus unserem Blickfeld entschwunden war, stiegen wir vorsichtshalber von unseren Pferden ab und vergewisserten uns nochmals, ob mit den Pferden alles in Ordnung war. Wir achteten darauf, dass die Sättel richtig saßen und die Gurte weder zu fest noch zu locker waren. Wir wollten unsere Pferde während der Reise stets als unsere Freunde behandeln, daher war es uns wichtig, mindestens genauso gut für sie zu sorgen wie für uns selbst. Als wir sicher waren, dass es ihnen gutging, bestiegen wir sie wieder, richteten den Blick entschlossen nach vorn und setzten unseren Ritt fort.
Es war Anfang 1927, als wir Lhasa verließen. Wir machten uns gemächlich auf den Weg nach Chotang, einer Ortschaft am Ufer des Brahmaputra-Flusses. Zuvor hatten wir uns lange und ausführlich über die beste Route beraten, und die Strecke entlang des Flusses über Kanting wurde uns als die günstigste empfohlen. Der Brahmaputra ist ein Fluss, den ich gut kenne. Ich habe eine seiner Quellen in einem Gebiet des Himalaya überflogen, als ich das Glück gehabt hatte, in einem manntragenden Flugdrachen zu fliegen. Wir in Tibet betrachteten den Fluss mit Verehrung, aber nicht mit der Ehrfurcht, die ihm anderswo entgegengebracht wurde. Hunderte von Kilometern entfernt, wo er in den Golf von Bengalen strömte, hielt man ihn für heilig, fast so heilig wie Benares. Es sei der Brahmaputra gewesen, so hatte man uns erklärt, der die Bucht von Bengalen erschaffen hätte. In den frühen Tagen der Geschichte floss der Fluss sehr schnell und er war auch sehr tief. Er strömte in einer nahezu geraden Linie von den Bergen herunter, riss die lockere Erde mit sich fort und ließ die wundervolle herrliche Bucht entstehen. Wir folgten dem Fluss durch die Pässe nach Sikang. In den alten Zeiten, den glücklichen Zeiten, als ich noch sehr jung war, war Sikang noch ein Teil von Tibet, eine Provinz von Tibet. Dann fielen die Briten in Lhasa ein, und danach fühlten sich auch die Chinesen dazu ermutigt und fielen in Sikang ein und eroberten es. Mit mörderischer Absicht drangen sie in diesen Teil unseres Landes ein, töteten, vergewaltigten, plünderten und brachten Sikang unter ihre Gewalt. Sie setzten chinesische Beamte ein, Beamte, die anderswo in Ungnade gefallen waren und dadurch bestraft wurden, dass man sie nach Sikang versetzte. Zu ihrem Unglück gewährte ihnen die chinesische Regierung keine Unterstützung. Sie mussten allein zurechtkommen, so gut sie eben konnten. Wir fanden, dass diese Chinesen bloß Marionetten waren, hilflose, untaugliche Männer, über die die Tibeter lachten. Natürlich taten wir von Zeit zu Zeit so, als würden wir den chinesischen Beamten gehorchen, aber es geschah nur aus Höflichkeit. Sobald sie uns den Rücken zudrehten, gingen wir wieder unsere eigenen Wege.
Tag für Tag zog sich unsere Reise hin. Wir rasteten immer dann, wenn wir ein Lamakloster erreichten, in dem wir die Nacht verbringen konnten. Da ich ein Lama war, sogar ein Abt und eine anerkannte Inkarnation, bereiteten uns die Mönche stets den allerbesten Empfang, den sie uns bieten konnten. Darüber hinaus reiste ich unter dem persönlichen Schutz des Dalai Lama, was sehr viel bedeutete.
Wir machten uns wieder auf den Weg und erreichten Kanting. Das ist eine berühmte Marktstadt, die für ihren Yakhandel bekannt war. In erster Linie aber berühmt als Exportzentrum für den Ziegeltee, den wir in Tibet so bekömmlich finden. Dieser Tee wurde aus China importiert und bestand nicht nur aus gewöhnlichen Teeblättern, sondern war mehr oder weniger ein chemisches Gemisch, das Tee, Zweigstücke, Soda, Salpeter und einige andere Zutaten enthielt. In Tibet gibt es kein so reichhaltiges Nahrungsangebot wie in anderen Teilen der Welt. Unser Tee musste sowohl als eine Art Suppe wie auch als Getränk dienen. In Kanting wurde der Tee gemischt und zu Blöcken oder Ziegeln gepresst, wie sie üblicherweise genannt werden. Diese Ziegel besaßen eine bestimmte Größe und ein bestimmtes Gewicht, sodass sie auf die Pferde und später auf die Yaks geladen werden konnten, die sie dann über das hohe Gebirge nach Lhasa transportierten. Dort wurden sie auf dem Markt verkauft und in ganz Tibet verteilt.
Teeziegel mussten eine bestimmte Größe und Form haben. Sie mussten aber auch speziell verpackt werden, damit sie keinen Schaden nahmen, falls ein Pferd einmal in einer seichten Gebirgsfurt straucheln und der Tee in den Fluss fallen sollte. Diese Ziegel wurden fest in Rohhäute, oder in Rohleder, wie es manchmal genannt wird, eingepackt und dann sofort ins Wasser getaucht. Danach wurden sie zum Trocknen auf die Felsen in die Sonne gelegt. Während sie trockneten, schrumpften die Häute. Sie schrumpften erstaunlich stark und pressten den ganzen Inhalt enorm fest zusammen. Die Häute nahmen ein bräunliches Aussehen an und wurden so hart wie Bakelit oder noch härter. Jedes dieser Lederbündel könnte man, wenn sie trocken waren, den Berghang hinunterrollen lassen, und sie würden unten sicher und unbeschädigt landen. Sie konnten auch in den Fluss fallen und dort vielleicht einige Tage liegen bleiben, und wenn man sie wieder herausfischte und trocknete, blieb alles noch intakt. Sie waren wasserdicht, und von daher konnte nichts verderben. Unsere Teeziegel in ihren getrockneten Häuten gehörten zu den hygienischsten Verpackungen der Welt. Der Tee wurde außerdem oft als Zahlungsmittel benutzt. Ein Händler, der kein Geld auf sich trug, konnte ein Stück Tee abbrechen und es eintauschen. Niemand musste sich Sorgen um Bargeld machen, solange er Teeziegel dabeihatte.
Kanting beeindruckte uns mit ihrem geschäftigen Treiben. Wir waren nur an unser heimatliches Lhasa gewöhnt. Hier in Kanting aber begegneten wir Menschen aus fernen Ländern wie Japan, Indien und Burma sowie Nomaden aus den Gebieten jenseits des Takla-Gebirges. Wir schlenderten über den Marktplatz, mischten uns unter die Händler und lauschten deren fremden Stimmen und unterschiedlichen Sprachen. Wir trafen auf Mönche verschiedener Glaubensrichtungen, darunter Zen-Buddhisten und andere. Danach machten wir uns, wundernd über die neuen Eindrücke, auf den Weg zu einem kleinen Lamakloster außerhalb von Kanting, wo man uns bereits erwartete. Unsere Gastgeber waren bereits besorgt, weil wir noch nicht angekommen waren. Wir erklärten ihnen umgehend, dass wir uns noch auf dem Markt umgesehen und uns den Markttratsch angehört hatten. Der zuständige Abt hieß uns herzlich willkommen und lauschte mit großem Interesse unseren Erzählungen aus Tibet. Er hörte sich die Neuigkeiten an, von denen wir ihm berichteten, denn wir kamen vom Potala, dem Sitz der Gelehrsamkeit. Wir waren auch die Männer, die das Chang-Tang-Hochgebirge besucht und große Wunder gesehen hatten. Unser Ruhm war uns tatsächlich vorausgeeilt.
Früh am Morgen, nachdem wir an der Andacht im Tempel teilgenommen hatten, machten wir uns wieder auf unseren Pferden auf den Weg, bepackt mit ein wenig Proviant: Tsampa. Die Straße war nur ein Saumpfad, der sich hoch oben am Rande einer Felsschlucht entlangzog. Weit unten wuchsen Bäume, mehr Bäume, als wir alle jemals gesehen hatten. Einige waren teilweise unter dem aufsteigenden Dunst eines Wasserfalls verborgen. Riesige Rhododendren gediehen in der Schlucht, und der Boden selbst war mit vielen bunten Blumen übersät, kleinen Bergblumen, die die Luft mit ihrem Duft erfüllten und der Landschaft etwas Farbe verliehen. Doch trotz der Schönheit der Umgebung fühlten wir uns bedrückt und elend – einerseits durch den Gedanken, unsere Heimat verlassen zu müssen, andererseits durch die immer dichtere Luft.
Unablässig führte uns der Weg immer tiefer und tiefer hinab. Uns fiel das Atmen immer schwerer. Es gab noch ein weiteres Problem, mit dem wir zu kämpfen hatten. In Tibet, wo die Luft dünn ist, kocht das Wasser schon bei niedrigen Temperaturen. In den noch höher gelegenen Gebieten konnten wir den Tee tatsächlich trinken, wenn er kochte. Wasser oder Tee ließen wir gewöhnlich so lange auf dem Feuer stehen, bis die aufsteigenden Blasen anzeigten, dass der Tee trinkfertig war. In diesen tieferen Lagen litten wir anfangs sehr unter verbrühten Lippen, als wir die Wassertemperatur zu überprüfen versuchten. Wir waren es gewohnt, den Tee sofort zu trinken, nachdem wir ihn vom Feuer genommen hatten, denn in Tibet mussten wir das tun, sonst hätte die bittere Kälte unserem Tee sofort die ganze Wärme entzogen. Zu diesem Zeitpunkt wussten wir noch nicht, dass der Luftdruck den Siedepunkt beeinflusst. Der Gedanke, dass wir das kochende Wasser abkühlen lassen könnten, ohne dass es gefriert, kam uns nicht in den Sinn.
Besonders große Schwierigkeiten bereitete uns das Atmen. Der hohe Luftdruck setzte unserer Brust und unseren Lungen schwer zu. Zuerst dachten wir, es habe einen emotionalen Grund, weil wir unser geliebtes Tibet verließen. Doch später fanden wir heraus, dass wir beinahe an der Luft ertranken. Keiner von uns war je auf einer Höhe von nur dreihundert Metern über dem Meeresspiegel gewesen. Lhasa selbst liegt auf dreitausendsechshundertfünfzig Metern über dem Meeresspiegel. Oft waren wir in noch höheren Regionen unterwegs, etwa im Chang-Tang-Hochgebirge, das sich über sechstausend Meter erhebt. Wir hatten früher viele Geschichten von Tibetern gehört, die Lhasa verlassen hatten, um im Tiefland ihr Glück zu suchen. Gerüchten zufolge starben viele nach Monaten des Leidens an schweren Lungenerkrankungen. In Lhasa kursierten aufsehenerregende Geschichten, laut denen jene, die in tiefere Lagen zogen, einem schmerzvollen Tod entgegentreten würden.
Ich wusste, dass das nicht stimmte, weil meine Eltern in Shanghai gewesen waren, wo sie etliche Besitztümer besaßen. Sie waren dorthin gereist und kehrten gesund wieder zurück. Mit meinen Eltern hatte ich wenig zu tun. Sie waren überaus beschäftigt und hatten eine derart hohe Stellung inne, dass sie kaum Zeit für uns Kinder hatten. Die Auskunft über ihre Reise nach Shanghai hatte ich von den Bediensteten erfahren.
Doch jetzt war ich sehr beunruhigt über den schweren Druck, den wir alle auf der Brust verspürten. Unsere Lungen fühlten sich an, als würden sie brennen, und wir hatten das Gefühl, ein Eisenband schnüre uns die Brust zu und hindere uns am Atmen. Jeder Atemzug erforderte enorme Anstrengung. Wenn wir uns zu schnell bewegten, schossen die Schmerzen wie ein Feuer durch uns hindurch. Je weiter wir reisten und je tiefer wir kamen, desto dichter wurde die Luft und desto wärmer die Temperaturen. Ein schreckliches Klima für uns. In Tibet, in Lhasa, wo wir herkamen, herrschte zwar eisige Kälte, aber es war eine trockene, eine gesunde Kälte. Bei solchen Bedingungen spielte die Temperatur keine große Rolle. Doch jetzt brachten uns dieser Druck der Luft und diese hohe Luftfeuchtigkeit beinahe um den Verstand. Wir waren extrem erschöpft.
Einmal versuchten die anderen, mich zu überreden, eine Umkehr nach Lhasa zu erlassen. Sie sagten, wir würden alle sterben, wenn wir unser waghalsiges Unterfangen fortsetzen würden. Doch da ich die Prophezeiungen kannte, wollte ich nichts davon wissen, und so ritten wir weiter. Als es immer wärmer wurde, wurde es uns auch noch schwindelig. Wir fühlten uns fast berauscht und hatten Probleme mit den Augen; wir konnten nicht mehr so weit und so klar sehen wie üblich, und wir schätzten die Entfernungen völlig falsch ein. Erst viel später fand ich die Erklärung dafür. Tibet besitzt die sauberste und klarste Luft auf der Welt, man kann achtzig Kilometer und noch weiter sehen, und man erkennt die Dinge so deutlich, als lägen sie nur gerade zwanzig Kilometer weit entfernt. Hier im Tiefland jedoch konnten wir nicht mehr so weit sehen, unsere Sicht wurde durch die dichte, verunreinigte Luft stark beeinträchtigt.
Viele Tage lang reisten wir weiter und kamen immer tiefer und tiefer und ritten durch Wälder, in denen mehr Bäume wuchsen, als jeder von uns je im Traum für möglich gehalten hätte, denn in Tibet gibt es nicht sehr viele Wälder oder Bäume. Nach einiger Zeit konnten wir der Versuchung nicht widerstehen, von den Pferden zu steigen und zu den verschiedenen Bäumen zu laufen, sie zu berühren und an ihnen zu riechen. Sie alle waren uns unbekannt und die Vielfalt beeindruckte uns. Die Rhododendren kannten wir natürlich; in Tibet wuchsen viele davon. Rhododendronblüten sind sogar eine besondere Delikatesse, wenn sie richtig zubereitet werden. Wir ritten weiter und staunten über alles. Staunten über den starken Kontrast zwischen dem Gesehenen und unserer Heimat. Ich kann nicht mehr sagen, wie lange wir unterwegs waren – wie viele Tage oder Stunden, denn das interessierte keinen von uns. Wir hatten reichlich Zeit. Die Hast und Hektik der Zivilisation waren uns fremd, und selbst wenn wir davon gewusst hätten, hätte es uns nicht interessiert.
Wir ritten täglich etwa acht bis zehn Stunden. Die Nächte verbrachten wir in Lamaklöstern entlang unserer Route. Es waren nicht immer Klöster, die genau unsere Form des Buddhismus praktizierten, doch das spielte keine Rolle, wir wurden stets herzlich willkommen geheißen. Unter uns, den wahren Buddhisten des Ostens, gab es keine Rivalität, keine Spannungen oder Abneigungen. Ein Reisender war immer willkommen. Und immer, solange wir uns dort aufhielten, nahmen wir, wie es bei uns Sitte ist, an allen Andachten teil. Wir ließen auch keine Gelegenheit aus, uns mit den Mönchen zu unterhalten, die uns so bereitwillig aufnahmen. Sie erzählten uns viele merkwürdige Geschichten über die sich wandelnden Zustände in China. Davon, wie sich die alte Ordnung des Friedens änderte. Sie berichteten, wie die Russen, die «Bären-Menschen», versuchten, die Chinesen mit ihren politischen Idealen zu indoktrinieren, die uns völlig falsch erschienen. Es schien uns, dass das, was die Russen predigten, darauf hinauslief: «Was dein ist, ist mein, und was mein ist, bleibt mein!» Wir hörten auch, dass die Japaner in verschiedenen Teilen Chinas Probleme verursachten. Offenbar drehte es sich um die Frage der Überbevölkerung. Japan hatte zu viele Menschen und zu wenig Nahrung, daher schienen sie zu versuchen, friedliche Völker zu überfallen und auszurauben, als seien nur die Japaner wichtig.
Schließlich verließen wir Sikang und überquerten die Grenzen nach Szechuan. Einige Tage später erreichten wir das Ufer des Yangtse. Hier machten wir an einem späten Nachmittag bei einem kleinen Dorf Halt, nicht weil wir unser Tagesziel erreicht hatten, sondern weil sich vor uns eine Menschenmenge versammelt hatte, offenbar für eine Versammlung. Wir drängten uns durch die Menge, und da wir alle eher kräftig gebaut waren, fiel es uns nicht schwer, uns bis ganz nach vorne zu schieben. Ein großgewachsener weißer Mann stand gestikulierend auf einem Ochsenkarren und pries das Wunder des Kommunismus. Er versuchte, die Bauern zu ermuntern, gegen die Landbesitzer zu rebellieren und diese zu töten. Er schwenkte eine Zeitung mit Bildern in die Luft, die einen scharfgesichtigen, bärtigen Mann zeigten, den er als den «Retter der Welt» bezeichnete. Doch weder die Bilder Lenins noch die Reden des Mannes beeindruckten uns. Angewidert wandten wir uns ab und zogen noch einige Kilometer weiter bis zu einem Lamakloster, in dem wir die Nacht verbringen wollten.
In verschiedenen Teilen Chinas, insbesondere in Sikang, Szechuan und Chinghai, gab es sowohl lamaistische als auch chinesische Klöster und Tempel. Viele Menschen dort zogen den tibetischen Buddhismus vor, deshalb wurden unsere Lamaklöster dort gebaut, um diejenigen zu lehren, die unsere Unterstützung brauchten. Wir strebten nie danach, Andersgläubige zu unserer Religion zu bekehren. Wir drängten niemanden, sich uns anzuschließen, da wir davon überzeugt sind, dass jeder seinen Glauben frei wählen sollte. Wir hatten auch nichts übrig für Missionare, die herumzogen und verkündeten, dass man sich dieser oder jener Religion anschließen müsse, um errettet zu werden. Wir waren überzeugt, dass diejenigen, die Lamaisten werden wollten, diesen Weg auch ohne unsere Überredung finden würden. Schließlich wussten wir selbst, wie wir über die Missionare gelacht haben, die nach Tibet und nach China kamen. Es war unter den Leuten ein verbreiteter Scherz, vorzugeben, bekehrt zu sein, nur um Geschenke und andere sogenannte Vorteile zu erhalten, die die Missionare verteilten. Zudem waren die Tibeter und die Chinesen, die noch der alten Ordnung folgten, sehr höfliche Menschen. Sie bemühten sich, den Missionaren Freude zu bereiten und sie in dem Glauben zu lassen, sie seien erfolgreich. Doch wir haben nie, auch nicht für einen Augenblick, an das geglaubt, was sie uns erzählten. Wir wussten, dass sie ihren eigenen Glauben hatten, aber wir bevorzugten es, unseren eigenen zu bewahren.
Wir zogen weiter und folgten dem Lauf des Yangtse, dem Fluss, den ich später noch so gut kennenlernen sollte. Dieser Weg war sehr angenehm. Fasziniert beobachteten wir die Boote auf dem Fluss. Wir hatten vorher noch nie Boote dieser Art gesehen, außer auf Bildern, und ich hatte einmal während einer besonderen hellsichtigen Sitzung mit meinem Mentor ein Dampfschiff gesehen. Doch dazu später mehr in diesem Buch.
In Tibet setzten unsere Bootsführer Koraks ein, Boote mit einem leichten Holzrahmengerüst, das mit Yakhaut überzogen war. Diese Boote konnten neben dem Bootsführer vier oder fünf Passagiere transportieren. Häufig führte der Bootsmann auch sein nichtzahlender Passagier, sein Haustier, eine Ziege, mit, die an Land zum Transport seiner Habseligkeiten diente. Während der Bootsführer das Boot über die Schulter hievte und über die Felsen kletterte, um Stromschnellen zu umgehen, die das Boot sonst zerstört hätten, trug die Ziege sein Gepäck und andere Lasten. Manchmal benutzte ein Bauer, der einen Fluss überqueren wollte, eine Ziegen- oder Yakhaut, deren Beine und andere Öffnungen abgedichtet wurden. Er benutzte dieses Hilfsmittel ähnlich wie die Menschen im Westen Schwimmflügel nutzen. Doch jetzt galt unser Interesse den eigentlichen Booten mit Segeln, Lateinersegeln, die im Wind flatterten.
An einem Tag blieben wir an einer seichten Stelle des Flusses mit unseren Pferden verblüfft stehen. Wir sahen zwei Männer, die ein langes Netz zwischen sich durch das flache Wasser zogen. Vor ihnen gingen zwei weitere Männer, die mit Stöcken auf das Wasser schlugen und dabei schrecklich laut schrien. Zuerst dachten wir, die beiden seien verrückt und die anderen mit dem Netz versuchten, sie einzufangen. Wir beobachteten sie weiter. Auf ein Zeichen eines Mannes verstummte der Lärm. Die Männer mit dem Netz liefen aufeinander zu, sodass ihr Weg sich kreuzte. Sie zogen die beiden Enden des Netzes zwischen sich zusammen und schleppten es ans Ufer. Dort angekommen, entleerten sie das Netz auf einer Sandbank, und mehrere Kilogramm schimmernde, zappelnde Fische fielen heraus. Das erschütterte uns zutiefst. Wir töten niemals, denn wir glauben, dass es nicht richtig ist, irgendein Lebewesen zu töten. In den Flüssen Tibets näherten sich Fische oft so nah einer ausgestreckten Hand, dass man sie berühren konnte. Sie fraßen einem aus der Hand und zeigten nicht die geringste Furcht vor den Menschen. Oft wurden sie auch als Haustiere gehalten. Hier in China jedoch dienten sie lediglich als Nahrung. Wir fragten uns, wie diese Chinesen sich Buddhisten nennen konnten, während sie so selbstverständlich für ihren eigenen Vorteil töteten.
Wir hatten viel zu viel Zeit vertrödelt. Wir waren vielleicht eine oder zwei Stunden am Flussufer gesessen. Es reichte uns also nicht mehr, für diese Nacht noch ein Lamakloster zu erreichen. Ergeben zuckten wir mit den Schultern und beabsichtigten, etwas abseits des Weges unser Nachtlager aufzuschlagen. Weiter vorne zur Linken entdeckten wir ein kleines, abgelegenes Wäldchen, durch das der Fluss floss. Wir ritten dorthin, stiegen ab und banden unsere Pferde so an, dass sie weiden und das für uns sehr üppige Gras fressen konnten.
Hier war es sehr leicht, Äste zu sammeln und ein Feuer zu machen. Wir kochten unseren Tee und aßen unser Tsampa. Eine Zeitlang saßen wir noch um das Feuer herum und unterhielten uns über Tibet, über das, was wir während der Reise gesehen und erlebt hatten, und darüber, wie wir uns die Zukunft vorstellten. Einer nach dem anderen meiner Begleiter gähnte, wandte sich ab, hüllte sich in seine Decke ein und schlief. Als schließlich die Glut versiegte und es dunkel wurde, wickelte auch ich mich in meine Decke ein und legte mich hin, aber nicht, um zu schlafen. Ich dachte an die vielen Entbehrungen, die ich ertragen hatte. Ich dachte an mein Elternhaus, das ich im Alter von sieben Jahren verlassen hatte, um in ein Lamakloster einzutreten. Ich dachte an die harten Umstände und die strenge Ausbildung. Ich dachte an meine Expeditionen ins Hochland und weiter nach Norden in das mächtige Chang-Tang-Hochgebirge. Ich dachte auch an den Erhabenen, wie wir den Dalai Lama nennen, und dann auch unvermeidlich an meinen geliebten Mentor, den Lama Mingyar Dondup. Ich war krank vor Sorge und tief betrübt. Auf einmal schien es, als würde die Landschaft wie von der Mittagssonne erhellt. Erstaunt blickte ich auf und sah vor mir meinen Mentor stehen.
«Lobsang! Lobsang!», rief er aus. «Warum bist du so niedergeschlagen? Hast du es schon vergessen? Auch das Eisenerz mag denken, es werde sinnlos im Schmelzofen gequält, doch wenn die gehärtete Klinge aus feinstem Stahl zurückschaut, weiß sie es besser. Du hast wirklich eine schwere Zeit durchgemacht, Lobsang, doch all das diente einem guten Zweck. Diese Welt ist, so wie wir oft darüber gesprochen haben, nur eine Illusion, eine Welt der Träume. Dir stehen noch viele Herausforderungen und viele harte Prüfungen bevor. Doch du wirst sie meistern und über sie triumphieren. Am Ende wirst du die Aufgabe erfüllen, die du dir vorgenommen hast.»
Ich rieb mir die Augen. Erst jetzt wurde es mir bewusst, ja natürlich, der Lama Mingyar Dondup war astralreisend zu mir gekommen. Ich selbst hatte das schon oft getan, doch er kam so unerwartet. Es zeigte mir deutlich auf, dass er immer an mich dachte und mir in Gedanken beistand.
Eine Zeitlang unterhielten wir uns über die Vergangenheit, sprachen über meine Schwächen und empfanden in einem flüchtigen, warmen Moment des Glücks die vielen schönen Zeiten nach, die wir wie Vater und Sohn miteinander verbracht hatten. Er zeigte mir mittels geistiger Bilder einige der Mühen auf, denen ich begegnen werde, und – was erfreulicher war – auch den möglichen Erfolg, den ich trotz aller fremden Versuche, diesen zu verhindern, erreichen könnte. Nach einer unbestimmten Zeit verblasste der goldene Schein, während mein Mentor seine letzten Worte der Hoffnung und Ermutigung immer wieder wiederholte. Mit diesen prägenden Gedanken legte ich mich unter dem frostigen Sternenhimmel nieder und schlief ein.
Am nächsten Morgen wachten wir früh auf und bereiteten unser Frühstück vor. Gemäß unserer Tradition begannen wir den Tag mit einer Morgenandacht, die ich als oberstes geistliches Mitglied unserer Gruppe leitete. Anschließend setzten wir unsere Reise auf dem Trampelpfad entlang des Flusses fort.
Gegen Mittag bog der Fluss nach rechts ab, doch wir folgten weiterhin dem geraden Weg. Dieser führte uns zu einer Straße, die uns ungewöhnlich breit erschien. Rückblickend war es tatsächlich nur eine kleine Straße, aber wir hatten zuvor noch nie eine solche von Menschenhand geschaffene Straße gesehen. Während wir weiterritten, waren wir von ihrer Beschaffenheit beeindruckt, besonders von dem Komfort, nicht ständig Wurzeln oder Schlaglöchern ausweichen zu müssen. Unsere Pferde trotteten gemächlich die Straße entlang, und wir rechneten damit, Chungking in zwei oder drei Tagen zu erreichen. Plötzlich trug der Wind etwas Unerklärliches zu uns herüber, das uns veranlasste, einander beunruhigt anzublicken. Einer meiner Kameraden schaute zufällig zum fernen Horizont, richtete sich erschrocken in den Steigbügeln auf, machte große Augen und gestikulierte heftig mit den Händen.
«Schaut!», rief er. «Da kommt ein Sandsturm!»
Er zeigte nach vorn, von wo sich uns zweifellos eine grauschwarze Wolke mit beträchtlicher Geschwindigkeit näherte. Auch in Tibet kennen wir Sandstürme, die feine Sandkörner mit sich führen und mit über hundertdreißig Stundenkilometern über das Land fegen. Alle mussten sich dann vor ihnen in Sicherheit bringen, außer den Yaks. Die dicke Wolle der Yaks schützte sie vor Verletzungen, doch alle anderen Lebewesen, vor allem die Menschen, werden durch diese scharfkantigen Sandkörner verletzt, die ihnen Hände und Gesichter so zerkratzten, dass es blutete. Wir waren beunruhigt, da dies der erste Sandsturm war, den wir erlebten, seit wir Tibet verlassen hatten. Wir schauten uns suchend nach Schutz um, konnten jedoch nichts Geeignetes finden. Zu unserem Entsetzen war die herannahende Wolke von einem merkwürdigen Geräusch begleitet, das seltsamer klang als alles, was wir je gehört hatten. Es erinnerte an eine Tempeltrompete, die von einem völlig unmusikalischen Anfänger gespielt wurde, oder – wie wir leidvoll dachten – an eine Teufelsheerschar, die auf uns zu marschierte. «Thrum-Thrum-Thrum» dröhnte es immer lauter und unheimlicher, begleitet von einem Rasseln und Klappern. Wir waren derart verängstigt, dass wir uns kaum noch rühren und klar denken konnten. Die Staubwolke raste immer schneller auf uns zu. Wir waren vor Angst beinahe wie erstarrt. Wieder dachten wir an die Staubwolken in Tibet, aber die hatten sich uns nicht mit einem solchen Lärm genähert. In großer Panik schauten wir uns erneut nach einem Unterschlupf um, nach einem Ort, an dem wir uns vor diesem fürchterlichen Sturm, der auf uns zukam, schützen konnten. Unsere Pferde brauchten nicht annähernd so lange wie wir, um zu entscheiden, in welche Richtung sie sich wenden sollten. Sie stoben auseinander, stellten sich auf die Hinterbeine und bäumten sich auf. Ich hatte den Eindruck, als würden die Hufe meines Pferdes in die Luft schnellen, während es sein kräftigstes Wiehern von sich gab. Es schien sich in der Mitte durchzubiegen, gefolgt von einem eigenartigen Ruck und dem Gefühl, als sei irgendetwas gebrochen.
«Oh, mein Bein ist abgerissen worden!», dachte ich erschrocken. Darauf trennte sich mein Pferd von meiner Gesellschaft. Ich segelte in hohem Bogen durch die Luft und landete flach auf dem Rücken neben der Straße, wo ich wie gelähmt liegenblieb. Schnell kam die Staubwolke näher. In ihrem Innern erblickte ich den Teufel persönlich. Ein röhrendes schwarzes Ungeheuer, das ratterte und brüllte. Es kam und fuhr an mir vorbei. Flach auf dem Rücken liegend und völlig verwirrt, hatte ich mein erstes Auto gesehen – einen alten, verbeulten amerikanischen Lastwagen, der lärmend mit Höchstgeschwindigkeit fuhr und von einem grinsenden Chinesen gesteuert wurde. Und erst der Gestank! «Teufelsatem» nannten wir es später. Eine Mischung aus Benzin, Öl und Kuhmist. Der Mist, den er geladen hatte, schüttelte es nach und nach über den Rand, und ein Teil davon landete mit einem lauten Platschen neben mir. Der Lastwagen donnerte vorbei, zog eine Staubwolke und schwarze Rauchfahnen hinter sich her. Bald war er nur noch ein kleiner, tanzender Punkt in der Ferne, der unsicher von einer Seite der Straße zur anderen schwankte, während der Lärm langsam nachließ und schließlich verstummte.