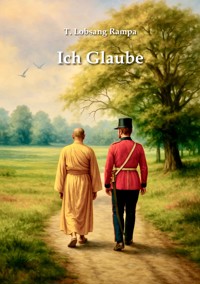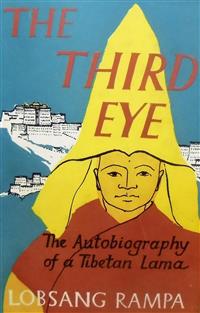0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
"Leben mit dem Lama" erzählt die bewegende Lebensgeschichte von Mrs. Fifi Greywhiskers, einer sanftmütigen Siamkatze, die auf einem stattlichen Anwesen eines Botschafters in Frankreich aufwächst. Als Zuchtkatze der Diplomatengattin fristet sie ein entbehrungsreiches Dasein, geprägt von Vernachlässigung und ständigen Reisen. Schicksalshaft findet sie schließlich im fortgeschrittenen Alter Aufnahme und ein glückliches Zuhause bei dem tibetischen Lama Lobsang Rampa und seiner Familie. Dort erfährt sie endlich Verständnis und die lang ersehnte Geborgenheit. Der Lama und Fifi fühlen sich auf besondere Weise tief verbunden, und so diktiert sie ihm auf telepathischem Wege ihre ergreifende Geschichte, die er sorgsam zu Papier bringt. Erleben Sie eine aussergewöhnliche Verbindung zwischen Mensch und Katze, die auf diese Art und Weise einzigartig ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
T. Lobsang Rampa
Leben mit dem Lama
Von Mrs. Fifi Greywhiskers übersetzt aus der siamesischen Katzensprache von T. Lobsang Rampa Illustriert von Sheelagh M. Rouse
Widmung
Ma, die uns stets pflegte, wenn wir krank waren, immer auf uns achtgab, wenn wir es brauchten, und die uns bedingungslos liebte, zu jeder Zeit.
Klappentext
«Leben mit dem Lama» erzählt die bewegende Lebensgeschichte von Mrs. Fifi Greywhiskers, einer sanftmütigen Siamkatze, die auf einem stattlichen Anwesen eines Botschafters in Frankreich aufwächst. Als Zuchtkatze der Diplomatengattin fristet sie ein entbehrungsreiches Dasein, geprägt von Vernachlässigung und ständigen Reisen. Schicksalshaft findet sie schließlich im fortgeschrittenen Alter Aufnahme und ein glückliches Zuhause bei dem tibetischen Lama Lobsang Rampa und seiner Familie. Dort erfährt sie endlich Verständnis und die lang ersehnte Geborgenheit. Der Lama und Fifi fühlen sich auf besondere Weise tief verbunden, und so diktiert sie ihm auf telepathischem Wege ihre ergreifende Geschichte, die er sorgsam zu Papier bringt. Erleben Sie eine aussergewöhnliche Verbindung zwischen Mensch und Katze, die auf diese Art und Weise einzigartig ist.
Vorwort
«Du bist wohl nicht ganz bei Trost, Fifi», sagte der Lama. «Wer sollte dir schon glauben, dass DU ein Buch geschrieben hast?» Er lächelte mich an, kraulte mich unter meinem Kinn, so wie ich es am liebsten mochte, und verließ den Raum, um etwas zu erledigen.
Ich saß da und begann zu überlegen. Warum, bitte schön, sollte ich nicht ein Buch schreiben? Ja, es stimmt, dass ich nur eine Katze bin, aber nicht irgendeine Katze. Oh nein! Ich bin eine Siamkatze, die weit gereist ist und viel gesehen hat. Gesehen? Nun, inzwischen bin ich völlig blind und auf den Lama und auf Lady Ku’ei angewiesen, die mir meine gegenwärtige Umgebung beschreiben müssen, aber ich habe meine Erinnerungen!
Natürlich bin ich alt, sehr alt sogar, und auch ein wenig gebrechlich. Doch das hindert mich nicht daran, die Ereignisse meines Lebens zu Papier zu bringen, solange ich noch dazu in der Lage bin.
Hier liegt also meine Geschichte vor, mit dem Titel «Leben mit dem Lama». Es waren die glücklichsten Tage meines Lebens. Es waren Tage des Sonnenscheins nach einem Leben voller Schatten.
Mrs. Fifi Greywhiskers
Kapitel 1
Meine zukünftige Mutter schrie sich ihre Seele aus dem Leib. «Ich will einen Kater», schrie sie, «einen schönen, stattlichen Kater!» Ihre raue Stimme wurde von allen als unerträglich empfunden. Aber meine Mutter war für ihre laute Stimme bekannt. Auf ihr nachdrückliches Verlangen hin wurden die allerbesten Katzenzüchter von ganz Paris durchkämmt, um für sie einen geeigneten Siamkater mit dem erforderlichen Stammbaum zu finden. Immer schriller und lauter wurde die Stimme meiner Mutter, und immer verzweifelter wurden die Menschen, während sie sich mit erneuter Anstrengung auf die Suche machten.
Schließlich wurde ein passender Kandidat gefunden und er und meine zukünftige Mutter wurden einander offiziell vorgestellt. Aus dieser Begegnung bin ich im Laufe der Zeit hervorgegangen, und nur ich allein durfte leben, meine Brüder und Schwestern wurden ertränkt.
Meine Mutter und ich lebten bei einer alteingesessenen französischen Familie, die ein großes Anwesen am Rande von Paris besaß. Der Mann war ein hochrangiger Diplomat, der fast täglich in die Stadt fuhr und oft abends nicht heimkehrte, sondern bei seiner Mätresse in der Stadt blieb. Madame Diplomat, seine hartherzige, oberflächliche und unzufriedene Frau, lebte mit uns zusammen und betrachtete uns Katzen nicht als «Personen» (wie wir es für den Lama sind), sondern nur als schmückendes Beiwerk, mit denen man bei Teepartys angeben konnte.
Meine Mutter hatte eine wunderschöne Figur, ein tiefschwarzes Gesicht, und einen stolz aufgerichteten Schwanz. Sie hatte sehr viele Preise gewonnen. Eines Tages, noch bevor ich vollständig entwöhnt war, sang sie ein Lied lauter als üblich. Dies brachte Madame Diplomat so in Rage, dass sie den Gärtner rief und befahl: «Pierre, bring sie zum Teich, aber sofort, ich kann das Geschrei nicht mehr länger ertragen.» Pierre, ein untersetzter, fahlgesichtiger Franzose, der uns hasste, weil wir ihm manchmal bei der Gartenarbeit halfen, indem wir die Pflanzenwurzeln inspizierten, um ihr Wachstum zu überprüfen, hob meine Mutter auf, meine wunderschöne Mutter, steckte sie in einen alten schmutzigen Kartoffelsack und marschierte mit ihr davon. In dieser Nacht weinte ich mich jämmerlich, verlassen und verängstigt, in einem kalten Schuppen in den Schlaf, wo Madame Diplomat nicht durch mein Wehklagen gestört würde.
Ich wälzte mich unruhig und fiebrig auf meinem kalten Bett aus alten Pariser Zeitungen, die man auf den Betonboden geworfen hatte, hin und her. Der Hunger nagte an meinem kleinen Körper, und die Sorge, wie ich durchkommen sollte, quälte mich.
Als die ersten Lichtstrahlen der Morgendämmerung zaghaft durch die von Spinnweben verhangenen Fenstern des Schuppens schienen, schreckte ich besorgt auf, als schwere Schritte den Pfad hinaufklapperten und an der Tür zögerten. Dann wurde die Tür geöffnet, und jemand trat ein. «Ah», dachte ich erleichtert, «es ist nur Madame Albertine, die Haushälterin.» Ächzend und keuchend beugte sie ihren massigen Körper hinunter, tauchte einen riesigen Finger in eine Schüssel mit warmer Milch und überredete mich fürsorglich, zu trinken.
Tagelang suchte ich im Schatten der Trauer überall nach meiner ermordeten Mutter, die einzig wegen ihrer herrlichen Singstimme getötet wurde. Tagelang spürte ich weder die Wärme der Sonne, noch vermochte mich der Klang einer wohlmeinenden Stimme zu erheitern. Ich hungerte, ich war durstig und völlig auf die guten Dienste von Madame Albertine angewiesen. Ohne sie wäre ich verhungert, denn ich war damals noch zu jung, um mich selbst ernähren zu können.
Die Tage schleppten sich dahin und wurden zu Wochen. Ich lernte, mich durchzuschlagen, doch die Entbehrungen in den frühen Tagen meines Lebens hinterließen bleibende Spuren in Form einer schwachen Konstitution. Das Anwesen war riesig. Ich wanderte oft herum und ging den Menschen und ihren ungeschickten und führungslosen Beinen aus dem Weg. Am liebsten kletterte ich auf Bäume, legte mich auf einen Ast und ließ mich von der Sonne wärmen. Dabei flüsterten mir die Bäume zu und erzählten mir von den glücklicheren Tagen, die im Herbst meines Lebens kommen würden. Damals verstand ich ihre Worte nicht, doch ich vertraute ihnen und bewahrte sie fest in meinem Gedächtnis, selbst in den dunkelsten Stunden.
Eines Morgens wachte ich auf, mit einem sonderbaren, undefinierbaren Verlangen. Ein verzweifelter Schrei entfuhr mir, den unglücklicherweise Madame Diplomat vernahm. «Pierre!», rief sie. «Hol einen Kater, irgendeiner genügt, um sie abzustellen.»
Später am Tag wurde ich gefasst und grob in eine hölzerne Kiste geworfen. Kaum war mir bewusst, dass noch jemand anwesend war, sprang schon ein alter Kater auf meinen Rücken. Meine Mutter hatte keine Gelegenheit mehr gehabt, mir viel über die «Tatsachen des Lebens» zu erzählen, daher war ich auf das, was folgte, nicht vorbereitet. Der zerzauste alte Kater stürzte sich auf mich, und ich fühlte einen entsetzlichen Stoß. Einen Augenblick lang dachte ich, einer der Familie hätte mir einen Fußtritt gegeben. Ein höllisch stechender Schmerz durchzuckte mich, und ich spürte, wie etwas zerriss. Ich schrie vor Schmerzen und Schrecken und attackierte den alten Kater heftig. Blut spritzte aus einem seiner Ohren, und seine schreiende Stimme vermischte sich mit meiner. Wie ein Blitz wurde der Deckel der Kiste aufgerissen, und erschrockene Augen starrten hinein. Ich sprang hinaus, und während ich entwischte, sah ich, wie der alte Kater fauchend und zischend direkt in den alten Pierre sprang. Dieser taumelte rückwärts und fiel vor die Füße von Madame Diplomat.
Ich flitzte über den Rasen und suchte Schutz auf einem freundlichen Apfelbaum. Ich kletterte den einladenden Baumstamm hoch und erreichte meinen Lieblingsast und legte mich keuchend hin. Das Rascheln der Blätter in der Brise beruhigte mich, während die Äste mich sanft in den Schlaf der Erschöpfung wiegten.
Den ganzen restlichen Tag und die ganze Nacht lag ich auf dem Ast; hungrig, verängstigt und krank. Ich fragte mich, warum die Menschen solche Rohlinge waren, so gleichgültig gegenüber den Gefühlen kleiner Tiere, die vollkommen von ihnen abhingen. Die Nacht war kalt, und von Paris zog ein leichter Nieselregen herüber. Ich war durchnässt und zitterte, aber ich war viel zu verängstigt, um herunterzusteigen und Schutz zu suchen.
Das kalte Morgenlicht wich langsam dem tristen Grau eines bedeckten Tages. Schwere Wolken zogen tief über den Himmel, und gelegentlich regnete es. Gegen Mittag tauchte eine vertraute Gestalt vor dem Hause auf. Madame Albertine näherte sich mit schwerem Gang dem Baum, kurzsichtig schaute sie hinauf und rief mich mit wohlwollender Stimme. Ich antwortete schwach, und sie streckte ihre Hand nach mir aus. «Ach, meine arme kleine Fifi, komm schnell zu mir, ich habe Essen für dich.» Vorsichtig kroch ich auf dem Ast rückwärts und kletterte den Baumstamm hinunter. Im Gras kniete sie neben mir, streichelte mich, während ich die Milch trank und das Fleisch aß, das sie mitgebracht hatte. Nach dem Essen rieb ich mich dankbar an ihr, denn ich wusste, dass sie meine Sprache nicht sprach, und ich sprach kein Französisch (obwohl ich alles verstand). Sie hob mich auf ihre breiten Schultern, trug mich ins Haus und nahm mich mit in ihr Zimmer.
Es war das erste Mal, dass ich dort war und ich schaute mich neugierig und interessiert um, fasziniert von der Einrichtung, die dazu einlud, sich die Krallen daran zu wetzen. Madame Albertine, die mich immer noch auf ihren Schultern trug, bewegte sich schwerfällig zu einem breiten Fenster und schaute hinaus. «Ach», seufzte sie schwer, «das Schlimme ist, dass es inmitten all dieser Schönheit so viel Grausamkeit gibt.» Sie nahm mich auf ihren üppigen Schoß und sprach zu mir: «Meine arme, hübsche kleine Fifi. Madame Diplomat ist eine harte und gefühllose Frau. Eine gesellschaftliche Aufsteigerin, wie sie im Buche steht. Für sie bist du nur ein Spielzeug, um damit anzugeben. Für mich bist du ein Geschöpf des allmächtigen Herrn. Aber du wirst das, was ich sage, nicht verstehen, kleine Katze!» Ich schnurrte, um ihr zu zeigen, dass ich es verstand und leckte ihre Hand ab. Sie tätschelte mich und meinte: «Oh, wie viel Liebe steckt in dir. Du wirst eine gute Mutter werden, kleine Fifi.»
Auf ihrem Schoß machte ich es mir bequem und schaute aus dem Fenster. Die Aussicht war so interessant, dass ich aufstehen und meine Nase gegen die Scheibe drücken musste, um einen besseren Ausblick zu haben. Madame Albertine lächelte mich liebevoll an, während sie spielerisch an meinem Schwanz zog, aber die Aussicht nahm meine ganze Aufmerksamkeit ein. Sie drehte sich um und ließ sich mit einem Plumps auf ihre Knie fallen, und wir schauten zusammen, Wange an Wange, aus dem Fenster.
Unter uns erstreckte sich der gepflegte Rasen wie ein glatter grüner Teppich, gesäumt von einer Allee stattlicher Bäume. Ein sandiger Weg führte in einer leichten Linkskurve zum Tor, hinter dem man das gedämpfte Rauschen des vorbeifahrenden Verkehrs vernehmen konnte. Mein alter Freund, der Apfelbaum, stand einsam und aufrecht am Rande eines kleinen künstlich angelegten Teichs. Auf dessen Oberfläche spiegelte sich das düstere Grau des Himmels, und er nahm den Glanz von altem Blei an. Rund um den Wasserrand wuchs ein spärlicher Streifen Schilf, der mich an die Haarfransen auf dem Kopf des alten Pfarrers erinnerte, der gelegentlich den «le Duc», den Ehemann von Madame Diplomat, besuchte (frz. le Duc, dt. der Herzog, Anm. d.Ü.).
Ich starrte erneut auf den Teich und dachte an meine arme Mutter, die dort umgebracht worden war. «Und wie viele andere?», fragte ich mich. Madame Albertine schaute mich plötzlich an und sagte: «Warum weinst du, meine kleine Fifi? Ja, ich glaube, ich sehe da eine Träne. Es ist eine schreckliche, schreckliche Welt, kleine Fifi, unbarmherzig für uns alle.»
Plötzlich bogen in der Ferne kleine schwarze Punkte auf den Fahrweg ein, von denen ich wusste, dass es Autos waren, und brausten auf das Haus zu, wo sie in einer Staubwolke und mit quietschenden Reifen vor der Eingangstreppe zum Stehen kamen. Fast im selben Moment ertönte ein schrilles Klingeln, sodass mir das Fell zu Berge stand und sich mein Schwanz aufplusterte. Madame Albertine nahm den Hörer des Haustelefons ab, und ich hörte die schrille Stimme von Madame Diplomat: «Albertine, Albertine, ich bitte Sie, sofort herunterzukommen. Wir haben Besuch bekommen. Und außerdem, warum sind Sie um diese Uhrzeit auf Ihrem Zimmer? Wozu bezahle ich Sie überhaupt? Dass ich Sie behalte, verdanken Sie nur meiner Großzügigkeit. Sie sollten nicht so herumfaulenzen, Albertine!» Die Stimme verstummte, und Madame Albertine seufzte frustriert: «Ach, das hat mir der Krieg eingebrockt. Nun arbeite ich sechzehn Stunden am Tag für einen Hungerlohn. Ruh dich aus, kleine Fifi, und hier ist eine Kiste mit Erde.» Sie seufzte erneut, tätschelte mich einmal mehr und ging aus dem Zimmer. Ich hörte die Treppe unter ihrem Gewicht knarren, dann – war Stille.
Auf der Steinterrasse unter meinem Fenster wimmelte es von Menschen. Madame Diplomat verbeugte sich so unterwürfig, dass ich wusste, es handelte sich um wichtige Personen. Kleine Tische erschienen wie durch Zauberhand, mit feinen weißen Tüchern bedeckt (meine Tischtücher waren benutzte Zeitungen der Le Paris Soir), und Bedienstete trugen in rauen Mengen Essen und Getränke heraus. Ich wandte mich ab, um mich zusammenzurollen, als ein plötzlicher Gedanke durch meinen Kopf schoss, der meinen Schwanz vor Schreck aufplustern ließ. Ich hatte die grundlegendste Vorsichtsmaßnahme vergessen, das Allerwichtigste, was mir meine Mutter beigebracht hatte. «Untersuche IMMER zuerst einen fremden Raum, Fifi», hatte sie gesagt. «Durchforste alles gründlich. Überprüfe alle Fluchtwege. Sei auf der Hut vor dem Ungewöhnlichen, dem Unerwarteten. Ruhe niemals, bis du den Raum kennst!»
Schuldbewusst erhob ich mich und erschnupperte die Luft, und überlegte, wie ich vorgehen sollte. Ich würde zuerst bei der linken Wand beginnen und mich dann rundherum durcharbeiten. Ich sprang zu Boden, spähte unter den Fenstersessel und schnupperte nach allem Ungewöhnlichem. So lernte ich die Umgebung, die Gefahren und die Vorteile kennen. Die Tapete war blumig und verblichen – große gelbe Blumen auf einem lilafarbenen Hintergrund. Hohe, blitzsaubere Stühle mit verblasstem roten Samtbezug. Die Unterseiten von Stühlen und Tischen waren sauber und frei von Spinnweben. Katzen, wissen Sie, sehen die Unterseite der Dinge, nicht die Oberseite, und Menschen betrachten die Welt nicht aus unserer Perspektive.
An einer Wand stand eine hohe Kommode, und ich begab mich in die Mitte des Raumes, um zu überlegen, wie ich darauf gelangen könnte. Nach einer schnellen Einschätzung entschied ich mich, von einem Stuhl auf den Tisch zu springen – oh, wie glatt er war! Von dort aus konnte ich dann die Kommode erreichen. Eine Weile saß ich da, wusch mein Gesicht und die Ohren und dachte über die Situation nach. Beiläufig blickte ich hinter mich und wäre vor Schreck beinahe umgefallen. Eine Siamkatze schaute mich an – offensichtlich hatte ich sie beim Waschen gestört. «Seltsam», dachte ich, «ich habe nicht erwartet, hier eine Katze anzutreffen. Madame Albertine musste sie geheim gehalten haben. Ich will ihr wenigstens ‹Hallo› sagen.» Ich ging auf sie zu, und sie schien dieselbe Idee zu haben und kam ebenfalls auf mich zu. Wir blieben stehen, mit einer Art Fenster zwischen uns. «Erstaunlich!», überlegte ich. «Wie kann das sein?» Vorsichtig, in Erwartung eines Tricks, spähte ich hinter das Fenster. Aber dort war niemand. Erstaunlicherweise kopierte sie jede Bewegung, die ich machte. Schließlich dämmerte es mir. Dies war ein Spiegel, ein seltsames Ding, von dem mir meine Mutter einmal erzählt hatte. Natürlich war das der Erste, den ich je gesehen hatte, denn dies war mein erster Besuch im Haus. Madame Diplomat war sehr eigen, und Katzen waren im Haus nicht erlaubt, es sei denn, sie wollte mit uns angeben – mir war diese Demütigung bisher erspart geblieben.
«Trotzdem», murmelte ich zu mir selbst, «ich sollte mit meinen Nachforschungen fortfahren. Der Spiegel kann warten.» Auf der anderen Seite des Raumes sah ich eine große metallene Einrichtung mit Messingkugeln an jeder Ecke, und der gesamte Raum zwischen den Kugeln war mit einem Tuch bedeckt. Schnell sprang ich von der Kommode auf den Tisch und rutschte ein wenig auf der hochpolierten Oberfläche, und sprang dann direkt auf das Tuch, das auf der metallenen Einrichtung lag. Ich landete in der Mitte, und zu meinem Schrecken hob mich das Ding in die Luft! Als ich wieder landete, begann ich loszulaufen, während ich überlegte, was ich als Nächstes tun sollte.
Einige Augenblicke lang saß ich auf dem rot-blauen Teppich mit dem Wirbelmuster. Obwohl er makellos sauber war, hatte er schon bessere Tage gesehen. Er schien perfekt, um meine Krallen daran zu wetzen, also zerrte ich ein wenig daran, und es half mir, klarer zu denken. Ja, natürlich! Diese große Einrichtung war ein Bett. Mein Bett bestand aus alten Zeitungen auf dem Betonboden eines Schuppens, während Madame Albertine ein altes Tuch über ein Eisengestell gelegt hatte. Vor Freude schnurrte ich, dass ich das Rätsel allein gelöst hatte, und untersuchte interessiert die Unterseite davon. Riesige Sprungfedern, von einem offensichtlich enorm großen Sack bedeckt, trugen das Gewicht der darauf liegenden Tücher. Ich konnte deutlich erkennen, wo Madame Albertines beleibter Körper einige der Federn verbogen und durchhängen ließ.
Im Interesse einer gezielten Erforschung zog ich an einem herabhängenden Zipfel eines gestreiften Stoffs auf der hinteren Seite nahe der Wand. Zu meinem ungläubigen Schrecken flatterten aus einem Riss Federn heraus. «Du heiliger Kater!», rief ich aus. «Madame Albertine bewahrt hier tote Vögel auf. Kein Wunder, ist sie so dick – sie muss sie in der Nacht essen.» Nach einem weiteren flüchtigen Schnüffeln rundum, hatte ich alle Möglichkeiten des Bettes ausgeschöpft.
Ich schaute mich um und überlegte, was ich als Nächstes erkunden sollte. Eine offene Tür fiel mir ins Auge. Nach einem halben Dutzend Sprüngen hockte ich mich vorsichtig an einen Türpfosten, beugte mich vor und erhaschte mit einem Auge einen ersten Blick. Das Bild war so seltsam, dass ich nicht gleich begreifen konnte, was ich sah. Alles auf dem Boden glänzte und hatte ein schwarz-weißes Muster. An einer Wand stand eine riesige Pferdetränke (ich wusste, was das ist, wir hatten solche in der Nähe der Ställe), und an der anderen Wand befand sich die größte Porzellantasse, die ich mir je vorstellen konnte. Die Tasse stand auf einem Holzpodest und hatte einen weißen, hölzernen Deckel. Meine Augen wurden runder und runder, und ich musste mich hinsetzen und mein rechtes Ohr kratzen, während ich über all das nachdachte. Wer würde denn schon aus einem so großen Ding trinken wollen, fragte ich mich.
In diesem Moment hörte ich, wie Madame Albertine die knarrende Treppe hinaufstieg. Ohne mich nochmals zu vergewissern, ob meine Schnurrhaare auch ordentlich zurückgekämmt waren, eilte ich zur Tür, um sie zu begrüßen. Auf meine Freudenrufe strahlte sie und sagte: «Ach, kleine Fifi! Ich habe für dich die besten Reste auf den Tellern gesammelt. Die Sahne und die Froschschenkel sind für dich. All diese fetten Schweine stopfen sich gerade bei ihrem Gelage den Bauch voll. Puh! Sie machen mich krank!» Sie beugte sich herunter und stellte die Teller – echte Teller – direkt vor mich hin. Doch ich hatte jetzt keine Zeit zum Essen. Ich musste ihr sagen, wie gerne ich sie hatte. Ich schnurrte laut, als sie mich hochhob und mich an ihre warme Brust drückte.
Diese Nacht schlief ich am Fuße von Madame Albertines Bett. Zusammengekuschelt auf der riesigen Bettdecke fühlte ich mich so wohl wie noch nie zuvor, seit mir meine Mutter genommen worden war. Meine Ausbildung schritt voran, und ich erkannte den wahren Zweck der «Pferdetränke» und dem, was ich in meiner Unwissenheit für eine riesige Porzellantasse gehalten hatte. Bei dem Gedanken, wie unwissend ich war, errötete ich im ganzen Gesicht und am Hals.
Am Morgen kleidete sich Madame Albertine an und ging nach unten. Ich hörte viele Geräusche und laute Stimmen. Vom Fenster aus sah ich Gaston, den Chauffeur, wie er den großen Renault auf Hochglanz polierte. Dann verschwand er und kehrte kurz darauf in seiner besten Uniform zurück. Er fuhr zum Vordereingang, und die anderen Bediensteten luden den Kofferraum mit vielen Koffern und Taschen voll. Ich duckte mich tiefer. Monsieur «le Duc» und Madame Diplomat gingen zum Auto, stiegen ein und wurden von Gaston den Fahrweg hinuntergefahren.
Kaum waren sie losgefahren, drang Lärm von unten hoch und wurde lauter. Doch dieses Mal klang es, als würden die Menschen feiern. Madame Albertine kam keuchend die knarrende Treppe hinauf. Sie war ganz rot vor Freude und vom Wein, den sie getrunken hatte, um die Abreise der Herrschaften zu feiern. «Sie sind gegangen, kleine Fifi», schrie sie, offensichtlich dachte sie, ich wäre taub. «Sie sind gegangen – eine ganze Woche lang. Nieder mit der Tyrannei! Nun können wir schalten und walten, wie wir wollen!» Sie nahm mich zu sich hoch und trug mich die Treppe hinunter, wo eine Feier im Gange war. Die Bediensteten sahen jetzt alle glücklicher aus, und ich war äußerst stolz, dass mich Madame Albertine trug, obwohl ich befürchtete, dass mein Gewicht von zwei Kilo sie vielleicht ermüden könnte.
Eine Woche lang schnurrte der ganze Haushalt. Am Ende der Woche wurde das ganze Haus aufgeräumt, und alle setzten ihre miserabelste Miene auf, um sich auf die Rückkehr von Madame Diplomat und ihrem Mann vorzubereiten. Um ihn haben wir uns überhaupt nicht gekümmert, denn er lief gewöhnlich herum und fummelte an seinem Knopf der Ehrenlegion herum, als hätte er Angst, ihn zu verlieren. Jedenfalls dachte er mehr an den Dienst für den Staat als an Bedienstete und Katzen. Madame Diplomat war das Problem. Sie war ein richtiger Drachen, und es war wie eine Gnadenfrist vor der Guillotine, als wir erfuhren, dass sie noch ein oder zwei Wochen weg sein würden, da sie sich anscheinend mit «wichtigen Personen» trafen.
Die Zeit verging wie im Flug. Morgens half ich den Gärtnern, eine oder zwei Pflanzen umzugraben, um zu sehen, ob sich die Wurzeln richtig entwickelten. Nachmittags zog ich mich auf einen bequemen Ast des alten Apfelbaums zurück und träumte von einem wärmeren Klima und von uralten Tempeln, in denen Priester in gelben Roben schweigend ihren religiösen Pflichten nachgingen. Plötzlich wurde ich vom Lärm der Flugzeuge der französischen Luftwaffe aufgeschreckt, die wie verrückt über den Himmel donnerten.
Ich wurde jetzt langsam schwerer, und meine jungen Kätzchen begannen sich in mir zu regen. Es war nicht mehr so leicht, sich zu bewegen, und ich musste auf meine Schritte achten. Seit einigen Tagen hatte ich die Angewohnheit, in die Molkerei zu gehen und zuzuschauen, wie die Milch von den Kühen in ein Gerät geschüttet wurde, das surrte und sich dann in zwei Ströme teilte – einen mit Milch und einen mit Sahne. Ich saß auf einem niedrigen Regal, sodass ich niemandem im Weg war. Die Milchmagd sprach mit mir, und ich antwortete ihr.
Eines Abends saß ich auf dem Regal, nicht weit von einer halbvollen Milchkanne entfernt. Die Milchmagd unterhielt sich mit mir über ihren neuen Freund, und ich schnurrte und versicherte ihr, dass zwischen ihnen alles in Ordnung sei. Plötzlich war ein ohrenbetäubender Schrei zu hören, wie von einem Kater, dem man auf den Schwanz getreten ist. Madame Diplomat stürzte in die Molkerei und schrie: «Ich hab’ euch doch gesagt, ihr sollt hier keine Katzen reinlassen, ihr werdet uns noch vergiften!» Sie nahm das Erstbeste, was sie in die Finger kriegen konnte, ein Kupfermaß, und warf es mit aller Kraft gegen mich. Es traf mich heftig in die Seite und schleuderte mich in die Milchkanne. Der Schmerz war schrecklich. Ich konnte kaum paddeln, um obenauf zu bleiben. Ich spürte die Lebensgeister aus mir weichen. Der Boden der Molkerei erzitterte unter schweren Schritten, und Madame Albertine erschien. Schnell kippte sie die Kanne um und goss die blutgetränkte Milch aus. Sachte Hände hoben mich auf. «Ruft den Tierarzt», befahl sie. Ich wurde ohnmächtig.
Als ich erwachte, befand ich mich in Madame Albertines Schlafzimmer in einer warmen, kuscheligen Kiste. Drei Rippen waren gebrochen, und ich hatte meine jungen Kätzchen verloren. Eine Zeit lang war ich sehr krank. Der Tierarzt kam sehr oft, um nach mir zu sehen. Man erzählte mir, dass er mit Madame Diplomat ein sehr ernstes Gespräch geführt hatte. Er hatte sogar von Grausamkeit gesprochen, von sinnloser Grausamkeit. Und er hatte hinzugefügt, dass sie sich mit so einem Verhalten keine Freunde machen würde, zumal die Hausangestellten ihm, dem Tierarzt, versichert hatten, dass ich ein tapferes, sauberes und sehr ehrliches Kätzchen sei.
Madame Albertine netzte meine Lippen mit Wasser, denn mir wurde bei dem Gedanken an Milch ganz übel. Tag für Tag versuchte sie, mich zu überreden, zu essen. Der Tierarzt sagte: «Es besteht jetzt keine Hoffnung mehr. Sie wird sterben. Sie wird keinen weiteren Tag ohne Nahrung überleben.» Ich fiel in ein Koma. Von irgendwoher schien ich ein Rauschen der Bäume und das Knacken von Ästen zu hören. «Kleine Katze», sagte der Apfelbaum, «kleine Katze, dies ist nicht das Ende. Erinnerst du dich, was ich dir gesagt habe, kleine Katze.» Seltsame Geräusche summten in meinem Kopf herum. Ich sah ein helles gelbes Licht, ich sah wunderschöne Bilder und roch die Freuden des Himmels. «Kleine Katze», flüsterten die Bäume, «dies ist nicht das Ende. Esse und lebe. Esse und lebe. Dies ist nicht das Ende. Du hast eine Bestimmung in deinem Leben, kleine Katze. Du wirst deine Tage in Freude beenden, wenn die Jahre erfüllt sind. Nicht jetzt. Dies ist nicht das Ende.»
Müde öffnete ich meine Augen und hob meinen Kopf leicht an. Madame Albertine kniete neben mir, große Tränen liefen ihr die Wangen herunter, und hielt mir fein geschnittenes Hühnerfleisch hin. Der Tierarzt stand an einem Tisch und zog eine Spritze aus einer Flasche auf. Schwach nahm ich ein Stückchen Fleisch, hielt es einen Augenblick in meinem Mund und schluckte es. «Ein Wunder! Ein Wunder!», sagte Madame Albertine.
Der Tierarzt drehte sich mit offenem Mund um, legte langsam die Spritze hin und kam zu mir herüber. «Es ist, wie Sie sagen, ein Wunder», bemerkte er. «Ich war gerade dabei, die Gnadenspritze aufzuziehen, um sie von ihrem Leiden zu erlösen.» Ich lächelte sie an und schnurrte dreimal – das war alles, wozu ich in der Lage war. Als ich wieder in den Schlaf fiel, hörte ich ihn sagen: «Sie wird sich erholen.»
Eine Woche lang befand ich mich in einem schlechten Zustand. Ich konnte nicht tief einatmen und auch nicht mehr als ein paar Schritte gehen. Madame Albertine hatte mir meine Kiste mit Erde ganz nahe neben mich hingestellt, damit ich meine guten Gewohnheiten nicht verlor, die mir meine Mutter beigebracht hatte. Etwa eine Woche später trug mich Madame Albertine nach unten. Madame Diplomat blieb am Eingang eines Raumes stehen und schaute uns streng und missbilligend an. «Sie muss in den Schuppen gebracht werden, Albertine», sagte Madame Diplomat.
«Ich bitte Sie, Madame», sagte Madame Albertine. «Es geht ihr noch nicht gut genug, und wenn sie schlecht behandelt wird, werden ich und noch andere Bedienstete gehen.» Stumm und hochmütig wandte sich Madame Diplomat ab und ging ins Schlafzimmer. In der Küche, unter der Treppe, kamen einige ältere Frauen auf mich zu, um mit mir zu sprechen. Sie sagten mir, sie seien froh, dass ich besser aussehe.
Madame Albertine setzte mich sanft auf den Boden, sodass ich herumgehen und alle Neuigkeiten der Dinge und der Menschen lesen konnte. Schnell wurde ich müde, denn es ging mir noch lange nicht gut. Ich schaute in Madame Albertines Gesicht und sagte ihr, dass ich zu Bett gehen möchte. Sie hob mich auf und trug mich wieder in die oberste Etage des Hauses. Ich war so müde, dass ich schon eingeschlafen war, bevor sie mich in mein Bett gelegt hatte.
Kapitel 2
Es ist leicht, im Nachhinein weise zu sein. Das Schreiben eines Buches weckt Erinnerungen. In den Jahren der Entbehrungen erinnerte ich mich oft an die Worte des alten Apfelbaumes: «Kleine Katze, dies ist nicht das Ende. Du hast eine Bestimmung in deinem Leben.» Damals dachte ich, diese freundlichen Worte seien nur dazu da, mich aufzumuntern. Heute weiß ich es besser. Jetzt, im Herbst meines Lebens, empfinde ich endlich Glück. Auch wenn ich nur für einen Moment abwesend bin, höre ich schon besorgte Stimmen: «Wo ist Fifi? Ist alles in Ordnung mit ihr?» Und dann weiß ich, dass ich um meiner selbst willen geliebt werde, und nicht, weil ich dekorativ bin. In meiner Jugend war das anders. Ich war nur ein Vorzeigeobjekt, oder wie es die modernen Menschen nennen würden, ein «Konversationsobjekt». Die Amerikaner würden es «Gimmick» nennen.
Madame Diplomat war von zwei Dingen besessen. Zum einen war sie von der Idee besessen, in der Hierarchie der französischen Gesellschaft immer weiter aufzusteigen, und zum anderen war sie überzeugt, dass der sichere Weg zum Erfolg darin bestand, mich vor ihren Gästen zu präsentieren. Das erstaunte mich, denn ich wusste, dass sie im Grunde genommen Katzen hasste (außer bei öffentlichen Anlässen). Ich wurde im Haus nicht geduldet, ausgenommen, wenn Gäste anwesend waren. Die Erinnerung an die erste «Prahlerei» mit mir ist mir noch sehr lebhaft im Gedächtnis geblieben.
Es war an einem sonnigen Tag im Garten. Ich betrachtete die Blumen und beobachtete Bienen, die Blütenstaub an ihren Beinen trugen. Dann ging ich zu einer Pappel und untersuchte sie. Der Hund eines Nachbarn war kürzlich dort gewesen und hatte eine Nachricht hinterlassen, die ich lesen wollte. Immer wieder warf ich einen Blick über meine Schulter, um sicherzustellen, dass alles in Ordnung war, und widmete mich dann wieder der Nachricht. Allmählich vertiefte ich mich so sehr in das Lesen dieser Nachricht, dass ich nicht einmal mehr wahrnahm, was um mich herum geschah. Unerwartet packten mich grobe Hände und rissen mich aus meiner Erkundung. «Zisst!», zischte ich, als ich mich losriss und gleichzeitig nach hinten trat. Schnell kletterte ich den Baumstamm hinauf und schaute nach unten. «Lauf zuerst weg und schau erst danach zurück», hatte meine Mutter gesagt. «Es ist besser, einmal unnötig davonzulaufen, als stehenzubleiben und nie mehr weglaufen zu können.»
Ich schaute hinunter und sah Pierre, den Gärtner, der sich die Nasenspitze hielt. Ein paar Tropfen dunkelrotes Blut liefen seinen Fingern entlang. Er sah mich hasserfüllt an, bückte sich, hob einen Stein auf und warf ihn mit aller Kraft gegen mich. Ich wich geschickt um den Baumstamm aus, doch die Vibration des Steins gegen den Stamm brachte mich beinahe zu Fall. Er bückte sich, um einen weiteren Stein aufzuheben, als sich in diesem Augenblick hinter ihm die Büsche teilten und Madame Albertine hindurchtrat, die leise auf dem moosigen Gras dahergekommen war. Mit einem Blick erfasste sie die Situation. Schnell schoss ihr Fuß nach vorn, und Pierre fiel um. Sie packte ihn am Kragen, zog ihn hoch und schüttelte ihn heftig – er war nur ein kleiner Mann – und wirbelte ihn herum. «Wenn du dieser Katze etwas antust, bringe ich dich um! Madame Diplomat hat dich nur geschickt, sie zu finden, und nicht, um ihr weh zu tun, du Schweinehund.»
«Die Katze sprang mir aus den Händen, und ich fiel gegen den Baum, und davon habe ich Nasenbluten», murmelte Pierre. «Ich verlor die Nerven wegen der Schmerzen.»
Madame Albertine zuckte mit den Schultern und wandte sich mir zu: «Fifi, Fifi, komm zu Mama», rief sie.
«Ich komme», rief ich, während ich mich am Baumstamm festkrallte und rückwärts herunterrutschte.
«Nun leg dein bestes Benehmen an den Tag, kleine Fifi», sagte Madame Albertine. «Die Mätresse möchte dich ihren Gästen zeigen.» Die Bezeichnung «Mätresse» amüsierte mich immer. Wie konnte Madame Diplomat die «Mätresse» sein, wenn doch Monsieur le Duc eine Mätresse in Paris hatte? Wie auch immer, dachte ich, wenn sie sie «Mätresse» nennen wollen, dann ist das ihre Sache! Sie waren sowieso sehr seltsame und eigenartige Leute.
Gemeinsam überquerten wir den Rasen. Madame Albertine trug mich, damit meine Pfoten für die Besucher sauber blieben. Auf der Steintreppe beobachtete ich eine Maus, die über den Balkon rannte und in einem Loch unter einem Busch verschwand. Durch die offenen Türen des Salons sah ich viele Menschen, die wie ein Schwarm Stare schnatterten.
«Ich habe Ihnen Fifi mitgebracht, Madame!», sagte Madame Albertine. Die «Mätresse» sprang auf, nahm mich behutsam von meiner Freundin weg und rief: «Oh, mein Liebling, meine süße kleine Fifi!» Dabei drehte sie sich so schnell um, dass mir ganz schwindlig wurde. Die Frauen standen auf und umringten uns mit bewundernden Rufen. Siamkatzen waren in jenen Tagen in Frankreich eine Seltenheit. Selbst die anwesenden Männer traten heran, um einen Blick auf mich zu werfen. Mein schwarzes Gesicht, der weiße Körper, der mit einem schwarzen Schwanz endete, schien sie zu beeindrucken.
«Sie ist eine ausgesprochene Rarität», verkündete Madame Diplomat. «Sie hat einen ausgezeichneten Stammbaum und kostete ein Vermögen. Sie ist so anhänglich, dass sie nachts bei mir schläft.» Ich protestierte umgehend gegen eine solche Lüge, und alle wichen erschrocken zurück.
«Sie spricht nur», sagte Madame Albertine beruhigend, die angewiesen worden war, im Salon zu bleiben, «für alle Fälle». Albertine war genauso verblüfft wie ich, dass Madame Diplomat solche unverschämten Lügen von sich gab.
«Oh, Renée», sagte eine Frau, die zu Besuch war, «du solltest sie mit nach Amerika nehmen, wenn du gehst. Amerikanische Frauen können die Karriere deines Mannes sehr unterstützen, wenn sie dich mögen, und so eine kleine Katze zieht sicherlich die Aufmerksamkeit auf sich.» Madame Diplomat setzte ein so verkniffenes Gesicht auf, dass ihr Mund fast ganz verschwand. «Sie mitnehmen?», fragte sie. «Wie soll ich das denn anstellen? Sie würde auf der Flugreise nur Ärger machen.»
«Unsinn, Renée, ganz und gar nicht», erwiderte ihre Freundin. «Ich kenne einen Tierarzt, der dir ein Medikament geben kann, das sie für die gesamte Reise schlafen lässt. Du kannst sie in einer gepolsterten Kiste als Diplomatengepäck mitnehmen.»
Madame Diplomat nickte. «Ja, Antoinette, gib mir seine Adresse, bitte», antwortete sie.
Eine Weile musste ich noch im Salon bleiben, während die Leute meine Figur bewunderten und über die Länge meiner Beine sowie die Schwärze meines Schwanzes staunen konnten.
«Ich dachte, die allerbesten Siamkatzen hätten einen geknickten Schwanz», sagte eine Besucherin.
«Oh, nein», erklärte Madame Diplomat, «Siamkatzen mit einem geknickten Schwanz sind jetzt nicht mehr in Mode. Je gerader der Schwanz, desto wertvoller ist die Katze. Bald werden wir diese hier decken lassen, damit sie uns hübsche Kätzchen schenkt.»
Endlich konnte Madame Albertine mit mir den Salon verlassen. «Puh!», rief sie aus, «lieber vierbeinige Katzen als diese zweibeinige Sorte.» Schnell schaute ich mich um. Ich hatte noch nie zuvor zweibeinige Katzen gesehen und ich verstand auch nicht, wie sie zurechtkommen sollten. Hinter mir war nichts außer einer geschlossenen Tür, also schüttelte ich nur verwirrt den Kopf und ging weiter neben Madame Albertine her.
Es wurde dunkel, und ein leichter Regen prasselte gegen die Scheiben, als in Madame Albertines Zimmer nervös das Haustelefon läutete. Sie erhob sich, um den Anruf entgegenzunehmen, und die schrille Stimme von Madame Diplomat störte den Frieden: «Albertine, haben Sie die Katze in Ihrem Zimmer?»
«Ja, Madame, es geht ihr noch nicht gut», erwiderte Albertine. Die Stimme von Madame Diplomat stieg eine Oktave höher. «Albertine, ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich sie nicht im Haus haben will, außer wenn Besuch da ist. Bringen Sie sie sofort in den Schuppen. Ich wundere mich über meine Güte, Sie zu behalten. Sie sind so nutzlos!»
Widerstrebend zog sich Madame Albertine eine grob gestrickte Wolljacke an, schlüpfte mühsam in einen Regenmantel und band sich einen Schal um den Kopf. Sie hob mich auf, wickelte einen Schal um mich und trug mich die Hintertreppe hinunter. In der Dienstbotenkammer blieb sie stehen, nahm eine Taschenlampe und ging zur Tür. Ein stürmischer Wind wehte uns ins Gesicht. Tiefliegende Wolken rasten über den Nachthimmel. Von einer hohen Pappel herab schrie trübsinnig eine Eule, als unsere Anwesenheit die Maus verscheuchte, die sie jagen wollte. Die regennassen Äste ergossen ihre Wasserlast über uns, als wir sie streiften. Der Weg war rutschig und tückisch im Dunkeln. Madame Albertine schlurfte weiter, wählte vorsichtig im schwachen Taschenlampenlicht ihre Schritte aus und murmelte Verwünschungen gegen Madame Diplomat und alles, wofür sie einstand.