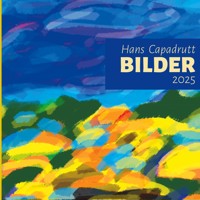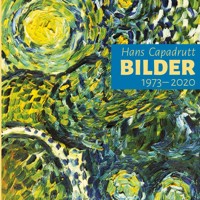Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Hans Capadrutt erzählt von seiner Jugend auf dem Bauernhof im kleinen Bergdorf Dalin am Heinzenberg (Graubünden/Schweiz). Über das Viehhüten auf dem Maiensäss Pranzolas, dem Heuen auf dem grösseren Berg Prau Pigniel, über Nachbarn, Hirten und Alpen, Spiele und Streiche, die Schule und seine Eltern. Es ist ein sehr persönliches Buch.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 248
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
VORWORT
Da ich in meinem Berufsleben immer wieder Bücher mit und für Autoren machen durfte, fand ich, es wäre an der Zeit, einmal selber eines zu schreiben: Über meine Erinnerungen als Bergbauernbub am Heinzenberg.
Nach langem Zögern und Überlegen begann ich, zuerst vorsichtig, ängstlich, unsicher. So, als ob ich einen Pfad durch einen unbekannten Wald suchte und nicht wüsste, ob ich ihn je finden oder mich sogar darin verlaufen würde.
Nachdem der Anfang gemacht und die erste Lichtung sichtbar war, stieg meine Zuversicht. Ich wurde mutiger und der Pfad breiter. Das Schreiben fiel mir immer leichter. Es fing an zu fliessen.
Die meisten Leute, die in diesem Buch vorkommen, Nachbarn, Bekannte, Ferienleute und andere, weilen schon lange nicht mehr unter uns. Von den noch Lebenden hoffe ich, dass sich niemand durch meine Erinnerungen in seiner Privatsphäre verletzt fühlt.
Es ist ein sehr persönliches Buch. Meine Erinnerungen sind deshalb vielleicht für Leser, die nicht in meiner Generation am Heinzenberg aufgewachsen sind, nicht besonders interessant. Trotzdem hoffe ich, dass etwas von dem, was ich in meiner Kindheit erlebt habe, einige Leser erfreuen und vielleicht sogar zum Schmunzeln bringen wird.
Das Verständnis erleichtert ein die mundartlichen und romanischen Wörter erläuterndes Glossar ab Seite 199.
Domat/Ems, Juli 2021
23.8. 2009: Aussichtspunkt Crap Carschenna oberhalb Sils i. D. (1110 m ü.M.)
Foto: Hans Capadrutt
Ich danke allen bisherigen Lesern für ermunternde erste Feedbacks und wünsche allen zukünftigen viel Vergnügen beim Lesen meiner Erinnerungen. .
Ganz besonders danke ich Alfons Heusser, der mich mit wertvollen Ratschlägen sowie als Korrektor und Lektor bei dieser Ausgabe unterstützt hat.
INHALT
V
ORWORT
D
IE ERSTEN
J
AHRE
E
IN NEUES
Z
UHAUSE
N
ACHBARN
F
ERIEN
-
D
ALINER UND ANDERE
H
IRTEN UND
A
LPEN
P
RAU
P
IGNIEL
P
RANZOLAS
S
PIELE
S
TREICHE
F
ESTTAGE
S
CHULE
D
ER
S
PION
M
AMA UND
P
APA
G
LOSSAR
Sarn, vorne links Portein. Foto: Hans Capadrutt
DIE ERSTEN JAHRE
Von links: Mama, Papa, Hans, Albert und Christian, ca. 1953.
DER 25. JANUAR 1950
war der wichtigste Tag in meinem Leben. Um 09:25 Uhr wurde ich im Krankenhaus Thusis durch einen Kaiserschnitt aus dem Bauch meiner Mutter geholt.
Es soll ein sehr kalter und schneereicher Winter gewesen sein. Deswegen war es nicht einfach für meine Mutter, mit mir im Bauch von Sarn nach Thusis ins Spital zu kommen. Ein Bekannter aus dem Domleschg soll uns mit seinem Jeep geholt und ins Spital gefahren haben. Heutzutage wäre es wahrscheinlich ein Suzuki.
«Das ist ein haariger Kerl!» soll der Arzt, Doktor Steiner, gesagt haben. Ausser auf dem Kopf ist das immer noch so, nur haben die Haare jetzt an Farbe verloren.
Als Mama mit mir zusammen das Spital nach einer Woche verliess, empfand ich ein Gefühl des Bedauerns. Neben mir auf der Säuglingsabteilung lag ein Mädchen, mit dem ich mich – natürlich unbemerkt von Mama und den Schwestern – angefreundet hatte. Es würde ich jetzt leider nie wieder sehen.
Als meine Eltern heirateten, zog Papa weg von Dalin, wo er mit drei Geschwistern auf einem Bauerngut aufgewachsen war. Nach Sarn ins Haus von Tata, wo Mama mit ihrer Mutter wohnte. Sie pachteten dort ein Gut und hatten so eine kleine Landwirtschaft.
Bei dem Wort «Tata» sehe ich eine weisshaarige, liebevolle Frau vor mir, bei der ich mich sehr wohl und geborgen fühlte. Leider habe ich keine andere Erinnerung als dieses Bild und das sichere Wissen, dass diese Zeit, diese ersten vier Jahre bei Tata, einfach wunderbar waren. Sie kümmerte sich liebevoll um mich, wenn Mama und Papa aufs Feld mussten. Um mich und meine beiden Brüder.
Das Zusammenleben mit meinen Eltern und uns drei Kindern wird für sie wohl nicht immer einfach gewesen sein. Oft kam auch noch meine Tante Tilli, die ältere Schwester von Mama, von Präz her mit mehreren Enkelkindern auf Besuch. Und alle wollten verpflegt und betreut werden.
Tata, Annamarie Schmid-Lanicca.
Christian und Hans.
Tata mit Mama auf dem Arm, Neni mit Bäsi Tilli davor und vorn links Öhi Albert, der als Kind an der Zuckerkrankheit starb.
Wenn heute meine Enkel für einen Nachmittag zu uns kommen, freue ich mich sehr. Aber ich habe auch nichts dagegen, wenn sie nach ein paar Stunden wieder abgeholt werden.
Nachdem das Spielzeug-Chaos aufgeräumt ist, lege ich mich aufs Kutschi und atme ein paar Mal tief durch. Meine rot-weiss getigerte Katze Daisy kommt wieder aus der Deckung hervor. Ich streichle ihr weiches Fell, kraule sie hinter den Ohren. Sie fängt an zu schnurren, und die Welt ist für uns zwei wieder in Ordnung.
AUS DEM STALL GESCHLEUDERT
Am Anfang brachten meine Eltern das Heu mit einem vom Ochsen gezogenen Leiterwagen in den Stall. An den Ochsen kann ich mich noch erinnern, wie Mama ihn einen steilen Feldweg hinauf auf die Strasse und ins Dorf führte. Später hatten wir dann auch ein Ross wie die anderen Bauern im Dorf.
Ich bin etwa drei Jahre alt, als ich mich auf dem Maiensäss Parsiras in den Stall begebe, wo das neue Ross steht. Ich will ihm meine Liebe zeigen und lege meine Arme um eines seiner Hinterbeine.
Das schöne Tier versteht meine Liebesbezeugung leider nicht, erschrickt und schlägt aus. Ich muss sein Bein loslassen und fliege in hohem Bogen durch die Stalltüre hinaus. Über den Miststock und in die Nesseln, die sich darunter breit gemacht haben.
Ich kann mich noch an den Stall und das Pferd von hinten erinnern. Wie die Sonne in den Stall schien und auch an den unfreiwilligen Flug in die Nesseln, aber an keine Angst. Ich glaube, ich war nicht einmal erschrocken. Wie durch ein Wunder blieb ich – wohl weil ich das haarige, braune Bein fest umschlungen hatte – unverletzt. Schlimmer wäre es gewesen, wenn das Pferd ausgeschlagen hätte, als ich noch hinter ihm stand.
UNTER DEM LEITERWAGEN
Auf demselben Maiensäss hatte Papa eines Tages den leeren Leiterwagen in der Wiese abgestellt. Den Wagen, den das Ross mit Heu oder Heublachen beladen ziehen musste und den wir auch brauchten, um die Robi auf den Berg zu transportieren.
Christian und ich klettern auf den Wagen und haben unseren Plausch, darauf zu sitzen, zu liegen und uns wohl zu fühlen. Die Bremse, die den Wagen in der Wiese festhält, wird mit einer Kurbel angezogen und gelöst.
Es dauert nicht lange, bis wir uns mit dieser interessanten Kurbel beschäftigen. Meinem älteren Bruder gelingt es dann, sie zu drehen. Er dreht und dreht und dreht ... Die Bremsklötze lösen sich ... Der Wagen rollt zuerst langsam, dann immer schneller mit uns die Wiese durab.
Mama erzählte später, dass der Wagen sich überschlagen habe, weil die vordere Achse mit den Holmen sich drehte. Der gleiche Effekt wie beim Velofahren, wenn man den Lenker zu stark abdreht. Christian sei noch rechtzeitig vom Wagen gesprungen. Mich aber habe man darunter gefunden, eingeschlossen und geschützt durch die Holzverstrebungen der Seitenwände.
Meine Schutzengel gaben sich wirklich Mühe, damit ich weiterleben konnte.
IM DORFBRUNNEN
Etwas, das mich damals ganz ungemein faszinierte, war der Lastwagen von Uli Lareida aus Dalin.
Unter dem Haus von Tata bildete das Haus von Paul Pintg einen kleinen Tunnel über der Strasse. Da hindurch fuhr ab und zu mit lautem Brummen dieses grosse Auto. Nach einiger Zeit tauchte es wieder auf, diesmal von der anderen Seite.
Uli Lareida mit seinem ersten Lastwagen, einem Ford mit dem Kontrollschild GR 1417. Beachtenswert die Telefonnummer 323 auf der Tür.
Fotos: Kulturarchiv Cazis
Das war unheimlich spannend. Wenn das Motorengeräusch anschwoll, ging es sehr schnell. Kaum kam die lange Schnauze hervor, verschwand der Kipper mit Sand auch schon wieder hinter dem Stall Richtung Dalin.
Ich höre, dass Uli unter dem Haus von Tata vorbeifährt, laufe zur Strasse hinunter und unter dem Haus von Paul Pintg hindurch zum grossen Dorfbrunnen, wo der Lastwagen steht. Beim Brunnen bleibe ich stehen, lehne mich an den steinernen Rand und schaue zu, wie Uli und sein Mitarbeiter etwas abladen.
Nach einer Weile versuche ich, auf den Brunnenrand zu klettern, verliere das Gleichgewicht und falle rücklings ins Wasser. Ein Gefühl von Schweben. Über mir wunderschöne blaugrüne Wasserspiele. Ich fühle mich wohl und bin mir keiner Gefahr bewusst.
Mein Sarner Neni und Tata in jungen Jahren.
Meine Cousins, die Kinder von Bäsi Tilli Manni in Präz. Von links unten: Arno, Reto, Kurt, Margreth und auf Tatas Schoss Marianne. Im Wagen mein Bruder Christian, 1949.
Als ich erwache, liege ich zu Hause in meinem Bett, dick eingehüllt in Wolldecken. Tata beugt sich über mich und redet mit mir.
Ich weiss nicht mehr, was sie sagte. Aber mir war bewusst, dass etwas ganz falsch gelaufen war. Ich fühlte mich schuldig, weil ich Tata Sorgen gemacht hatte.
Mama erzählte später, dass Uli zum Glück auf der Brunnenseite des Lastwagens gearbeitet habe und mich noch rechtzeitig aus dem Wasser fischen konnte.
KÖBIS TÖFF
In Sarn gab es noch etwas, das mich und Christian enorm interessierte: Der Töff von Köbi Gees. Er stand meist neben einem Stall auf der Strasse nach Dalin. Auch da war ein Durchgang unter Haus und Stall wie bei Paul Pintg.
Eines Tages versucht mein Bruder auf den schönen roten Töff von Köbi zu klettern. Kaum ist er oben, fällt das schwere Vehikel um. Christian hat Glück und kommt unverletzt, aber mit einem ziemlichen Schrecken davon. Wir rennen, so schnell wir können weg, nach Hause zu Tata und den Eltern.
Ob Köbi herausfand, wer seinen Töff zu Fall gebracht hat, weiss ich nicht. Er war ein sehr ruhiger, freundlicher Mann mit wunderbar strahlenden hellblauen Augen. Als Schreiner und Zimmermann auch ein Ein-Mann-Unternehmer wie Uli Lareida.
Meine Erlebnisse in der Erinnerung sind wie Traumszenen. Bilder, kleine Filme, nur Bruchstücke. Ich sehe das Bild mit dem Töff von Köbi, die Brunnenszene mit mir als Hauptdarsteller, Tata, wie sie sich über mich beugt. Das ist alles. Keine Erinnerung an davor oder danach. Ebenso ist es mit allen anderen Erlebnissen von Sarn, über die ich schreibe. Nur einzelne Szenen und Bilder. Wie Fotografien oder ganz kurze Filme.
DAS EI IM BARMEN
Mit meinem Bruder erkundete ich oft die Umgebung von Tatas Haus. Die Gassen, die Ställe ... Es gab keine Verbote, soweit ich mich erinnern kann. Man liess uns unsere eigenen Erfahrungen machen, was ich gut finde. Ich nehme aber schon an, dass man ein Auge auf uns hatte.
Unterhalb von Tatas Haus steht ein alter Stall, den mein Bruder und ich schon lange auskundschaften wollten. Eines Tages öffnen wir die schwere Stalltür und tappen in das Halbdunkel hinein. Es riecht nach kaltem Mist. Nachdem sich meine Augen etwas an die Dunkelheit gewöhnt haben, entdecke ich in einem Barmen ein weisses Etwas. Ich nähere mich behutsam und finde in einer Tole aus Stroh ein frisch gelegtes Ei. Ich taste nach ihm, greife seine Form, nehme es in die Hand und bin völlig fasziniert von meinem Fund. Es ist eine wunderbare Entdeckung für mich, ein Wunder.
Beim Einkaufen freue ich mich jedes Mal, ein Pack mit grossen Bio-Eiern auszusuchen. Am liebsten habe ich die braunen, obwohl mein Ei im Barmen weiss war. Zu Hause dämpfe ich im Steamer jeweils eine Packung auf Vorrat. Wenn ich dann mitten in der Nacht Hunger bekomme, esse ich stehend in der Küche so ein hartes Ei mit etwas Aromat dazu. Eine Ernährungsberaterin hat mir gesagt, da sei alles drin, was ein Leben brauche.
Ob das Huhn oder das Ei zuerst existierte, ist in diesem Moment kein Thema. Wenn es mir schmeckt und der Hunger gestillt wird, sage ich zu allem ja, was essbar ist.
FREMDE SPIELZEUGAUTOS
Gegenüber vom Dorfbrunnen in Sarn steht ein grosses Haus. Davor spielten manchmal Kinder, die dort auf Besuch oder in den Ferien waren. Die kleinen Buben besassen schöne farbige Spielzeugautos, die ich und meine Brüder nicht hatten. Ich hätte so gerne auch eines gehabt oder wenigstens mit einem gespielt. Doch die fremden Buben waren nicht bereit, ihre Autos zu teilen.
Meine Enkel sind gesegnet mit einer ganzen Bagger-, Lastwagen-, Traktor- und Autoflotte, die sie von Götti, Gotta, Tat, Onkel und Neni, Nona und Bekannten bekommen haben.
Ich glaube, dass sie ein gutes Gefühl dabei haben, und das freut mich. Wenn sie zu uns auf Besuch sind, holen sie immer zuerst die Autos hervor, die wir noch von unseren Söhnen her bei uns haben. Die werden auf dem Teppich ausgebreitet, und dann wird gespielt. Dass ich, der Neni, mitmachen muss, ist selbstverständlich. Sie verstehen auch, dass ich nicht mehr so schnell mit einem Auto auf den Knien durchs Wohnzimmer robben kann, und geben mir leichtere Aufgaben. Wie zuschauen, Briobahn aufbauen oder Sirup servieren.
NENIS PFEIFEN
Weit oben und unerreichbar für mich, lugen ein paar Pfeifen zu mir herab. Sie liegen auf dem Buffet in der Stube, auf das sie vielleicht noch mein gestorbener Neni gelegt hat, und sie ziehen mich magisch an. Mir ist, als ob sie mir gehörten. Ich muss wohl ziemlich gestürmt haben, denn irgendwann gibt man mir eine in die Hand.
Das ist dann ein unbeschreibliches Gefühl. Das dunkelbraune, gefaserte Holz, die schwungvolle Biegung vom Kopf zum Mundstück und eine gewundene grüne Schnur als Zierde.
Ich will die Pfeife von meinem Neni nicht mehr hergeben.
Leider waren die Pfeifen dann plötzlich verschwunden. Darüber habe ich in meinem Leben immer wieder nachgedacht, wieso diese Pfeifen nicht mehr da waren.
Seltsamerweise ist mir erst vor ein paar Jahren der Gedanke gekommen, dass Mama oder Papa oder vielleicht auch Tata die Pfeifen versorgt haben könnten, damit ich aufhörte zu stürmen.
Meinen Neni von Sarn, Tatas Mann, dem die Pfeifen gehörten, habe ich nie gekannt. Er starb zwölf Jahre vor meiner Geburts. Er war Landjäger in Pany und St. Antönien und hatte dort am Dorfeingang das Haus Bellavista gebaut, wo Mama geboren worden ist.
NESA
Eine besondere Beziehung muss ich zu Nesa gehabt haben. Nesa war unsere Nachbarin und die Güte in Person. Auf jeden Fall muss ich mit meinen zwei oder drei Jahren sie tief ins Herz geschlossen haben.
Einmal soll ich das ganze Dorf hinunter bis in den Laden gelaufen und durch die aufgeweichte Naturstrasse, die Molta, mit einem grossen Brot für Nesa zurück gekommen sein. Nesa hatte mich natürlich nicht geschickt, aber sie soll gesagt haben, ich solle es ihr nur geben, das könne sie schon brauchen.
Mama erzählte einmal – mit einem bedauernden Ausdruck im Gesicht –, dass Nesa gerne Wein trinke. Jemand hätte sogar durch die geschlossene Tür hindurch gehört, wie sie, nach jedem Schluck, das Glas auf dem Tisch abgestellt hätte. Dieser «Jemand» muss sein Ohr wohl sehr nah an Nesas Tür gehalten und sogar hindurchgesehen haben. Wie sonst wäre es möglich gewesen zu wissen, was Nesa in ihrem Glas hatte.
Arme Nesa. Sie wird wohl einsam gewesen sein, mein Brot konnte ihr nicht helfen.
GIOVANNI
In Sarn hatten wir einen Knecht, der Giovanni hiess. Ich erinnere mich, dass ich auf der Laube lag und von oben herab durch einen Spalt im Holzboden beobachtete, wie er mit dem Bieli vor dem Schopf Holz spaltete.
Aus irgendeinem Grund mochte ich Giovanni besonders. Er bedeutete mir viel. Wahrscheinlich, weil er so anders war als die anderen Leute im Dorf und eine andere Sprache hatte.
Zu jener Zeit gab es viele Italiener im Dorf, die den Bauern bei der Arbeit halfen. Am Abend, nach getaner Arbeit, trafen sie sich dann am Dorfbrunnen zum grossen Palaver.
Das sei ein Heidenlärm gewesen, erzählte Mama. All die jungen Italiener die in ihrer Sprache lachten und sangen. Natürlich in typisch südländischer Lautstärke.
Die lebenslustige Art der Italiener war sicher ein schöner Kontrast und eine Auflockerung zu der ernsten, nur auf Arbeit und Fleiss ausgerichteten Lebensweise der Einheimischen.
Einem dieser Südländer gelang es sogar, ein einheimisches Mädchenherz zu erobern und ein tüchtiger Schwiegersohn eines Sarner Bauern zu werden.
PUM PONI
Es gibt noch ein Erlebnis in Sarn, dass ich nie vergessen habe. Es hängt mit Toni und einem seiner Brüder zusammen, beide viel grösser und älter als ich.
Eines Tages treffe ich im Dorf auf Toni und seinen Bruder. Die Beiden lupfen mich über eine Mauer in einen kleinen Garten, wo ich gefangen bin. Sie laufen weg und tun, als ob sie gehen würden. Dann kommen sie zurück, hänseln mich und spielen ihre Macht aus. Ich weine, habe Angst und ein schlimmes, ohnmächtiges Gefühl.
ERSTE KONTAKTE NACH DALIN
Eines Tages – wahrscheinlich an einem Sonntag – besuchten meine Eltern mit uns Buben vom Maiensäss Parsiras aus Nana und Neni, Öhi Balza und Bäsi Anna auf ihrem Maiensäss Prau Pigniel.
Papa hält mich an seiner starken Hand. Wir laufen über einen schmalen Steg, der über einen wild rauschenden Bach führt. Auf beiden Seiten riesig hohes Gras. So riesig, weil ich noch so klein bin. Ich habe Angst vor dem Bach, der wilden Gegend. Es ist unheimlich und fremdartig.
Dieser Besuch war der erste bewusste Kontakt zu den Daliner Verwandten. Ich kann mich noch an Neni und die Hütte erinnern aber nur verschwommen. Das ist alles.
Eines Tages brachte man mich nach Dalin zu Nana, Neni, Öhi Balza und Bäsi Anna. Ich verstand nicht, warum man mich zu diesen Leuten brachte. Ich musste dann dort übernachten, im Zimmer bei meiner Tante.
Bäsi Anna liegt mit geschlossenen Augen und gefalteten Händen im Bett. Hinter ihr und mir gegenüber steht ein mit geschnitzten Köpfen verzierter dunkler Kasten, der mir Angst macht. Meine Tante ist noch eine Fremde für mich. Ich mache die ganze Nacht kein Auge zu.
Am anderen Tag musste Öhi Balza mich mit seinem Ross wieder nach Hause fahren, nach Sarn zu Tata, wo ich mich so viel wohler fühlte.
EIN NEUES ZUHAUSE
Dalin heute. Foto: Hans Capadrutt
Dalin, ca. 1945. In der Wiese unterhalb der Strasse wird gemistet.
Fotos: Kulturarchiv Cazis
Andreas Lareida, der «Alte Deia», ca. 1945. Die beiden Frauen hinten auf der Bank sind vermutlich Nana und hinter dem mittleren Rechenstiel Bäsi Anna.
ZÜGLETE
An die Züglete nach Dalin im Jahre 1954 kann ich mich nicht erinnern. Die frühesten Bilder haben mit Bäsi Anna zu tun. Bäsi Anna war die Schwester von Papa, meine Tante und romanische Kindergärtnerin der Scoletta in Präz.
In diesem romanischen Kindergarten sitze ich dann eines Tages mit mehreren anderen Kindern an einem Tisch. Wir kneten aus farbigen Plastilinstäben Figuren. Ich fühle mich nicht wohl. Der fremde Ort, dieses dunkle Holzhaus zuunterst im Dorf, die anderen Kinder, mit denen ich in der Gruppe zusammen sein muss und die mir noch nicht vertraut sind ...
BÄSI ANNA
Meine Tante war eine dynamische Frau. Als Mama meinen Bruder und mich an einem Morgen zum Heuen auf eine Wiese unterhalb vom Dorf mitgenommen hatte, tauchte plötzlich Bäsi Anna auf. Energisch und ohne Mama um Erlaubnis zu fragen, nahm sie uns Buben an der Hand und schleppte uns nach Präz in die Scoletta.
Mit grossen Schritten lief sie voraus. Uns blieb nichts anderes übrig, als zu rennen. Die Bäsi streckte den kleinen Finger nach unten und sagte de i kini, was soviel hiess wie gib den Finger oder nimm meinen kleinen Finger. Und so klammerte ich mich an ihrem kleinen Finger fest, und sie zog mich hinter sich her bis in die Scoletta.
Mama war gerade das Gegenteil von Bäsi Anna, ganz ohne diese Dynamik. Sie hatte es, mindestens in den ersten Jahren, nicht leicht in der Familie meines Vaters. Ich erinnere mich an eine Szene, in der Öhi Balza, Papas Bruder, in der Stube auf Mama einredete, die weinte. Ich war noch zu klein, um zu verstehen, was los war, doch die Situation bedrückte mich.
Die Scoletta vor Sontg Onna in Dalin. Albert und Hans stehen vor Bäsi Anna, ca. 1955.
Die Scoletta in der Quadra-Wiese in Präz. Hans in der hintersten Reihe zwischen Rosmarie (links) und Marlene, 1956.
Von links: Christian, Albert, Hans. Skihosen, Pullover und Mützen von Mama geschneidert und gestrickt, ca. 1954.
Von links: Christian, Hans, Albert mit Barri, ca. 1957.
«Bäsi Anna ist ein Ross!», sagte sogar Papa von seiner Schwester. Mit diesem Ross musste Mama dann mehrere Jahre im gemeinsamen Haushalt zurechtkommen. Mit ihr, Nana, Neni und Öhi Balza. Bald musste sie für alle kochen, weil die anderen mit der groben Arbeit im Feld und im Stall beschäftigt waren.
Eine riesige Arbeit gab natürlich die Wäsche für so viele Personen. Vor allem die Bettwäsche, die man etwa fünzig Meter durab – und später wieder duruf – zum und vom Untara Dorfbrunna schleppen musste, wo ein Holzofen mit einem riesigen Metall-Kessi stand.
Dieses Kessi wurde mit Wasser gefüllt und mit grossen Holzscheiten befeuert, bis das Wasser die nötige Temperatur hatte. Dann kam die Wäsche hinein. Die Leintücher, Kissen- und Bettdeckenanzüge wurden mit einer langen Holzkelle immer wieder gedreht und gesotten.
Mit der gleichen Technik, wie man Spaghetti um eine Gabel wickelt, wurde die Wäsche mit der Holzkelle zum Brunnen geschleppt und dort mit einer grossen Bürste im kalten Wasser geschrubbt, bis sie sauber war. Mama erzählte oft, was das für ein Krampf war.
Ein anderes Beispiel, warum Bäsi Anna von Papa als Ross bezeichnet wurde: Wir waren auf dem Maiensäss Prau Pigniel am Heuen. Papa und Bäsi Anna warfen das Heu auf den Wagen, jeder von einer Seite. Das Fuder war schon ziemlich hoch, doch die Bäsi stemmte ihre Heugabel mit soviel Kraft und Schwung in die Höhe, dass das Heu auf der anderen Seite Papa auf dem Kopf landete statt auf dem Fuder.
Papa sagte manchmal, seiner Schwester fehle ein Mann. Dann mussten wir lachen, weil wir alle wussten, dass es kein Mann schaffen würde, sie zu zähmen.
Martin Bundi, der nachmalige SP-Nationalrat, gab in jungen Jahren eine Zeit lang Schule in Präz. Papa erzählte einmal, dass er damals an meiner Tante interessiert gewesen sein könnte. An sich hätte das gut gepasst, könnte man meinen. Sie und er, ein Oberländer und späterer Präsident der Renania, wären mit ihrem Romanisch wie Schwester und Bruder gewesen.
Bäsi Anna war eine Kämpferin. Sie kämpfte bis zu ihrem frühen Tod für ihr Romanisch und speziell für ihren Präzer Dialekt, den Plead da Preaz. Sie schrieb Gedichte und Liedtexte, erzählte im romanischen Radio Geschichten und redete mit uns immer romanisch. Wir verstanden ungefähr, was sie sagte, antworteten aber meist auf Deutsch, weil wir wegen Mama in unserer Familie – der Familie innerhalb Papas Familie – nur Deutsch sprachen.
Mama wollte auf keinen Fall Romanisch lernen. Sie sagte mir später einmal, dass sie diese Sprache gehasst habe. Also muss sie trotz ihrem zierlichen Äusseren doch ziemlich stark gewesen sein, wenn sie sich gegen Bäsi Anna durchsetzen konnte.
Interessant ist, dass Tata, Mamas Mutter, in Sarn mit Nesa, der ich damals das Brot vom Dorfladen gebracht hatte, romanisch redete. Romanisch war damals am äusseren Heinzenberg noch stark verbreitet. Warum Mama davon nicht inspiriert wurde, weiss ich nicht. Sie war eben von ihrem Vater her eine Walserin, eine von Langwies.
Viele Jahre später, als ich als Schriftsetzer in der Druckerei Bischofberger in Chur arbeitete, half ich Bäsi Anna einmal, ihr eigenes Heinzenberger Romanisch unverändert zu veröffentlichen.
Pfarrer Michael aus dem Schams war damals Redaktor der romanischen Zeitschrift «Casa Paterna», die ich betreute. Bäsi Anna schickte ihm ihren Beitrag in ihrem Romanisch und schrieb, dass sie es genau so gedruckt haben wolle. Als das Manuskript in der Druckerei und bei mir im Satz ankam, waren die Randspalten voll roter handschriftlicher Korrekturen, die ich für den Druck ausführen sollte. Pfarrer Michael hatte Bäsi Annas Heinzenberger Romanisch ins Schamser Romanisch abgeändert.
Ich nahm das korrigierte Manuskript mit nach Dalin und zeigte es meiner Tante. Sie war empört und befahl mir, alles so zu lassen, wie sie es geschrieben habe. Also machte ich in Bäsi Annas Auftrag keine Korrekturen. Ihr Artikel wurde im Heinzenberger bzw. im Präzer Romanisch gedruckt.
Als Pfarrer Michael das las, war er empört, und wie! Ich entschuldigte mich mit Bäsi Annas Auftrag, da sie ja die Autorin sei. Deshalb hätte ich gedacht, dass sie das Sagen habe.
Wer die romanische Mentalität kennt, versteht, dass Pfarrer Michael mir das nie vergessen konnte. Natürlich habe auch ich das nie vergessen, denn schliesslich habe auch ich fünfzig Prozent romanisches Erbe in mir.
Vor etwa zwanzig Jahren ergab es sich, dass wir uns anlässlich eines Evangelischen Kirchentages in Valendas an einem Tisch in der Turn- und Festhalle gegenüber sassen. Pfarrer Michael war schon sehr alt und erkannte mich nicht mehr. Man kam am Tisch ins Gespräch. Ich merkte, dass er gerne gewusst hätte, wer und woher ich und mein Begleiter waren. Wir sagten, wir kämen von Domat/Ems; unsere Frauen seien dort im Kirchenvorstand. Darauf fragte Pfarrer Michael, wie denn meine Frau heisse. Als ich den Nachnamen nannte, ging ein Ruck durch den alten Mann. Er bekam glänzende Augen. Hob die Hand mit gestrecktem Zeigefinger gegen mich: «Sie! Sie haben mir damals die Korrekturen von Annas Artikel nicht gemacht! Ohhh! Ja, ja! Das war nicht in Ordnung!»
Dann schwieg er, verlor sich in Gedanken und schaute mich nur noch ab und zu intensiv an. Wahrscheinlich erlebte er in der Erinnerung noch einmal seine Schamser-Romanisch-Niederlage und den Sieg von Bäsi Anna mit ihrem Heinzenberger Romanisch. Das hatte er nicht vergessen. Und ich auch nicht.
Pfarrer Michael habe ich nie mehr getroffen. Jetzt ist er ja schon seit vielen Jahren in den anderen Welten, wo, so hoffe ich auf jeden Fall für ihn, Schamser Romanisch gesprochen wird. Und auch Bäsi Anna ist schon lange gestorben und könnte vielleicht ganz in der Nähe von Pfarrer Michael logieren. Magari hat sie sogar Anhänger für ihr Romanisch gefunden oder arbeitet mit Pfarrer Michael zusammen an einem Rumantsch in Tschiel.
Im Beruf und auch im Militär war ich oft mit Romanisch sprechenden Leuten zusammen. Doch jedes Mal, wenn ich etwas von meinen bescheidenen Heinzenberger Romanisch-Kenntnissen von mir gab, erntete ich Gelächter. «Was ist denn das für ein Romanisch?» hiess es. So bin ich darauf gekommen, das Erbe von Bäsi Anna für mich zu behalten, und habe jetzt fast vieles vergessen.
Das meist gehörte Romanisch in meiner Umgebung ist das Oberländer Romanisch, und das tönt doch sehr anders, als das von Bäsi Anna. Als Kinder haben wir uns immer über das mira leu! von Mengia, der Frau von Gieri in Dalin, lustig gemacht. Wir sagten ja «varda» für «schau» nicht «mira» wie die Oberländer.
Ich habe immer wieder daran gedacht, doch noch richtig Romanisch zu lernen. Dieses Vorhaben ist daran gescheitert, dass kein Romanisch dem von Bäsi Anna genug ähnlich war. Und etwas anderes wollte und konnte ich nicht lernen. Die Prägung durch meine dynamische Tante war wohl einfach zu gross.
Eines Tages kaufte die Bäsi sich eine Geige. Fortan hörten wir ab und zu seltsame Geräusche aus dem unteren Stock, wo sie mit Nana, Neni und Öhi Balza wohnte. Meine Tante versuchte, das Geigenspiel sich selber beizubringen.
In diesem Fall wäre etwas mehr Bescheidenheit allerdings von Vorteil gewesen. Ich kann mich an keinen einzigen schönen, harmonischen Ton erinnern, der zu uns in den oberen Stock herauf geklungen wäre. Es tönte jeweils eher wie das gequälte Jammern einer unglücklichen Seele im Fegefeuer oder wie das Geräusch von seit Jahren nicht mehr geölten Eisenscharnieren einer Stalltüre. Mir tat die schöne Geige leid.
Mir fällt aber auch auf, dass Bäsi Annas Charakter sich irgendwie quervererbt haben könnte und gewisse Anlagen von ihr auch in mir vorhanden sind. Auch ich habe immer zu Extremismus geneigt und habe mir nie gerne etwas sagen lassen. Das führte dann dazu, dass ich für alles, was ich lernen wollte, länger brauchte als jemand, der einfach das übernahm, was schon andere herausgefunden hatten.
Bäsi Anna hatte im Verborgenen aber auch ein Herz aus Gold. Sie wurde aufgrund ihrer Tätigkeit in der Scoletta für etwa zwanzig Kinder als Gotta angefragt. Sie nahm alle Anfragen an und verteilte auch jedes Jahr so viele Geschenke, wie sie Patenkinder hatte.
In ihr brannte eine enorme Liebe, die sie eben nicht einem Mann und eigenen Kindern, sondern dem Romanischen und ihren Patenkindern weitergab. Sie war sehr kreativ, bastelte, malte und kreierte Spiele. Ich kann mich an Puzzles erinnern, die sie selbst zeichnete, anmalte und dann mit der Laubsäge zuschnitt. Natürlich spielte sie Flöte und sang mit uns in der Scoletta. Sie schrieb viel, dichtete und liess sogar ein Büchlein mit ihren Gedichten drucken. Es gibt auch romanische Lieder mit ihren Texten, die heute noch Chöre in der Gegend ab und zu vortragen.
In der Scoletta bastelten wir mit Bäsi Anna Kasperlifiguren aus Zeitungspapier, das wir im Wasser auflösten und dann im Leim tränkten. Nachdem wir aus dieser Masse das Wasser herausgepresst hatten, konnten wir Gesichter für die Kasperlifiguren formen und, wenn das Material trocken war, anmalen. Im Hals machten wir von unten her ein Loch bis in den Kopf. Dann kam ein Kleid mit Ärmeln dazu, und wir konnten mit drei Fingern die Figur bespielen. In den Kopf kam der Zeigefinger, in die Ärmel der Daumen und der Mittelfinger.
Bäsi Anna spielte uns auch oft Kasperlitheater vor. Das machte sie so gut und dramatisch, dass wir vor Angst schlotterten und uns fast die Haare zu Berge standen. Ihre Figuren schrien, weinten, lachten und kämpften, dass wir völlig aus dem Häuschen gerieten und uns fast nicht mehr beruhigen konnten. Sie feierte mit uns auch bei Kerzenlicht Kinderweihnachten in der Turnhalle. Daran habe ich ganz wunderbare Erinnerungen.