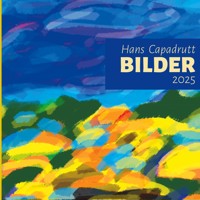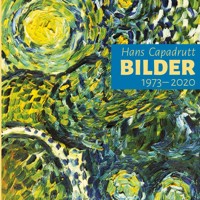Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In "Erinnerungen - Vom Bauernbub zum Jünger Gutenbergs" erzählt der Autor noch einmal ein paar Erlebnisse als Bergbauernbub. Dann geht es in die Schriftsetzer-Lehre. Berufliche und private Erlebnisse wechseln sich ab. Nach der Lehre - in der es einige Probleme zu bewältigen gibt - geht es hinaus in die Welt. Auf fremde "Inseln", auf denen andere Regeln gelten als auf der "Heimat-Insel".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 255
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Mann muß hinaus
Ins feindliche Leben,
Muß wirken und streben
Und pflanzen und schaffen,
Erlisten, erraffen,
Muß wetten und wagen,
Das Glück zu erjagen.
Aus: «Das Lied von der Glocke» von Friedrich Schiller
INHALT
VORWORT
NOCH EINMAL BERGBAUERNBUB
WEICHENSTELLUNG
IN DER LEHRE
VERÄNDERUNG
FREIZEIT-ERLEBNISSE
EIN ANDERER WIND
DIE GRÜNE SCHULE
DIENST AM VATERLAND
ES FÄHRT EIN ZUG
NEUORIENTIERUNG
BLEISATZ UND ÖLFARBEN
IM UNTERLAND
DAS LEBEN GEHT WEITER
KURZGESCHICHTE
GEDICHTE
FEEDBACKS UND NACHWORT
DER FLUG DER BIENE
Wenn ich zurückschaue, kommt mir mein Lebensweg vor wie der Flug einer Biene über mehrere Inseln. Auf der Suche nach Nektar flog ich manchmal auf die eine, dann auf die andere und oft im Kreis. Einmal landete ich auf einer nahrhaften Blüte, dann auf einem trockenen Ast. Manchmal surrte ich verzweifelt auf etwas herum, durch das ich hindurchsehen, jedoch nicht hindurchfliegen konnte. In allen Situationen fand ich jedoch immer einen Weg. Den Weg nach Hause!
Umschlagbild: Hans mit Neni Christian Capadrutt (ca. 1956).
VORWORT
Es freut mich, dass mein erstes Buch «Ein Bergbauernbub am Heinzenberg» auf recht viel Anklang gestossen ist, ja mehrere Leser sogar begeistert hat.
In meinem zweiten Buch erzähle ich noch einmal ein paar Erlebnisse als Bergbauernbub. Dann geht es in die Schriftsetzer-Lehre, wo mehrere – für Laien wahrscheinlich schwer zu verstehende – Fachbegriffe vorkommen, die berufsbedingt jedoch nicht zu vermeiden waren.
Berufliche und private Erlebnisse wechseln sich ab. Nach der Lehre – in der es einige Probleme zu bewältigen gab – ging es hinaus in die Welt. Auf fremde «Inseln», auf denen andere Regeln galten als auf der «Heimat-Insel».
Der ehemalige Bergbauernbub war ein junger Mann geworden, der so schnell als möglich auf eigenen Füssen stehen wollte. Als Geselle stand er im Beruf auf der untersten Sprosse der Leiter. Und auch privat musste er ganz neu beginnen. Niemand stand – wie beim Schüler-Skirennen in Präz – im Zielraum und applaudierte bei seiner Ankunft in der Stadt.
Es ist wieder ein sehr persönliches Buch. Meine Erinnerungen kommen so daher, wie ich sie von 1966 bis ca. 1978 erlebt, empfunden und gefühlt habe. Offen und – wie mir jemand gesagt hat – vielleicht etwas (zu) direkt. Trotzdem hoffe ich, dass auch dieses Buch es wert ist, gelesen zu werden.
Domat/Ems, Juni 2019
Aussichtspunkt Crap Carschenna mit Blick auf den äusseren Heinzenberg.
NOCH EINMAL BERGBAUERNBUB
Anna Capadrutt-Camenisch feiert am 16. Juni 1938 in bester Gesundheit ihren 95. Geburtstag.
«DAS KUNNT VO PORTEIN»
Meine Urnana war eine robuste Frau. Wahrscheinlich in der gleichen Art wie ihre Enkelin, meine Bäsi Anna.
Sie wurde fünfundneunzig Jahre alt und war, soviel ich weiss, nie krank. Kaum zu glauben bei der damaligen Lebensweise. Jahrein, jahraus arbeiten. Vom Morgen bis am Abend, im Haushalt, auf dem Feld und im Stall. Dazu vier Kinder grossziehen. Bettwäsche, Kleider, Windeln waschen am Brunnen. Kein Kühlschrank in der Küche und schon gar kein Geschirrspüler.
Und erst die Ernährung. Keine steril in Plastik abgepackte Bio-Kost vom Coop, Migros oder Aldi. Das muss gewimmelt haben von «Käfern» aller Art. Wie konnten die Leute das damals nur überleben? ;-)
Papa erzählte ab und zu lachend, dass seine Nana einmal auf der Strasse bei Song Onna dem Pfarrer begegnet sei. Der habe sich Zeit genommen und lange mit ihr geplaudert.
So lange bis sie das gleiche Problem bekommen habe wie ich in der zweiten Klasse bei Fräulein Göhring. Und es auch auf die gleiche Weise gelöst habe.
Als ob es die normalste Sache der Welt wäre, habe sie etwas den langen Rock gelupft und – während sie sich mit dem Pfarrer weiter unterhielt – ihr Problem auf die Strasse rinnen lassen.
Weil Papa als Bub scheinbar auch nicht immer so folgte wie er es später von uns Buben verlangte, davonlief und machte, was er wollte, liess sich seine Nana etwas Besonderes einfallen, um ihn zu kontrollieren.
Eines Tages habe sie einen langen Kälberstrick auf die Wiese mitgenommen und das eine Ende ihm und das andere sich selbst um die Taille gebunden. So habe sie dann seelenruhig weiter gearbeitet und ihr Enkel musste ihr auf Schritt und Tritt bei der Arbeit nachlaufen.
Ölbild. Urneni Johann Balthasar Capadrutt, geb. 1843, Bierbrauer in Neapel.
Urnana Anna Capadrutt, geb. 1843, war eine Tochter von Thomas Camenisch von Portein. Ihr Mann, mein Urneni Johann Balthasar Capadrutt, war – wie Papa erzählte – einmal Bierbrauer in Neapel.
Ihre Tochter, meine Nana Anna Capadrutt, geb. 1894, war eine Pedrett von Präz und heiratete meinen Neni Christian Capadrutt.
Anna Capadrutt-Camenisch mit ihrer Enkelin Anna (Bäsi Anna, ca. 1936).
Alle Fotos: Kulturarchiv Cazis.
Schon als Bub zeigte sich, dass auch ich den speziellen Humor von Papa, Öhi Balza und Öhi Christli mitbekommen hatte. Wie übrigens auch mein Bruder Albert.
Einmal brachen meine Eltern in Gelächter aus, als ich am Mittagstisch z Chalb machte und auf ihren gutmütigen Spott antwortete: «Das kunnt vo Portein.»
Das fanden sie ungeheuer lustig, weil ich gar nicht wissen konnte, was das auf sich hatte mit Portein. Scheinbar war mir einmal zu Ohren gekommen, dass über die Verwandtschaft von Portein geredet worden war. Das benutzte ich dann im richtigen Moment, um bei meiner Familie eine Pointe zu landen.
Wenn ich mich recht erinnere, erzählte Papa einmal, dass seine Nana Pfeife geraucht habe. Ganz sicher bin ich mir allerdings nicht. Falls doch könnte es meine Freude an diesen schönen, meist aus besonderem Holz geschnitzten, Rauchinstrumenten erklären. Und somit könnte ich wieder sagen: «Das kunnt halt vo Portein.»
Neni mit Papa, Nana mit Bäsi Anna, Öhi Balza und Urnana (ca. 1927).
Neni, Nana, Papa, Bäsi Anna und Öhi Christli auf dem Bänkli vor der Hütte von Prau Pigniel (ca. 1950).
Nana, Bäsi Anna, Urnana, Öhi Christli, Papa (ca. 1940).
Vor einiger Zeit bekam ich einen Anruf von einem Mann aus Davos, der erzählte, dass er den Stammbaum meines Grossvaters Albert Schmid, dem Vater meiner Mutter, zusammengestellt habe, und dass auch wir beide verwandt seien.
Dass mein Neni von Sarn zwölf Geschwister hatte, war eine Überraschung. Davon habe ich nie etwas mitbekommen.
Wie schon im ersten Buch erwähnt, fällt es mir schwer, die komplizierten Verzweigungen verwandtschaftlicher Zusammenhänge weiter als bis zu Kusin und Klikusin nachzuvollziehen. Dass Mama eine Kusine von Jakob Schutz, dem ehemaligen Nationalrat aus Filisur, war, konnte ich trotzdem behalten.
Maiensäss Prau Pigniel. Bäsi Anna und Öhi Balza wetzen für das Mähen der Mägari beim «Tänneliwald» ihre Sägasa.
Ich mache mir oft Gedanken darüber, wie all diese verschiedenen Erbteile in mir zu dem geführt haben, was meine Anlagen und meinen Charakter ausmachen.
Je fünfzig Prozent von Mama und Papa, also von Schmid und Capadrutt. Mama hatte hälftig Schmid und Lanicca bekommen, weil Tata eine Lanicca aus Sarn war. Papa neben Capadrutt und Camenisch aus Portein wegen Nana, seiner Mutter, auch noch zur Hälfte Pedrett. Allein das ist schon ziemlich kompliziert für mich.
Dass etwas an der Vererbungslehre dran ist, wird kaum jemand bestreiten. Mit ganz dar Papa oder ganz d Mama wird zum Beispiel ausgedrückt, dass ein Kind einem Elternteil «nachschlägt». Manchmal ist es aber auch ganz dar Neni oder d Nana.
Weil ich jedoch immer wieder sehe, wie verschieden Geschwister sein können, die doch in der Regel von den gleichen Eltern abstammen, frage ich mich, wie denn das zustande kommt.
Auf Seite 45 in diesem Buch sagte mir Sancho in der Lehre, dass ich im Zeichen Wassermann geboren sein müsse – und hatte recht. Was mich natürlich staunen liess.
Nachdem auch ich mich viele Jahre mit Astrologie beschäftigt hatte, gelang es mir ebenfalls, ab und zu anhand gewisser Verhaltensweisen astrologische Einflüsse zu erkennen.
Als Papa auf Prau Pig niel beim Heuen einmal sagte, dass Bäsi Anna ein Ross sei, beschrieb er damit die enorme Kraft und Dynamik der Widder-Energie, die meine Tante auch verwendete, um ihr Romanisch unter die Leute zu bringen.
ANNANUTINA
Fährt man von Sarn her durchs Dalinertobel am Haus vorbei, das damals Bäsi Anna, Öhi Balza und Nana gehörte, führt die Strasse bald darauf um Hansruedis Stall herum ins Dorf.
Ich kann mich erinnern, wie der alte Tscharner vor dieser unübersichtlichen Kurve jeweils ausgiebig «Tütato, tütatooo ...» hornte, bevor er mit seinem Postauto um den Rank fuhr.
Die Poststelle in Dalin wurde von Annanutina, der ledigen Schwester von Johann Richard, betreut. Sie wohnte mit ihrer Mutter im unteren Teil des Dorfes. Im Attenhofer-Haus. An der Wand neben der Treppe prangte eine grosse, rote Tafel mit der Aufschrift «POST – Telephon – Telegraph».
Wenn Papa am Telefon verlangt wurde, kam die Pöstlerin auf die Haustür und rief: «Bartli, Telefon!» Dann sprang Papa ihr voraus auf die Strasse und eilte hinunter ins Postbüro, wo das einzige Telefon im Dorf an der Wand hing.
Mit einer grossen Ledertasche über der Schulter lief Annanutina jeden Tag geruhsam von Haus zu Haus, verteilte Zeitungen, Briefe, Postkarten und auch schon etwas Werbung, wie zum Beispiel den Jelmoli-Katalog. Neben dem Amt als Pöstlerin unterstützte sie ihren Bruder Johann Richard bei der Arbeit auf dem Hof.
Weil der kleine Bruder meiner Jugendfreundin Rosmarie gleich hiess wie ich, war er dar kli Hans und ich dar gross Hans. So konnte man uns auseinanderhalten.
An einem schönen Sommermorgen liefen dar gross Hans und dar kli Hans durchs Dorf bis zur Posthaltestelle bei Deias Haus und von dort den Stutz duruf zum Hof von Johann Richard.
Sein Haus – heute das seines Sohnes Hansruedi – war durch eine überdachte Laube mit dem Stall verbunden, der in der Kurve, wo der alte Tscharner mit dem Posthorn hupte, an der Strasse steht.
Die beiden Buben öffneten das hölzerne Tor, liefen durch den Hof und auf der anderen Seite hinaus zum Backhaus.
Das Backhaus war ein kleiner, länglicher, gemauerter Bau mit einem Spitzdach. Dort drin stand der grosse Backofen, in dem die Bäuerinnen abwechselnd ihre Brote buken. Neben der sonnenverbrannten Tür befand sich ein kleines Fenster.
Dar gross Hans schaut durchs Fenster in den geheimnisvollen Raum. Die Sonnenstrahlen zeichnen helle, längliche Muster auf die alten Bretter. Wenn er sich bewegt, verändert sich auch sein Schatten. Er zieht und rüttelt an der Klinke. Plötzlich geht die Tür einen Spalt breit auf. Die beiden Buben zwängen sich hindurch und stehen gleich darauf vor dem grossen Backofen.
Nachdem sie den Raum inspiziert haben, fangen sie an herumzualbern. Machen Fangis, ziehen die Schuhe aus, laufen barfuss durch den Raum. Es wird immer lustiger.
Bald liegen ihre Kleider auf dem Boden, und wie Kobolde, die sich aus ihrer Höhle gewagt haben, rennen sie nackt in der Backstube herum.
Plötzlich verdunkelt sich das Fenster, ein Schatten fällt in den Raum. Die beiden Kobolde erschrecken und würden am liebsten sofort wieder in ihren Höhlen verschwinden. Doch da sie keine echten Kobolde sind, gibt es auch keine Höhlen.
Dar gross Hans und dar kli Hans sind in der Backstube gefangen und der Frau, die hinter dem Schatten steht, hilflos ausgeliefert. Es ist eine unverheiratete Frau, die wahrscheinlich noch nie zwei nackte Kobolde in Aktion gesehen hat: Annanutina, die Pöstlerin.
Wie wir aus dem Backhaus und nach Hause gekommen sind, daran kann ich mich nicht erinnern.
Mein Bruder erzählte kürzlich, dass Annanutina zu Hause Bericht erstattet habe. Ich weiss allerdings nicht mehr, ob Mama mich darauf angesprochen oder deswegen geschimpft hat.
DIE KRÄMERIN
Mama erzählte oft, dass sie während der Schneiderinnenausbildung mehrere Jahre jeden Tag zu Fuss von Sarn nach Thusis und zurück gelaufen sei. Manchmal, wenn es grad gepasst hätte, habe sie aber auch mit dem alten Thomas auf dem Heimweg mit der Pferdepost mitfahren können.
Mama arbeitet in der Stube an ihrer Bernina-Nähmaschine. Über ein Trittbrett, das sie mit dem Fuss bedient, wird ein Schwungrad angetrieben, dessen Bewegungsenergie auf die Nadel übertragen wird.
Sie klagt, dass die Maschine sich manchmal benehme wie ein störrischer Esel. Nämlich immer dann, wenn sie selbst ungeduldig oder ärgerlich sei. Das würde ihre Bernina nicht vertragen.
Wir Buben haben ein Tuch über den Stubentisch gelegt und liegen darunter in unserer Hütte. Plötzlich ruft es auf der Haustür «Holla!»
Mama steht auf, öffnet die Stubentür und geht in den Gang. Neugierig kriechen wir aus unserer Hütte und hören, wie sie sich mit einer fremden Person unterhält. Dann tritt eine alte Frau in die Stube. Auf dem Rücken trägt sie eine schmale, hohe Kommode mit vielen kleinen Schubladen.
Staunend betrachte ich die Krämerin. So eine Frau habe ich noch nie gesehen.
Mich wunderte, dass Mama so freundlich zu dieser fremden Frau war. Uns Buben hatte man erzählt, dass man mit Zigeunern vorsichtig sein müsse, weil sie stehlen und betrügen würden. Vor dieser Frau schien Mama jedoch keine Angst zu haben.
Sie machte den Tisch frei, und die Krämerin legte ächzend ihre schwere Last auf unser Hüttendach. Dann öffnete sie vor unseren staunenden Bubenaugen die kleinen Schubladen.
Mit Entzücken betrachtete Mama die vielen Gebrauchsgegenstände, die sie für ihre Näh- und Schneiderkunst brauchen konnte.
Freudig wählte sie mehrere Sachen aus, legte sie auf den Tisch, liess sich beraten. Dann lief sie zum Stubenbuffet, kam mit dem schwarzen Portemonnaie von Papa zurück und bezahlte.
Die ganze Zeit fragte ich mich, wie diese alte Frau eine so schwere Last durch die Gegend tragen konnte. Etwas an ihr faszinierte mich. Ich spürte, dass sie aus einer ganz anderen Welt kam. Sie war eine Fahrende. Immer unterwegs. Im Gegensatz zu uns ohne festes Zuhause.
Mama machte Kaffee, und die Frau erzählte, wo sie schon überall hausiert habe. Am ganzen Heinzenberg und auch anderswo. Nicht immer würden die Leute sie gut behandeln. Aber das sei halt, wenn man eine Zigeunerin sei. Diese Szene habe ich nie vergessen. Wie die alte Frau mit ihrem von Wind und Wetter gezeichneten Gesicht an unserem Stubentisch sass, aus ihrem Leben erzählte und ihr Leid klagte.
Und auch nicht, wie Mama zuhörte und an ihrem Schicksal teilnahm. Ihr Verhalten hat meine Einstellung zu den Fahrenden bis heute geprägt. Vielleicht bin ich deshalb jahrelang umhergestreift und erst spät etwas ruhiger und sesshafter geworden.
Nach etwa einer Stunde dankte die Krämerin für den Kaffee, stand auf, wuchtete stöhnend die schwere Kommode auf ihren alten Rücken und verschwand aus meinem Leben, jedoch nicht aus meiner Erinnerung.
SCHÜLERSKIRENNEN
Das jährliche Schülerskirennen startete oberhalb dem Dorf in der Allmend. Ganz in der Nähe stand d Hütta vom Haas, unserem Schafhirt.
Die Piste führte zwischen Lärchen hindurch und – je nachdem wie viel Schnee lag – über oder durch den Zaun in einer Rechtskurve in die Wiesen der Präzer Bauern hinunter. Auf eine steile Strecke dem Hang entlang folgte eine Linkskurve. Nach einer kurzen Gleiterstrecke fuhr man einen kleinen Hang hinunter und über den Alpweg. Wenn der Sprung über den Weg ohne Sturz gemeistert war, kam der gefürchtete Schlusshang ins Zielgelände, wo Eltern, Onkels, Tanten, Götti, Gotta und Freunde standen und den ankommenden Rennfahrern applaudierten.
Schon Wochen vor dem Rennen wurde die Piste von uns Schülern mit den Ski in den Schnee gestampft. Die Aufsicht hatten die ältesten Schüler und einige Erwachsene, die für ihr Rennen die Piste noch ein Stück weiter in die Allmend hinauf stampften.
An einem Sonntag laufen meine Brüder und ich mit den Ski auf den Schultern und den Stecken in der Hand am Tanzsaal vorbei die Alpstrasse hinauf zur Piste, um für das Rennen zu trainieren.
Dort angekommen werfe ich meine Bretter auf den Boden, richte sie parallel aus und spärtze die Schuhe unter die Lederriemen zwischen die Metallbacken. Dann ziehe ich die dicke Feder über den hinteren Teil der Schuhe und achte darauf, dass sie genau in der Vertiefung des Schuhabsatzes liegt. Ich beuge mich nach vorn und drücke mit aller Kraft die beiden Verschlüsse nach unten, bis sie mit einem harten Klapf auf dem Ski aufschlagen.
Zu dritt stägeln wir die Piste duruf. Ein Stück weiter oben treffen wir ein paar Präzer Buben.
Einer von ihnen wollte uns zeigen, wie gut er seine Ski gewachst hatte. Er nahm Anlauf, machte eine «Christiania» und landete, als ob er ufra Iisblaatra usgrutscht wäre, auf dem Rücken. Das Problem war, dass seine Ski keine Kanten hatten. Die spiegelglatt gewachsten Skiseiten konnten auf der harten Piste nicht greifen. Das gab mir zu denken, weil meine Ski auch keine Kanten hatten.
Beim ersten Skirennen, an das ich mich erinnere, war ich noch bei den Jüngsten eingeteilt. Deshalb starteten wir nicht so weit oben wie die grossen Buben und mussen auch nicht den steilen Zielhang hinunter fahren.
Renntag. Mit etwas Glück schaffe ich den Sprung über den Alpweg und erwische die Rechtskurve in die Schleife, die etwas später links um den Zielschuss herum führt. In dieser Kurve kann man leicht abrutschen und verliert dann für den folgenden Schräghang Tempo.
Und genau das passiert. Ich schlittere neben die Piste. Deshalb heisst es dann am Abend bei der Rangverkündigung in der Turnhalle: «Achter Rang ...!»
Mit gesenktem Kopf laufe ich nach vorn und nehme eines der letzten Geschenke vom Gabentisch.
Bei den grossen Buben gewann Kassel, der Bruder von Rosmarie und vom klina Hans. Das gefiel mir und motivierte mich. Was dar Kassel konnte, wollte ich auch einmal können.
Ein paar Jahre später war ich der Jüngste in der Kategorie der grossen Buben, musste zum ersten Mal ganz oben starten und auch den steilen Zielhang hinunterfahren, was mich etwas beunruhigt.
Renntag. Ich bin angespannt. Auf schwachen Beinen trage ich meine Ski, die ich von meinem zehn Jahre älteren Cousin Kurt bekommen habe, den Alpweg hinauf zur Rennpiste. Sie sind zwei Meter zehn lang und eigentlich viel zu gross für mich. Doch ich komme gut mit ihnen zurecht und bin stolz, endlich auch Ski mit Kanten zu haben.
Zusammen laufen wir Rennfahrer die Piste hinauf zum Start. Zwischen zwei Lärchen, die das Starthäuschen ersetzen, steht schon Netti, der uns ins Rennen schicken wird. Er hat seine Uhr auf die Sekunde genau mit jener abgeglichen, die im Zielgelände unsere Zeit stoppen wird.
Ich reihe mich, gemäss der Nummer auf meiner Jacke, zum Start ein. Der Erste startet, der Zweite, der Dritte ... Dann bin ich dran. «Achtung, fertig, looos!»
Ich stosse meine Stöcke in den Schnee ..., bekomme überraschend schnell Tempo ... Die Piste ist härter und schneller als gedacht. Ich flitze zwischen den Lärchen hindurch ...
Bald kommt die Rechtskurve durch den Zaun. Ich lasse meine Bretter laufen, rattere dann dem Hang entlang nach unten und konzentriere mich auf die nächste Kurve. Auch die gelingt problemlos. Was für ein Unterschied zu den alten Ski ohne Kanten!
Dann nach rechts, den Hügel hinunter und über den Alpweg. Ich fliege durch die Luft, lande hart, gehe in die Knie ... Kann mich mit Mühe halten. Die Ski an meinen Füssen gleiten auf den Steilhang zu. Jetzt fühle ich mich wie ein Jockey, der die Kontrolle über sein Pferd verloren hat.
Wir rasen den Zielhang hinunter, zwischen den beiden Fahnen hindurch und auf den Platz, wo die vielen Leute stehen. Knapp vor den Zuschauern mache ich eine Christiania.
Keuchend lehne ich mich auf meine Stöcke und betrachte verwundert meine Ski.
Bei der Rangverkündigung am Abend gab es eine Überraschung: Im ersten Rang und Sieger der 1. Kategorie: Dar gross Hans.
Mir wurde schwindlig vor Aufregung und Freude. Wie in Trance lief ich durch die Turnhalle zum Gabentisch. Alle Geschenke waren noch da, ich konnte nehmen, was ich wollte. Dann kam die zweite und dritte Überraschung: Auf Rang zwei und drei folgen meine Brüder.
Bei da Maitla siegte wieder Rosmarie, meine Nachbarin und Schulfreundin; die Schwester vom Kassel, der die letzten Jahre bei den Buben gewonnen hatte.
Auch in den beiden folgenden Jahren waren meine Ski schneller als alle anderen. Und jedes Mal kam es mir vor, als ob ich nur ein Jockey auf einem Rennpferd wäre.
Meine Brüder belegten wieder – diesmal in umgekehrter Reihenfolge – den zweiten und dritten Rang. Und Rosmarie hatte immer noch keine Konkurrenz bi da Maitla.
Für die Rangverkündigung am Abend in der Turnhalle waren die Frauen schon vor Wochen aufgerufen worden, Kuchen, Torten und Gebäck zu liefern. Auf beiden Seiten der Turnhalle standen Tische, voll beladen mit all den Köstlichkeiten, die unsere Mütter gebracht hatten.
Auch Mama war eine Spezialistin darin, mehrstöckige, mit Crème gefüllte Torten herzustellen. Ich sehe noch, wie sie in der Küche steht und voller Freude ihre Kunstwerke kreiert.
Wir Buben schauten zu, durften ab und zu probieren und fanden natürlich, dass ihre Torten die Schönsten von allen waren.
Nach der Rangverkündigung herrschte in der Turnhalle eine Stimmung wie an Weihnachten in der Kirche, nachdem die Kinder ihre Geschenke erhalten hatten. Es wurde gegessen, getrunken, gelacht und geredet, bis die Mütter und Väter aufstanden und sich mit ihren Skirennfahrer/innen langsam auf den Heimweg machten.
TSCHUTTEN BEI DER BURG
Unterhalb von Präz steht die Burg Heinzenberg. Entstehungszeit laut Wikipedia um das Jahr 1200 herum. Die Geschichte und das Alter der Burg kümmert uns Buben allerdings nicht. Wir streichen um die Ruine herum, weil im Gestrüpp Niela, so dick wie die Stumpen vom alta Deia, zu finden sind. Die schneiden wir mit dem Sackmesser in kurze Stücke und zünden sie an, als ob es Zigarren wären.
Meine Raucherkarriere dauert allerdings nur kurz. Die Niala brennt mir auf der Zunge und vom Geruch wird mir übel. Weil die Wiese unterhalb der Burg eine der wenigen ebenen Flächen am äusseren Heinzenberg ist, treffen wir Buben von Dalin, Präz und Raschlinas uns dort am Sonntag manchmal mit Hatti und Netti, um Fussball zu spielen.
Ich gehörte nicht zu den begehrten Spielern, weil ich einen Ball weder stoppen noch halten noch gezielt weitergeben konnte. Meist kam ich deshalb in die Verteidigung oder, was mir am liebsten war, ich durfte zwischen den beiden Haselstecken das Goal bewachen. Das war eher meine Welt. Da fühlte ich mich gut, weil ich nur für mich allein verantwortlich war. Wenn ich einen Ball nicht halten konnte, war das nicht so schlimm, wie wenn ich ihn nicht stoppen und weiterleiten konnte.
Manchmal ertappte ich mich allerdings bei der Frage, wieso die anderen Buben all diese Dinge konnten. Und warum mich nie jemand diese Techniken gelehrt hatte. Denn ich war, wie meine beiden Brüder auch, ein flinker Turner und guter Skifahrer. Noch so gerne hätte ich gelernt, wie man einen hohen Ball elegant abnehmen, stoppen und weitergeben kann.
Weil mich das scheinbar niemand lehren konnte, gab ich mir im Tor um so mehr Mühe. Furchtlos warf ich mich den Stürmern vor die Füsse, nahm ihnen den Ball weg, hechtete auf die Seite und schob auch scharf geschossene Bälle noch knapp über die Haselstauden rechts oder links vom Tor.
Einmal gelang es mir, einen hart geschossenen Ball noch mit einer Hand abzulenken. Er flog hinter dem Tor zlochab und verschwand. Als ich mein überdehntes Handgelenk rieb, kam Netti zu mir, massierte die schmerzende Stelle und lobte mich für meinen Mut. Das entschädigte mich für alle Mühe.
Was ein Foul war, ein Abseits oder ein Corner, wurde von Netti und Hatti entschieden, während sie selber als Stürmer agierten. Natürlich war man nicht immer gleicher Meinung. Manchmal dauerte es lange, bis so ein Fall ausdiskutiert war und wir weiterspielen konnten. Fast noch schwieriger war die Frage zu beantworten, was ein Tor war und was nicht. Bei zwei biegsamen Haselstecken als Torpfosten und ohne Netz im Hintergrund war manchmal schwer auszumachen, ob der Ball gerade noch innerhalb oder ausserhalb der Stecken hindurch geflogen war.
An einem Sonntag kommt Netti vom Militär auf den Fussballplatz. Er ist in der Rekrutenschule und muss die Uniform, wie damals üblich, auch im Urlaub tragen.
Zum Match kommen ein paar Mädchen zur Burgwiese herunter, unter ihnen Lucy. Netti ist ein attraktiver, sportlicher Bursche, und die Uniform macht ihn für d Maitla natürlich noch interessanter.
Bevor wir zu spielen anfangen, wird erst einmal gescherzt, gelacht und geneckt. Netti zieht für den Match seinen grünen Ausgangsjopen aus, nimmt die Mütze vom Kopf und legt beides sorgfältig auf einen grossen Felsbrocken auf der einen Torseite. Lucy schnappt sich die Mütze, setzt sie auf und rennt lachend über den Fussballplatz davon.
Ich beobachte, wie der sportliche Rekrut ihr nachrennt. Natürlich ist er schneller und fängt das Mädchen bald ein. Sie ringen um die Mütze. Lucy kreischt und lacht und wehrt sich. Nach einer Weile ist das Spiel beendet.
Lucy gesellt sich zu ihren Freundinnen, und Netti beginnt mit dem Zusammenstellen der Mannschaften.
Als es dann hiess, dass dar Hans wiedar im Gool isch, nahm ich mir vor, allen – und besonders Lucy – zu zeigen, wie mutig und gut ich für meine Mannschaft die Bälle halten konnte.
IN DER BADI
Eines Tages machte Mario den Vorschlag, am Sonntag die Badi in Thusis zu besuchen, um schwimmen zu lernen. Was natürlich sofort unsere Zustimmung fand. Keiner von uns Buben und auch niemand im Dorf konnte schwimmen. Und schon gar nicht unsere Eltern.
Am Äusseren Heinzenberg gab es nur den Balveinsersee, den wir ab und zu besuchten. Doch dort war es nicht möglich, schwimmen zu lernen, weil das Ufer nirgends einen Zugang bot, der für Nichtschwimmer geeignet gewesen wäre.
Nachdem wir die Erlaubnis der Eltern erhalten hatten, machten wir uns zu Fuss auf den Weg. Hinunter in die Baria und bis nach Summaprada. Von dort zum Bahnhof Thusis und über die Compognastrasse hinunter in die Badi.
Waren wir aufgeregt, als wir zum ersten Mal das Thusner Waldschwimmbad betraten! Der Mann an der Kasse empfahl uns, ein Schliessfach zu mieten, weil immer wieder Wertsachen gestohlen würden.
Mario, der Älteste, nahm den Schlüssel. Wir betraten die Umkleidekabinen und standen kurz danach mit Turnhosen bekleidet auf dem Rasen, wo viele Leute sich auf ihren Badetüchern von der Sonne bräunen liessen.
Nachdem wir einen Platz nah am Schwimmbecken gefunden hatten, breiteten wir unsere Tücher aus.
Männer, Frauen und Kinder schwammen scheinbar mühelos durchs Wasser, sprangen vom Einmeterbrett, tauchten und spielten.
Es sieht so einfach aus. Ich lasse mich im Nichtschwimmerbecken ins Wasser gleiten und beginne mit Armen und Beinen zu rudern. Doch so einfach geht es nicht. Ich gehe sofort unter, schlucke Wasser und komme hustend wieder hoch.
Meinen Brüdern und Mario geht es nicht besser.
Also halten wir uns vorerst am Beckenrand fest, strecken die Beine nach hinten und tun, was die Kaulquappen im Seeli auf Prau Pigniel machten, nachdem ihr Schwanz durch Beine ersetzt worden war. Wir schlagen nach hinten aus und üben erst einmal diese Froschbewegung.
Dann versuchten wir es nochmals mit ein paar Schwimmzügen. Mit wenig Erfolg. Stundenlang übten wir, schluckten Wasser, tauchten wieder auf, machten ein paar schnelle Bewegungen. Es war nicht einfach, aber wir gaben nicht auf.
Auf dem Heimweg hinauf nach Präz und Dalin besprachen wir voller Freude unsere Erlebnisse, erzählten und diskutierten. Die Zeit verging wie im Flug.
Natürlich wären wir gerne jeden Sonntag in die Badi gegangen, doch wenn es während der Woche geregnet hatte und erst am Sonntag auftat, mussten wir beim Heuen helfen.
Papa arbeitete nur im Notfall am Sonntag. Ich höre noch, wie er sagt: «Am Sunntig heuat ma nit!»
Wer genau mit ma gemeint war, wusste ich nicht, sah aber, dass die anderen Bauern scheinbar nichts mit diesem Wort zu tun hatten. Die meisten heuten auch am Sonntag, wenn es vom Wetter her nicht unbedingt nötig gewesen wäre.
Doch wenn wirklich a riisa Blätz Heu am Boden lag, mussten auch wir bei Kirchenglockengeläute auf die Wiese.
Bis Ende Sommer gelang es uns Buben aber doch noch, einige Sonntage in der Badi zu verbringen. Jeder von uns konnte beim letzten Besuch schon ein paar Meter schwimmen, ohne unterzugehen. Auch äusserlich unterschieden wir uns nicht mehr von den uns umgebenden Badibesuchern.
Mamma hatte uns richtige Badehosen gekauft, wir waren braungebrannt und lagen auf schönen, farbigen, grossen Badetüchern.
Ich traute mich immer öfter, die hübschen Bikini-Maitla, die sich neben mir auf der Wiese räkelten, anzlianza und war glücklich, wenn ab und zu zrugg glianz wurde.
WEICHENSTELLUNG
BERUFSWAHL
Als ich fünfzehn war, machten sich meine Eltern langsam Gedanken, was aus ihrem Zweitältesten einmal werden sollte. Dass ich mich nicht als Bauer eignete, war allen klar. Dazu war ich zu wenig praktisch veranlagt.
Im Sommer nach meinem zwölften Geburtstag geschah etwas, das ich nicht einordnen konnte. Eines Tages wachte ich auf und sah alles in einem neuen Licht. Mich, meine Eltern und Brüder, die Nachbarn, die Tiere und die Weiden. Die ganze kleine Welt um mich herum.
Es war ein schönes Erlebnis. Ich dachte lange darüber nach und kam zum Schluss, dass es etwas mit dem Älterwerden zu tun haben könnte. Was bedeuten würde, dass auch Papa, Mama, Öhi Balza und die anderen Erwachsenen mit zwölf Jahren etwas Ähnliches erlebt haben mussten.
Eines Abends, als ich mit Mama von der Wiese heimzua laufe, sage ich deshalb: «Gäll, mit zwölf erläbt ma am meischta!»
Voller Vertrauen, dass sie das bestätigen und mich damit ein Stück weit auf dem Weg in der Erwachsenenwelt willkommen heissen wird. Doch das tut sie nicht.
«Varzell nit so a Quatsch!», sagt sie heftig, lässt mich stehen und läuft voraus ins Dorf.
Es dauerte eine Weile, bis ich begriff, dass Mama mein Erlebnis also nicht gehabt hatte und wahrscheinlich auch alle anderen Erwachsenen in meiner Umgebung nicht.
Das beschäftigte mich.
Ich fragte mich, mit wem ich hätte reden können. Doch weil ich jeden Tag sah, dass es – ausser der täglichen Arbeit – kein Thema gab, über das gesprochen wurde, beschloss ich, meine Erfahrung für mich zu behalten.
Etwa zur gleichen Zeit hatte ich einen Traum. Ich sah einen alten Mann mit langem, weissem Bart. Er war an seinem Lebensende angelangt, hatte es geschafft, bis zum Ende durchzuhalten.
Als ich mich in diesem Mann wiedererkannte, durchflutete mich eine ungeheure Erleichterung.
Heute denke ich, dass das Lied «You raise me up» am ehesten ausdrückt, was ich damals empfunden habe:
You raise me up, so I can stand on mountains,
Yor raise me up to walk on stormy seas,
I am strong when I am on your shoulders
You raise me up to more then I can be.
Als ich fünfzehn war, machte ich an einem wunderschönen Sommersonntagmorgen einen Spaziergang durch Danlarasch. Ich kam an der Lärche vorbei, an der ich vor einiger Zeit beim Hüten ein Gesicht in die Rinde geschnitzt hatte.
Eine Weile betrachtete ich mein Werk. Es war verwittert, aber immer noch gut zu erkennen. Ich strich über die harte Rinde, befühlte die Formen, erinnerte mich, wie ich zum Schnitzen gekommen war.
Es war in der Sekundarschule, wo wir eines Tages die Aufgabe bekamen, Gips mit Wasser zu mischen und die Masse in eine Form zu giessen. Nachdem das Gemisch getrocknet war, sollten wir ein Gesicht in den Gips schnitzen.
Ich lege los, arbeite mit Begeisterung, schneide immer tiefer und modelliere jedes Detail heraus.
Als ich fertig bin schaut mich ein ernstes Gesicht an, eine Maske mit tiefen Stirnfalten, ausgeprägten Lippen und hervorstehenden Wangen.