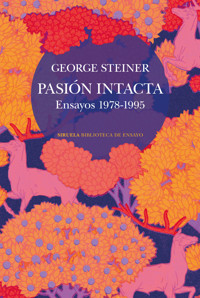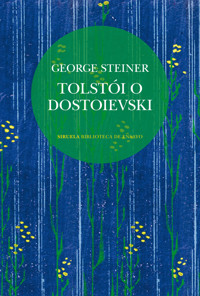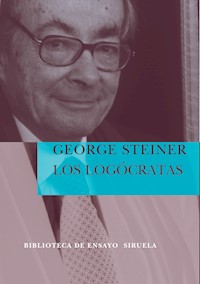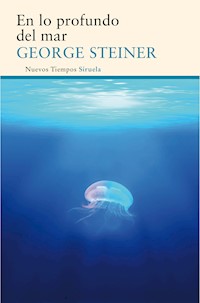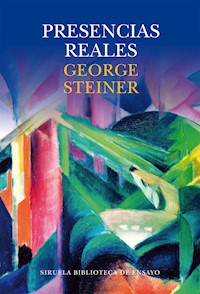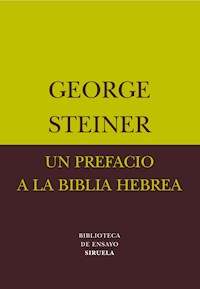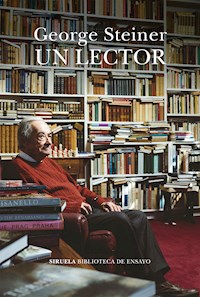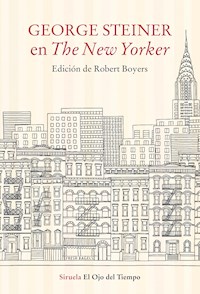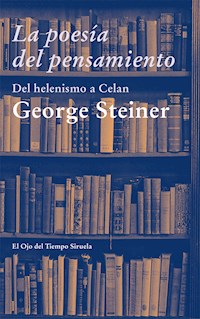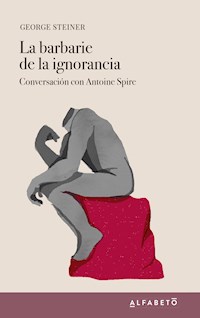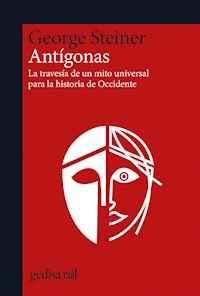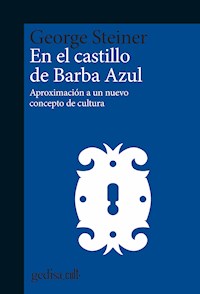16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
George Steiner, der unnachgiebige Denker, polyglotte Intellektuelle und scharfzüngige Kritiker, gibt im Gespräch mit Laure Adler Einblick in sein Leben und Werk. Tief verwurzelt in der europäischen Kultur, wurde für den Sohn österreichischer Juden, die 1940 aus Paris nach New York flohen, eine Frage zum Angelpunkt seines Denkens: Wie konnte das zivilisierte, kultivierte Europa diese unvorstellbare Barbarei hervorbringen? Als die Kulturjournalistin Laure Adler in einem englischen Garten zum ersten Mal George Steiner begegnet, weiß sie noch nicht, dass sie einen sehr langen Nachmittag miteinander verbringen werden: Über mehrere Jahre treffen sie sich immer wieder, um ihr Gespräch fortzusetzen. Steiner, als einer der letzten Benjaminschen Flaneure, rekapituliert das zwanzigste Jahrhundert. Seine Eltern fliehen vor dem wachsenden Antisemitismus in Wien nach Paris, 1940 schafft die Familie es gerade noch rechtzeitig, Frankreich in Richtung New York zu verlassen. Steiners Denken ist von seiner Biographie beeinflusst: seine Liebe für Sprache genauso wie seine Verachtung für die großen Mythen des vergangenen Jahrhunderts, die Psychoanalyse, der Marxismus und der Strukturalismus. Aber Steiner begleitet seine Leser nicht nur bravourös durch die Gedankenwelt des zwanzigsten Jahrhunderts, immer wieder kehrt er zu seiner großen Liebe, der Musik, zurück, die für ihn Ausdruck purer Lebenslust ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 173
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
George Steiner
Ein langer Samstag
Ein Gespräch mit Laure Adler
Aus dem Französischen von Nicolaus Bornhorn
Hoffmann und Campe
Vorwort von Laure Adler
Das erste Mal habe ich George Steiner vor etwa zehn Jahren bei einem Meeting gesehen. In jener Zeit, kurz vor den Wahlen zum Europäischen Parlament, war es noch vorstellbar, mitteleuropäische Intellektuelle einzuladen und ihnen zuzuhören … Der Saal war voll besetzt, und man bot dem Publikum gegen Ende des Tages Gelegenheit, Fragen zu stellen. Steiners Vortrag über die Zunahme populistischer Strömungen war eindringlich gewesen, sowohl auf historischer als auch auf philosophischer Ebene. Einer der Anwesenden stellte eine spitzfindige Frage, wohl eher, um die eigenen Kenntnisse herauszustellen als an einer Antwort interessiert. Steiner schonte ihn nicht. Ich dachte, dass dieser bedeutende Intellektuelle, dessen Werk mir zum Teil bekannt war, kein einfacher Mensch sein dürfte.
Und damit lag ich durchaus richtig. Ich sah ihn zwei Jahre später wieder, während eines Kolloquiums über die Figur der Antigone an der École normale supérieure, zu dem aus der gesamten Welt die wichtigsten Spezialisten angereist waren, um ihre Sichtweisen auszutauschen. Im Gegensatz zu den anderen mischte Steiner sich vor Beginn der Tagung nicht unter die Teilnehmer. Er wahrte Abstand, war angespannt, in Gedanken versunken. Er glich einem Romantiker aus dem neunzehnten Jahrhundert, der im Begriff ist, sich im eiskalten Morgengrauen zu duellieren, wohl wissend, dass er sein Leben aufs Spiel setzt.
So ähnlich war es dann auch. Wenn Steiner spricht, bezieht er Stellung. Sein Denken ist stets auf Abenteuer aus, entfaltet sich im Augenblick, da es sich artikuliert, und obgleich seine Bildung enzyklopädisch ist, in mehreren Sprachen und auf unterschiedlichen Gebieten, geht Steiner auf die Jagd. Er wildert, dringt ein ins Dickicht. Er verabscheut die gebahnten Wege, nimmt Irrwege in Kauf, auch wenn diese ihn zur Umkehr zwingen. Er will sich selbst zum Staunen bringen.
Diese Übung ist nicht einfach für jemanden, der nie der Ansicht war, die Sedimentierung der Kenntnisse sei ein Mittel, artikulierte Rede vorzutäuschen, welcher wiederum eine Theorie zugrunde liege.
Um denken zu können, muss man auf Sprache zurückgreifen. Steiner aber hat seit Jahrzehnten deren Fallstricke, Tricks, Schwierigkeiten und doppelte Böden untersucht. Als Bewunderer Heideggers, dessen Lektüre fester Bestandteil seines Tagesablaufs ist, arbeitet sein Geist stets im Bewusstsein der eigenen Endlichkeit und im verzweifelten Versuch, die poetische Rede mit dem Ursprung der Sprache in Übereinstimmung zu bringen.
Man könnte sich lange auslassen über die Komplexität von Steiners Denkübungen. Doch ist das nicht das Wesentliche, es amüsierte ihn eher. Bei ihm hat man nie das Gefühl, dass man an ein Ziel kommen muss, dass die Erhellung eines Problems Trost brächte. Im Gegenteil. Die Suche selbst bildet das Salz des Lebens. Und je gefährlicher die Übung, desto größer sein Jubel.
Er liegt ständig auf der Lauer. Gewitzt und sarkastisch, schont er weder sich selbst noch seine Zeitgenossen, ist mal ernst, dann wieder ausgelassen hellsichtig bis zur Verzweiflung, beseelt von einem aktiven Pessimismus.
Er ist ein Sohn Kafkas, dessen Werk er auswendig kennt, doch Freud ist ihm zuwider, und der Psychoanalyse gegenüber legt er eine, gelinde gesagt, merkwürdige Geringschätzung an den Tag. Auf ein Paradox mehr oder weniger kommt es ihm nicht an. Er bewundert die exakten Wissenschaften, verbringt jedoch, gleich einem Hobbybastler, beträchtliche Zeit damit, die vorsprachlichen Zonen aufzusuchen, die unsere Beziehung zur Welt regeln.
Interviews kann er nicht ausstehen. Das wusste ich. In einem Augenblick, da meine Stellung mir vorübergehend untersagte, meinen Beruf als Journalistin auszuüben, schlug ich ihm vor, mit einem Interviewpartner seiner Wahl längere Gespräche für France Culture zu führen. Er antwortete: »Kommen Sie. Besuchen Sie mich.« Ich bat den Intendanten von Radio France um die Erlaubnis, ausgerüstet mit einem Tonbandgerät nach Cambridge aufbrechen zu dürfen, etwa so wie eine Internatsschülerin um Ausgang bäte, weil eine Großtante für einige Stunden zu Besuch ist.
Seine Frau Zara öffnete die Tür. Sie hatte in einer Schreibpause zwischen zwei Seiten einen Cheesecake gebacken (sie gehört, was die europäische Geschichte des aufkommenden Totalitarismus betrifft, zu den bedeutendsten zeitgenössischen Historikerinnen). Draußen, in dem kleinen Garten, wuchsen Stockrosen, und Vögel zwitscherten ununterbrochen auf den Zweigen des blühenden Kirschbaums. George führte mich zum Ende des Gartens und öffnete die Tür seines Büros, eine Art achteckiger Hütte, die so konstruiert ist, dass sie eine maximale Anzahl von Büchern fassen kann.
Er unterbrach die Mozartplatte, die er gerade hörte. Das Gespräch konnte beginnen.
Ich ahnte nicht, dass ich noch so oft wiederkommen würde und dass sich für ihn im Lauf der Zeit – wie im Geheimen – die Lehre dessen vorbereitete, was er als langen Samstag bezeichnet.
In diesem Herbst werde ich mit dem fertigen Buch zurückkehren. Ich hoffe, dass George dann den neuen Text, an dem er zurzeit arbeitet, beendet hat. So böte sich die Gelegenheit, unsere Unterredung fortzusetzen.
Laure Adler Juli 2014
Eine bewegte Erziehung. Vom Exil zum Institut
Ihr Freund Alexis Philolenko spricht in den Cahiers de l’Herne von etwas ganz Bestimmtem: Ihrem Arm, dieser Missbildung, dieser physischen (Tat-)Sache. Er sagt, Sie hätten in Ihrem Leben vielleicht darunter gelitten. Und doch sprechen Sie nie davon.
Für mich ist es naturgemäß sehr schwierig, das objektiv zu beurteilen. Das Genie meiner Maman – einer großen Wiener Dame – ist in meinem Leben entscheidend gewesen. Sie war natürlich mehrsprachig, sprach Französisch, Ungarisch, Italienisch, Englisch; sie war wahnsinnig stolz, aber auf gänzlich private Art und Weise; und sie hatte ein wunderbares Selbstvertrauen.
Ich muss drei oder vier Jahre alt gewesen sein – genau kann ich das nicht mehr sagen, aber diese Episode hat mein Leben entscheidend beeinflusst. Meine ersten Jahre waren sehr schwierig, da mein Arm mehr oder weniger an den Leib gefesselt war; die Behandlungen waren sehr unangenehm, ich war ständig in Sanatorien. Maman aber sagte zu mir: »Du hast unglaubliches Glück! Du brauchst keinen Militärdienst zu leisten.« Dieser Satz hat mein Leben verändert. »Welch ein Glück du hast!« Dieser Gedanke war ein wunderbarer Fund ihrerseits, und es stimmte. Ich habe mein Studium zwei oder drei Jahre vor meinen Altersgenossen, die ihren Militärdienst ableisten mussten, beginnen können.
Denken Sie nur: dass sie darauf gekommen war! Mir ist die aktuelle Therapiekultur zuwider, die verschleiernde Wörter für Behinderte gebraucht, die uns weismachen will: »Man wird dies als sozialen Vorteil behandeln …« Aber dem ist nicht so: Es ist hart, sehr ernst, aber es kann sehr wohl zum Vorteil gereichen. Ich bin in einer Zeit erzogen worden, in der man Aspirin und Nougatbonbons ablehnte. Es gab Schuhe mit Reisverschluss – genial einfach. »Nein«, sagte Maman. »Du wirst lernen, Schnürsenkel zu binden.« Ich versichere Ihnen, es ist schwierig. Wer zwei gute Hände hat, denkt keinen Augenblick daran, aber das Schnüren von Schuhen ist eine unerhörte Kunst. Ich schrie, ich weinte; aber nach sechs oder sieben Monaten konnte ich meine Schnürsenkel binden. Und Maman sagte: »Du kannst mit der linken Hand schreiben.« Ich weigerte mich. Da hielt sie meine Rechte hinterm Rücken fest: »Du wirst lernen, mit der behinderten Hand zu schreiben.« – »Ja.« Und sie hat es mich gelehrt. Schließlich konnte ich Bilder und Zeichnungen mit meiner »schlechten« Hand anfertigen. Das kam einer metaphysischen Anstrengung gleich, einer Metaphysik des Willens, der Disziplin, und vor allem des Glücks, darin ein großes Privileg zu erkennen; und so ist es mein Leben lang geblieben.
Das hat mir auch erlaubt, glaube ich, bestimmte Zustände, bestimmte Ängste von Kranken zu verstehen, die für apollinische Menschen, die einen prachtvollen Körper und eine wunderbare Gesundheit haben, nur schwer fassbar sind. Welche Bezüge bestehen zwischen körperlichen oder geistigen Leiden und gewissen intellektuellen Anstrengungen? Das verstehen wir zweifellos nur unvollständig. Vergessen wir nie, dass Beethoven taub war, Nietzsche unter schrecklicher Migräne litt und Sokrates ausgesprochen hässlich war! Im anderen das zu erkennen, was er überwinden konnte, ist hochinteressant. Angesichts einer Person frage ich mich stets: Was hat er oder sie durchlebt? Welchen Sieg hat er oder sie errungen – welche tiefgreifende Niederlage erlitten?
In Errata erzählen Sie, dass Ihr Vater, der aus Wien kam, das Heraufkommen des Nationalsozialismus sehr früh erkannt hat, und die Familie deshalb nach Paris gezogen ist. Sie wurden in Paris geboren und sind sehr früh zusammen mit Ihrer Mutter Zeuge einer Demonstration geworden, auf der die Menschen »Tod den Juden!« riefen.
Ja, das wurde bekannt als Stavisky-Skandal. Eine obskure Angelegenheit, an die man sich aber erinnert, weil die französische extreme Rechte sich oft auf sie bezieht. Auf der Straße marschierte ein gewisser Colonel de la Roque vorbei. Heute erscheint er als eine auf komische Weise finstere Figur, aber in jener Epoche nahm man ihn sehr ernst. Ich stand daneben, vorm Lycée Janson-de-Sailly, lief mit meinem Kindermädchen die Rue de la Pompe hoch, weil eine kleine Meute rechtsextremer Demonstranten unter Führung jenes Colonel de la Roque vorrückte. »Tod den Juden!« Ein Slogan, der sich bald zu »Lieber Hitler als die Front populaire« wandeln sollte. All dies in einem Viertel (Rue de la Pompe, Avenue Paul-Doumer), in dem die jüdische Bourgeoisie stark vertreten war. Nicht dass Maman Angst gehabt hätte, aber aus Respekt für ein wenig veraltete Konventionen sagte sie zu mir und dem Kindermädchen: »Schließt die Vorhänge.« In dem Augenblick betrat mein Vater das Zimmer und entgegnete: »Öffnet die Vorhänge.« Er nimmt mich bei der Hand. An der Wohnung war ein kleiner Balkon. Ich erinnere mich noch genau an jede Einzelheit dieser Szene: »Tod den Juden! Tod den Juden!« Mit ruhiger Stimme sagt er zu mir: »Das nennt sich Geschichte, und du darfst dich niemals fürchten.« Für ein Kind von sechs Jahren sind solche Worte entscheidend. Seitdem weiß ich, dass dies Geschichte heißt, und wenn ich Angst habe, schäme ich mich und versuche, keine Furcht zu empfinden.
Ich hatte sehr früh das außerordentliche Privileg zu wissen, wer Hitler war, was mir eine bewegte Erziehung bescherte. Seit meiner Geburt im Jahr 1929 sah mein Vater mit absoluter Klarheit voraus – ich bin im Besitz seiner Tagebücher –, was sich ereignen würde. Nichts hat ihn überrascht.
Ihr Vater, der also vorausahnte, was sich in einem vom Nationalsozialismus entflammten Europa ereignen würde, fasste dann den Entschluss, mit seiner Familie in die Vereinigten Staaten zu emigrieren. Unter welchen Umständen?
In Frankreich hatte Paul Reynaud im letzten Moment entschieden, dass das Land unbedingt Jagdflieger, die Grumman, benötige. Mein Vater wurde zusammen mit anderen Finanzexperten nach New York geschickt, um über den Kauf von Jagdflugzeugen zu verhandeln. Als er in New York eintrifft, kommt es zu einem phantastischen Zwischenfall. Heute denkt niemand mehr daran, dass New York damals eine völlig neutrale Stadt war, voller Nazis auf Mission, die das Hakenkreuz am Kragen trugen; auch Bankiers waren darunter, betraut mit Kaufaufträgen oder Verhandlungen. Im Wall Street Club bemerkt der Direktor von Siemens, der ein enger Freund meines Vaters gewesen war, seine Anwesenheit und lässt ihm eine kurze Notiz überbringen. Mein Vater zerreißt den Zettel vor aller Augen, wendet sich seinem Freund auch nicht zu. Er wollte ihn weder hören noch sehen. Doch sein Freund passt ihn in der Toilette ab, fasst ihn an den Schultern und sagt: »Du wirst mir zuhören. Wir schreiben das Jahr 1940; wie ein Messer, das heiße Butter zerteilt, werden wir Frankreich durchqueren. Bring um Himmels willen deine Familie da raus!« Diese Szene spielt sich vor der fatalen Wannseekonferenz ab, aber die großen Bankiers und Firmenchefs wussten von polnischen Zeugen und Wehrmachtsangehörigen in Polen, was sich dort abspielte; sie wussten, dass man alle Juden umbringen würde. Nicht wie, nicht mit welchen Methoden, aber sie wussten, dass man vorhatte, alle Juden niederzumetzeln.
Das war 1940, kurz vor der deutschen Invasion. Glücklicherweise nimmt mein Vater diese Warnung sehr ernst, Gott sei’s gedankt, und bittet Paul Reynaud, den Besuch seiner Familie, meiner Mutter, meiner Schwester und mir, in den Vereinigten Staaten zu erlauben. Reynaud gewährt ihm den Besuch. Doch meine Mutter weigert sich: »Kommt nicht in Frage! Wenn wir Frankreich verlassen, werden die Kinder ihre Abiturprüfungen verpassen. Und mein Sohn wird nicht in die Académie française aufgenommen!« Zum Glück waren wir eine jüdische Familie, in der das Wort des Vaters von entscheidendem Gewicht war. So haben wir im Moment der deutschen Invasion Paris verlassen und konnten mit dem letzten amerikanischen Passagierdampfer nach Genua flüchten. Wäre ich sonst heute am Leben? Man sagt, die Deutschen hätten nichts gewusst, aber sicher ist – das habe ich mir nicht ausgedacht –, dass einige schon seit Ende 1939 auf dem Laufenden waren, seit der Besatzung Polens, wo die großen Massaker bereits begonnen hatten. Natürlich durfte man nicht darüber sprechen. Aber als Direktor von Siemens wusste man Bescheid, weil man im Generalstab der Wehrmacht darüber sprach, sich erzählte, was in Polen geschah. So haben wir unser Leben retten können.
Vielleicht haben Sie deshalb dieses Schuldgefühl, das Sie in mehreren Ihrer Bücher formulieren: dieses Gefühl, überflüssig zu sein?
Ja, dieses Gefühl ist sehr stark. Aus meiner Klasse in Janson-de-Sailly haben zwei Juden überlebt. Dabei war es eine Klasse voller Juden, weil Janson-de-Sailly so etwas wie die jüdische Akademie für die Jüngeren war. Alle anderen sind umgebracht worden. Daran denke ich jeden Tag. Der Zufall, das Monte-Carlo des Überlebens, die unerforschbare Lotterie des Lebens. Warum sind die anderen Kinder und ihre Eltern tot? Ich glaube, niemand hat das Recht, den Versuch zu unternehmen, das zu verstehen. Man kann es nicht verstehen. Letztlich kann man nur sagen: »Es handelt sich um Zufall … um außergewöhnlich mysteriöse Zufälle.« Ist man religiös – ich bin es nicht –, sieht man darin das Schicksal walten. Ansonsten muss man den Mut aufbringen zu sagen: »Es war ein reines Lottospiel, und ich habe einen Treffer gezogen.«
Jetzt befinden Sie sich also in den Vereinigten Staaten, sind im Lycée eingeschrieben – und es beginnen nicht sehr glückliche Jahre für Sie.
Noch gibt es das Buch nicht, welches das New York jener Jahre beschriebe. Es wäre aber ein fesselndes Sujet. Das Lycée war natürlich fest in der Hand Vichys. In meine Klasse gingen die beiden – übrigens sehr liebenswürdigen – Söhne des Admirals, der im Auftrag Pétains die Flotte in Martinique befehligte. Offiziell stand das Lycée auf Seiten Pétains, andererseits nahm es Flüchtlinge und Widerstandskämpfer aller Art auf. In der Klasse über mir gab es zwei junge, gerade erst siebzehnjährige Freunde, die ihr Alter verschwiegen, um in Frankreich kämpfen zu dürfen, und beide verloren im Vercors ihr Leben. Sie waren nur zwei Jahre älter als ich. Im Lycée schlug man sich in den Pausen, da gab es echten Hass. Das Vichy-Regime jener Jahre war sehr selbstbewusst, nicht nur Juden waren ihm verhasst, sondern auch die Linke und all jene, welche Anwandlungen von Widerstand zeigten. Doch als sich der Wind drehte, trugen der Leiter des Lycées, die Lehrer, das Aufsichtspersonal plötzlich das Lothringer Kreuz, Symbol des Freien Frankreichs. Dies war für mich ein einschneidendes Erlebnis: von einem Tag zum andern! Der General de Gaulle besucht das Lycée, und jene Halunken werfen sich ihm natürlich zu Füßen, heucheln Begeisterung für die Libération. Das war mir eine eindringliche Lehre.
Davon abgesehen habe ich eine vorzügliche Bildung genossen. Warum? Weil bedeutende Intellektuelle, die in New York im Exil lebten, Gören wie uns unterrichteten, um etwas Geld zu verdienen. So waren etwa Étienne Gilson und Jacques Maritain meine Philosophielehrer, bevor sie ihre Stellen in Princeton und Harvard antraten. Ich hatte Unterricht bei Lévy-Strauss oder Gurewitsch. Diese Geistesriesen verschwendeten ihre Zeit mit Jugendlichen wie uns, die sie auf Examen und Reifeprüfung vorbereiteten. Das war eine phantastische Zeit. Mein bester Freund war der junge Perrin – dessen Vater zusammen mit Joliot-Curie den Nobelpreis für die Entdeckung der Radioaktivität erhalten hatte und der seine Hoffnungen in den Kommunismus setzte. Joliot-Curie, Perrin, Hadamard: Diese gesamte Gruppe hoffte, dass die Libération ein marxistisches Frankreich möglich machen würde. Diese Jahre im Lycée waren sehr wichtig und haben mich, trotz allem, geformt; mir ist heute bewusst, dass sie entscheidend waren, ich habe ihnen viel zu verdanken.
Dass Sie dieser Zeit sehr viel verdanken, hat Sie aber nicht daran gehindert, die Vereinigten Staaten Richtung Großbritannien zu verlassen.
Da war zuerst Paris, wo ich 1945 eintraf. Sie können sich nicht vorstellen, wie das war, Paris im Jahr 1945. Ich wollte mich am Louis-le Grand oder Henri-IV in der Khâgne oder Hypokhâgne1 einschreiben (ich war eingebildet genug, um zu glauben, dass ich die Aufnahmeprüfung zur École normale supérieure bestehen würde), aber mein Vater sagte: »Das kommt nicht in Frage! Die Zukunft gehört der angloamerikanischen Sprache. Sollte es dir eines Tages gelingen, ein Buch auf Englisch zu schreiben, das etwas taugt, wird man es ins Französische übersetzen.« Ich erinnere mich noch sehr gut an diese außergewöhnliche Prophezeiung. Ich habe mich meinem Vater gefügt und die ersten Studienjahre in den Vereinigten Staaten verbracht, an zwei bedeutenden Universitäten: Chicago und Harvard. Ich denke noch über das Schicksal der französischen Sprache in meinem Leben nach; in vielerlei Hinsicht war das eine Schlüsselfrage. Welchen Verlauf hätte mein Leben genommen, wenn ich die Aufnahmeprüfung zur École normale angegangen hätte? Ich bedaure noch jetzt, es nicht versucht zu haben.
Sie haben sich im Anschluss für ein Leben in London entschieden und, paradoxerweise, für eine Tätigkeit bei einer Zeitschrift, dem Economist. Man kennt Sie als Philosophen, Schriftsteller, Semiotiker, Intellektuellen – aber nur wenige wissen, dass Sie Ihr Leben als Wirtschaftsexperte begonnen haben – als Berichterstatter, Journalist und Wirtschaftsexperte.
Der Economist war die meistbeachtete Wochenzeitschrift der Welt. Das Wichtigste dabei: Man arbeitete anonym, die Artikel wurden nicht signiert. Die Aufnahme kam durch eine Art Prüfung zustande. Ich hatte keine Ahnung von politischer Ökonomie, interessierte mich aber leidenschaftlich für gute Prosa und internationale Beziehungen. Man bat mich – ich war jung, lächerlich jung –, Leitartikel über die europäisch-amerikanischen Beziehungen zu verfassen. So verbrachte ich vier wundervolle Jahre, doch dann spielte das Schicksal mir übel mit, eine Wendung, die sich letztlich als äußerst interessant herausstellte. Der Economist schickt mich als Korrespondent über den Atlantik, um über die Debatte zur amerikanischen Atomstreitmacht zu berichten: Würden die Vereinigten Staaten ihre nuklearen Kenntnisse mit Europa teilen? Unter Eisenhower entschieden sie sich dagegen. Dieser Ausgang lag nicht auf der Hand; noch erhoffte man sich eine echte Zusammenarbeit. In diesem Kontext mache ich Station in Princeton, einem wunderbaren, unwirklichen Städtchen, um Robert Oppenheimer zu interviewen, den Vater der Atombombe. Er verabscheute (auf fast pathologische Weise) Journalisten, aber zu mir sagte er: »Ich gebe Ihnen zehn Minuten.« Er war ein Mann, vor dem man fast körperlich Angst verspürte; das lässt sich nur schwer beschreiben. Eines Tages hörte ich, wie er vor meinem Büro zu einem jungen Physiker sagte: »Sie sind noch so jung und haben schon so wenig erreicht!« Nach solch einem Satz kann man nur noch zum Strick greifen! Oppenheimer hatte unser Treffen auf die Mittagsstunde gelegt. Er kam nicht. Also ging ich essen, zusammen mit George Kennan, dem diplomatischsten aller Diplomaten, Erwin Panofsky, dem bedeutendsten Kunsthistoriker jener Zeit, und Harold Cherniss, dem großen Hellenisten und Platonspezialisten. Während wir auf das Taxi warteten, das mich eine halbe Stunde später abholen sollte, bat Cherniss mich in sein Büro; im Verlauf unserer Diskussion betrat Oppenheimer den Raum und nahm hinter uns Platz. Das ist die Falle par excellence: Wenn Ihre Zuhörer Sie nicht sehen können, paralysiert sie das und macht Sie selbst zum Gebieter vor Ort. Oppenheimer war spezialisiert auf diese Art theatralischer Inszenierung. Cherniss zeigte mir eine Passage bei Platon, die er als Herausgeber betreute und die eine Leerstelle enthielt; er mühte sich, sie zu füllen. Als Oppenheimer mich fragte, wie ich mit dieser Passage verfahren würde, suchte ich stotternd nach einer Antwort. Und er fügte hinzu: »Ein bedeutender Text sollte Leerstellen haben.« Da sagte ich mir: »Junge, du hast nichts zu verlieren, dein Taxi kommt in fünfzehn Minuten.« Und ich widersprach ihm: »Das ist ein schwülstiges Klischee. Zuerst einmal ist es ein Zitat Mallarmés. Zudem gehört es zu der Art von Paradox, mit dem man unbegrenzt spielen kann. Aber wenn man Sie bittet, eine Platonausgabe für den Normalsterblichen herauszugeben, sollten die Leerstellen besser gefüllt sein.« Oppenheimers Erwiderung war vortrefflich: »Nein, in der Philosophie ist es gerade das Implizite, das zur Beweisführung anregt.« All das amüsierte ihn, dem nie jemand zu widersprechen wagte, königlich, und es entspann sich eine echte Diskussion über das Thema. Mitten in unserem Gespräch kam Oppenheimers Sekretärin herein und verkündete: »Das Taxi von Herrn Steiner fährt gleich wieder ab.« Ich wollte für meine Reportage weiter nach Washington. An der Tür des Instituts fragte mich dieser unglaubliche Mensch, in einem Ton, als spräche er zu einem Hund: »Sind Sie verheiratet?«
»Ja.«
»Haben Sie Kinder?«
»Nein.«
»Umso besser. Das erleichtert die Unterbringung.«
Auf diese Art hat er mir, als erstem jungen Altsprachler, zum Eintritt ins Institute for Advanced Studies in Princeton verholfen. Unsere Begegnung hatte ihn ungemein amüsiert … Ich schickte dem Economist ein Telegramm, und sie antworteten: »Machen Sie keine Dummheit. Sie fühlen sich wohl bei uns, und wir geben Ihnen einen Tag pro Woche für Ihre Recherchen. Schreiben Sie Ihre Bücher über Tolstoi, Dostojewski, die Tragödie. Aber bleiben Sie bei uns.« Und wieder frage ich mich, wie schon bei der École normale, ob ich nicht hätte weitermachen sollen … Ich hätte gewiss die Nummer 2 dort werden können … Das hatten sie beim