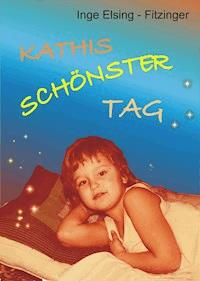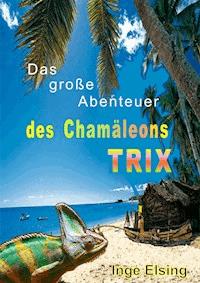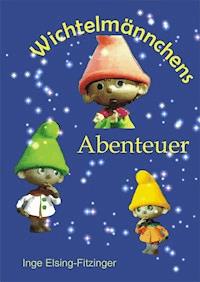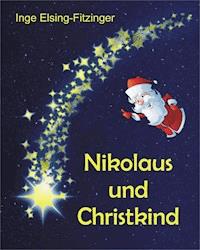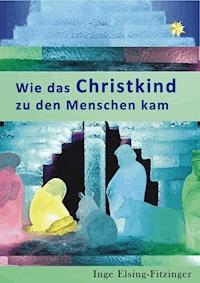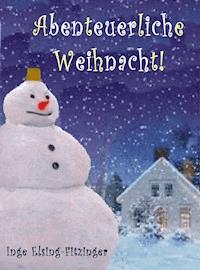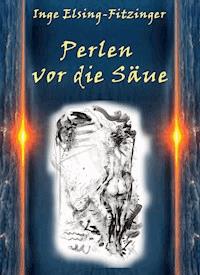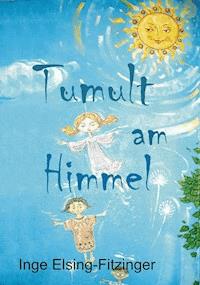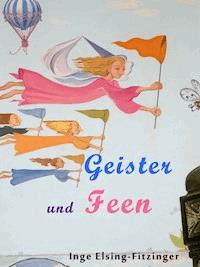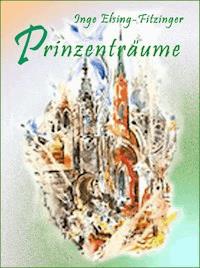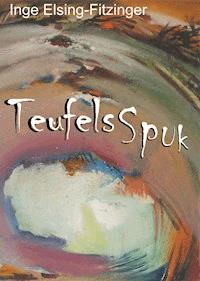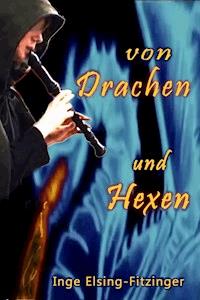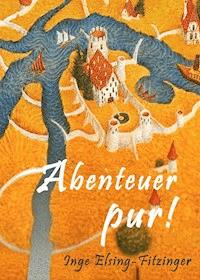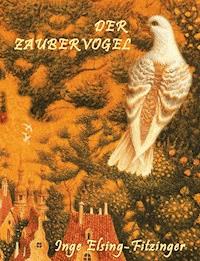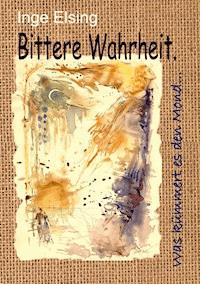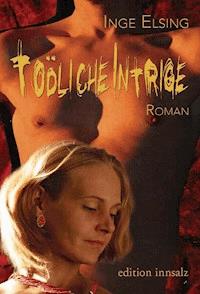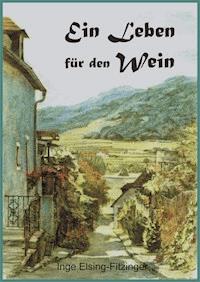
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Ein interessanter Streifzug durch die Entwicklungsgeschichte einer der schönsten Regionen Österreichs, die Wachau im Donautal, zwischen Krems und Melk. In heiterer, lehrreicher, besinnlicher und interessanter Weise führt dieses Buch über Tausende Jahre Geschichte schließlich zu Josef Jamek aus Joching. Dieser Mann zählt zu den hervorragendsten Persönlichkeiten der Region Wachau. Mit unermüdlichem Einsatz, mit Herz, Kraft und Verstand erkämpfte er zahlreiche Neuerungen, wie den Ausbau der Wachaustrasse, die Danauuferbahn, Bewässerungsanlagen und Vieles mehr. Doch vor allem war er der Erste Weinbauer, der sortenreine, köstliche Weine auf den Markt brachte. Anfangs von allen belächelt, setzte er unter schwersten Bedingungen diesen Traum in die Tat um. In zahlreich persönlichen Zitaten wird sein erfülltes Leben beschrieben. Sie erfahren auch Vieles über hervorragende Winzer der Region, über Maler und Dichter des wohl schönsten Flecken Österreichs, das Donautal. Mit vielen authentischen Zitaten gewürzt, ist es ein Vergnügen in diesem Roman zu schmökern. Für das Cover und die Illustrationen zeichnet Olga Karlowa, akademische Malerin und Architektin.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 177
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inge Elsing-Fitzinger
Ein Leben für den Wein
WACHAU, Josef, Jamek aus Joiching - JJJ
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
WACHAU, Josef, Jamek aus Joching – JJJ
Erinnerungen: Eis laufen, Eis hacken! Die Jochinger Lacke
Unwetter und Missernten
Die Wachau und der Wein
Kriegsbeginn 1939.
Die Landschaftsmalerei
Der Visionär Josef Jamek
Die erste Bouteille
Die neue Wachaustraße 1958
Die Donau
„Jameks Kampf“ 1971
Alte Rebsorten
Das große Erbe
Impressum neobooks
WACHAU, Josef, Jamek aus Joching – JJJ
Ökonomierat Josef Jamek, der Doyen der Wachau und brillanter Repräsentant der Wachauer Weinkultur und Gastlichkeit, sitzt versunken in einem Korbstuhl auf der Terrasse seines gediegenen Anwesens in Joching, einem früheren Lesehof des Stiftes Michelbäuern, im Salzburgischen. In seinen Augen spiegelt sich die Melancholie einer oft sehr harten doch erfüllten Vergangenheit. Ein stattlicher Mann, trotz des hohen Alters. Viel hat sich ereignet in seinem arbeitsreichen Leben. Schönes und weniger Schönes. Dennoch leuchtet Zufriedenheit auf, wenn er versonnen die Hand seiner geliebten Frau Edeltraut streichelt. Unendliche Zuneigung liegt in dieser schlichten Geste.
Die Züge des alten Mannes reflektieren ein ausgefülltes Leben. Heute weiß er, daß er sich richtig entschieden hatte. Das Schicksal wollte ihm oft einen Strich durch die Rechnung machen, doch er hat sich nie unterkriegen lassen.
„Das Einzige, was wir zu fürchten haben, ist die Furcht selbst. Ich habe für meinen großen Traum tapfer gekämpft und mein Ziel erreicht. Träume dürfen nicht nur geträumt werden, Träume müssen gelebt werden. Die Welt ist voll davon.“
Josef Jamek war ein Visionär mit unerschütterlichem Glauben an sich selbst.
„Wer Perfektion zu erlangen sucht, verfolgt den Weg der Eitelkeit. Unsere kleinen Mängel helfen uns demütiger, menschlicher und duldsamer gegenüber den Mängeln anderer zu sein.“
Der unbeugsame Mann hatte teil an entscheidenden Augenblicken in der Geschichte der Wachau, da er stets den weisen Worten des Jesuitenpaters Anthony Mello folgte: „Charakter erkennt man daran, wie jemand mit Tiefschlägen umzugehen vermag. Wer die Welt zu ändern versucht, muss zunächst einmal sich selbst ändern.“
Sein, durch Fleiß und Ausdauer, sowie charismatische Pionierarbeit vorangetrieben, hart erarbeiteter Besitz, liegt in guten Händen. Die jüngste Tochter Jutta und Schwiegersohn Hans Altmann haben das Weingut 1996 übernommen.
„Die neue Generation hat ein gemeinsames Dogma“,meint er ruhig und zufrieden. „Das Alte bürgt für Qualität. Revolutionäres wollen sie tunlichst meiden. Die Kinder wissen, sie sind Botschafter für eine der wichtigsten Regionen Österreichs.Ein schmales Tal, in dem auf kleinstem Raum eine Fülle von köstlichen Weinen und lukullischen Verheißungen, Labsal für Leib und Seele garantieren.“
Es ist ein besinnlicher Nachmittag. Die milde Luft streift durch die alten Bäume und Sträucher. Ich bin fasziniert von der kraftvollen Aura dieses weisen Mannes, der mir einen unvergesslichen Tag bereitet.
„Ein wunderschönes, sagenumwobenes Tal ist es, indem wir leben und arbeiten dürfen. Im Frühling, wenn die Birken wie Erstkommunikantinnen mit wallendem Haar von den Abhängen grüßen, wenn sich die purpurne Pracht der Pfirsichblüten mit dem Blütenschnee der Marillenbäume vermischt.“Der alte Mann lächelt, bläht die Nasenflügel, saugt die würzige Luft der Landschaft ein.
„Im Juni, zur Weinblüte. Haben sie diesen aromatischen Duft schon einmal genossen?“Fragt er, und bedauert mich sichtlich, als ich verneine. „Ein Erlebnis, das die Sinne verwirrt. Ein Geruch der süchtig macht, den man nie wieder missen möchte. Wenn die steil abfallenden Bergflanken im Feuer der Herbstsonne brennen! Was für ein zauberhafter Anblick.“
Unvermittelt erhebt sich Josef Jamek und breitet die Arme aus, als wolle er das ganze Donautal an seine Brust drücken.„Ich liebe meine Heimat, meine Frau, meine Familie. Ich danke Gott für jede Stunde meines erfüllten Lebens.“
Etwas später, bei einem gepflegten Glas Wein lächelt der sechsundachtzigjährige Mann verschmitz und prostete mir schalkhaft zu.
„Das Lustigste in unserer Familiengeschichte ist die Tatsache, dass der Name Jamek nur aus einer Unachtsamkeit heraus weiterleben durfte. Eigentlich sollten wir Prager heißen.“
Stunden später wusste ich warum.
Viele Bücher über die Region Wachau geben authentisches Zeugnis über die geschichtliche und kulturelle Entwicklung dieses berauschenden Fleckens Erde.
Lassen Sie mich diese Fakten nur flüchtig streifen, um einen Übergang zu schaffen, zu den eigentlichen Geschehnissen, die dieses Buch beinhalten soll:
Die Entstehungsgeschichte und das Wirken einer der bekanntesten Familien dieser Region, der FamilieJOSEF JAMEKausJOCHING
Geschichtlicher Streifzug
Vor etwa 30 Millionen Jahren rauschte über den heutigen Gipfeln der Donauberge das Tertiärmeer. Die Bergspitzen flachten ab. Als das Meer zurückwich, grub sich die Urdonau kraftvoll in das harte Gestein des Urgebirgsmassives der böhmischen Masse ein bis hin zum Dunkelsteinerwald.
Jahrtausende schon verbindet der Donaulauf Länder und Völker. Altsteinzeitliche Menschen durchstreiften die Auen, jagten Mammute, fischten in der Donau und sammelten Wildfrüchte auf den sonnigen Terrassen. Später war der Fluss Handels- und Heerstraße für Einwanderer und Krieger.
Die Kelten bevölkerten das Land und die Römer, die regen Handel miteinander betrieben. Der römische Kaiser Prubus soll bereits im dritten Jahrhundert Reben aus seiner italienischen Heimat importiert, und den Weinanbau maßgeblich gefördert haben. Mit dem köstlichen Traubensaft vermochte er wohl seine Legionen bei Laune zu halten. Weinbaukundige Veteranen wurden entlang der Donau angesiedelt.
Der Donaustrom wurde sowohl strategisch als auch kommerziell genutzt. Auf Treppelwegen zogen Pferde die Schiffe mit römischen Soldaten und Kriegsgütern donauaufwärts. Man baute das Lager Favianis (Mautern) auf einer leicht erhöhten Flussterrasse, um vor plötzlichen einbrechenden Wassermassen geschützt zu sein. Reste alter Wachtürme in Rossatzbach und Arnsdorf geben Zeugnis davon.
Die Marille, ein Markenzeichen der Wachau, soll schon vor dieser Zeit auf dem Donauweg in die Wachau gekommen sein.
Um 430 n. Chr. zogen die Hunnen durchs Donautal. Viel Elend blieb in der Wachau zurück. Ein frommer Mönch, der heilige Severin, kam im Jahr 455 in diese Gegend und linderte die große Not. Er gründete ein Kloster und übernahm in diplomatischer Mission die Vorbereitungen für den geordneten Abzug der Römer. Bis zu seinem Tod 482 lebte er in Favianis, dem heutigen Mautern. Die „Vita Severini“ von Eugippius legt ein schriftliches Zeugnis vom Wein- und Obstbau in der Wachau dar.
Nach dem Zusammenbruch der römischen Herrschaft zogen die Avaren raubend und plündernd durch die Lande. Auch Slawen bevölkerten diesen Landstrich. Viele Ortsnamen erinnern heute noch daran: Jauerling, Kollmütz, Seiberer usw.
Die Bedeutung der Schifffahrt in der Karolingerzeit lässt sich daran ermessen, dass Karl der Große (er drängte 791 die Avaren bis zum Wienerwald zurück) plante, im Jahr 793 einen Rhein- Main- Donau- Kanal zu bauen. Seine Ingenieure waren dieser Aufgabe jedoch noch nicht gewachsen.
Im 11. und 12. Jh. nahmen adelige Herren aus den Bajuwarischen Regionen und zahlreiche Klöster die Donauregion unter ihren „Schutz“. In Pöchlarn hielt Markgraf Rüdiger von Bechelaren Hof. Der Rugenkönig Feva residierte inChremisa,unserem heutigen Krems und dehnte seinen Einfluss bis nach Favianis (Mautern) aus. Mit großem Fleiß und Wissen förderten diese Herren den Weinbau und legten letztendlich den Grundstein für das kostbare Erbe, den Haupterwerbszweig der hiesigen Bevölkerung.
Noch heute bezeugen dies zahlreiche Lese- und Zehenthöfe aus gotischer Zeit, jedoch großteils aus Renaissance und Barock, umgebaut oder neu errichtet. Jeder dieser Höfe, ein architekturgeschichtliches Charakteristikum der Wachau, ist ganz individuell gestaltet: Ein einfaches Gebäude inmitten der Ortschaft (der Melkerhof in Wösendorf), oder er beherrschte die Orte (der Florianihof in Wösendorf, der Prandtauerhof in Joching), oder aber schlossgleich, wie der Erlahof in Spitz.
Generationen von Winzern modelten in der Fron der Klöster ganze Berge um. Anonyme Schöpfer der trocken geschichteten Bruchsteinmauern hinterließen ein Tal voller Stufen und Hügeln. Eine Notwendigkeit. Der Boden wäre ohne diese Terrassen ins Tal gerutscht.
Viele Prüfungen hatte das Land zu bestehen. Die Wirren der Völkerwanderung, den Dreißigjährigen Krieg, die Klimaverschlechterung im 17. und 18. Jahrhundert.
Der Westfälische Frieden am 24. Oktober 1648, beendete die Schreckensperiode und brachte den protestantischen Mächten bedeutende Gewinne.
Die Habsburger blieben im Besitz der Kaiserwürde. Die österreich- habsburgischen Länder wurden wieder zur „Casa Austria“, dem Haus Österreich.
Mit dem Niedergang des Lehnswesens begann der Aufstieg der Söldnertruppen. Soldaten, die für Löhnung Kriegsdienst leisteten. Sie kämpften nicht aus Überzeugung, nur für guten Sold. Die Besoldung erfolgte in Form von Geld oder Beute. Plünderungen waren an der Tagesordnung.
Familiengeschichte
Im Allgäu lebte die rechtschaffene Familie Notz, die mit ihrer Hände Arbeit Haus und Hof bestellte. Sie hatten vier Töchter und zwei stattliche Söhne. Jonathan der Erstgeborene, ein leidenschaftlicher Bauer, ging den Eltern sehr zur Hand. Martin hingegen, war ein wissenshungriger Bursche, ein Phantast. Schon in jüngsten Jahren zog es ihn hin zum Pfarrhaus und zu den wunderschönen Büchern, die er mit Hilfe der geistlichen Herren binnen kurzer Zeit zu lesen vermochte. Bald war er auch des Schreibens mächtig.
Während die übrige Familie tagaus, tagein ums Überleben kämpfte, Wälder rodete, Äcker bebaute, sich um das Vieh kümmerte, schmökerte der Jüngling in dicken Wälzern, die ihm Hochwürden willig borgte. Er träumte von der großen weiten Welt.
Als die Schweden durch die Lande tobten, verließ Martin Notz den elterlichen Hof und kämpfte für die Gerechtigkeit. Immer weiter trieb es den Burschen Richtung Osten. Über Ulm bis nach Passau. Um den feindlichen Truppen zu entkommen, flüchtete er sich nachts in Klöster. Die frommen Mönche rieten ihm weiter zu ziehen nach Österreich, wohin er sich frierend und bettelnd durchschlug. Die Hoffnungslosigkeit des Kriegführens entmutigte ihn bisweilen, auch die kämpfenden Truppen holten ihn ein.
Söldnerscharen überrollten das Waldviertel bis hinunter zur Stadt Krems. Mittendrin Martin, der als Taglöhner, Spitzel und Kundschafter sein Bestes gab, den Überlebenskampf zu gewinnen. So gelangte er in die Donauregion.
Martin Notz, 1640 (Urkundlich nachgewiesen in einem Pfarrbrief aus Rossatz)
Es war eine sternenklare Vollmondnacht. Das Grölen der Soldaten, die beängstigende Orgie, die Vergewaltigungen unschuldiger Mädchen waren vorüber. Nun lagen die Landser trunken und erschöpft auf verdreckten Kotzen. Die hässlichen Sprüche der sinnlos besoffenen Meute hallten noch in Martins Ohren, als er sich zum Donauufer schlich. Ein Wachposten lehnte völlig trunken an dem schmalen Wall der zur Brücke führte.
Trotz klirrender Kälte zog er die schweren Stiefel aus, band alte Lumpen um die Füße und steuerte den schweren Holzschwielen zu, die ihn, so hoffte er inständig, ans andere Ufer bringen mögen. Tagsüber rollten Rossfuhrwerke über diese Brücke aus massivem Holz.
Zwei Stunden später stand er leichten Herzens auf der anderen Seite des gewaltigen Stroms und suchte Unterschlupf in einer Scheune. Am nächsten Morgen schulterte Martin seine kargen Habseligkeiten und marschierte stromaufwärts, bis er eine kleine Ansiedlung erreichte. Ein bescheidenes Kirchlein, ein paar verstreute Bauernhäuser mit wohl bestellten Wein- und Obstgärten. Und wieder war es der Pfarrer, dem er als Ersten gegenüberstand. Etwas unbeholfen stellte er sich vor, schilderte in abgehackten Worten seine Lebensgeschichte und die grauenvollen Erlebnisse seiner Flucht, inständig hoffend auf Verständnis und Hilfe. Kurz entschlossen reichte ihm der fromme Mann freundschaftlich die Hand.
Auf dieser Seite der Donau schien die Welt noch einigermaßen in Ordnung. Der Gemeindevorsteher hatte ein wohl bestelltes Bauernhaus, einige Kühe und Schweine. Hühner und Gänse gaggerten am Hof, als er am nächsten Tag in Begleitung seines neuen Schutzherrn das Anwesen betrat. Ein prächtiger, viereckiger Misthaufen zierte den Bauernhof, auf dem ein stolzer Hahn zum Morgenappell krähte. Schwalben nisteten im Gebälk der Ställe, flitzten den Kühen um die Ohren. Vor dem großen Eingangstor stand eine stattliche Linde, die den müden, vom Weingarten kommenden Arbeitern wohligen Schatten spendete. Es waren Menschen, die hart zu arbeiten wussten, die sich nicht leicht irgendwelchen Zwängen unterordneten, die sich mit den Unbilden der Natur und der Obrigkeit auseinandersetzten und ihre besondere Würde hatten.
Die Großmutter hieß die Neuankömmlinge eintreten, stellte einen Krug Milch auf den Tisch und legte einen großen Leib Brot dazu. Sogar ein Stück Speck zauberte sie hervor. Kurz darauf betrat der Hausherr die freundliche Stube. Der Pfarrer schilderte in wenigen Worten die Situation. Eine kleine Notlüge würde ihm der Herrgott sicher verzeihen, betete er innständig. Martin wurde als Gast willkommen geheißen. Wenig später teilte ihm der Hausherr bereits jede Menge Arbeit zu, die er mit Freuden bewerkstelligte.
Die Tochter des Hauses, ein bezauberndes Geschöpf, ermutigte den hübschen Burschen anfangs zwar eher schüchtern, später wesentlich offenherziger, sich ihr nicht nur kameradschaftlich zu nähern. Es dauerte kaum ein Jahr, bis Martin die holde Maid zum Altar führen durfte.
Da im Pfarrhaus zu wenig Platz war, wurde im Haus des Vorstehers ein Klassenzimmer eingerichtet, in dem Martin die Dorfjugend anfänglich zweimal pro Woche lesen und schreiben lehrte. Die erste Schule war gegründet.
Bald zählte Martin zu den angesehenen Leuten im Dorf, neben dem Schmied und dem Bader, der ein Bruder des Vorstehers war. Dieser wusch und knetete seine Kunden, schor ihnen die Haare oder ließ sie zur Ader. Ihm oblag die Pflege und Heilung der Kranken. Oft half Martin mit seinem, aus Büchern erlerntem Wissen aus.
Immer wieder drangen Soldaten in die Donauregion ein, plünderten und brandschatzten verheerend. Regimenter wurden einquartiert.
Zahlreiche Klöster hatten in der Wachau ihre Weingärten und Lesehöfe. Der köstliche Traubensaft erfreute nicht nur den Gaumen der geistlichen Obrigkeit. Auch weltliche Herrscher genossen diese Köstlichkeit und übten ihre Macht aus. Schwer trafen die Bevölkerung die horrenden Abgaben und Robotleistungen. Den Weinbauern und Bauern wurde befohlen, je nach Größe ihres Besitzes, Taglöhnerarbeit oder Fuhrwerksdienste zu leisten. Ein Zehent, der zehnte Teil einer Nutzung musste abgeliefert werden. Der Hühnerdienst zur Faschingszeit, Eier- und Käsedienst zu Ostern, der Traidingpfennig und der Weidpfennig brachten die fleißigen Menschen oft in harte Bedrängnis. Viele hungerten und darbten dahin.
Martin erhielt eine Besoldung als Schulmeister von der Pfarre. Für den Taglohn von fünfeinhalb Pfennig konnte er sich fünf Semmeln kaufen, oder einen halben Laib Brot, oder ein Pfund Rindfleisch. Da er auch noch den Kirchendienst versah, erhielt er zusätzlich eine geringe Entschädigung. Es war eine abenteuerliche Zeit. Martin half ausgebrochene Tiere wieder einzufangen, Brände zu löschen, Sandsäcke aufzutürmen gegen die bisweilen tobenden Wassermassen des Stroms.
1682 war eine Überschwemmungskatastrophe schrecklichen Ausmaßes. Alle Keller standen unter Wasser, alle Ställe. Das Vieh musste eiligst in die höher gelegenen Weingärten getrieben werden. Viele Tiere und Menschen verloren ihr Leben. Die Uferregion, die Häuser waren völlig vermurt. Wochen und Monate schufteten die braven Leute, um wieder ein würdiges Dasein führen zu können.
Die feindlichen Truppen zogen weiter Richtung Wien. Martin wagte sich bisweilen auch über die Holzbrücke ans andere Ufer. Nach Abzug der Schweden im Jahr 1650 standen viele Häuser in der Wachau leer und zahlreiche Wein- und Obstgärten waren vernichtet.
Durch Zufall traf Martin Botschafter, die Kunde aus der Heimat brachten. Bald fand er auch Mittel und Wege, Botschaften in die Heimat zu schicken. Die Sehnsucht nach seinen Lieben war allemal zu groß.
Solcherart gelang es ihm, seine Schwestern nach und nach zu sich in die Wachau zu holen, wo er sie mit bestmöglichen heiratsfähigen Männern verehelichte. Eine seiner Schwestern nahm den Bader von Weißenkirchen zum Mann. Dieser genoss neben den üblichen Dienstleistungen auch als Zahnzieher den besten Ruf.
Im Laufe der Jahre war Martin Notz ein echter Wachauer geworden, der versuchte sein Leben hier nach besten Kräften zu bewerkstelligen. Seine Frau gebar ihm einige Söhne und ein niedliches Töchterchen. Das Familienglück schien vollkommen. Martin war ein angesehener Mann geworden, von jedermann geachtet und geschätzt.
1683 belagerten die Türken von Juli bis September zum zweiten Mal die Stadt Wien. Osmanische Krieger plünderten die Gegenden. Im Kupfertal, gegenüber von St. Michael errichtete Martin mit anderen Bürgern der Wachau eine Sperrmauer. Glücklicher Weise kam kein Türke bis zu dieser Sperre. Die Bewohner nördlich der Donau, wo Martins Schwestern ihre neue Heimat gefunden hatten, mussten kaiserliche Truppen einquartieren und Proviant liefern. Abermals wurden zahlreiche Felder und Weingärten verwüstet. Der Schaden war immens, Hunger und Not an der Tagesordnung.
Nach dem Tod Martins setzte einer seiner Söhne den Unterricht fort. Viele Bewohner dieser Region konnten bereits lesen und schreiben.
Not gebiert Großes. Meister Martin Johann Schmidt, der „Kremser Schmidt“, und bedeutendster einheimische Maler, wurde 1718 in Grafenwörth geboren. Er schuf mit seinen Schülern herrliche Werke, die weit über die Grenzen des Landes hinaus Anerkennung fanden. Seine prächtigen Werke begegnen uns allerorts in den Kirchen des Donautals.
Baumeister Jakob Prandtauer erbaute in dieser Zeit den St. Pöltnerhof in Joching, die Straße am rechten Donauufer wurde verbreitert.
Doch auch Kriegwirren blieben der neuen Generation nicht erspart. 1704, während der Bayrischen Kriege, gab es wiederum viele Einquartierungen und Plünderungen.
Die Familien waren teils Schiffer, teils fleißige Winzer, die ihre Weingärten mit Sorgfalt und Liebe betreuten.1728 schmeckte der Most wie Zucker und wegen der großen Weinernte gab es in den folgenden Jahren einen Weinüberschuss, der die Preise gewaltig drückte.
Die schon im 1349 von Schiffsleuten aus dem Orient eingeschleppte Pest, breitete sich im Laufe der Jahrhunderte immer wieder aus. Im Jahr 1730 forderte die Seuche viele Opfer. Familie Notz hatte ebenfalls einige Todesopfer zu beklagen.
1741 mussten die Wauchaubewohner während des Österreichischen Erbfolgekrieges hohe Kriegstribute nach Dürnstein leisten. Bergleute schürften auf dem Arzberg Zink und Eisenerz, Blei und Kupfer. Die Menschen lernten das in den Kupfersiederein gewonnene Kupfervitriol zur Schädlingsbekämpfung zu verwenden. Mit dem „grünen Süppchen“ besprengten sie die kränkelnden Weinstöcke. Viel Schaden wurde in der Region durch diese glorreiche Entdeckung verhindert.
1770 wurden die ersten Volkszählungen durchgeführt. Jedes Haus bekam eine Nummer.
1805 hatte Kaiser Franz, gemeinsam mit den Russen den Kampf gegen Napoleon I. aufgenommen. Dieser rückte in Eilmärschen gegen Wien. Französische Truppen zogen durch Weißenkirchen, Joching, Wösendorf und St. Michael. Das Österreichische Heer wurde bei Ulm geschlagen. Die russischen Truppen unter General Kutusow hatten die Steinerbrücke passiert und sie vor nachrückenden Franzosen in Brand gesetzt. Sie wollten sich so rasch wie möglich mit Russischen und Österreichischen Einheiten in Znaim vereinen. Dass die Franzosen zum Flankenschutz ihrer Truppen drei Divisionen unter Marchall Mortier am linken Donauufer marschieren ließen, war eine absolut unerwartete Überraschung für ihre Gegner. Militärische Verbände trafen bei Dürnstein und Loiben aufeinander. Loiben wurde dreimal erobert und dreimal zurückerobert. Divisionen rückten gegen Dürnstein und Weißenkirchen vor.
Wiederum litten die Bewohner massiv unter der Besatzungsmacht. Soldaten drangen in Keller ein, berauschten sich und zertrümmerten die Fässer. Den Gemeinden wurde auferlegt, hunderte Eimer Wein in die Lager zu liefern. Die Menschen waren hoffnungslos verschuldet und mussten ein Darlehen aufnehmen.
Russen und Österreicher, geführt von Feldmarschallleutnant von Schmitt beschlossen, die Franzosen von den Bergen aus anzugreifen. Der ortskundige Jäger von Dürnstein Andreas Bayer führte die kaiserlichen Truppen über unzugängliche, vereiste Wege. Den Pferden wurden Lappen um die Hufe gewickelt, um geräuschlos vorzudringen. Durch diesen schlauen Schachzug gelang es tatsächlich die Franzosen zu besiegen. Loiben blieb als Trümmerfeld zurück. Unterloiben wurde angezündet, die Keller geplündert, das Vieh geschlachtet, die Weinstöcke verbrannt.
Zum 100. Jahrestag des Gefechtes von Loiben wurde 1905 in den Weingärten zwischen Dürnstein und Loiben das Franzosendenkmal errichtet.
Jamek – Notz: Eine gelungene Fusion
Im 18. Jh. war die Familie NOTZ eine angesehene Schifffahrtsfamilie in St. Lorenzi, und betrieb die Rollfähre nach Weißenkirchen. An den Markttagen ließen sich die Bäuerinnen vom rechten zum linken Donauufer bringen. Ausgerüstet mit selbst geflochtenen Strohkörben, begierig nach neuesten Tratschgeschichten, trieben die Menschen regen Handel. Sie tauschten Mitgebrachtes gegen dringend Nötiges, und kehrten nach vielen Stunden wieder wohl gerüstet und um einiges an „Wissenswertem“ reicher zurück auf ihre Höfe. Eine willkommene Abwechslung, die man sich nur in dringlichsten Fällen entgehen ließ.
Im November 1787 brach dann eine 6 Meter hohe Wasserflut über die Ortschaften herein. Großer Schaden wurde angerichtet. Schiffe aus den Verankerungen gerissen, abgetrieben oder zerstört.
Anton Notz, 1804-1853, Hausbesitzer –Schiffseigner
Dieser Mann war ein angesehener Schiffmeister. Er hatte an die zwanzig Schiffleute, die teils mit Flößen und Plätten, aber auch mit einerSiebnerinund mehrerenViererinnen(große Zillen) Güter transportierten. Nach den verheerenden Kriegswirren florierte der Handel bestens. Die Bauern konnten solcherart ihre Waren auf umliegenden Märkten anbieten und tauschten dafür Gerätschaften aller Art ein.
Ein unbekannter Reporter:
„Die Schifffahrt der Neuzeit war von den großen Schiffszügen und ihren Schiffsreitern geprägt. Ein Schiffszug bestand aus drei Haupt- und sechs Nebenschiffen, dazu 33 Schiffsreiter, die die schwere Last gegen die Stromrichtung auf Treppelwegen beförderten. Zuweilen wurden großen Schiffen sogar bis zu 60 Reiter vorgespannt. (In früherer Zeit waren es Menschen, die die Schiffe einzeln stromaufwärts zogen.) Im Verlauf solcher Fahrten, mussten die Pferde öfters das Ufer wechseln. Dann wurden die Rösser auf Nebenschiffe verladen und ans andere Ufer gefahren“.
Die Flößer überdauerten diese Zeit bis zum Jahr 1951. Immerhin fuhren damals noch 28 Flöße durch den Strudengau. Seit der Gründung der„Ersten k.k.privilegierten Donau- Dampfschiffahtsgesellschaft“1829, hatten die alten Schiffsmeister hart um ihr Brot zu kämpfen. Viele ließen sich entmutigen, warfen das Handtuch. Anton Notz kämpfte bis zuletzt erfolgreich. Das erste Dampfschiff, die „Maria Anna“ durchfuhr bereits 1837 die Wachau.
Immer wiederkehrende Überschwemmungen und Eisstöße forderten übermenschliche Kräfte von den Schiffsleuten und ihren Familien. Am 20. Februar 1830 stieg das Wasser nach dem großen Eisstoß 220 Zentimeter hoch, am 2. Februar 1862 210 Zentimeter über das Niveau der alten Bundesstraße.
Anton Notz heiratete eine gewisse Seltenheim Magdalena. die ihm 11 Kinder gebar.
Eine ihrer Töchter,Magdalena Notz,wurde am 24.März 1834 in St. Lorenzi geboren. Sie ehelichteLeopold Jamek,24.1.1829,den Großvater vonJosef Jamek, einen Bauer, der als uneheliches Kind vonAnna Marie Jamekgeboren wurde. Später heiratete Anna Marie den KindsvaterFlorian Prager.
Erst als Leopold Magdalena Notz 1857 ehelichen wollte, kramte man den Taufschein hervor und bemerkte, dass der erste Prager-Sohn den Namen Jamek trug. Man konnte diesen aber jetzt nicht mehr ändern.
Die Urgroßeltern von Josef Jamek waren Ferdinand Jamek, geboren 1786, Bauer in Pesenbuch/ Gansbach. Seine Frau hieß Rosalia Buchecker, geboren1790. Eine Tochter warAnna-Marie, geboren1810.
Die Großeltern von Josef Jamek: Anna Maria Jamek (Mutter v. Leopold Jamek) heiratete Prager Florian
Leopold Jamekwurde in Förthof- Stein am 24. 1.1829geboren.