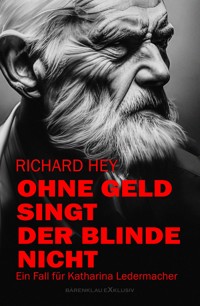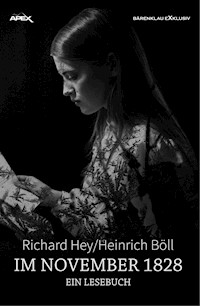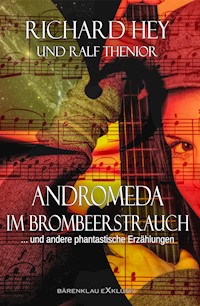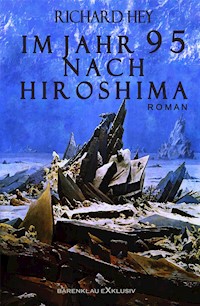3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bärenklau Exklusiv
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Katharina Ledermacher, Ende Dreißig, geschieden, eine Tochter lebt beim Ex-Ehemann, arbeitet nicht wie weibliche Polizisten sonst in der Abteilung »Sitte« oder »Jugend«, sondern als Kriminalkommissarin bei der West-Berliner Polizei, Referat »Tötung«. Katharina Ledermacher ist besessen von ihrem Beruf. Als eines Tages am Ufer des Lietzensees ein alter Mann mit eingeschlagenem Kopf aufgefunden wird, ergibt die Autopsie einen merkwürdigen Befund: Im Magen des minderbemittelten Rentners befinden sich Champagner, Hummer und Kaviar. Bei ihren Ermittlungen trifft die »Ledermacherin« auf gesellschaftliche Randgruppen – die Rockerbande »Luzifers Lieblinge«, die vermummt in gestohlenen Autos herumrast und Überfälle macht, merkwürdiger noch: auf recht rüstige Insassen eines Altersheims, die trostloses Heimdasein gegen eine illegale dolce vita auf eigene Faust vertauschen, und auf andere skurrile Typen des Berliner Milljöhs. Die Kriminalkommissarin Katharina Ledermacher, Überraschungen gewohnt, stößt bei ihrer Suche nach dem Mörder auf immer unglaublichere Tatsachen.
Dieser Kriminalroman wurde 1978 vom Deutschen Fernsehen verfilmt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Richard Hey
Ein Mord am Lietzensee
Ein Fall für Katharina Ledermacher
Ein Berlin-Krimi
Impressum
Copyright © by Authors/Bärenklau Exklusiv
Cover: © by Steve Mayer nach Motiven , 2022
Verlag: Bärenklau Exklusiv. Jörg Martin Munsonius (Verleger), Koalabärweg 2, 16727 Bärenklau. Kerstin Peschel (Verlegerin), Am Wald 67, 14656 Brieselang
Die Handlungen dieser Geschichten sind frei erfunden sowie die Namen der Protagonisten. Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind rein zufällig und nicht gewollt.
Alle Rechte vorbehalten
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Das Buch
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
Über den Autor Richard Hey
Das Buch
Katharina Ledermacher, Ende Dreißig, geschieden, eine Tochter lebt beim Ex-Ehemann, arbeitet nicht wie weibliche Polizisten sonst in der Abteilung „Sitte“ oder „Jugend“, sondern als Kriminalkommissarin bei der West-Berliner Polizei, Referat „Tötung“. Katharina Ledermacher ist besessen von ihrem Beruf. Als eines Tages am Ufer des Lietzensees ein alter Mann mit eingeschlagenem Kopf aufgefunden wird, ergibt die Autopsie einen merkwürdigen Befund: Im Magen des minderbemittelten Rentners befinden sich Champagner, Hummer und Kaviar. Bei ihren Ermittlungen trifft die „Ledermacherin“ auf gesellschaftliche Randgruppen – die Rockerbande „Luzifers Lieblinge“, die vermummt in gestohlenen Autos herumrast und Überfälle macht, merkwürdiger noch: auf recht rüstige Insassen eines Altersheims, die trostloses Heimdasein gegen eine illegale dolce vita auf eigene Faust vertauschen, und auf andere skurrile Typen des Berliner Milljöhs. Die Kriminalkommissarin Katharina Ledermacher, Überraschungen gewohnt, stößt bei ihrer Suche nach dem Mörder auf immer unglaublichere Tatsachen …
Dieser Kriminalroman wurde 1978 vom Deutschen Fernsehen verfilmt.
***
1. Kapitel
Seit einigen Tagen schlief Katharina Ledermacher in den frühen Morgenstunden unruhig.
Zu ihren Gewohnheiten gehörte es, gegen fünf, im Halbschlaf, mit einem geschlossenen und einem viertelgeöffneten Auge und behutsam, um nicht aufzuwachen, aufs Klo zu gehen. Erleichtert kuschelte sie sich danach wieder an Roberts Seite, überhörte sein betontes Ein- und Ausatmen, das ihr zeigen sollte: du hast mich gestört, und schlief sofort tief und ruhig weiter, bis sie durch dröhnende Glocken genau um sieben geweckt wurde. Die Drei-Zimmer-Wohnung lag im vierten Stock eines Altbauhauses in der Charlottenburger Pestalozzistraße, gegenüber der Trinitatis-Kirche auf dem Karl-August-Platz.
Die Kirche, ein aufgeplustertes Backsteinhuhn, wie Katharina fand, mit hoher, kupfergrünschwarzer Nachkriegsturmspitze, der höchsten West-Berlins, wie Robert behauptete, war im neunzehnten Jahrhundert in wilhelminischer Gotik gebaut worden. Das Läutwerk ging um sieben los, um zwölf, zu jeder Hochzeit, und sonntagvormittags ab acht mindestens viermal. Um sieben dauerte es genau drei Minuten. Meistens stand Katharina während der letzten Töne nackt am Fenster oder, im Sommer, in einem alten Unterhemd Roberts auf dem morschen Balkon, der immer noch nicht baupolizeilich abgebrochen worden war, und blickte über schüttere Akazienwipfel hinweg auf eine der vier riesigen Kirchturmuhren. Dann blickte sie auf ihre Armbanduhr. Diesen Moment mochte Katharina, egal ob noch Straßenlaternen brannten oder schon lange die Sonne schien.
Die türkischen und jugoslawischen Straßenreiniger waren noch fern. Die Expressreinigung, die Fleischerei, der Autoverleiher, das Bestattungsunternehmen, der Werkzeugladen, die Druckerei, die Schlosserei, die zoologische Handlung, Schuberts gegen Hertie ankämpfende Feinkost, die drei Möbelgeschäfte, fünf Kneipen und sieben Trödelläden, die Katharina sehen konnte, hatten alle noch geschlossen. Ebenso Hertie an der Ecke Wilmersdorfer. An zwei, drei weiteren Läden blieben seit Monaten die Rollläden schief und verdreckt heruntergezogen, Firmenschilder waren abgenommen oder zerschlagen. Aber in den andern, noch nicht dem Verfall und den Ratten überlassenen Läden wurde schon gearbeitet. Einige Hunde vermehrten die bereits vorhandenen Kackhaufen und Pissepfützen auf dem Karl-August-Platz und auf den Bürgersteigen der Pestalozzistraße. Einige der in langen Reihen an beiden Straßenrändern parkenden Autos setzten sich in Bewegung, lautlos unter dem Lärm der Glocken. Erst wenn der letzte Glockenton allmählich verstummte, waren wieder Geräusche zu hören, das Kaffeewasser aus der Küche, von der Straße Schritte, Rufe, misstönendes Anlassen von kalten Automotoren, Hundebellen. Und Katharinas Arbeitstag begann: Anziehen, Frühstückmachen, Zeitunglesen, Von-Robert-Verabschieden. Meistens ging sie noch ein paar Schritte durch die Krumme Straße, rannte im Hochhaus gegenüber der Oper in den achten Stock, sah nach ihrer eigenen Zweizimmerwohnung, sah Post durch und flüchtig von schräg oben auf ihr verdrecktes Auto im Innenhof, ließ den Aufzug kommen und leer nach unten fahren, rannte zugleich über die Treppe los, war immer vor dem Aufzug unten und fuhr dann mit der U-Bahn, einmal Umsteiger bis Bayerischer Platz, zu ihrem Büro in der Gothaer Straße, wo die Westberliner Kriminalpolizei einige ihrer Abteilungen hat.
Seit dem zweiten Januar dröhnten die Glocken nicht mehr rücksichtslos um sieben. Sie dröhnten auch nicht mehr um zwölf. Sie läuteten zurückhaltend höchstens sonntags und bei Hochzeiten. Und wenn Katharina von ihrem einäugigen Fünf-Uhr-früh-Gang ins Bett zurückgekehrt war, fürchtete sie jetzt, nicht mehr rechtzeitig aufzuwachen, falls sie, wie üblich, aus dem sorgfältig bewahrten Halbschlaf wieder in den Tiefschlaf glitte. Robert behauptete zwar, er habe wie jeder Schulmeister die innere Uhr, und er könne zu jeder gewünschten Minute wach werden, aber Katharina misstraute ihm.
Und weil sie immer wieder vergaß, ihren eigenen Wecker aus dem Hochhaus herüberzuholen, war sie jetzt mit sorgenvollem Nachdenken über ihr Schlafdefizit beschäftigt. Wenigstens glaubte sie das, bis Robert sie sanft wachrüttelte. Es war schon zwanzig nach sieben, er hatte Kaffee gemacht und Zeitungen und Schrippen geholt. Alle Lampen in der Wohnung brannten. Draußen war es noch dunkel.
2. Kapitel
Der Studienrat Robert Tillmann saß in Tweedhosen und rostrotem Rollkragenpullover auf dem Badewannenrand und las der Kriminalkommissarin Katharina Ledermacher abwechselnd aus der Frankfurter Rundschau und der Berliner Morgenpost vor, Ausgaben von Donnerstag, 11. Januar. Katharina sah ihn durch den Spiegel. Sie trug Lidschatten auf und langte zwischendurch nach der Tasse mit heißem Kaffee, die Robert ihr aufs Fensterbrett gestellt hatte. Sie prüfte den Pagenschnitt ihrer dunklen Haare, fand ihn noch in Ordnung. Sie fand ihre grauen Augen in Ordnung. Sie fand ihre Brüste in Ordnung. Sie fand die senkrechte Falte über ihrer Nase in Ordnung. Wenn die Falte tief war, ging es ihr nicht besonders. Sie merkte, dass Robert sie beobachtete.
»Jetzt Wirtschaft«, sagte sie.
Robert las ihr ein paar Überschriften und Zwischentitel aus dem Wirtschaftsteil vor. Sie betrachtete ihn, seine rosige Haut, sein rotblondes gelocktes Haar, seine beginnende Stirnglatze. Er neigte etwas zur Korpulenz. Aber wenn er sich bewegte, wirkte er behände, überhaupt nicht massig. Sie ging massigen Männern, wenn sie es einrichten konnte, aus dem Weg, seit sie vor zehn Jahren von Ruedi Scheidt, 195 Zentimeter groß, zwei Zentner schwer, geschieden worden war.
»Oh«, sagte Robert, »das hier wird dir Freude machen.«
»Gott, schon halb«, murmelte Katharina und rannte in den Flur. Robert folgte ihr und las dabei vor: »Die Serie brutaler Raubüberfälle und vandalischer Zerstörungen – schöner Genitiv – vandalischer Zerstörungen in unserer Stadt geht weiter. Die Polizei sieht hilflos zu.«
Katharina, vor dem Flurspiegel, schon im Mantel: »Klar. Was soll sie auch sonst tun. Hast du meine Handschuhe gesehen?« Robert gab sie ihr. Sie hatten neben dem Spiegel auf dem Garderobentisch gelegen.
»Weiterhin werden Geschäfte aufgebrochen, Passanten niedergeschlagen und beraubt. Der Kassierer, der bei dem Überfall auf die Discontobank in Steglitz vor drei Tagen durch zwei Schüsse schwer verletzt wurde, ist noch immer bewusstlos. Die billige Plastik-Kinderkarnevalsmaske – kühne Substantivhäufung – die er dem Räuber vom Gesicht gerissen hatte, ist das einzige Beweisstück der Polizei. Solche für Kinder gedachten Gesichtsmasken werden in diesen Tagen zu Tausenden angeboten und verkauft, auch an Erwachsene, obwohl der Berliner doch eigentlich kein Karnevals-Jeck ist. Die Kripobeamten hoffen, dass der Kassierer bald zu sich kommen und aussagen wird. Das ist eine magere Aussicht. Seit Anfang November vorigen Jahres rasen immer häufiger auf gleiche Weise Maskierte am helllichten Tag in gestohlenen Autos rücksichtslos über Zebrastreifen und Bürgersteige hinweg, schleudern während des Fahrens Steine in Schaufenster oder schießen sie einfach entzwei. Tausende von Zigarettenautomaten und Hunderte von Verkehrszeichen wurden zerstört, Omnibusse der BVG beschädigt.«
Katharina lief zwischen Schlafzimmer und Wohnzimmer hin und her. »Wo sind meine Hausschlüssel?«
»Auf dem Eisschrank.«
Robert folgte Katharina in die Küche. »Die Bewohner ganzer Straßenzüge werden durch gellende rhythmische Hupkonzerte tyrannisiert. Dabei ist der Silvester-Terror noch unvergessen, zu dessen trauriger Bilanz die abgebrannte Terrasse des Bristol-Restaurants auf dem Kurfürstendamm sowie einige hundert mutwillig beschädigte und in Brand gesteckte Autos gehören. Allgemein wird die berüchtigte Jugendlichenbande ›Luzifers Lieblinge‹ für diese sich häufenden Verbrechen verantwortlich gemacht. Aber die Polizei behauptet, keine Beweise zu haben. Wir müssen feststellen –«
Katharina rief aus dem Wohnzimmer: »Bleibt’s beim Kino heute Abend?«
Robert erschien in der Wohnzimmertür, die Zeitung in der Hand. »Wenn deine Lieblinge es uns erlauben.«
»Die Lieblinge geh’n mich nichts an. Die fallen unter J II.«
Katharina stopfte Akten, die sie neben dem Fernsehapparat gefunden hatte, in eine viel zu kleine Klarsichthülle. »Und aus Jugend II bin ich seit einem Jahr raus.« Sie rannte an ihm vorbei in den Flur, drehte sich um. »Also dann, Dicker. Was gibt’s heute bei dir?«
»Fünf Stunden Deutschaufsatz. Und bei dir?«
»Engelhard und Wankum.«
Die Abteilungsleiterin in der Firma Auto-Schönfeld Helga Engelhard und der Arbeiter Rudi Wankum hatten vor drei Tagen, wie es schien, ihr Leben gemeinsam und freiwillig mit ein paar Schüssen beendet. Es konnte aber auch sein, dass sie umgebracht worden waren.
»Heute kommt Irina. Du brauchst nicht abzuwaschen.«
Robert blickte hinter ihr her. Sie hatte gerade die Wohnungstür geöffnet.
»Mach’s gut.«
Sie lächelte, winkte, schlug die Wohnungstür zu.
Im Gegensatz zu der hellen Wohnung, mit ihren hohen stuckverzierten Räumen und ihren zwar kaum noch schließenden und stark verzogenen, aber doch eindrucksvollen Flügeltüren, war das Treppenhaus ein durch schmutzige Glühbirnen schlecht beleuchtetes modrig riechendes Loch mit herabfallendem Putz an den verschimmelten Wänden, fleckigen Linoleumresten auf den Stufen und einem Geländer, das bedrohlich knackte, wenn es berührt wurde. Der Besitzer hatte kein Interesse an einem Haus, das umso schneller im Charlottenburger Untersumpf versacken würde, je mehr Hochhäuser in der Nachbarschaft entstanden und den Grundwasserspiegel senkten. Katharina konnte auch dieses Treppenhaus in Rekordzeit hinter sich bringen. Aufwärts brauchte sie nur einmal einzuatmen. Abwärts, wie jetzt, keinmal.
Sie stand einen Moment vor der Haustür auf der Straße, knöpfte ihren abgewetzten dunkelbraunen Lammfellmantel zu, sog Luft ein. Die war für Januar nicht übermäßig kalt, aber feucht. Sie roch fast so wie die Luft im Treppenhaus. Katharina hätte gern Schnee gehabt. Aber es schneite nicht. Es war immer noch dunkel in den von zu wenig Laternen beleuchteten Straßen. Ein kleines graues Auto bog langsam von der Krummen Straße ein, blinkte mit den Scheinwerfern, hupte kurz, hielt vor ihr. Eine Wagentür wurde geöffnet. Der Fahrer grinste sie durch die stark verschmutzte Windschutzscheibe an. Katharina stieg ein. »Schönen guten Morgen, Ledermacherin«, sagte der Fahrer und fuhr los. »Das war Sekunden-Timing.«
»Morgen, Zobel«, murmelte Katharina. »Seit wann werde ich abgeholt? Ist was mit Gerfried und Doris?«
Manfred Zobel, 24, ledig, war der jüngste von den drei ihr unmittelbar unterstellten Kriminalbeamten, Heinz Gerfried, 35, verheiratet, der älteste, und Doris Wingert, ledig, war so dazwischen, um die Dreißig.
»Was haben Sie mir beigebracht? Nicht zwei Fragen auf einmal.« Zobel grinste wieder. Manchmal mochte Katharina dieses Grinsen, manchmal nicht. Heute fand sie es einfältig. Zobel hörte auf zu grinsen. »Am Lietzensee liegt ein alter Mann mit eingeschlagenem Kopf. Die Charlottenburger Kollegen wollten nicht warten, bis die Zentrale einen aus der Tötung schickt.« Zobel machte eine Pause, während er sein kleines graues Auto in den Morgenverkehr der Kantstraße einfädelte. In dieser Pause sagte er nicht: Also haben sie in Ihrer Wohnung angerufen. Natürlich vergeblich. Was Ihren Lehrer betrifft, sind die eben noch nicht auf dem Laufenden, sondern er sagte, nach der Pause, schon auf der Kantstraße: »Da haben die mich angerufen und gefragt, ob ich Sie nicht erwischen kann, bevor Sie in die Zentrale fahren.«
Zobel wohnte nur ein paar Autominuten weiter am Sophie-Charlotte-Platz hinter der Charlottenburger Polizeiinspektion am Kaiserdamm. Da hatte er früher im Ersten Kommissariat gearbeitet. Gleich als Anfänger hatte er großen Erfolg gehabt. Es war ihm gelungen, einen erfahrenen, international gesuchten Taschendieb festzunehmen.
»Es ist Ihnen doch recht so?«, erkundigte sich Zobel und sah sie an, weil sie bloß schweigend dasaß.
»Überhaupt nicht«, sagte sie. Sie fror. Sie hatte keine Lust, sich mit dem eingeschlagenen Kopf eines alten Mannes zu beschäftigen. Sie fühlte sich noch nicht wach. Sie brauchte die tägliche U-Bahnfahrt ins Büro, um aufzuwachen. Als sie den besorgten Blick von Zobel spürte, lächelte sie. »Aber es ist natürlich richtig so«, sagte sie. Ihr Atem beschlug die Windschutzscheibe. Bevor das Auto warm wurde, hielt Zobel schon und genau da, wo die Neue Kantstraße als hellerleuchteter Damm den Lietzensee in zwei dunkle Hälften teilte. Vor ihnen standen quer über dem Bürgersteig zwei Streifenwagen der Polizei mit lautlos rotierendem Blaulicht, dazwischen ein roter VW-Bus der Feuerwehr. Auf der gegenüberliegenden Seite der Lietzenseebrücke warteten zwei Taxen. Die Fahrer dösten am Steuer. Aus dem herabgekurbelten Fahrerfenster des vorderen Streifenwagens kam knatternd und quäkend eine Funknachricht. Katharina verstand nur noch das Wort »Ende«, als sie ausstieg. Sie fror noch immer. Zwei uniformierte Beamte, langhaarig, schnauzbärtig, für Katharina unbegreiflich aktiv, unbegreiflich freundlich an diesem Morgen, forderten mit kreisenden Handbewegungen Schulkinder und Erwachsene auf, nicht stehenzubleiben. Aber die Schulkinder und Erwachsenen blieben trotzdem stehen, zuckendes Blaulicht auf den Gesichtern, glotzten und warteten.
Katharina begrüßte die beiden Beamten. Ein dritter kam aus dem vorderen Streifenwagen. Er war kaum älter als die beiden anderen Beamten, aber schon ziemlich dick, und er schwitzte. Die frierende Katharina betrachtete die Schweißtropfen auf seiner Stirn, während er sprach, und er blickte abwechselnd von Zobel, den er kannte, zu Katharina, die er nicht kannte.
»Ich habe gerade was von der Zentrale durchgekriegt.« Er bemühte sich, hochdeutsch zu sprechen. »Da ist soeben einer von Luzifers Lieblingen in Gewahrsam genommen worden. Der hatte einen Totschläger bei sich. Ich soll es dem Kommissar ausrichten, Zobel.«
»Danke«, sagte Katharina. »Bitte teilen Sie der Zentrale mit, dass der Kommissar eingetroffen ist.« Der umfangreiche Beamte sah noch mal von Zobel zu Katharina, grüßte und klemmte sich wieder in seinen Streifenwagen, während Katharina und Zobel durch ein schief in der Angel hängendes offenes Eisentor gingen. Das Tor stammte noch aus der Zeit, als der Lietzenseepark nachts geschlossen gehalten wurde. Nach wenigen Schritten befanden sie sich im Dunkeln. Der Großstadthimmel über ihnen war hell. Aber ihre Schuhe sahen sie kaum als Schatten auf dem dunkelgrauen ebenen Weg, der sie parallel zur Straße nach unten führte. Vom Weg zur Straße hinauf standen kahle schwarze Büsche. Durch Äste und Sträucher sah Katharina unten den Schein einer starken Taschenlampe, der langsam kreiste. Sie hörte Stimmen.
Am zugefrorenen See war ein kleiner runder Platz. Auf dem Platz lagen Bänke übereinandergeschichtet, Äste und Laub waren zu einem Haufen zusammengekehrt. Mit dem Rücken zu Katharina ein paar Leute: ein Streifenpolizist, der den Lichtschein seiner Taschenlampe auf dem Ästehaufen wandern ließ, ein Fotograf mit Fellmütze, der vor dem Haufen kniete und am Blitzlicht hantierte, ein Mann in Leder, der ebenfalls kniete und, vom Schein der wandernden Taschenlampe gestreift, kleine Klarsichtbeutel sortierte, zwei ruhig wartende Männer mit einer Bahre, abseits ein älterer Mann mit Hut, der sich bückte. Im plötzlichen Aufflammen des Blitzlichts sah Katharina, dass er im Begriff war, mit pedantischer Sorgfalt ein Abhorchgerät in einer Arzttasche zu verstauen. Und jetzt sah sie auch die regungslos liegende Gestalt im dunklen Mantel, flach ausgestreckt inmitten der Äste, als sei sie mit ihnen zusammen aufgekehrt worden.
Katharina ging näher heran, alle wandten sich zu ihr um. In der beginnenden Morgendämmerung hatten sie graue, schattige Gesichter. Etwas entfernt quakten ein paar Enten. Oben, auf der Straße, rauschten die Autos vorbei. Katharina schüttelte ein paar Hände. Den Fotografen, den Kollegen vom Charlottenburger Erkennungsdienst und den Arzt kannte sie.
»Wer hat ihn gefunden?«, fragte sie.
»Der ist jetzt drüben bei den Enten«, sagte der Polizist und sah Katharina neugierig an. »Ein Angestellter des städtischen Gartenbauamts Charlottenburg. Er kam heute Morgen früher als gewöhnlich, weil wir nachts bis zu minus fünf hatten. Er wollte nachsehen, ob das Wasserloch für die Enten nicht zugefroren war. Da fand er den hier liegen.«
Die Taschenlampe des Polizisten leuchtete über den dunklen, abgetragenen Mantel, über verbrauchte, glänzende Hosen, über die seitwärts von den Ästen herabhängenden Hände, auf einen gepflegten alten schwarzen Schuh, auf eine goldgeränderte intakt gebliebene Brille, die neben dem Schuh auf dem Boden lag, auf eine gepunktete Schleife und ein blasses, faltiges Gesicht darüber, das aus den Ästen streng nach oben blickte. Im Mund des Gesichtes steckte ein zusammengerolltes Taschentuch mit den deutlich sichtbaren eingestickten Buchstaben H.B.
»Der Gärtner hielt ihn erst für betrunken. Er sagt, der hat noch als Leiche eine Fahne gehabt. Er versuchte, ihn aufzurichten. Im Dunkeln konnte er ja nicht gleich erkennen, was los war. Er hat den Kopf angefasst und etwas angehoben. Da spürte er, dass der Hinterkopf sich weich und klebrig anfühlte. Als er losrannte, um Hilfe zu holen, trat er gegen die Brille, und sie flog bis drüben ans Ufer. Er hat sie für uns wieder dahin gelegt, wo sie seiner Meinung nach war.«
»Sagt er«, bemerkte Zobel.
»Sagt er«, wiederholte der Polizist. Er fügte hinzu, als schlösse das jeden Verdacht aus: »Aber er hat sich ausgewiesen.«
»Der Gärtner war wieder der Mörder, haha«, sagte der Fotograf. Als die anderen ihn schweigend ansahen, hing er sich mürrisch seine beiden Fotoapparate um den Hals. »Mein Gott, das ist ein uralter Wiener Witz. Ich dachte, ihr kennt den. Na gut. Kontaktabzüge können Sie in einer Stunde haben.« Er tippte an seine Fellmütze, ging dann den Weg nach oben zurück, den Katharina mit Zobel heruntergekommen war.
»Das hier«, sagte der Polizist, »haben wir auf dem Weg gefunden. Ungefähr da, wo der Fotograf jetzt langgeht.«
Während Zobel sich umdrehte und hinter dem Fotografen herblickte, der neben dem schwarzen Gestrüpp verschwand, reichte der Polizist Katharina einen Berliner Personalausweis, leuchtete mit der Taschenlampe hinein. Sie sah das Gesicht eines knapp siebzigjährigen Mannes, der durch eine Brille streng am Betrachter vorbeiblickte. Sie las den Namen: Hermann Brückner, und die Adresse: Berlin-Nikolassee, Von-Luck-Straße, und gab den Ausweis an Zobel.
»Wird rausgefallen sein«, sagte Zobel, während er die Adresse im Licht der Taschenlampe des Polizisten abschrieb, »als man ihm das Tuch aus der Tasche fischte, um ihn zu knebeln.«
»Möglich«, sagte Katharina.
»Das bedeutet«, fuhr Zobel fort, »dass wir eventuell mit zwei oder sogar mehreren an der Tat Beteiligten rechnen müssen.«
»Eventuell ja«, sagte Katharina und tastete Mantel- und Jacketttaschen des Toten ab. Sie fand ein Schlüsselbund mit Sicherheitsschlüsseln und einem einfachen Schlüssel, sowie eine alte schwarze Geldbörse mit einem Zehnmarkschein und einem Fünfzigpfennigstück. Sonst nichts. Sie gab Schlüsselbund und Geldbörse Zobel, der die Gegenstände samt dem Ausweis in eine Hertie- oder Neckermann-Plastiktüte schob. Er fuhr nie zum Dienst ohne mindestens zwei solcher Plastiktüten. Die von der Kriminalpolizei üblicherweise verwendeten Klarsichtbeutel waren ihm zu klein. In der zweiten Plastiktüte verstaute er die goldgeränderte Brille und die kleinen Klarsichtbeutel mit Laubresten, Zweigen, Mantelstoffasern und Spurenfolien, die ihm der Charlottenburger Kollege reichte. »Von mir aus wär’s das«, sagte der. »Bloß an den Knebel bin ich nicht ran. Das macht ihr man besser im Labor.«
Katharina blickte auf die dunkle, mehrfach gestopfte Wollsocke des linken schuhlosen Fußes, die halb vom Fuß geglitten war und ein Stück magere Altmännerwade und den unteren Teil einer langen grauen Unterhose freigab. Dann wandte sie sich an den Arzt: »Wann ungefähr ist der Tod eingetreten?«
Der Arzt hob seine Tasche ein wenig und senkte sie gleich wieder. »Um Mitternacht herum. Eine halbe Stunde früher, eine halbe Stunde später. Genaueres nach dem Obduktionsergebnis. Dass der Tote erhebliche Mengen Alkohol zu sich genommen hat, möchte ich einstweilen nicht ausschließen. Übrigens bin ich ziemlich sicher, dass er nicht am Knebel erstickt ist. Zumal der Knebel ja weder mit Heftpflaster noch mit Stricken befestigt gewesen zu sein scheint. Er ist ihm bloß so reingestopft worden, für den Moment der Schläge. Und diese zwei, drei wuchtigen Schläge mit einem massiven Gegenstand haben ihm die Schädeldecke zertrümmert.« Wieder hob und senkte sich die Tasche. »Ich wundere mich, dass nicht Gehirnsubstanz ausgetreten ist.«
Der Arzt stellte die Tasche auf den Boden, griff nach dem Kopf des Toten, schloss ihm jetzt erst beiläufig die Augen und drehte ihn vorsichtig ein wenig. Der Polizist leuchtete mit der Taschenlampe, und Katharina sah blutverklebtes, schütteres graues Haar, tief in eine ausgezackte Wunde gepresst, und lappige blasse Kopfhaut.
»Mit einem massiven Gegenstand«, wiederholte sie und ging um Hermann Brückner herum.
»Wir haben hier schon abgesucht«, sagte der Polizist. Der Arzt hatte seine Tasche wieder in der Hand, und die Tasche hob und senkte sich. »Ja, Frau Ledermacher, dann darf ich mich wohl zunächst empfehlen. Ich rufe an, sobald ich mehr weiß.«
»Danke, Dr. Martin.«
Der Arzt lüftete auf altmodische Weise knapp seinen Hut vor Katharina. Sie dankte auch dem Herrn im knirschenden Leder und wandte sich an den Polizisten: »Wir müssen diesen Teil des Parks zunächst noch abgesperrt halten. Bitte sagen Sie Ihren Kollegen oben Bescheid, dass auch die anderen Ausgänge besetzt werden, Wundtstraße, Witzlebenplatz und so weiter.« Sie nickte den beiden Männern mit der Bahre zu, die geduldig auf genau dies Nicken gewartet hatten und sich jetzt in Bewegung setzten, um Brückner samt Einzelschuh aufzunehmen. »Aber nicht den Knebel berühren«, sagte Katharina.
Die Männer brummten etwas wie: na klar, na was, hoben den Toten umsichtig von den Ästen und bedeckten ihn und das zusammengerollte initialengeschmückte Taschentuch in seinem Mund mit einer Plane. Dann folgten sie dem Arzt und dem Polizisten nach oben. Sie trugen den Toten wie einen Verletzten ohne jedes Schwanken. Katharina sah einen Moment hinter dem Zug her. Am gegenüberliegenden Seehotel war die Leuchtschrift verblasst, rosa Streifen am Himmel kündigten einen überraschend klaren und trockenen Wintertag an.
Katharina fror. Ihr fiel ein, dass sie Dr. Martin nach einem Kreislaufmittel fragen wollte. Aber Dr. Martin war schon oben auf der Straße. Sie nahm sich vor, ihn zu fragen, wenn er in ein paar Stunden den Obduktionsbefund durchgeben würde. Zobel hatte inzwischen die Äste und das Laub auseinandergetreten und die kahlen Büsche durchsucht, die um den kleinen Platz herumstanden. Jetzt kam er, enttäuscht die Plastikbeutel schwenkend, zu Katharina zurück. »Man kann natürlich einen Hammer, eine Eisenstange, ein Bleirohr oder so was auch wieder mit nach Hause nehmen«, murmelte er, während beide langsam in Richtung Enten am graugefrorenen See entlanggingen.
»Ja«, sagte Katharina.
»Und man braucht einen alten Mann, den man knebeln will, nicht unbedingt zu fesseln. Obwohl es ungewöhnlich ist. Knebeln und fesseln gehört verdammt noch mal zusammen.« Er machte eine Pause. Katharina schwieg. »Ich habe nämlich nicht nur nach Eisenstangen gesucht«, sagte Zobel, »sondern auch noch nach Schnüren oder Riemen, die jemand weggeworfen haben könnte.«
»Habe ich vermutet«, sagte Katharina. Sie spürte, dass die Bewegung ihr guttat, und ging etwas schneller.
»Jemand«, fuhr Zobel fort, »der den alten Mann ursprünglich fesseln wollte, dann aber sah, dass er das gar nicht nötig hatte.«
»Man kann auch Schnüre oder Riemen wieder mit nach Hause nehmen«, sagte Katharina.
Zobel rieb sich mit der freien Hand die roten Ohren.
»Ja. Andererseits: wenn viele Arme und Hände zur Verfügung stehen, jemanden festzuhalten, der getötet werden soll, dann braucht man ihn nicht zu fesseln. Dann braucht man ihm nur einen Knebel in den Mund stopfen, damit er nicht schreit.«
Katharina blieb stehen. Sie waren an der eisfrei gehaltenen Stelle des Sees angelangt. Enten und Schwäne paddelten misstrauisch vor ihnen auf und ab. Zwei Enten, die am Ufer gesessen hatten, stürzten sich flügelschlagend ins Wasser. Hinter ihnen, an einer Baracke, klapperte ein schlecht befestigter Fensterladen. Unter dem vergitterten Fenster war ein Schild angebracht: Städtisches Gartenbauamt Charlottenburg. Links neben dem Fensterladen gab es eine sehr enge, niedrige Tür. Rechts vom Fenster war ein Eisenkorb befestigt mit einem weiteren Schild: Futter für unsere Tiere. Der Korb sah nach Abfallkorb aus, und er war mit Pappbechern und Bananenschalen gefüllt. Zobel prüfte das Vorhängeschloss des Türriegels. Dann trat er zurück und blickte sich um.
»Kein Gärtner«, sagte er.
»Haben Sie einen erwartet?«, fragte Katharina. »Wenn er Brückner getötet hat, wär er ja blöd, hier rumzustehn, bis wir ihn holen. Hat er ihn nicht getötet, gehn ihn unsere Untersuchungen nichts an. Er findet eine Leiche, ruft als ordentlicher Bürger die Polizei und kümmert sich im Übrigen um seine Arbeit. Er wird noch was anderes zu tun haben als hier Enten zu füttern.«
»Abfallkörbe auszuleeren scheint nicht dazu zu gehören«, sagte Zobel. Sie gingen den Weg zurück, den sie gekommen waren.
»Brückner ist möglicherweise in letzter Zeit zu Geld gekommen«, sagte Katharina. »Solche goldgeränderten Brillen sind teuer. Auf dem Ausweisfoto hatte er noch eine billige.«
»Sieht aber nicht nach Raubmord aus.«
»Nein, eigentlich nicht.«
Zobel blieb stehen. »Vielleicht doch. Wenn jemand ihm von hinten eins über den Schädel gibt, ihm sein Geld klaut und aus seinem Taschentuch einen Knebel macht, hinterher, damit die Polizei denken soll, da waren zwei oder drei oder noch mehr Täter.« Zobel unterbrach sich, dachte nach. »Also. Noch mal. Wenn Brückner mit jemand gesoffen hat, sagen wir: mit einem städtischen Gärtner, nur beispielsweise, Ledermacherin, und der schlecht bezahlte Gärtner hat gesehn, in Brückners alter Geldbörse stecken ein paar blaue Lappen, und wenn dann die beiden zusammen hier entlanggegangen sind, und der Gärtner schlägt ihm mit einem Spaten oder einer Hacke eins über den Kopf.«
»Oder mit einer Ente«, sagte Katharina.
Zobel ging beleidigt weiter, kickte einen kleinen Stein vom Weg über die Eisfläche. Plötzlich rannte er ans Ufer. Fast zugleich hatte auch Katharina den Gegenstand gesehen, der in etwa drei Meter Entfernung vom Ufer auf dem Eis lag. Auf dem Hinweg zu den Enten und Schwänen hatten sie ihn nicht sehen können, weil er hinter einem umgestürzten, im See festgefrorenen Baum lag. Jetzt, vor den dunklen Ästen des Baums, war deutlich eine Art hölzernes Rad mit schwarzer Achse zu erkennen.
Zobel legte die Plastikbeutel hin, probierte, ob das Eis ihn trug. Es knackte. Er trat auf den eingestürzten Baum. Der bewegte sich, das Eis knackte noch mehr. Zobel warf sich zu Boden, kroch, Arme und Beine flach von sich gestreckt, parallel zum Baum über das Eis auf den Gegenstand zu. Katharina kauerte sich am Ufer hin, bereit, Zobel zu helfen, falls er einbrach.
Gegenüber im dritten Stock des See-Hotels betrat ein weißhaariger Herr im Schlafanzug den Balkon seines Zimmers, um Morgengymnastik zu machen. Er breitete seine Arme aus, atmete tief ein, aber er fing seine Übungen nicht an, sondern blickte, eingeatmet, mit weit ausgebreiteten Armen, auf die Frau unten am andern Ufer, die einen auf dem Bauch übers Eis rutschenden Mann am linken Schuh festhielt. Als der Mann ans Ufer zurückgerutscht war, ließ der weißhaarige Herr die Arme sinken, atmete aus und ging zurück in sein Zimmer. Zobel rappelte sich hoch und zeigte Katharina auf drei Handschuhfingern, um mögliche Abdrücke nicht zu verwischen, einen tellergroßen fünf Zentimeter dicken Teakholzaschenbecher, in dessen Mitte ein mit schwarzem Lack überzogener vierzig Zentimeter hoher Eisenmast befestigt war. Am Rand des Teakholzaschenbechers flache ovale Ausbuchtungen zur Ablage von Zigarren, am Eisenmast ein paar abgerissene goldene Zwirnsfäden. Katharina dachte sofort an den Kommissars-Stammtisch, jeden dritten Dienstag im Monat in einem Lokal am Bayerischen Platz. Auf dem reservierten Tisch stand ein kleiner hölzerner Fahnenmast auf einer nicht sehr massiven Unterlage. An dem kleinen Fahnenmast hing eine Art Standarte, grün mit Troddeln, und auf der Standarte war altrosa eingestickt das Wort »Stammtisch«. Zweifellos handelte es sich auch bei diesem Teakholzaschenbecher und dem schwarzlackierten Eisenmast um etwas, das angefertigt worden war, um eine Stammtischstandarte zu tragen, und es war offensichtlich, dass es sich um einen sehr viel feineren Stammtisch als den der Kriminalbeamten handeln musste.