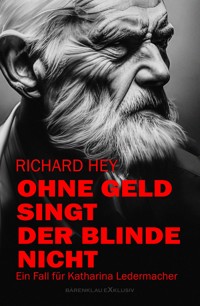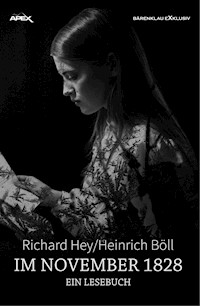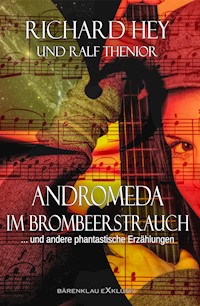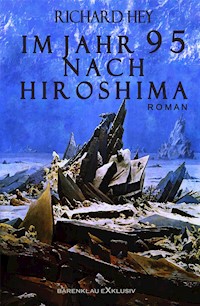3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bärenklau Exklusiv
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Katharina Ledermacher, Oberkommissarin bei der Berliner Kripo, hat einen neuen Fall zu bearbeiten, der plötzlich nicht nur ihr dienstliches, sondern auch ihr privates Engagement verlangt. Nach Zusammenstößen zwischen der Polizei und Demonstranten ist in einer leeren Villa die Leiche einer jungen Frau gefunden worden. Die Ermittlungen führen die Kommissarin zu einer bankrotten Baufirma und einem Abtreibungsarzt, und sie muss sich mit dem Geschäftsgebaren einer Abschreibungsgesellschaft befassen. Dann wird ein Arzt ermordet, eine Kartei verschwindet, es kommt zu Hausbesetzungen ...
Und unter den Besetzern entdeckt Katharina Ledermacher ihre siebzehnjährige Tochter.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Richard Hey
Engelmacher & Co.
Ein Fall für Katharina Ledermacher
Ein Berlin-Krimi
Impressum
Copyright © by Authors/Bärenklau Exklusiv
Cover: © by Steve Mayer nach Motiven, 2023
Korrektorat: Bärenklau Exklusiv
Verlag: Bärenklau Exklusiv. Jörg Martin Munsonius (Verleger), Koalabärweg 2, 16727 Bärenklau. Kerstin Peschel (Verlegerin), Am Wald 67, 14656 Brieselang
Die Handlungen dieser Geschichten sind frei erfunden sowie die Namen der Protagonisten. Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind rein zufällig und nicht gewollt.
Alle Rechte vorbehalten
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Das Buch
Engelmacher & Co.
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
Über den Autor Richard Hey
Das Buch
Katharina Ledermacher, Oberkommissarin bei der Berliner Kripo, hat einen neuen Fall zu bearbeiten, der plötzlich nicht nur ihr dienstliches, sondern auch ihr privates Engagement verlangt. Nach Zusammenstößen zwischen der Polizei und Demonstranten ist in einer leeren Villa die Leiche einer jungen Frau gefunden worden. Die Ermittlungen führen die Kommissarin zu einer bankrotten Baufirma und einem Abtreibungsarzt, und sie muss sich mit dem Geschäftsgebaren einer Abschreibungsgesellschaft befassen. Dann wird ein Arzt ermordet, eine Kartei verschwindet, es kommt zu Hausbesetzungen ... Und unter den Besetzern entdeckt Katharina Ledermacher ihre siebzehnjährige Tochter.
***
Engelmacher & Co.
1. Kapitel
Fünf Stunden nachdem das tote Mädchen in einem Kellerraum der verwüsteten Villa am Wannsee gefunden worden war, begann Katharina Ledermacher ihren Urlaub.
Es war halb sieben Uhr früh, draußen noch dunkel, ein milder Morgen Ende Februar. In der Halle des Tempelhofer Flughafengebäudes warteten die ersten Passagiere vor den Schaltern. Zufrieden sah Katharina zu, wie ihr Gepäck gewogen wurde, und ging dann, die Umhängetasche schlenkernd, hinüber zur Passkontrolle.
Sie fröstelte. Sie war übermüdet, und sie hatte eine schwere Darmgrippe noch nicht überstanden. Obwohl es in der Halle warm war, schlug sie den Kragen ihres abgewetzten braunen Lammfellmantels hoch. »Den brauchst du da doch nicht«, hatte Robert eben noch gemurmelt, nackt, verschlafen, während unten das Taxi kurz hupte. Und Kathinka, in Laken und Kissen gewickelt, hatte widerwillig ein Auge aufgeklappt, als Katharina die Tür öffnete und sich über sie beugte, um sie zum Abschied zu küssen. »Gott, Mami«, hatte Kathinka gesagt und das Auge wieder geschlossen, »mach bloß im Flur das Licht aus.«
Katharina kramte gerade in der Umhängetasche nach ihrem Pass, als sie schräg hinter sich eine knarrende Bassstimme rufen hörte: »Ledermacherin.«
Sie wandte sich halb um.
Gerfried kam durch die Halle eilig auf sie zu. Dabei bemühte er sich, den düsteren Ausdruck seines faltigen Gesichts aufzuhellen und die Stimme zu dämpfen. »Gut, dass ich Sie noch erreiche.«
Gerfried und Katharina hatten sich vor drei Stunden am demolierten Gartentor der Wannseevilla verabschiedet, während der Leichnam des Mädchens an ihnen vorbei über die Straße getragen wurde, der Kollege von der Spurensicherung seine Plastikbeutel und Folien im Licht der Scheinwerfer der Einsatzwagen sortierte und der Fotograf, mürrisch wie immer, die Kamera auf den Rücksitz seines Autos warf. Gerfried hatte in den von langsam ziehenden Wolken halb verdeckten Mond geblickt und ihr einen guten Urlaub gewünscht.
»Gerfried.« Katharina versuchte zu lächeln, aber sie merkte, dass es ihr nicht gelang. »Wenn der Chef Sie geschickt hat, sagen Sie ihm –«
Gerfrieds beträchtlicher Adamsapfel unter dem hellseidenen Rollkragenpullover bewegte sich auf und nieder. »Die Handtasche«, flüsterte er.
In der Handtasche des Mädchens hatte sich außer kosmetischem Kleinkram und einem Notizbuch mit vielen Adressen ein sorgfältig verschnürtes Päckchen befunden, dessen Einwickelpapier die Aufschrift trug: REINHARD-Spielwaren, Basel.
»Da war eine Handgranate drin«, flüsterte Gerfried so deutlich, dass sich einige Leute umdrehten. »Eine ältere britische«, setzte er bedeutungsvoll, aber leiser hinzu, als seien ältere britische Handgranaten besonders gefährliche Explosivkörper.
»Besprechen Sie’s mit Doris und Zobel«, sagte Katharina und legte dem Beamten, der Gerfried misstrauisch musterte, ihren Pass vor. Der Beamte blätterte sofort im Fahndungsbuch.
»Aber der Chef«, flüsterte Gerfried wieder lauter, »der Chef bittet Sie, in Anbetracht dieses Umstands …«
»Grüßen Sie ihn«, sagte Katharina, griff nach dem Pass, den der Beamte ihr enttäuscht entgegenschob, und ging zur Kabine, in der die Fluggäste nach Waffen abgetastet wurden. Nach drei Schritten drehte sie sich plötzlich um. Sie sah, was sie erwartet hatte: das erleichterte Gesicht Gerfrieds. Ihre Weigerung, wegen einer älteren britischen Handgranate auf den Urlaub zu verzichten, bedeutete, dass der Referatsleiter die Aufklärung dieses Falls Gerfried übertragen würde. Sie nickte ihm zu. Sie mochte ihn, trotz seiner betulichen, altväterlichen Art und obwohl er gelegentlich andeutete, dass er Frauen als Vorgesetzte von Männern grundsätzlich missbilligte.
»Sie werden das schon hinkriegen mit der Handtasche, Gerfried«, sagte sie.
Zwanzig Minuten später sah sie von oben die Lichter des West-Berliner Funkturms und die des Ost-Berliner Fernsehturms am Alexanderplatz. Nach anderthalb Stunden hetzte sie in Düsseldorf zum Abflugschalter der Chartermaschine, entschlossen, jede Lautsprecherdurchsage zu überhören, die Frau Ledermacher aus Berlin dringend ans Telefon riefe. Es kam keine Lautsprecherdurchsage. Aber ein blondes Mädchen hinter dem Counter, das Bordkarten verteilte, sagte, ohne aufzublicken: »Sie sind doch aus Berlin, wissen Sie schon, da haben sie eben einen Politiker entführt.« Welchen Politiker, wusste das Mädchen nicht mehr.
Als letzte, vor Erschöpfung zitternd, erreichte Katharina die vollbesetzte Maschine, von hundertachtzig Passagieren missbilligend betrachtet, und setzte sich möglichst unauffällig auf den ihr zugewiesenen Platz neben einem voluminösen Ehepaar.
Unmittelbar nach dem Start fing das Ehepaar an, sich gegenseitig mit Keksen zu füttern. Bald umhüllte Katharina der Zigarettenqualm ihrer Nachbarn. Wohlig betäubt vom Fluglärm und vom munteren Geplauder der anderen dachte sie an die Handgranate in der Handtasche und an Politiker in West-Berlin, die für eine Entführung in Frage kommen konnten. Dann schlief sie ein.
2. Kapitel
Noch vor drei Wochen, gequält von hohem Fieber, Brechanfällen und Darmkrämpfen, hatte sie sich geweigert, an Urlaub zu denken. Vom vorigen Jahr standen ihr zwar noch fünf Urlaubstage zu, aber die wollte sie benutzen, um mit Robert über Ostern nach Prag zu fahren. Kathinka würde dann bei ihrem Vater in der Schweiz sein. Als jedoch Katharinas Chef, seinen Kahlkopf bedachtsam massierend, nahezu dienstlich anordnete, sie habe auf der Stelle vierzehn Tage Urlaub »irgendwo im Süden« zu nehmen, und als auch Dr. Martin, der Polizeiarzt, und ihre Mitarbeiter Gerfried, Zobel, Doris Wingert auf sie einredeten, vor allem aber, als Robert und Kathinka sie bedrängten, mochte sie Prag nicht mehr erwähnen und stimmte schließlich, ermüdet, allen zu.
Robert hatte sich in den Kopf gesetzt, es müssten die Kanarischen Inseln sein.
Aber sämtliche Flüge zu den Kanarischen Inseln waren ausgebucht gewesen. Robert war zwei Nachmittage durch die Reisebüros von Charlottenburg gerannt, während sie am Küchentisch, ihrem Lieblingsplatz, Akten aufarbeitete und dünnen schwarzen Tee trank. Oder, Pfefferminztee, trinkend, im Schaukelstuhl in Roberts Arbeitszimmer saß und aus dem Fenster über die von Winter zu Winter schütterer werdenden Akazienwipfel auf den Turm der Trinitatiskirche gegenüber sah, Chet Bakers Comeback-Platte aus Kathinkas Zimmer hörte und ruhig schaukelnd darüber nachdachte, ob der Automobilverkäufer Friedrich Löboldt wirklich bloß aus Eifersucht die Prokuristin Helga Engelhard und den Arbeiter Rudi Wankum erschossen hatte. Und wieso vier Kriminalbeamte drei Jahre gebraucht hatten, um das herauszukriegen.
Robert hatte schließlich um die Ecke bei Hertie den letzten Platz in der Maschine von Düsseldorf nach Lanzarote buchen können. »Das Problem«, hatte er Katharina erklärt, »besteht darin hinzukommen. Freie Hotelzimmer gibt’s genug. Aber seit der Kerosinpreiserhöhung lassen die Gesellschaften weniger Chartermaschinen fliegen. Und mit Linienmaschinen kostet’s zu viel und dauert mit dreimal Umsteigen auch viel länger. Im Übrigen habe ich dir ein sehr gutes Hotel ausgesucht.«
Katharina hatte überrascht festgestellt, dass sie über sich verfügen ließ. Während der Woche, die noch bis zum Abflug verging, hatte sie sich allerdings wieder ein bisschen erholt. Sie hatte sogar die achtstündige Vernehmung einer Frau durchgestanden, die abwechselnd zugab und leugnete, drei Männer getötet zu haben. Danach hatte sie es eigentlich überflüssig gefunden, Urlaub machen zu sollen. Aber wenig später merkte sie doch, wie wenig sie sich zumuten konnte. Sie schaffte es kaum, ihrer heftig protestierenden Tochter den gelben gefütterten Wachstuchmantel zu entreißen, den Kathinka sich letzten Sommer von ihr ausgeliehen hatte, weil sie am verbilligten Wochenendflug einer Jugendgruppe nach Moskau teilnehmen wollte. Der Mantel war, wie selbstverständlich, anschließend in Kathinkas Kleiderschrank geblieben. Dabei war Kathinka mit ihren siebzehn Jahren vier Zentimeter größer und in den Schultern viel breiter als ihre Mutter. Sie musste wie eine gelbe Wurst durch Moskau gelaufen sein.
Während des Flugs wachte Katharina gelegentlich auf, sah Wolken in der Ferne stehen und hörte die Knabbergeräusche der schon wieder oder immer noch Keks kauenden Nachbarn. Einmal bot die Frau freundlich lächelnd auch Katharina einen Keks an. Katharina mochte ihn nicht ablehnen. Der Mann zeigte aus dem Fenster: unten war das Mittelmeer. Katharina hielt den Keks in der Hand und schloss die Augen, um nicht reden zu müssen.
Das Mittelmeer hatte sie zuletzt vor zwei Jahren gesehen. Da war sie nach Mallorca geflogen, auf den Spuren einer Altenheim-Bande. Die rüstigen Alten hatten, maskiert und unter dem Namen OZEL, Organisation zur Erhöhung des Lebensgefühls, mehrere Banken überfallen und sich mit dem erbeuteten Geld auf Mallorca zur Ruhe gesetzt. Juristisch wohl beraten, lebten sie noch heute unangefochten in hübschen komfortablen Villen am Meer.
Katharina beschloss, nicht mehr an Vergangenes zu denken, sondern leicht und heiter, wie es sich gehört, in den Urlaub zu fliegen.
Sie dachte an eine Fahnenstange.
Die Fahnenstange war morsch, abgebrochen und lag über dem Kopf des toten Mädchens. Sie wurde beleuchtet von einer Taschenlampe, die Gerfried in der Hand hielt. Sie lag etwas zu dekorativ, zu absichtlich über dem Kopf. Der Kopf wies keine äußeren Verletzungen auf, keine Schwellung, keinen Bluterguss. Der Kellerraum war eng, mit Schutt, vermoderten Liegestühlen und faulenden, rostenden Bootszubehörteilen gefüllt. Schwer vorstellbar, dass da jemand in der Lage gewesen sein sollte, einen immerhin noch fast drei Meter langen Fahnenstangenrest zu schwenken, um ihn dem Mädchen über den Kopf zu schlagen.
Wahrscheinlich hatte das Mädchen woanders sterben müssen.
Aber wo? Und wie?
Das Mädchen war nach einer Prügelei zwischen Hausbesetzern und Polizisten gefunden worden. Es konnte also von herabstürzendem Mauerwerk erschlagen und anschließend von den in Panik geratenen Hausbesetzern in den Keller geschleppt worden sein. Aber dann hätten Katharina und Dr. Martin mindestens Hautabschürfungen entdecken müssen. Und warum sollten sich die Hausbesetzer gerade diesen Raum ausgesucht haben? Er lag unter einer Terrasse auf der Rückseite der Villa, hatte keine Verbindung zum übrigen Keller und war nur von außen, von der Uferseite her, zu betreten.
Oder zwischen den Hausbesetzern und dem Mädchen hatte es, bevor die Polizei kam, Streit gegeben und das Mädchen war dabei getötet worden. Aber wozu dann diese Fahnenstange. Schließlich: die Handgranate. Das Mädchen sah nicht aus wie eine Anarchistin. Aber sehen Anarchisten aus wie Anarchisten? Und verpacken Anarchistinnen, die einen Politiker entführen wollen, Handgranaten als Kinderspielzeug und lassen sich anschließend von Hausbesetzern töten? Das Mädchen war blass, nicht hübsch, nicht hässlich, etwas zu fleischige Nase, kleiner, nicht sehr geformter Schmollmund, die aschblonden Haare nach Brigitte frisiert, schöne lange Wimpern, Leberfleck hinterm rechten Ohr. Im Gesicht ein Ausdruck von Verstörung. Katharina schien es außerdem entstellt, obwohl nicht der geringste Kratzer zu entdecken war. Figur mittel, nicht schlank, nicht dick. Kleidung mittel, nicht modisch, nicht unmodern: Hosen, Pulli, Trenchcoat, Kopftuch.
Katharina öffnete die Augen. Sie hielt den Keks in der Hand. Ihre Nachbarn starrten immer noch nach unten, aufs Mittelmeer. Sie schob den Keks unter den Sitz, beugte sich vor, sah ebenfalls aus dem Fenster. Sie sah nur Wolken. Aufatmend lehnte sie sich zurück, schloss schnell die Augen, bevor die Nachbarn mit ihr reden konnten. In zwei Stunden würde sie landen. Kein Gedanke mehr an Fahnenstangen und tote junge Frauen.
Sie dachte an Kathinka.
Vor zwei Jahren hatte ihre Tochter noch beim Vater in Zürich gelebt. Plötzlich hatte sie unbedingt bei Katharina und Robert wohnen wollen. Das war dann, im Einvernehmen mit allen Beteiligten, bewerkstelligt worden. Und anfangs hatte sich Kathinka auch wohl gefühlt in der Pestalozzistraße. Sicher fand sie es schick, eine Mutter zu haben, die, obwohl Kriminalkommissarin, mit einem Lehrer einfach so zusammen lebte. Aber in letzter Zeit hatte sie sich verändert. Sie zog sich häufig mit Freundinnen und Freunden in Katharinas Apartment zurück, das ein paar Minuten von Roberts Wohnung entfernt im achten Stock eines Hochhauses lag. Katharina betrat ihre eigene Wohnung, wenn überhaupt, nur morgens, bevor sie mit der U-Bahn ins Büro fuhr. Sie sah dann nach der Post und aus dem Fenster nach dem Auto, das unbenutzt und verdreckt im Hof stand. Wenn Kathinka am Tag vorher da gewesen war, sah sie außerdem große Mengen von schmutzigem Geschirr in der Küche.
Katharina hätte gelegentlich gern mit ihrer Tochter über diese Freunde und Freundinnen gesprochen. Aber Kathinka, sonst nicht wortkarg, reagierte jedes Mal unwillig. Robert schien das alles für normal zu halten. Er hatte sich von Anfang an gut mit Kathinka verstanden. Und zumindest sonntags morgens, wenn sie zu dritt in Roberts Bett saßen, umgeben von zerfledderten Zeitungen, und im Gedröhn der Glocken von St. Trinitatis geröstete Graubrotscheiben mit Marmelade (Robert) oder Salami (die beiden Frauen) verschlangen, zumindest dann gab es nicht die Spur von Problemen.
Kurz bevor sie wieder einschlief, sah Katharina das Gesicht des erschlagenen Mädchens aus der Wannseevilla vor sich. Sie versuchte herauszufinden, warum es entstellt auf sie gewirkt hatte.
3. Kapitel
Busse brachten sie vom Flugplatz der kleinen Stadt zu den verschiedenen Hotels. Katharinas Hotel lag etwa dreißig Kilometer außerhalb des Ortes. Sie sah einen gelblichen Himmel, keinen Baum, keinen Busch. Die Insel bestand aus Geröllhalden von ausgeglühter Lava, an deren Rand sie entlangfuhren. Die übermüdete Reiseleiterin begrüßte sie, das Mikrofon ungeschickt vor den Mund haltend, »auf diesem wunderschönen Fleckchen Erde«. Katharina sah weiterhin nur bimssteinartigen, dunkel-ockerfarbenen oder braunen Schutt. Einstmals, noch in geschichtlicher Zeit, so stand es im Prospekt, hatte es hier Wälder und Wiesen gegeben.
Die Reiseleiterin machte auf ein Gebäude aufmerksam. Katharina sah tausend Meter entfernt in halber Höhe eines Lavaberges eine einsame leuchtend weiße Windmühle mit schwarzen großen Flügeln und schwarzer Haube. An einem querstehenden Flügelblatt baumelte etwas Dunkles. Sie erfuhr, dass die Windmühle von einem Amerikaner gebaut worden war, der sich mit seinen gesamten Ersparnissen aus einigen Jahrzehnten Uhrenhandel hier zur Ruhe gesetzt hatte. Und die Vogelscheuche hätte er wohl angebracht, damit die Vögel nicht seinen neu eingesäten Rasen auf dem mühsam herbeitransportierten Humusboden gefährdeten. Katharina sah ein paar größere Vögel um die Vogelscheuche kreisen. Sie hielt sie für Möwen.
Sie fuhren an Bauplätzen und vereinzelt liegenden weißen Bungalows vorbei. Einige waren von blühenden Sträuchern umgeben, die von kleingewachsenen Männern in ausgeblichenen dunklen Hemden und ausgebeulten geflickten Hosen begossen wurden. Nur wenige Bungalows schienen im Moment bewohnt. Sie gehörten, teilte die Reiseleiterin mit, vor allem Deutschen, Skandinaviern und Amerikanern. Als sie auf das Hotel zurollten, war Katharina schon wieder müde. Dr. Martin hatte sie in seiner umständlichen Art darauf vorbereitet, dass das Klima der Kanarischen Inseln blutdrucksenkend wirke und daher nicht ungefährlich für Leute mit niedrigem Blutdruck sei.
Das Hotel, Imponierbau aus Beton, Glas und Marmor, stand nah am Meer inmitten von Rasenflächen und Blumenrabatten. Der Weg zum Eingangsportal war gesäumt von blühenden Büschen, einigen neugepflanzten Palmen und Bäumen mit roten Blüten. Auch hier die kaum mittelgroßen Männer in den verwaschenen düsteren Hemden, die mit ernsten Gesichtern Wasserschläuche auf Rasen und Blumen richteten.
Über weiche braune Teppiche ging Katharina hinter einem Kellner in dunkelrotem Jackett hinauf in den zweiten Stock. Das Zimmer gut ausgestattet, ockerfarbene Bettdecken und Vorhänge, Möbel aus Palisanderholz. Aber Fenster gegen Nordwesten. Katharina würde auf ihrem Zimmerbalkon erst am späten Nachmittag, wenn überhaupt, Sonne haben.
Sie hatte es nicht anders erwartet. Kein Hotel überlässt allein reisenden Frauen gute Zimmer. Sie fühlte sich zu schwach, um gleich zu protestieren. Das hatte Zeit bis morgen. Über Zimmertelefon gab sie ein Telegramm an Robert auf und bestellte dann einen Liter Wein. Der wurde auch sofort gebracht, von einem sehr jungen schüchternen Kellner mit leicht rachitisch gekrümmten Beinen. Seufzend vor Erleichterung schluckte sie einige von Dr. Martins Kreislaufpillen, trank zwei Gläser Wein und schlug die Bettdecke zurück. Anderthalb Stunden Schlaf, und der Urlaub konnte beginnen. Sie hatte die Hosen schon ausgezogen und die Bluse aufgeknöpft, als sie die Zimmertür leise schnappen hörte.
Sie drehte sich um. Vor ihr stand ein älterer Kellner, der sie ausdrucksvoll ansah und sein Jackett auszuziehen begann. Wenn das zum Empfang gehört, dachte sie, ist es jedenfalls übereilt. »Das habe ich nicht bestellt«, sagte sie.
Sie hatte keine Ahnung, ob der Kellner sie verstand. Aber er streifte hastig das Jackett über und verließ das Zimmer.
Abends, im noch leeren Speisesaal, sah sie ihn wieder. Sie saß allein an einem kleinen Tisch, und er näherte sich ihr, um sie nach ihren Wünschen zu fragen. Der Chef de Service persönlich hatte sie beehrt. Er lächelte ihr zu, als seien sie vertraut miteinander. Sie erwiderte das Lächeln nach einigem Zögern und, wie sie hoffte, zurückhaltend und damenhaft. Essen mochte sie plötzlich nichts mehr. Sie trank ein Glas Mineralwasser und ging zurück in ihr Zimmer.
Nachts träumte sie von dem Gesicht des Mädchens aus der Wannseevilla. Berufliches erschien in ihren Träumen nur, wenn ihre Nerven überreizt waren. Gegen Morgen lag sie wach und horchte auf die entfernte Brandung. Und auf das Geräusch des rieselnden und sprühenden Wassers aus den Schläuchen, die schon in aller Frühe von den schweigsamen Männern auf Bäume und Sträucher gerichtet wurden. Darüber schlief sie wieder ein.
Alle Mädchen, die Kindergärtnerinnen werden wollten, standen in der Kapelle und sangen. Neben Katharina sang die Frau, die möglicherweise drei Männer umgebracht hatte. Ein runder Bauch wölbte sich unter ihrem rot-weiß karierten Sommerkleid. Sie war schwanger. »Trotz dem alten Drachen«, sangen die Seminaristinnen mit hellen Stimmen, »trotz dem Todesrachen, trotz der Höll dazu, tobe Welt und ringe, ich steh hier und singe in gar sich’rer Ruh.« Katharina hätte gern alle Strophen gesungen, aber die Schwangere neben ihr beunruhigte sie, und sie wachte auf.
Beim Zähneputzen beschloss sie, sich abzulenken und an einem von der Reisegesellschaft veranstalteten Ausflug teilzunehmen.
Während des Frühstücks erfuhr sie, dass die Vogelscheuche an der Mühle des Amerikaners keine Vogelscheuche war, sondern der Amerikaner. Der hatte fast zwei Jahre an seiner Mühle gebaut. Als sie fertig dastand, als jedes Möbelstück, jedes Bild und jedes Whiskyglas, jeder Teppich und jeder Vorgartenstrauch sich am vorgesehenen Platz befanden, als er nur noch einen Hebel umzulegen brauchte, damit der Wind mit Hilfe der Flügel das eingebaute Elektrizitätswerk in Gang setzte, da erhängte er sich an einem der Windmühlenflügel. Das war vor drei Tagen gewesen. Wenn nicht so verdächtig viele Vögel auf den Flügeln der Mühle gesessen hätten, wäre es vermutlich auch jetzt noch keinem aufgefallen.
Diese Neuigkeit war Hauptgesprächsthema der Gäste, während der Bus sie zu den Kamelen fuhr. »Ja«, sagte ein zufrieden nickender Mann, der neben Katharina gefrühstückt und dabei sieben Hörnchen mit Butter und Marmelade verzehrt hatte, »das weiß man ja, Lanzarote ist die Insel der Selbstmörder.«
Später brachten hochmütig blickende Kamele sie hinauf zum Krater. Jedes Kamel trug zwei Gäste, einen links, einen rechts, in Körben, die durch breite Riemen zwischen den Höckern verbunden waren. Katharina wurde übel vom Passgang der Tiere. Sie betrachtete den tiefbraunen gegerbten Nacken des Kameltreibers, der einen Moment neben ihr ging, hager, klein, eine folkloristische Kappe auf dem Kopf. Gelegentlich rief er den Tieren heisere Worte zu. Das Kamel, das vor Katharina schwankte, hatte Durchfall. Unaufhörlich lief ein dünnes gelbes Rinnsal aus ihm heraus. Sein Fell war stumpf, abgeschabt, und es zitterte beim Gehen unter der Last, die es zu tragen hatte. Um nicht fortwährend den entzündeten Kamelafter vor Augen zu haben, sah Katharina angestrengt seitwärts, die Geröllhalde hinauf. Sie hörte, ein Ei, oben auf die Felsen geworfen, werde augenblicklich zum Spiegelei durch die vulkanische Hitze. Und die Reiseleiterin habe Eier bei sich, um das zu demonstrieren. Und dann solle noch eine Höhle besichtigt werden, die in den herrlichsten Farben schillere, weil Kupferadern hindurchführten.
Katharina interessierte sich für nichts mehr. Sie war froh, als sie wieder im Bett des Hotelzimmers lag. Zum Baden hatte sie noch keine Lust. Sie wartete darauf, dass die Sonne um achtzehn Uhr ihren Balkon erreichen würde.
Die Herren hinter der Glasscheibe der Eingangshalle hatten ihr versprochen, sich ab morgen nach einem anderen Zimmer für sie umzusehen.
Zum Abendessen zog sie sich das lange dunkelgrüne Samtkleid an. Es sah teuer aus. Tatsächlich hatte sie es in einer Boutique am Kurfürstendamm für zweihundertfünfzig Mark im Schaufenster gesehen. Gekauft hatte sie es aber bei C&A, leicht beschädigt, für zwanzig Mark. Aufmerksam betrachtete sie sich im Spiegel. Das Kleid fiel glatt und weich bis zum Boden, so war kaum zu merken, dass ihre Beine etwas zu kurz waren. Die Figur erschien ihr annehmbar. Durch die Krankheit war sie schlanker geworden. Sie hatte wieder, wie als Mädchen, einen fühlbaren Hüftknochen, der sich unter dem Samt abzeichnete. Den brauch ich zum Festhalten, hatte damals Kathinkas Vater gesagt. Während sie Lidschatten auftrug, beobachtete sie die Falte zwischen ihren Augen. Sie war tiefer, als Katharina erwartet hatte. Der Pagenschnitt der sehr dunklen Haare gefiel ihr. Das Gesicht war ihr zu blass. Die Heimkinder hatten sie »Augi« genannt. Keine Seminaristin hatte so große Augen gehabt. Jetzt fand sie ihre Augen normal.
Bevor sie den Speisesaal betrat, hörte sie Stimmengewirr und Geschirrklirren. Rund fünfzig Leute aßen bereits. Die nahe am Eingang Sitzenden schauten auf, einige der Frauen sofort abschätzend, als fragten sie sich, ob Katharina sich einen ihrer verfetteten sechzigjährigen Ehemänner greifen wollte. Im Hintergrund entdeckte sie das Düsseldorfer Ehepaar. Die beiden winkten ihr fröhlich zu, boten ihr den freien Stuhl am Tisch an, und Katharina setzte sich zu ihnen.
Sie war beeindruckt vom Anblick der bloßen roten Oberarme der Frau. Auch das Gesicht der Frau war rot, gedunsen, ölglänzend. Der Mann sah genauso aus. Beide erzählten zufrieden und im rheinischen Singsang von ihren Erfahrungen. Sie fühlten sich wohl. Katharina stellte sich vor, wie sie den ganzen Tag über unten am Swimmingpool oder am Meer Speckwamme und Bierbauch sorgfältig hin und her gewendet hatten, damit kein Stück Wellfleisch ungerötet bliebe. Aber während sie das dachte, fand sie sich überheblich. Diese beiden genossen bloß ihren Urlaub, sie waren zwar derb, aber friedfertig. Gewöhnlich lernte Katharina solche durch und durch normalen Menschen erst kennen, wenn sie sich in einem unnormalen Zustand befanden: als gewaltsam Getötete oder als plötzlich totschlagende Kurzschlusstäter.
Sie hörte also zu und lächelte verbindlich.
»Enee«, sagte die Frau, »dat die aber auch grade den Dingens, den Lorenz entführt haben.«
»Dat Billa versteht dat nit«, erklärte der Mann Katharina. »Natürlich is dat ’ne sehr jute Einfall von dem CDU-Wahlbüro.« Und er legte seine rote Hand auf den dicken roten Unterarm seiner Frau und lachte dröhnend. Katharina hätte vor Schmerz geschrien, wenn sich auf ihren sonnenverbrannten Unterarm eine schwere Hand gelegt hätte. Aber die Frau schrie nicht. Sie knuffte ihren Mann und lachte mit.
Erst jetzt bemerkte Katharina, dass der schüchterne junge Kellner schräg hinter ihr stand. Er versuchte ihr mitzuteilen, dass sie am Telefon erwartet wurde. Sie sprang auf, warf ein Glas um, entschuldigte sich.
Einige Gäste sahen hinter ihr her, als sie den Speisesaal verließ. Es war nicht üblich, hier angerufen zu werden.
In der engen, stickigen Kabine neben der Rezeption bekam sie kaum Luft. Sie ließ die Tür geöffnet und wartete ungeduldig, bis zu ihr durchgestellt wurde.
Es war Robert. Seine Stimme nah und voller Wärme. Sofort sah sie ihn vor sich, wie er am Schreibtisch saß, die Ellbogen auf seine Papiere gestützt, in schmuddeligen Cordhosen und rostrotem Pullover. Er zog nie was anderes an. Wenn sie sagte: du brauchst aber wirklich einen Anzug, dann ging er widerstrebend einkaufen und kam mit neuen braunen Cordhosen und einem neuen rostroten Pullover zurück. Natürlich hatte er kein Telegramm bekommen, und er machte sich Sorgen.
»Kein Grund zum Sorgenmachen«, sagte sie.
»Wirklich nicht?« Er kannte ihre Stimme. »Kreislauf?«
»Ein bisschen.«
»Hat dein Zimmer Sonne?«
»Ein bisschen.«
»Mami?« Jetzt war Kathinka am Apparat. »Betrügst du uns auch nicht, da im Ferienparadies?«
»Ich schaff’s nicht. Die fetten Weiber hier passen zu sehr auf ihre fetten Männer auf.« Katharina fühlte sich nicht in der Lage, besonders geistreich zu antworten. »Und was gibt’s bei euch?«
»Bei uns? Och, eigentlich nichts Besonderes.«
»Nichts was?«
»Besonderes.«
Pause, Knacken.
»Mama«, sagte Kathinka, »du willst ja bloß was über den Lorenz hören.«
»Der Lorenz interessiert mich nicht. Ich will was über die junge Frau in der Wannseevilla hören.«
»Worüber?«
»Was mit der Leiche ist.« Krachen in der Leitung. »Hallo?«
»Mami?«
»Mit der Leiche von dem Mädchen. Da muss doch schon was in der Zeitung stehn.«
»Nun lass doch die Puppe in dem Wannseeschuppen. Mach man lieber Urlaub.«
»Gib mir Robert.«
»Der wird dir dasselbe sagen.«
»Meine Schöne«, sagte Robert, »wirklich, lass mal den Berliner Kram hinter dir.«
»Ich bin aber neugierig.«
Robert seufzte. »Im Abend steht, die junge Frau, die ihr da im Keller gefunden habt –«
Pfeifen. Knacken. »Ja?«, sagte Katharina. »Ja?«
»Sie ist nicht gestorben, weil sie einen Schlag auf den Kopf erhalten hat. Sie war schon ein paar Stunden vorher tot. Hörst du mich?«
»Sehr gut.«
»Sie ist an einer unsachgemäß vorgenommenen Abtreibung gestorben.«
Die Pigmentstörungen im Gesicht dieses Mädchens. Sie hatten auf die Schwangerschaft hingewiesen.
»Identifiziert?« Katharina fragte, als sei sie gerade dienstlich informiert worden. Robert lachte sein albernes, glucksendes Huhnim-Sand-Lachen. »Nein, Oberkommissarin.«
»Und die Handgranate? Ist die …«
Kathinka meldete sich. »Sag mal, Oberkommissarin, glaubst du, eines deiner fetten Weiber würde an einer unsachgemäß vorgenommenen Abtreibung sterben?«
»Unwahrscheinlich.«
»Da siehst du’s mal wieder. Nein, lass mich.«
Das galt Robert. »Dein Robert will mir dauernd das Telefon aus der Hand reißen.«
»Du reißt es ihm ja auch dauernd aus der Hand.«
»Das ist was anderes. Ich wollte dir noch sagen, deine Bullen verhören doch jetzt pausenlos die Hausbesetzer. Wie sie die Leiche da reingeschafft haben. Aber ich sag dir, die haben da keine Leiche reingeschafft. Und auch keiner Leiche einen Balken oder so was über den Schädel gehaun. Ich kenn die.«
»Wen?«
»Die Typen, die den Kasten besetzt haben. Die haben mit der Leiche nichts zu tun.«
»Woher kennst du die?«
»Och, nur so. Durch Jungs von der Schule. Wirklich, von denen steht keiner auf Leichen.«
»Stehn deine Typen vielleicht auf Handgranaten?«
Kichern am anderen Ende.
»Mama, willst du den Fall aus fünftausend Kilometer Entfernung lösen? Überlass das man deinem Gerfried. Werd lieber gesund.«
»Dem schließe ich mich an«, sagte Robert.
»Was machen deine Deutschaufsätze, Schulmeister?«, fragte sie schnell. Sie wollte nicht, dass das Gespräch schon aufhörte. Robert bekam häufig Ärger wegen der unüblichen Themen für die Deutschaufsätze der oberen Klassen. Aber er brachte es immer fertig, seine Pläne nicht nur durchzusetzen, sondern hinterher auch noch dafür gelobt zu werden: entweder verbündete er sich mit Schülern und Elternbeirat gegen die peinlich berührte Schulleitung oder mit Schülern und Schulleitung gegen die besorgten Eltern. Diese Taktik hatte er bei der Gewerkschaftsarbeit gelernt. In letzter Zeit allerdings waren seine Mehrheiten mühsamer herzustellen gewesen.
»Na ja«, sagte Robert. »Ein Thomas-Mann-Thema natürlich, eins über Schillers Geschichte des Dreißigjährigen Krieges, eins über Gefangene.«
»Gefangene?«
»Ich weiß noch nicht genau. Was ist und zu welchem Ende betreibt man Strafvollzug? So etwa. Wir diskutieren das gerade. Glaubst du, wir können Doris Wingert bitten, zu dem Thema zu referieren?«
Katharinas Assistentin hatte früher an verschiedenen Vollzugsanstalten gearbeitet. Sie war beliebt gewesen bei Kollegen und sogar bei Inhaftierten. Aber sie hatte es nicht ausgehalten, nur mit Gefangenen und anderen Bewachern Umgang zu haben. Deshalb hatte sie sich zur Kripo gemeldet. »Weil«, wie Manfred Zobel, Katharinas jüngster Assistent, mit seinem breiten Western-Held-Grinsen gelegentlich erläutert hatte, »jemand, den man verhaftet, ja noch kein Gefangener ist, sondern fast noch frei, und jemand, der einen eben noch Freien am Weglaufen hindert, ist auch fast noch kein Bewacher.« Immer zuverlässig, meistens freundlich, manchmal etwas spitz, etwas altjüngferlich, munter und verwelkt zugleich ging sie ihrem Dienst nach. Ihre dichten blonden Haare wurden erstaunlicherweise von Jahr zu Jahr prächtiger.
»Frag sie doch«, sagte Katharina. »Sie kommt sicher. Wenn sie Zeit hat«, setzte sie hinzu.
»Schreibst du mal?«
»Mir auch«, rief Kathinka dazwischen.
»Aber ja«, sagte Katharina glücklich. »Natürlich schreibe ich euch.«
»Also tschau, Mami. Bleib sauber.«
»Also mach’s gut, meine Schöne. Erhol dich.«
Als sie schwitzend die Kabine verließ, bemerkte sie, wie der Geschäftsführer aus der Rezeption sie nachdenklich betrachtete. Was hat er gehört? dachte sie. Hat er was von Leiche und Handgranate mitgekriegt? Sie nahm sich vor, künftig aufzupassen. Sie wollte nicht, dass man hier ihren Beruf erfuhr. Sie hatte Heimerzieherin angegeben. Das war sie ja vor zehn Jahren auch noch gewesen.
Im Salon standen und saßen Gäste vor dem Fernsehapparat. Bilder von Berlin wurden gezeigt, ein verlassener Mercedes, ein Foto des entführten Oppositionspolitikers, der Bürgermeister. Katharina verstand nicht, was der spanische Kommentator sagte.
In ihrem Zimmer legte sie sich aufs Bett, sah zu, wie der Abendwind die Vorhänge vor der offenen Balkontür blähte, hörte von draußen die Bewässerungsgeräusche.
Sie trank den Rest Wein aus der Flasche, die neben dem Bett stand, und fragte sich, in wessen Interesse es liegen konnte, dass diese tote junge Frau in diesem Keller der Wannseevilla gefunden wurde. Und ob diejenigen, die sie dort hingebracht und unter die Fahnenstange gelegt hatten, wussten oder nicht wussten, dass in ihrer Handtasche eine Handgranate war. Sie fragte sich, wofür eine Frau, die zu einer Abtreibung geht, eine Handgranate braucht.