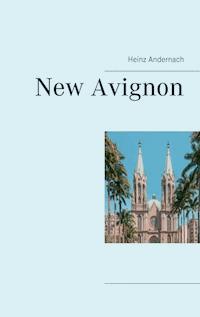Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Diese kleine Ich-Erzählung, im Jahre 2036 spielend, handelt von einem alten, fast dementen Schriftsteller, der, statt sich mit einer Pistole umzubringen, einen Haus- und Pflegeroboter erwirbt und damit seinem Leben neue Hoffnung gibt. Er will sogar mithilfe des Roboters seinen letzten Roman schreiben. Eine Tragikomödie um Demenz, Freundschaft und künstliche Intelligenz. Eine rührende Geschichte um komische Alltagssituationen, dem SEK, eine Geschichte mit einem schließlich überraschenden, märchenhaften Ende.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 101
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Teil I
Teil II
Teil III
Teil I
Ich habe mich dann doch nicht erschossen, sondern einen Hasegawa 23C bestellt. Nicht ganz billig mit 59000 Euro, aber der Hasegawa 23C stellt in der gehobenen Mittelklasse der Haus- und Pflegeroboter eine gewisse Größe dar. Ich habe viele Testberichte studiert und gab schließlich dem Hasegawa den Vorzug, obwohl er gut zehntausend Euro teurer ist als der Yamashita.
Die Beretta liegt mehr oder weniger ungenutzt in der Schublade. Das Magazin enthält noch einen Schuss, die anderen habe ich probeweise abgegeben, um ein Gefühl für das Ding zu kriegen, aber wenn sie zum Einsatz gekommen wäre, hätte ich das Gefühl nicht wirklich mehr gebraucht. Obgleich, es ist nicht trivial, zum richtigen Abschluss zu kommen.
Ich habe über geeignete Techniken recherchiert und die Schilderung gewisser Unfälle war dann eher abschreckend. In eine Filiale von Dignitas zu gehen, um sich dort umbringen zu lassen, mochte ich auch nicht.
Dieser multinationale Konzern sollte an meinem Tod nicht verdienen. Bin ich feige?
Gewissermaßen ja, allerdings gehört auch Mut dazu, sich seinen unheilbaren Krankheiten zu stellen, aber die nicht unmittelbare Zukunft ist fern und es bleibt eine Restnaivität, um die unaufhaltsame Katastrophe zu verdrängen.
Dabei habe ich alles hautnah miterlebt, bei den Eltern. Beide Elternteile wurden im vergleichsweise hohen Alter durch degenerative Nervenkrankheiten zerstört. Vater durch Parkinson, verknüpft mit einer starken Senilität und Mutter durch Alzheimer, aber genau diagnostiziert worden ist das damals nicht. Alles liegt nun mehr als zwanzig Jahre zurück und die Erinnerungen verblassen.
Ich habe sie gepflegt, beziehungsweise die Pflege organisiert, war ständig bei den Eltern.
Bei mir fing es früher an, zuerst Parkinson und kurz vor meinem 80. Geburtstag kam dann die Diagnose Alzheimer hinzu. In meinem Alter waren meine Eltern noch sehr rüstig, fit, wie man sagt, aber bei all dem Alkohol, den Zigaretten und den Psychopharmaka, die ich zu mir genommen habe, ist es kein Wunder, dass die Degeneration früher eintritt.
Die Mittelchen gegen diese Krankheiten sind besser geworden, bleiben aber auch im Jahr 2036 Mittelchen, die den Ablauf der Krankheiten etwas verlangsamen.
Mit der neuen Diagnose erinnerte ich mich wieder stärker an Mutter, an ihre wunderlichen Spleens, die sie entwickelte. Ich war ihr zwei Jahre älterer Bruder, und wenn ich meinen Ausweis vorlegte, als Beweis, dass sie 32 Jahre älter war als ich, sagte sie, der sei gefälscht.
Das Geschäft, indem sie als Mädchen während der Naziherrschaft eine Ausbildung gemacht hatte, spielte eine sehr große Rolle und die polnischen Pflegekräfte, die ich für meine Eltern organisiert hatte, waren schließlich Mitarbeiterinnen dieses Ladens. Gleichwohl hatte sie ihre klaren Momente und ich versuchte mich darin, mich mit ihr zu unterhalten, intensiver dann in einer Zeit, als mein Vater schon tot war.
Abhängig von der Sache hielt ihr Gedächtnis nur wenige Sekunden bis mehrere Tage vor. Ich wunderte mich darüber, dass ihr wirres Reden immer die gleichen Motive aufwies. Immer wieder wollte sie nach Hause fahren, in das Reich ihrer Kindheit und meine Überzeugungsarbeit, dass ihre Eltern, alle Verwandten, tot seien, gelang manchmal, aber nicht immer.
Meine Mutter schien meine Alltagssorgen zu begreifen, ihr gelang es spielend für fast jeden Buchstaben einen weiblichen oder männlichen Vornamen aufzusagen, aber irgendetwas an ihrer Realität stimmte nicht mehr. Obwohl sie ja zu Hause war, erkannte sie das nicht, erfragte jedes Mal den Weg zur Toilette, und obwohl sie ihren Aufenthalt nicht als zu Hause erkannte, kannte sie jedes Detail in ihrer Wohnung, ob Möbel oder das große Gemälde im Wohnzimmer.
Sie erfand Geschichten, wie die Dinge hierher gekommen waren oder sagte „Solche Bilder gibt es viele“ oder „So einen Schrank haben wir auch zu Hause“ und wenn ich sie nach der Straße fragte, wo sie wohne und anschließend sagte, dieses Haus stände in dieser Straße, sagte sie, dass es von diesen Straßen mit diesem Namen viele gäbe, was definitiv nicht stimmte.
Bei meiner Mutter verlief die Krankheit langsam, im Gegensatz zu meiner Tante, die innerhalb eines Jahres zu einem Nichts wurde, jedenfalls von Außen gesehen und in diesem „Nicht-Sein-Zustand noch dreizehn Jahren vor sich hin dämmerte.
Kurz nach meiner Diagnose habe ich den Kontakt zu meinem früheren Arbeitskollegen Andreas aufgenommen, der immer schon Waffennarr war, der immer der Überzeugung war, dass die Waffen nicht das Problem seien, der das Gewaltmonopol des Staats in Gefahr sah, aber sich selbst hoch aufrüstete, in dem naiven Glauben, dass wenn die Guten, die Anständigen sich bewaffnen, dem Bösen, dem Verbrechen Einhalt geboten würde.
Andreas konnte sich denken, wozu seine Beretta, die er für einen Freundschaftspreis hergab, gut sein würde. Im Prinzip waren seine Waffen alle registriert, bis auf ganz wenige wie diese Beretta, aber was ihn letztendlich zu dieser Straftat bewog, weiß ich nicht. Jedenfalls hat er die Waffe vorher gründlich gereinigt, um keine Spuren zu hinterlassen.
Mir konnte es egal sein, eine Straftat zu begehen, es wäre eh die Letzte. Das Ding jagte mir aber dann Angst ein, nachdem ich mehrfach mit ihm Bekanntschaft geschlossen hatte. Schwer lag die Waffe in der Hand, ich führte sie an die Schläfe, steckte sie in den Mund. Der Rückstoß war nicht unerheblich.
Lieber Andreas, vielleicht steige ich in mein vollautomatisches Elektromobil und fahre nochmals in die Eifel und gebe dir das Ding zurück, aber mal abwarten, was Hasegawa dazu sagt. Vielleicht verdanke ich seinem angedeuteten Lächeln mein Leben, mein kleines bescheidenes Leben, das noch vor mir liegt.
Das Leben besteht immer aus dem Pool der Erinnerungen, die meinem Hier und Jetzt zur Verfügung stehen, dem Hier und Jetzt und dem zukünftigen, dem Potenziellen, das, was noch kommen kann.
Die Krankheit wird die Zukunft zerstören, aber ebenso die Vergangenheit und schließlich wird mein Hier und Jetzt gnadenlos isoliert – keine Vergangenheit, keine Zukunft – und erbärmlich hilflos sein.
Hast du Alzheimer, wirst du gemieden, Bekannte interessieren sich nicht mehr für dich; ich hab das an meiner Mutter gesehen.
Der Hasegawa kann etwas lächeln und ich bin noch gespannt, was er sonst noch kann. Ich habe schon früh die Entwicklung der Robotik verfolgt, vielleicht, weil ich an eine Möglichkeit von Pflege gedacht hatte, aber auch, weil ich im Laufe meines Lebens immer einsamer wurde. Vielleicht steckt ein kleiner Japaner in mir, der auch tote Dinge beseelt sieht.
Ich hatte dann nach meinem Entschluss weiterzuleben, beschlossen, zusammen mit einem Hasegawa, Tagebuch zu schreiben. Dabei lege ich weniger Wert auf Gedanken und Philosophien, sondern auf die kleinen Details, die ich erlebe, um später mein Erinnerungsvermögen zu überprüfen.
Aber ich erlebe wenig, vielleicht die herausragenden Nachrichten, denn ich habe immer noch nicht aufgehört, Nachrichten zu sehen, obwohl sie nie erbaulich waren und die Realität der Welt nur wenig mit meiner zu tun hat; mich betreffende Gesetzesänderungen werde ich schon bemerken. Ich wollte aber nicht nur Tagebuch schreiben, sondern auch meinen letzten Roman.
Der Hasegawa hatte eine Lieferzeit von sechs Wochen; die Nachfrage ist doch recht groß. Beim Kauf muss man sich etwas Zeit nehmen, denn man hat viele Möglichkeiten einen Hasegawa zu konfigurieren.
Insbesondere das Äußere sollte ja ansprechend sein. Das Aussehen des Hasegawa ist später nur schlecht veränderbar. Grundsätzlich kann man die Maschinenvariante, die Menschenvariante oder die Fantasyfigur wählen, wobei sich die Proportionen beeinflussen lassen. Sie erinnern bei der von mir gewählten, menschlichen Variante entfernt an einen Sumoringer.
Der menschliche Hasegawa kennt natürlich zwei Geschlechter, und da die Figur eines Hasegawas nicht unbedingt meinem Schönheitsideal entspricht, habe ich einen männlichen Hasegawa konfiguriert. Ich habe einen eurasischen Gesichtstypus gewählt, die Hautfarbe ist eher weiß, denn ich wollte jede mögliche Interpretation von Rassismus verhindern.
Mein Hasegawa ist mein Diener, im Grunde mein Sklave, denn er wird mir gehören. Auf keinen Fall soll es ein schwarzer Hasegawa sein.
Zeiten des Rassismus sind in unserer Gesellschaft längst nicht passe, prekäre Jobs werden immer noch besonders häufig mit Farbigen besetzt.
Es gibt noch die südländischen Reinigungskräfte, Bedienungen, Zusteller; nicht alle wurden von Roboter ersetzt. Der untere Rand der Dienstleistungsgesellschaft ist das Los vieler Migranten und inwieweit dies auf das kollektive Unbewusste dieser Gesellschaft wirkt, ist mir nicht klar.
Selbst das scheinbare Alter eines Hasegawas kann man konfigurieren. Mein Hasegawa sieht etwa nach 60 aus. Zuerst wollte ich wie die meisten einen jüngeren Gesichtstypus kreieren, aber dann gefiel mir die Idee eines älteren Hasegawas besser. Ganz so alt sollte er nicht sein, damit ich nicht zu sehr an mein eigenes fortgeschrittenes Alter erinnert werde. Aber es sollte ein sehr erwachsener, reifer Roboter sein.
Ich selbst war ja gefühlt mein ganzes Leben lang ein Kindskopf, wenn gleich ich mit spätestens sechzig eine Respektsperson gewesen sein muss: jedenfalls das sichtbare Alter, meine Körpergröße und Übergewicht suggerierten mir das, diese Möglichkeit der Wahrnehmung durch die Anderen.
Ich war also mit fünfzig, sechzig Respektsperson, gleichsam wird man von den wesentlich Jüngeren nicht mehr ernst genommen, weil man längst zum alten Eisen gehört und den Zenit der eigenen Leistungsfähigkeit längst überschritten hat.
Ich kratze hier nur an der Oberfläche des Problems, vereinfache.
Manchmal war es für mich ein Trost, dass Schriftsteller bis ins hohe Alter produktiv sein können, während man bei den Schachspielern oder zum Beispiel Physikern davon ausgehen kann, dass sie ihre größten Leistungen vor ihrem dreißigsten, spätestens vierzigsten Lebensjahr vollbracht haben.
Ich war Schriftsteller, aber kein besonders guter; jedenfalls war ich nie in irgendeiner Weise erfolgreich und konnte zeitlebens nicht annähernd von den Tantiemen meinen Lebensunterhalt bestreiten.
Ich habe es nicht aufgegeben zu schreiben und gewissermaßen suche ich einen Neuanfang, denn nachdem in den letzten Jahrzehnten meine Geschichten von Jahr zu Jahr düsterer wurden, träume ich jetzt von einem optimistischen Roman, der an einem Ort fernab all der Probleme spielen soll, nicht unbedingt in einem fiktiven Schlaraffenland, aber losgelöst von den individuellen und kollektiven Dramen, mit dem immanenten Wahnsinn, die unsere Welt als Nebenwirkung mitliefert. Aber ich wollte nicht ablenken. Der Hasegawa ist um die sechzig. Sein Outfit sollte nicht nachlässig wirken, so wie das bei mir oft war, sodass ich vielleicht auch mit 60 oft nicht wie eine Respektsperson wirkte.
Die Rolle einer Respektsperson war mir dann spätestens angenehm, als die Leute begannen, häufiger zu grüßen.
Die Rolle des Freaks hatte mir nie gelegen; schließlich kam ich mir vor wie ein enfant terrible, reifere Züge machten mein einsames Leben erträglicher und das entfant terrible oder der Freak tauchten nur in meinen Büchern auf.
Wenn man älter wird, verliert man oft an Radikalität, weil man resigniert hat, beziehungsweise zur Einsicht gekommen ist, dass man keine Lösungen hat, die Gesellschaft zu revolutionieren. Schlimmer noch, wäre ich ein Politiker mit großem Einfluss, würde ich kläglich versagen.
In meiner Jugend hatte ich fast anarchistische Ideale: Die Produktionsmittel sollten allen gehören, alles unter dem Motto des naiven „Keine Macht für Niemand“. Ich weiß heute nicht, ob, wenn fast alle Mitglieder der Gesellschaft diese Ideen gut finden würden und bereit wären, unter solch märchenhaften Verhältnissen zu leben, ob diese Gesellschaft überlebensfähig wäre oder ökonomisch grandios scheitern würde.
Kommunismus, selbst naiver Urkommunismus war schon damals für mich mit Begriffen wie Staatsdiktatur, Totalitarismus und Stalinismus besetzt, die wenigen Monate der Kommunen im katalanischen Spanien während des Bürgerkrieges machten Mut, aber „Keine Macht für Niemand“, was für eine naive Utopie, auch die katalanischen Revolutionäre wurden geführt von Leuten wie Durruti.
Später habe ich nicht das gewählt, womit ich mich identifizieren konnte, sondern, was mir als gesellschaftlich möglich erschien und ein bisschen in die Richtung meiner Ideale ging. Ich habe der Revolution keine Chance gegeben und sie nie unterstützt. Aber welche Reförmchen schließlich die Richtigen sind, wusste ich auch nicht.
So gesehen bin ich ein völlig unpolitischer Mensch geworden, der keine Antworten kennt. Ein bisschen Umweltschutz ist vielleicht gut, zu viel könnte schaden, die Wirtschaft ruinieren und zur Unruhe führen. Eine Umverteilung von oben nach unten, eine gerechte Steuer, könnte die Wirtschaft lähmen und zu Unruhen führen. Auch in späten Jahren habe ich nichts mehr gefürchtet als Faschismus, auch den Netz-Faschismus, egal, ob von links oder rechts kommend. Stalinismus ist eine perfide Art von Faschismus.
Wenn ich in prekären Armutsverhältnissen gelebt hätte, irgendwo in Afrika, Asien oder auf dem Balkan, hätte ich dies vielleicht anders gesehen, aber ich war immer Bürger der relativ wohlhabenden Bundesrepublik Deutschland, immer ein Bürger ohne wirkliche Geldnöte.