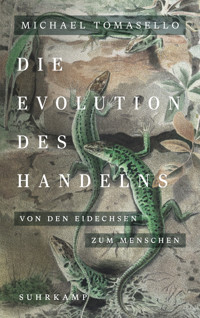19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Spätestens seit Darwin steht die Frage im Raum, was den Menschen von anderen Tieren unterscheidet. Michael Tomasello präsentiert eine faszinierende Antwort: Es ist das auf Kooperation ausgerichtete soziale Verhalten, das den Sonderweg des Menschen in der Evolution ebnete. In seinem Buch zeichnet er nach, wie veränderte Umweltbedingungen die frühen Menschen zwangen, die Welt aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten, ihr Verhalten stärker aufeinander abzustimmen und ihr Denken und Handeln im Lichte der normativen Standards der Gruppe zu prüfen. Wie aus kollaborativer Interaktion und Kommunikation völlig neue und einzigartige Formen des Denkens und dann auch Sprache und Kultur entstanden, zeigt dieses Buch.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 362
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Werkzeuggebrauch oder Kultur? Sprache oder Religion? – Spätestens seit Darwin steht die Frage im Raum, was den Menschen von anderen Tieren unterscheidet. In seinem neuen Buch, Quintessenz seiner langjährigen Forschung, präsentiert Michael Tomasello eine faszinierende Antwort: Es ist das auf Kooperation ausgerichtete soziale Verhalten, das den Sonderweg des Menschen in der Evolution ebnete – die Tatsache, daß unsere Vorfahren irgendwann einmal damit begonnen haben, ihre Köpfe zusammenzustecken, Ziele gemeinsam auszuhecken und zu verfolgen.
Aber warum haben sie überhaupt damit begonnen? Tomasello zeichnet nach, wie die frühen Menschen aufgrund veränderter Umweltbedingungen dazu genötigt waren, die Welt nicht mehr nur aus ihren individuellen, sondern aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Um zu überleben, mußten sie ihr Verhalten stärker aufeinander abstimmen, lernen, komplexe Schlußfolgerungen zu ziehen und ihr Denken und Handeln im Lichte der normativen Standards der Gruppe zu prüfen. Wie aus diesen neuen Formen kollaborativer Interaktion und Kommunikation, dieser erzwungenen Hinwendung zu einer kooperativen Lebensform, völlig neue und einzigartige Formen des Denkens entstanden – und dann auch Sprache und Kultur –, zeigt dieses Buch.
Michael Tomasello, geboren 1950, ist Co-Direktor am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig und leitet dort das Wolfgang-Köhler-Primaten-Forschungszentrum. Für seine Forschungen wurde er mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Jean-Nicod-Preis, dem Hegel-Preis der Stadt Stuttgart und dem Max-Planck-Forschungspreis.
Im Suhrkamp Verlag sind erschienen:
Die kulturelle Entwicklung des menschlichen Denkens. Zur Evolution der Kognition (stw 1827), Die Ursprünge der menschlichen Kommunikation (2009 und stw 2004) sowie Warum wir kooperieren (eu 36).
MICHAEL TOMASELLO
EINE NATURGESCHICHTE DES MENSCHLICHEN DENKENS
Aus dem Amerikanischen von Jürgen Schröder
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2014
Der vorliegende Text folgt der Erstausgabe, 2014.
Titel der Originalausgabe:
A Natural History of Human Thinking
Die Originalausgabe in englischer Sprache, die dieser Übersetzung zugrunde liegt, erschien erstmals 2014 bei Harvard University Press
Copyright © 2014 by Michael Tomasello
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation
in der Deutschen Nationalbibliografie;
detaillierte bibliografische Daten sind im Internet
über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© der deutschen Ausgabe Suhrkamp Verlag Berlin 2014
© 2014 by Michael Tomasello
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr.
Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
Zur Gewährleistung der Zitierbarkeit zeigen die grau hinterlegten Ziffern die jeweiligen Seitenanfänge der Printausgabe an.
Für Rita, Anya, Leo und
Inhalt
Vorwort 9
1 Die Hypothese geteilter Intentionalität 13
2 Individuelle Intentionalität 21
Die Evolution der Kognition 22
Denken wie ein Menschenaffe 32
Kognition im Dienste der Konkurrenz 47
3 Gemeinsame Intentionalität 55
Eine neue Form der Zusammenarbeit 57
Eine neue Form kooperativer Kommunikation 79
Zweitpersonales Denken 107
Perspektivität: Der Blick von hier und dort 118
4 Kollektive Intentionalität 123
Die Entstehung der Kultur 125
Die Entstehung konventioneller Kommunikation 141
Akteursneutrales Denken 169
Objektivität: Der Blick von nirgendwo 179
5 Menschliches Denken als Kooperation 185
Theorien der kognitiven Evolution des Menschen 186
Sozialität und Denken 198
Die Rolle der Ontogenese 212
6 Schluß 219
Anmerkungen 227
Literatur 231
Register 245
Vorwort
Dieses Buch ist eine Fortsetzung von – oder besser ein Prequel zu – Die kulturelle Entwicklung des menschlichen Denkens, das 2002 in deutscher Übersetzung erschien. Es hat aber auch einen etwas anderen Fokus. In jenem Buch lautete die Frage, was die menschliche Kognition so einzigartig macht, und die Antwort war: Kultur. Individuelle menschliche Wesen entwickeln einzigartig leistungsfähige kognitive Kompetenzen, weil sie inmitten aller möglichen Arten kultureller Artefakte und Praktiken, einschließlich einer konventionellen Sprache, heranreifen, und natürlich besitzen sie die kulturellen Lernkompetenzen, die zu ihrer Beherrschung notwendig sind. Menschen internalisieren die Artefakte und Praktiken, denen sie begegnen, und diese dienen dann zur Vermittlung all ihrer kognitiven Interaktionen mit der Welt.
Im vorliegenden Buch geht es um eine ähnliche Frage: Was macht das menschliche Denken einzigartig? Und die Antwort ist ebenfalls ähnlich: Das menschliche Denken ist grundsätzlich kooperativ. Aber diese etwas andere Frage und die etwas andere Antwort führen zu einem ganz anderen Buch. Das Buch von 2002 war unkompliziert und einfach, weil die Daten, die wir aus dem Vergleich von Menschenaffen mit Menschen hatten, so spärlich waren. Daher konnten wir solche Dinge sagen wie »Nur Menschen verstehen andere als intentionale Akteure, und das ermöglicht die menschliche Kultur«. Aber wir wissen jetzt, daß das Bild komplexer ist. Menschenaffen scheinen viel mehr über andere als intentionale Akteure zu wissen, als man zuvor glaubte, und dennoch haben sie keine menschenähnliche Kultur oder Kognition. Gestützt auf umfangreiche Forschungen, über die hier berichtet wird, scheint der entscheidende Unterschied nun zu sein, daß Menschen andere nicht nur als intentionale Akteure verstehen, sondern ihre Köpfe auch mit anderen in Akten geteilter Intentionalität zusammenstecken, zu denen alles von konkreten Akten gemeinschaftlichen Problemlösens bis zu komplexen kulturellen Institutionen gehört. Der Fokus liegt jetzt also weniger 10auf der Kultur als einem Prozeß der Weitergabe, sondern mehr auf der Kultur als einem Prozeß sozialer Koordination – und tatsächlich argumentieren wir hier dafür, daß moderne menschliche Kulturen durch einen früheren Evolutionsschritt ermöglicht wurden, bei dem Menschen ihr Auskommen fanden, indem sie sich mit anderen in relativ einfachen Akten gemeinschaftlicher Nahrungssuche koordinierten.
Die spezifische Fokussierung auf das Denken bedeutet, daß dieses Buch nicht einfach nur dokumentiert, daß Menschen auf eine solche Weise an geteilter Intentionalität teilhaben, wie es ihre nächsten Primatenverwandten nicht tun. Das wurde an anderer Stelle geleistet. Vielmehr untersucht es darüber hinaus die zugrundeliegenden Denkprozesse, die daran beteiligt sind. Um die Eigenart dieser Denkprozesse zu beschreiben – insbesondere um menschliches Denken vom Denken anderer Menschenaffen zu unterscheiden –, müssen wir seine Komponentenprozesse der kognitiven Repräsentation, des Schlußfolgerns und der Selbstbeobachtung charakterisieren. Die Hypothese geteilter Intentionalität behauptet, daß alle drei dieser Komponenten im Laufe der Evolution des Menschen in zwei entscheidenden Schritten umgewandelt wurden. In beiden Fällen war die Umwandlung Teil einer größeren Veränderung sozialer Interaktion und Organisation, bei der die Menschen gezwungen waren, kooperativere Lebensweisen anzunehmen. Um zu überleben und zu gedeihen, waren die Menschen zweimal gezwungen, neue Möglichkeiten zu finden, um ihr Verhalten mit anderen bei gemeinschaftlichen (und danach kulturellen) Aktivitäten zu koordinieren und ihre intentionalen Zustände mit anderen bei der kooperativen (und danach konventionellen) Kommunikation zu koordinieren. Und so wurde das menschliche Denken zweimal transformiert.
Die Niederschrift dieses Buches, wie auch der meisten anderen, wurde durch die Unterstützung vieler Institutionen und Personen ermöglicht. Ich möchte dem Center for Philosophy of Science der University of Pittsburgh (und insbesondere John Norton, dem hervorragenden Direktor und Seminarleiter) dafür danken, mich im Frühling 2012 für ein friedvolles Semester konzentrierten Schreibens beherbergt zu haben. Besonders profitierte ich während dieses Aufenthalts von Bob Brandom, der mir viel Zeit widmete und seine Gedanken zu 11vielen für das vorliegende Unternehmen zentralen Themen großzügig mit mir teilte. Ich danke ebenso Celia Brownell von der Abteilung für Psychologie der University of Pittsburgh und Andy Norman von der Carnegie-Mellon-Universität für viele nützliche Gespräche während dieses Semesters. Im darauffolgenden Sommer profitierte ich überaus von der Präsentation der Themen des Buches beim SIAS Summer Institute mit dem Titel The Second Person: Comparative Perspectives, das in Berlin von Jim Conant und Sebastian Rödl veranstaltet wurde. Das Buch ist aufgrund all dieser Begegnungen besser geworden.
Im Hinblick auf das Manuskript selbst möchte ich Larry Barsalou, Mattia Galotti, Henrike Moll und Marco Schmidt für das Lesen verschiedener Kapitel und ihre sehr hilfreichen Rückmeldungen danken. Von besonderer Bedeutung war, daß Richard Moore und Hannes Rakoczy jeweils das gesamte Manuskript in einem recht frühen Stadium lasen und eine Reihe wichtiger Kommentare und Vorschläge sowohl im Hinblick auf den Inhalt als auch auf die Darstellung lieferten. Dank geht auch an Elizabeth Knoll und drei anonyme Gutachter bei Harvard University Press für eine Reihe hilfreicher Kommentare und Kritiken an der vorletzten Fassung.
Zum Schluß und vor allem danke ich meiner Frau Rita Svetlova dafür, daß sie die ganze Zeit hindurch beständig detaillierte kritische Kommentare und Vorschläge beigesteuert hat. Viele Ideen wurden durch Gespräche mit ihr deutlicher, und verwirrende Passagen wurden durch ihr literarisch gebildetes Auge klar oder zumindest klarer.13
1DIE HYPOTHESE GETEILTER INTENTIONALITÄT
Allein die Kooperation stellt einen Prozeß dar, der Vernunft hervorbringen kann.JEAN PIAGET, Études sociologiques
Denken erscheint gewöhnlich als eine völlig einsame Aktivität. Und so ist es auch bei anderen Tierarten. Aber bei Menschen ist das Denken einem Jazzmusiker vergleichbar, der einen neuen Riff in der Abgeschiedenheit seines eigenen Zimmers improvisiert. Es ist zwar eine einsame Aktivität, aber auf einem Instrument, das andere für diesen allgemeinen Zweck hergestellt haben, nach Jahren des Zusammenspiels mit anderen Musikern und des Lernens von ihnen, in einer Musikgattung mit einer Geschichte voller legendärer Riffs, für ein imaginiertes Publikum von Jazzliebhabern. Das menschliche Denken ist eine individuelle Improvisation, die in eine soziokulturelle Matrix verwoben ist.
Wie entstand diese neue Form eines gesellschaftlich durchwirkten Denkens, und wie funktioniert sie? Eine Reihe klassischer Theoretiker hat die Rolle der Kultur und ihrer Artefakte betont, um bestimmte Typen individuellen Denkens zu ermöglichen. Beispielsweise machte Hegel (1807) geltend, daß die sozialen Praktiken, Institutionen und Ideologien einer bestimmten Kultur in einer bestimmten geschichtlichen Epoche einen notwendigen Begriffsrahmen für die individuelle menschliche Vernunft bilden (siehe auch Collingwood, 1946). Peirce (1931-1958) behauptete konkreter, daß nahezu alle der am höchsten entwickelten Denkformen, darunter insbesondere die Mathematik und formale Logik, nur möglich sind, weil Menschen über kulturell geschaffene, symbolische Artefakte verfügen wie etwa die arabischen Ziffern und die Notation der Logik. Vygotskij (1978) betonte, daß Kinder inmitten der Werkzeuge und 14Symbole ihrer Kultur aufwachsen, die insbesondere die sprachlichen Symbole einschließen, die ihre Welt für sie vorstrukturieren, und daß sie im Laufe der Ontogenese den Gebrauch dieser Artefakte internalisieren, was zu jener Art von innerem Dialog führt, der einer der Prototypen des menschlichen Denkens ist (siehe auch Bachtin, 1981).
Die andere Reihe klassischer Theoretiker hat sich auf die Grundprozesse der sozialen Koordination konzentriert, die die menschliche Kultur und Sprache überhaupt erst ermöglichen. Mead (1934) wies darauf hin, daß Menschen, wenn sie miteinander interagieren, und zwar insbesondere bei der Kommunikation, in der Lage sind, sich selbst in der Rolle des anderen vorzustellen und die Perspektive des anderen auf sich selbst einzunehmen. Piaget (1928) machte außerdem geltend, daß diese Fähigkeiten zur Rollen- und Perspektivenübernahme – zusammen mit einer kooperativen Einstellung – nicht nur Kultur und Sprache ermöglichen, sondern auch schlußfolgerndes Denken, bei dem die Individuen ihren eigenen Standpunkt den normativen Maßstäben der Gruppe unterordnen. Und Wittgenstein (1955) erläuterte mehrere unterschiedliche Möglichkeiten, wie die angemessene Verwendung einer sprachlichen Konvention oder kulturellen Regel von einer bereits existierenden Menge geteilter sozialer Praktiken und Urteile abhängen (»Lebensformen«), die die pragmatische Infrastruktur bilden, von der alle Verwendungen von Sprache und Regeln ihre zwischenmenschliche Bedeutung gewinnen. Diese Theoretiker der sozialen Infrastruktur, wie wir sie nennen könnten, teilen alle die Überzeugung, daß Sprache und Kultur nur der »Zuckerguß auf dem Kuchen« der ultrasozialen Möglichkeiten des Menschen sind, sich kognitiv auf die Welt zu beziehen.
So reich an Einsichten sie auch waren, operierten alle diese klassischen Theoretiker doch ohne die verschiedenen neuen, sowohl empirischen als auch theoretischen Puzzleteile, die erst in den letzten Jahren auftauchten. In empirischer Hinsicht besteht ein neues Ergebnis in den verblüffend hochentwickelten kognitiven Fähigkeiten nichtmenschlicher Primaten, die hauptsächlich in den letzten Jahrzehnten entdeckt wurden (zu Überblicksartikeln siehe Tomasello und Call, 1997; Call und Tomasello, 2008). So verstehen Menschenaffen als die engsten lebenden Verwandten der Menschen bereits auf menschenähnliche Weise viele Aspekte ihrer physikalischen und so15zialen Welten, einschließlich der kausalen und intentionalen Beziehungen, die diese Welten strukturieren. Das bedeutet, daß viele wichtige Aspekte des menschlichen Denkens nicht von den einzigartigen Formen der Sozialität, Kultur und Sprache des Menschen abstammen, sondern vielmehr von so etwas wie den individuellen Problemlösefähigkeiten der Menschenaffen im allgemeinen.
Eine weitere neue Reihe von Ergebnissen betrifft vorsprachliche (oder gerade erst sprechende) Kleinkinder, die erst noch vollständig an der Kultur und Sprache um sie herum partizipieren müssen. Diese noch ganz jungen menschlichen Wesen operieren dennoch schon mit einigen kognitiven Prozessen, die den Menschenaffen fehlen und die es ihnen ermöglichen, mit anderen auf verschiedene Weise sozial in Verbindung zu treten, was Menschenaffen nicht können, zum Beispiel durch geteilte Aufmerksamkeit und kooperative Kommunikation (Tomasello et al., 2005). Die Tatsache, daß diese vorkulturellen und vorsprachlichen Wesen schon in kognitiver Hinsicht einzigartig sind, liefert eine empirische Stütze für die Behauptung der Theoretiker der sozialen Infrastruktur, daß bedeutende Aspekte des menschlichen Denkens kein Ausfluß der Kultur und Sprache an sich sind, sondern vielmehr von gewissen tieferen und primitiveren Formen der einzigartigen sozialen Bindung des Menschen herstammen.
In theoretischer Hinsicht haben jüngere Fortschritte in der Philosophie des Handelns leistungsfähige neue Denkwege zu diesen tieferen und primitiveren Formen der einzigartigen gesellschaftlichen Beteiligung des Menschen aufgezeigt. Eine kleine Gruppe von Handlungstheoretikern (z. B. Bratman, 1992; Searle, 1995; Gilbert, 1989; Tuomela, 2007) hat untersucht, wie Menschen sich mit anderen in Akten sogenannter geteilter Intentionalität oder »Wir-Intentionalität« zusammentun. Wenn Menschen mit anderen an gemeinschaftlichen Aktivitäten teilnehmen, bilden sie zusammen gemeinsame Ziele und gemeinsame Aufmerksamkeit aus, die dann individuelle Rollen und individuelle Perspektiven erzeugen, die innerhalb der Gruppe miteinander koordiniert werden müssen (Moll und Tomasello, 2007). Darüber hinaus gibt es eine tiefe Kontinuität zwischen solchen konkreten Manifestationen gemeinsamen Handelns und gemeinsamer Aufmerksamkeit einerseits und abstrakteren kulturellen Praktiken und Erzeugnissen andererseits wie zum Beispiel kulturel16len Institutionen, die von vereinbarten sozialen Konventionen und Normen strukturiert – ja geschaffen – werden (Tomasello, 2009). Im allgemeinen sind Menschen also in der Lage, sich mit anderen auf eine Weise, wie es andere Primaten anscheinend nicht können, zu koordinieren, das heißt, ein »wir« zu bilden, das wie eine Art pluraler Akteur fungiert, um alles mögliche zu schaffen, von einer gemeinschaftlichen Jagd bis zu einer kulturellen Institution.
Weiter findet man in dieser theoretischen Richtung, daß als eine spezifische Form menschlicher gemeinschaftlicher Aktivität und geteilter Intentionalität die menschliche kooperative Kommunikation eine Reihe besonderer intentionaler und inferentieller Prozesse beinhaltet – die erstmals von Grice (1957, 1975) identifiziert und seither von Sperber und Wilson (1996), Clark (1996), Levinson (2000) und Tomasello (2008) ausgearbeitet und modifiziert wurden. Menschliche Kommunikatoren stellen Situationen und Entitäten durch externe Kommunikationsmittel für andere Personen begrifflich dar; diese anderen Personen versuchen dann zu bestimmen, warum der Kommunikator meint, daß diese Situationen und Entitäten für sie relevant sein werden. Dieser dialogische Prozeß umfaßt nicht nur Kompetenzen und Motive für geteilte Intentionalität, sondern auch eine Reihe komplexer und rekursiver Schlußfolgerungen über die Intentionen der anderen gegenüber meinen intentionalen Zuständen. Diese einzigartige Form der Kommunikation – die nicht nur für den reifen Sprachgebrauch, sondern auch für die vorsprachliche gestische Kommunikation von Kleinkindern charakteristisch ist – setzt sowohl einen geteilten Begriffsrahmen zwischen den Kommunikationspartnern (bzw. einen gemeinsamen begrifflichen Hintergrund) als auch eine Beurteilung der individuellen Intentionen und Perspektiven dieser Partner innerhalb dieses Rahmens voraus.
Diese neuen empirischen und theoretischen Fortschritte ermöglichen uns die Konstruktion einer viel detaillierteren Erklärung der sozialen Dimensionen der menschlichen Kognition im allgemeinen, als es zuvor möglich war. In diesem Buch liegt unser Fokus auf den sozialen Dimensionen des menschlichen Denkens im besonderen. Obwohl Menschen und andere Lebewesen viele Probleme lösen und viele Entscheidungen treffen unter Rückgriff auf intuitive Heuristiken (sogenannte System-1-Prozesse), lösen Menschen und zu17mindest einige andere Lebewesen manche Probleme und treffen manche Entscheidungen durch Nachdenken (System-2-Prozesse; z. B. Kahneman, 2011). Ein spezifischer Fokus auf das Denken ist deshalb von Nutzen, weil er unser Thema auf einen einzigen kognitiven Prozeß einschränkt, aber auf einen solchen, der mehrere Schlüsselkomponenten umfaßt, insbesondere (1) die Fähigkeit, Erlebnisse »offline« für sich selbst kognitiv zu repräsentieren; (2) die Fähigkeit, Schlußfolgerungen zu simulieren oder zu vollziehen, die diese Repräsentationen kausal, intentional und/oder logisch umwandeln; und (3) die Fähigkeit, sich selbst zu beobachten und einzuschätzen, wie diese simulierten Erlebnisse zu spezifischen Verhaltensergebnissen führen könnten – und auf diese Weise eine umsichtige Verhaltensentscheidung zu treffen.
Es scheint offensichtlich, daß Menschen im Vergleich zu anderen Tierarten auf besondere Weise denken. Aber dieser Unterschied ist anhand von traditionellen Theorien des menschlichen Denkens schwer zu charakterisieren, da sie entscheidende Aspekte des Prozesses voraussetzen, die tatsächlich Errungenschaften der Evolution sind. Bei diesen handelt es sich genau um ebenjene sozialen Aspekte des menschlichen Denkens, auf denen unser primärer Fokus hier liegt. Obwohl also viele Tierarten Situationen und Entitäten zumindest in gewissem Maße abstrakt kognitiv repräsentieren können, sind nur Menschen dazu in der Lage, ein und dieselbe Situation oder Entität unter unterschiedlichen, ja sogar widersprüchlichen sozialen Perspektiven begrifflich zu fassen (was letztlich zu einem Gefühl für »Objektivität« führt). Obwohl außerdem viele Tiere auch einfache kausale und intentionale Schlußfolgerungen über externe Ereignisse ziehen, machen nur Menschen sozial rekursive und selbstreflexive Schlüsse über die intentionalen Zustände von anderen oder ihre eigenen. Und schließlich, obwohl viele Tiere ihre eigenen Handlungen im Hinblick auf den instrumentellen Erfolg überwachen und bewerten, überwachen und bewerten nur Menschen ihr eigenes Denken im Hinblick auf die normativen Perspektiven und Maßstäbe (»Gründe«) anderer oder der Gruppe. Diese grundlegend sozialen Unterschiede führen zu einem erkennbar anderen Typus des Denkens, den wir der Kürze halber objektiv-reflexiv-normatives Denken nennen können.18
In diesem Buch versuchen wir, die evolutionären Ursprünge dieses einzigartigen objektiv-reflexiv-normativen Denkens zu rekonstruieren. Die Hypothese geteilter Intentionalität lautet, daß das, was diesen einzigartigen Typus des Denkens erzeugte – seine Repräsentations-, Schlußfolgerungs- und Selbstbeobachtungsprozesse –, Anpassungen für den Umgang mit Problemen der sozialen Koordination waren, insbesondere mit Problemen, die sich durch die Versuche der Individuen ergaben, miteinander zusammenzuwirken und zu kommunizieren (mit anderen zu ko-operieren). Obwohl die Menschenaffen, die Vorfahren der Menschen, soziale Wesen waren, lebten sie größtenteils ein individualistisches und konkurrenzbetontes Leben, und daher richtete sich ihr Denken auf die Erreichung individueller Ziele. Aber die Frühmenschen wurden an einem bestimmten Punkt durch ökologische Umstände zu kooperativeren Lebensweisen gezwungen, und daher richtete sich ihr Denken stärker darauf, Möglichkeiten der Koordination mit anderen zu ersinnen, um gemeinsame Ziele oder gar kollektive Gruppenziele zu erreichen. Und das änderte alles.
Es gab zwei entscheidende Evolutionsschritte. Der erste Schritt, der den Blickpunkt von Theoretikern der sozialen Infrastruktur wie Mead und Wittgenstein widerspiegelt, beinhaltete die Entstehung eines neuen Typs kleinmaßstäblicher Zusammenarbeit bei der Nahrungssuche. Die Teilnehmer an dieser gemeinschaftlichen Nahrungssuche schufen sozial geteilte gemeinsame Ziele und gemeinsame Aufmerksamkeit (einen gemeinsamen Hintergrund), was die Möglichkeit individueller Rollen und Perspektiven innerhalb jener ad hoc geteilten Welt oder »Lebensform« erzeugte. Um diese neugeschaffenen Rollen und Perspektiven zu koordinieren, entwickelten die Menschen einen neuen Typ kooperativer Kommunikation, der auf den natürlichen Gesten des Zeigens und der Pantomime beruhte: Ein Partner lenkte die Aufmerksamkeit oder Vorstellung des anderen perspektivisch und/oder symbolisch auf etwas, das für ihre gemeinsame Aktivität »relevant« war, und dann zog dieser Partner kooperative (rekursive) Schlüsse über das, was intendiert war. Um diesen Prozeß durch Selbstbeobachtung zu überwachen, mußte der Kommunikator schon im voraus die wahrscheinlichen Schlußfolgerungen des Empfängers simulieren. Da die Zusammenarbeit und Kommunikation an diesem Punkt zwischen ad hoc und für den Au19genblick gebildeten Paaren von Individuen bestand – auf der Grundlage einer ausschließlich zwischen »ich« und »du« stattfindenden sozialen Interaktion –, können wir all das als gemeinsame Intentionalität bezeichnen. Wenn sie beim Denken zum Einsatz kommt, umfaßt die gemeinsame Intentionalität perspektivische und symbolische Repräsentationen, sozial rekursive Schlüsse und zweitpersonale Selbstbeobachtung.
Der zweite Schritt, der den Blickpunkt von Kulturtheoretikern wie Vygotskij und Bachtin widerspiegelt, vollzog sich, als menschliche Populationen größer zu werden und miteinander zu konkurrieren begannen. Diese Konkurrenz bedeutete, daß das Gruppenleben insgesamt zu einer großen gemeinschaftlichen Aktivität wurde und eine viel größere und beständigere geteilte Welt, das heißt eine Kultur entstand. Das daraus resultierende Gruppenbewußtsein bei allen Mitgliedern der Kulturgruppe (einschließlich der Fremden, die zur Eigengruppe gehörten) beruhte auf einer neuen Fähigkeit, einen gemeinsamen kulturellen Hintergrund durch kollektiv bekannte kulturelle Konventionen, Normen und Institutionen aufzubauen. Als Teil dieses Prozesses wurde die kooperative Kommunikation zu einer konventionalisierten sprachlichen Kommunikation. Im Kontext der kooperativen Argumentation beim Treffen von Gruppenentscheidungen konnten sprachliche Konventionen benutzt werden, um die Gründe einer Person für eine Behauptung innerhalb des Rahmens der Rationalitätsnormen der Gruppe zu rechtfertigen und explizit zu machen. Das bedeutete, daß die Menschen jetzt »objektiv« vom akteurneutralen Standpunkt der Gruppe aus räsonieren konnten (»von nirgendwo«). Da die Zusammenarbeit und Kommunikation an diesem Punkt konventionell, institutionell und normativ war, können wir all dies als kollektive Intentionalität bezeichnen. Wenn sie beim Denken zum Einsatz kommt, umfaßt die kollektive Intentionalität nicht nur symbolische und perspektivische Repräsentationen, sondern auch konventionelle und »objektive« Repräsentationen; nicht nur rekursive Schlußfolgerungen, sondern auch selbstreflexive und begründete Schlußfolgerungen; und nicht nur die zweitpersonale Selbstbeobachtung, sondern eine normative Selbststeuerung aufgrund der Rationalitätsnormen der Kultur.
Vor allem bedeutet dieses evolutionäre Szenario nicht, daß die heu20tigen Menschen qua Veranlagung auf diese neue Weise denken müssen. Ein modernes Kind, das auf einer einsamen Insel aufwächst, würde ganz auf sich gestellt nicht automatisch vollständig menschliche Denkprozesse aufbauen. Ganz im Gegenteil. Kinder werden mit Anpassungen zur Zusammenarbeit und Kommunikation und zum spezifischen Lernen von anderen geboren – die Evolution wählt adaptive Handlungen aus. Aber nur durch die tatsächliche Ausübung dieser Kompetenzen in der sozialen Interaktion mit anderen während der Ontogenese erzeugen Kinder neue Repräsentationsformate und neue Möglichkeiten des schlußfolgernden Denkens, wenn sie im Stile Vygotskijs ihre koordinierenden Interaktionen mit anderen zu einem Denken für sich selbst internalisieren. Das Ergebnis ist eine Art von kooperativer Kognition und Denken, die nicht so sehr neue Kompetenzen schafft, als vielmehr die Kompetenzen der Menschenaffen im allgemeinen zu etwas Kooperativem und Kollektivem macht.
Wir wollen also eine Geschichte – eine Naturgeschichte – darüber erzählen, wie das menschliche Denken entstand, beginnend mit unseren Menschenaffenvorfahren, dann weitergehend zu einigen Frühmenschen, die auf eine für die Spezies einzigartige Weise zusammenarbeiteten und kommunizierten, und endend bei modernen Menschen und ihren grundlegend kulturellen und sprachlichen Seinsweisen.21
2INDIVIDUELLE INTENTIONALITÄT
[D]as Verstehen [besteht] in dem Vorstellen der Tatsache […].LUDWIG WITTGENSTEIN, The Big Typescript
Kognitive Prozesse sind zwar ein Produkt der natürlichen Selektion, aber sie sind nicht ihr Ziel. Tatsächlich kann die natürliche Selektion die Kognition nicht einmal »sehen«; sie kann nur die Wirkungen der Kognition bei der Strukturierung und Regulation manifester Handlungen »sehen« (Piaget, 1983). In der Evolution gilt das Klugsein nichts, wenn es nicht zu klugem Handeln führt.
Die beiden klassischen Theorien des Tierverhaltens, der Behaviorismus und die Ethologie, konzentrierten sich zwar auf manifeste Handlungen, vergaßen aber irgendwie die Kognition. Die klassische Ethologie hat wenig oder gar kein Interesse an der Kognition von Tieren, und der klassische Behaviorismus stand dieser Idee regelrecht feindselig gegenüber. Obwohl zeitgenössische Programme der Ethologie und des Behaviorismus in gewisser Weise kognitive Prozesse berücksichtigen, liefern sie keine systematischen theoretischen Erklärungen. Auch irgendwelche anderen modernen Ansätze der Evolution der Kognition genügen nicht den gegenwärtigen Zielsetzungen.
Daher müssen wir, um mit der Darstellung der evolutionären Entstehung des einzigartig menschlichen Denkens zu beginnen, zuerst in groben Zügen eine Theorie der Evolution der Kognition im allgemeineren Sinne formulieren. Im Anschluß daran können wir dann mit unserer eigentlichen Naturgeschichte anfangen, indem wir diesen theoretischen Rahmen für die Charakterisierung von Kognitions- und Denkprozessen bei modernen Menschenaffen verwenden, und zwar als Stellvertreter des evolutionären Ausgangspunkts der Menschen, bevor sie sich vor etwa sechs Millionen Jahren von den anderen Primaten trennten.22
Die Evolution der Kognition
Alle Organismen verfügen über gewisse Reflexreaktionen, die linear als Reiz-Reaktionsverknüpfungen organisiert sind. Die Behavioristen meinen, daß alles Verhalten auf diese Weise organisiert ist, obwohl die Verknüpfungen bei komplexen Organismen in der Regel gelernt und auf unterschiedliche Weise mit anderen assoziiert werden. Die Alternative besteht darin anzuerkennen, daß komplexe Organismen auch über gewisse adaptive Spezialisierungen verfügen, die zirkulär als Rückkoppelungs-Steuerungssysteme mit eingebauten Zielzuständen und Handlungsmöglichkeiten organisiert sind. Im Ausgang von dieser Grundlage entwickelt sich die Kognition nicht aus einer komplexeren Gestaltung von Reiz-Reaktionsverknüpfungen, sondern daraus, daß der individuelle Organismus (1) Fähigkeiten zum flexiblen Treffen von Entscheidungen und eine Kontrolle über sein Verhalten in unterschiedlichen adaptiven Spezialisierungen gewinnt und (2) imstande ist, die kausalen und intentionalen Beziehungen, welche relevante Ereignisse strukturieren, kognitiv zu repräsentieren und Schlußfolgerungen aus ihnen zu ziehen.
Adaptive Spezialisierungen sind als selbstregulierende Systeme organisiert, ebenso wie viele physiologische Prozesse, etwa die homöostatische Regulation des Blutzuckers und der Körpertemperatur bei Säugetieren. Diese Spezialisierungen gehen in ihrer Fähigkeit, adaptives Verhalten in einem viel größeren Bereich von Umweltbedingungen hervorzubringen, über Reflexe hinaus und können in der Tat ziemlich komplex sein, zum Beispiel bei Spinnen, die Netze weben. Es ist unmöglich, daß eine Spinne ein Netz nur anhand von Reiz-Reaktionsverbindungen weben kann. Der Prozeß ist zu dynamisch und abhängig vom lokalen Kontext. Statt dessen muß die Spinne über Zielzustände verfügen und motiviert sein, diese hervorzubringen, und sie muß die Fähigkeit zur Wahrnehmung und zum Handeln besitzen, so daß sie diese Zielzustände auf selbstregulierte Weise hervorbringt. Aber adaptive Spezialisierungen sind noch nicht kognitiv (oder nur schwach kognitiv), weil es ihnen per definitionem an Wissen mangelt und sie unflexibel sind: Wahrgenommene Situationen und Verhaltensmöglichkeiten zur Zielerreichung sind zum größten Teil auf unflexible Weise miteinander verknüpft. Der individuelle 23Organismus verfügt nicht über die Art von kausalem oder intentionalem Verständnis der Situation, die ihm ermöglichen würde, mit »neuen« Situationen flexibel umzugehen. Die natürliche Selektion hat diese adaptiven Spezialisierungen so gestaltet, daß sie invariant »in denselben« Situationen wie denen funktionieren, denen der Organismus in der Vergangenheit begegnet ist, und deshalb bedarf es keiner Klugheit seitens des Individuums.
Kognition und Denken betreten die Bühne, wenn Organismen in weniger vorhersagbaren Welten leben, und die natürliche Selektion formt kognitive Prozesse und solche der Entscheidungsfindung, die das Individuum befähigen, neue Situationen zu erkennen und, auf sich gestellt, flexibel mit unvorhersagbaren Erfordernissen umzugehen. Was den effektiven Umgang mit einer neuen Situation ermöglicht, ist ein gewisses Verständnis der daran beteiligten kausalen und/oder intentionalen Beziehungen, das dann eine angemessene und potentiell neue Verhaltensreaktion nahelegt. Beispielsweise könnte ein Schimpanse erkennen, daß das einzige Werkzeug, das ihm in einer gegebenen Situation zur Verfügung steht, aufgrund der physikalischen Kausalität in diesem Fall eine Verhaltensweise erfordert, die er noch nie zuvor im Hinblick auf dieses Ziel vollzogen hat. Ein kognitiv kompetenter Organismus funktioniert daher als Steuerungssystem mit Referenzwerten oder -zielen, mit Fähigkeiten zur Beachtung von Situationen, die kausal oder intentional für diese Referenzwerte oder -ziele »relevant« sind, und mit Fähigkeiten zur Auswahl von Handlungen, die zur Erfüllung dieser Referenzwerte oder -ziele führen (auf der Grundlage der kausalen und/oder intentionalen Struktur der Situation). Diese Beschreibung in Begriffen von Steuerungssystemen ist im Grunde identisch mit dem klassischen Überzeugungs-Wunsch-Modell des rationalen Handelns in der Philosophie: ein Ziel oder Wunsch, gekoppelt mit einer epistemischen Verbindung zur Welt (zum Beispiel einer Überzeugung, die auf einem Verständnis der kausalen oder intentionalen Struktur der Situation beruht), erzeugt eine Absicht, auf eine bestimmte Weise zu handeln.1
Wir werden diese flexible, individuell selbstregulierte, kognitive Art und Weise des Umgangs mit Dingen als individuelle Intentionalität bezeichnen. Innerhalb dieses Selbstregulationsmodells individuel24ler Intentionalität können wir dann sagen, daß Denken stattfindet, wenn ein Organismus bei einer bestimmten Gelegenheit versucht, ein Problem zu lösen, und sein Ziel nicht durch manifestes Verhalten, sondern vielmehr dadurch zu erfüllen trachtet, daß er sich vorstellt, was geschehen würde, wenn er in einer Situation verschiedene Handlungen ausprobieren würde – oder wenn verschiedene äußere Kräfte in die Situation einflössen –, bevor er tatsächlich handelt. Diese Vorstellung ist nichts anderes als die »Offline«-Simulation potentieller Wahrnehmungserlebnisse. Um solcherart in der Lage zu sein, vor dem Handeln zu denken, muß der Organismus daher die oben skizzierten drei Voraussetzungen besitzen: (1) die Fähigkeit zur kognitiven Repräsentation von Erlebnissen »offline«, (2) die Fähigkeit zur Simulation oder zum Vollzug von Schlußfolgerungen, die diese Repräsentationen kausal, intentional und/oder logisch umwandeln, und (3) die Fähigkeit, sich selbst zu beobachten und zu bewerten, wie diese simulierten Erlebnisse zu spezifischen Verhaltensergebnissen führen – und auf diese Weise eine wohlüberlegte Verhaltensentscheidung zu treffen. Der Erfolg oder Mißerfolg einer bestimmten Verhaltensentscheidung gibt die zugrundeliegenden Prozesse der Repräsentation, Simulation und Selbstbeobachtung sozusagen indirekt dem unerbittlichen Sieb der natürlichen Selektion preis.
Kognitive Repräsentation
Die kognitive Repräsentation in einem selbstregulierenden intentionalen System läßt sich sowohl anhand ihres Inhalts als auch anhand ihres Formats charakterisieren. Was den Inhalt betrifft, so lautet die Behauptung, daß sowohl die internen Ziele des Organismus als auch seine von außen gelenkte Aufmerksamkeit (wohlgemerkt nicht nur Wahrnehmung, sondern Aufmerksamkeit) nicht punktförmige Reize oder Sinnesdaten zum Inhalt haben, sondern vielmehr ganze Situationen. Ziele, Werte und andere Bezugsgrößen (Pro-Einstellungen) sind kognitive Repräsentationen von Situationen, für die der Organismus eine Motivation hat, sie hervorzubringen oder aufrechtzuerhalten. Obwohl wir manchmal von einem Gegenstand oder einem Ort als dem Ziel einer Person sprechen, ist das in Wirklichkeit 25nur eine abgekürzte Redeweise: Das Ziel ist die Situation des Habens des Gegenstands oder des Erreichens des Ortes. Der Philosoph Davidson (2001/2013) schreibt: »Wünsche und Gelüste sind auf propositionale Inhalte gerichtet. Was man will, ist, […] daß man den Apfel in der Hand hält. […] Ähnliches gilt für Absichten. Wer die Absicht hat, in die Oper zu gehen, beabsichtigt, dafür zu sorgen, daß er im Opernhaus sitzt.« (S. 215) Im selben Sinne spricht die moderne Entscheidungstheorie häufig von dem Wunsch oder der Präferenz, daß ein bestimmter Sachverhalt verwirklicht sein soll.
Wenn Ziele und Werte als gewünschte Situationen repräsentiert werden, dann muß der Organismus in seiner Wahrnehmungsumgebung auf Situationen achten, die für diese Ziele und Werte relevant sind. Gewünschte Situationen und beachtete Umgebungssituationen haben deshalb zwangsläufig dasselbe wahrnehmungsbasierte, tatsachenähnliche Repräsentationsformat, was ihren kognitiven Vergleich ermöglicht. Natürlich nehmen komplexe Organismen auch weniger komplexe Dinge wahr wie Gegenstände, Eigenschaften und Ereignisse – und können ihnen für bestimmte Zwecke Beachtung schenken –, aber der vorliegenden Analyse zufolge sehen sie diese Dinge immer als Bestandteile von Situationen, die für das Treffen von Verhaltensentscheidungen relevant sind.
Um diesen Punkt zu veranschaulichen, nehmen wir an, daß die Darstellung in Abbildung 2.1 zeigt, was ein Schimpanse sieht, wenn er auf Nahrungssuche ist und sich einem Baum nähert.
Der Schimpanse nimmt die Szene im Grunde genauso wahr, wie wir es täten; unsere visuellen Systeme sind hinreichend ähnlich, so daß wir dieselben elementaren Gegenstände und ihre räumlichen Beziehungen sehen. Aber auf welche Situationen achtet der Schimpanse? Obwohl er seine Aufmerksamkeit im Prinzip auf alle der potentiell unendlich vielen Situationen richten könnte, die dieses Bild darstellt, muß er im gegenwärtigen Augenblick eine Entscheidung zur Nahrungssuche treffen, und daher achtet er auf die Situationen oder »Tatsachen«, die für diese Verhaltensentscheidung relevant sind, nämlich (auf deutsch formuliert):
– daß viele Bananen am Baum hängen
– daß die Bananen reif sind26
– daß auf dem Baum nicht schon konkurrierende Schimpansen sind
– daß man die Bananen durch Klettern erreichen kann
– daß keine Raubtiere in der Nähe sind
– daß eine schnelle Flucht von diesem Baum schwierig sein wird
– usw., usw.
Abbildung 2.1: Was ein Schimpanse sieht.
Für einen Schimpansen auf Nahrungssuche mit dem Ziel, Nahrung zu finden, sind alle diese Dinge vor dem Hintergrund all seiner Wahrnehmungs- und Verhaltensfähigkeiten und seines Wissens um die lokale Ökologie relevante Situationen, um zu entscheiden, was er tun soll – alle sind in einem einzigen visuellen Bild und natürlich nicht27sprachlich gegenwärtig. (NB: Selbst das Fehlen von etwas Erwartetem, etwa Nahrung, die nicht an ihrem üblichen Ort ist, kann eine relevante Situation sein.)
Relevanz ist eines jener ereignisabhängigen Urteile, für die man keine allgemeine Definition angeben kann. Aber in groben Zügen achten Organismen auf Situationen entweder (1) als Gelegenheiten oder (2) als Hindernisse mit Blick auf die Verfolgung und Aufrechterhaltung ihrer Ziele und Werte (oder als Informationen, die für die Vorhersage zukünftiger Gelegenheiten oder Hindernisse relevant sind). Verschiedene Tierarten haben natürlich unterschiedliche Lebensformen, was bedeutet, daß sie unterschiedliche Situationen (und Bestandteile von Situationen) wahrnehmen oder beachten. Für einen Leoparden würde die Situation der Bananen an einem Baum keine Gelegenheit zum Essen darstellen, aber die Anwesenheit eines Schimpansen wäre eine solche Gelegenheit. Im Gegensatz dazu stellt die Anwesenheit des Leoparden für den Schimpansen jetzt ein Hindernis für seinen Wert der Vermeidung von Raubtieren dar, und deshalb sollte er nach einer Situation suchen, die Fluchtgelegenheiten bietet, beispielsweise einen Baum ohne niedrig hängende Äste zum Hochklettern – eingedenk seines Wissens, daß Leoparden auf solche Bäume nicht hochklettern können, und seiner Vertrautheit mit seinen eigenen Kletterfähigkeiten. Wenn wir jetzt noch einen Wurm ins Spiel bringen, der auf der Oberfläche der Banane sitzt, würden sich die relevanten Situationen für die drei verschiedenen Tierarten – die Hindernisse und Gelegenheiten für ihre jeweiligen Ziele – noch weniger überschneiden, falls überhaupt. Relevante Situationen werden daher gemeinsam von den Zielen und Werten des Organismus, seinen Wahrnehmungsfähigkeiten, seinem Wissen und seinen Verhaltensfähigkeiten bestimmt, das heißt dadurch, daß er insgesamt als selbstregulierendes System funktioniert. Die Identifikation von Situationen, die für eine Verhaltensentscheidung relevant sind, impliziert daher die ganze Lebensweise des Organismus (von Uexküll, 1921).2
Im Sinne des Repräsentationsformats ist es also entscheidend, daß der Organismus seine Erlebnisse als Typen, also in einer verallgemeinerten, schematisierten oder abstrakten Form repräsentieren muß, um kreative Schlußfolgerungen zu ziehen, die über einzelne Erfah28rungen hinausgehen. Eine plausible Hypothese besteht in einer Art von Mustermodell, dem zufolge das Individuum in einem gewissen Sinne die einzelnen Situationen und Bestandteile, die es beachtet hat, »speichert« (in vielen Modellen der Wissensrepräsentation bildet die Aufmerksamkeit das Portal). Dann findet eine Verallgemeinerung oder Abstraktion über diese einzelnen Situationen hinweg statt in einem Prozeß, den wir Schematisierung nennen könnten. (Nach Langackers [1987] Metapher handelt es sich um einen Stapel von Folien, von denen jede eine einzelne Situation oder Entität darstellt, und die Schematisierung ist der Prozeß des Von-oben-durch-sie hindurch-Blickens auf der Suche nach Überschneidungen.) Wir können uns das Ergebnis dieses Schematisierungsprozesses als eine Reihe kognitiver Modelle vorstellen, die verschiedene Typen von Situationen und Entitäten abdecken, zum Beispiel Objektkategorien, Ereignisschemata und Situationsmodelle. Eine Situation oder Entität als Instanz eines bekannten Typs zu erkennen – als Exemplar einer kognitiven Kategorie, eines Schemas oder Modells – ermöglicht neue Schlußfolgerungen über die Instanzen, die dem Typ entsprechen.
Kategorien, Schemata und Modelle als kognitive Typen sind nichts anderes als bildhafte oder ikonische Schematisierungen der vorhergehenden Erfahrung des Organismus (oder in manchen Fällen seiner Spezies) (Barsalou, 1999, 2008). Als solche leiden sie nicht an der Unbestimmtheit der Interpretation, die manche Theoretiker ikonischen Repräsentationen zuschreiben, welche als mentale Bilder betrachtet werden, das heißt der Unbestimmtheit, ob es sich bei diesem Bild um das einer Banane, einer Frucht, eines Gegenstands usw. handelt (Crane, 2003). Sie leiden deshalb nicht daran, weil sie aus individuellen Erfahrungen zusammengesetzt sind, in denen der Organismus auf eine relevante (schon »interpretierte«) Situation achtete. Somit »interpretiert« oder versteht der Organismus einzelne Situationen und Entitäten im Kontext seiner Ziele, wenn er sie an bekannte (kognitiv repräsentierte) Typen assimiliert: »Das ist noch so eines.«29
Simulation und Schlußfolgerungen
Bei einem Organismus mit individueller Intentionalität beinhaltet das Denken Simulationen oder Schlußfolgerungen, die kognitive Repräsentationen von Situationen und ihre Bestandteile auf unterschiedliche Weise verknüpfen. An erster Stelle stehen jene instrumentellen Schlußfolgerungen, die beim Treffen von Verhaltensentscheidungen der Art »Was würde geschehen, wenn …« eine Rolle spielen. In einer konkreten Problemlösungssituation – wenn etwa ein Stock unter einem Stein eingeklemmt ist – könnten beispielsweise manche Organismen diejenige Art inferentieller Simulation durchlaufen, die Piaget (1975) »mentalen Versuch und Irrtum« nannte: Der Organismus stellt sich eine mögliche Handlung und ihre Konsequenzen vor. So könnte ein Schimpansenweibchen in ihrer Vorstellung simulieren, was geschehen würde, wenn sie kräftig an dem Stock zöge, ohne es wirklich zu tun. Wenn sie zu der Einschätzung gelangte, daß das in Anbetracht der Größe und des Gewichts des Steins erfolglos wäre, könnte sie sich dafür entscheiden, den Stein beiseite zu schieben, bevor sie an dem Stock zieht.
Ebenfalls möglich sind Schlußfolgerungen über kausale und intentionale Beziehungen, die von äußeren Kräften erzeugt werden, und darüber, wie diese das Erreichen von Zielen und Werten beeinflussen könnten. Ein Schimpanse könnte beispielsweise einen kleinen Affen sehen, der auf dem Bananenbaum sitzt und frißt, und schließen, daß es keine Leoparden in der Nähe gibt (weil der Affe fliehen würde, wenn es welche gäbe). Oder ein Bonobo, der eine Feige auf dem Boden gefunden hat, könnte schließen, daß sie süß schmecken wird und daß sich ein Samen darin befindet – auf der Grundlage der Kategorisierung der angetroffenen Feige als »noch so eine« und der natürlichen Schlußfolgerung, daß diese dieselben Eigenschaften wie andere aus der Kategorie haben wird. Oder ein Orang-Utan könnte einen Artgenossen, der einen Baum hochklettert, als intentionales Ereignis eines bestimmten Typs erkennen, dann etwas mit Bezug auf Ziele und Aufmerksamkeit als intentionale Ursachen schließen und auf diese Weise die bevorstehenden Handlungen des Kletterers vorhersagen. Wenn sie solche Erfahrungen schematisieren (was möglicherweise durch die Erfahrung der Spezies unterstützt wird), können In30dividuen potentiell kognitive Modelle allgemeiner Muster von Kausalität und Intentionalität aufbauen.
Die beste Methode zur Konzeptualisierung solcher Prozesse besteht in offline stattfindenden, bildgestützten Simulationen einschließlich neuer Kombinationen repräsentierter Ereignisse und Entitäten, die das Individuum als solche nie zuvor direkt erfahren hat, beispielsweise ein Menschenaffe, der sich vorstellt, was der kleine Affe täte, wenn ein Leopard die Bühne betreten würde (siehe Barsalou, 1999, 2008, zu relevanten Daten über Menschen; Barsalou, 2005, dehnt die Analyse auf nichtmenschliche Primaten aus). Wesentlich ist, daß die kombinatorischen Prozesse selbst kausale und intentionale Beziehungen beinhalten werden, die verschiedene wirkliche und vorgestellte Situationen miteinander verknüpfen, sowie »logische« Operationen wie das Konditional, die »Negation«, den Ausschluß und dergleichen. Diese logischen Operationen sind nicht selbst bildartige kognitive Repräsentationen, sondern vielmehr kognitive Prozeduren (enaktiv, in Bruners Terminologie, oder operativ, in der Terminologie Piagets), zu denen der Organismus nur über den tatsächlichen Gebrauch Zugang hat. Konkrete Beispiele dafür, wie das funktioniert, werde ich anführen, wenn wir uns das Denken von Menschenaffen im folgenden Abschnitt genauer ansehen.
Die Selbstbeobachtung des Verhaltens
Um effektiv zu denken, muß ein Organismus mit individueller Intentionalität in der Lage sein, das Ergebnis seiner Handlungen in einer gegebenen Situation zu beobachten und zu bewerten, ob sie dem erwünschten Zielzustand oder dem Ergebnis entsprechen. Der Vollzug solcher Prozesse der Selbstbeobachtung des Verhaltens und der Bewertung ermöglicht das Lernen aus Erfahrung über die Zeit hinweg.
Eine kognitive Variante solcher Selbstbeobachtung ermöglicht dem Akteur, wie oben erwähnt, eine potentielle Handlungs-Ergebnis-Sequenz im voraus inferentiell zu simulieren und sie zu beobachten – als ob sie eine wirkliche Handlungs-Ergebnis-Sequenz wäre – und dann das vorgestellte Ergebnis zu bewerten. In diesem Prozeß entstehen umsichtigere Entscheidungen aufgrund der Vorkorrektur 31von Fehlern. (Dennett [1995] nennt das Poppersches Lernen, weil ein Mißerfolg bedeutet, daß meine Hypothese »stirbt« und nicht ich.) Betrachten wir zum Beispiel ein Eichhörnchen, das in einem Baum auf einem Zweig sitzt und sich daranmacht, auf einen anderen Zweig zu springen. Man kann sehen, wie sich die Muskeln vorbereiten, aber in manchen Fällen entscheidet das Eichhörnchen, daß der Sprung zu weit ist, und klettert dann, nachdem es ein paar Sprünge angetäuscht hat, den Baumstamm hinunter und dann den anderen Zweig hinauf. Die einfachste Beschreibung dieses Ereignisses ist, daß das Eichhörnchen eine Simulation dessen, was es erleben würde, wenn es spränge, beobachtet und bewertet; beispielsweise würde es erleben, daß es den Zweig verfehlt und abstürzt – ein entschieden negatives Ergebnis. Das Eichhörnchen muß dann diese Simulation verwenden, um eine Entscheidung darüber zu treffen, ob es wirklich springen soll. Okrent (2007) behauptet, daß die im voraus stattfindende Imagination möglicher Ergebnisse verschiedener Verhaltensoptionen und die anschließende Bewertung und Entscheidung für diejenige mit dem besten vorgestellten Ergebnis das Wesen instrumenteller Rationalität ist.
Diese Art der Selbstbeobachtung, die das verlangt, was von einigen exekutive Funktion genannt wird, ist kognitiv, weil das Individuum in einem gewissen Sinne nicht nur seine Handlungen und deren Ergebnisse in der Umgebung beobachtet, sondern auch seine inneren Simulationen. Es ist dem Organismus auch möglich, solche Dinge wie die Informationen, die ihm für die Entscheidung zur Verfügung stehen, zu bewerten, um die Wahrscheinlichkeit vorherzusagen, daß er eine erfolgreiche Wahl treffen wird (bevor er tatsächlich wählt). Menschen verwenden sogar die vorgestellten Bewertungen anderer Personen – oder das imaginierte Verstehen anderer im Falle der Kommunikation –, um potentielle Verhaltensentscheidungen zu bewerten. Was auch immer ihre spezifische Form sein mag, eine interne Selbstbeobachtung einer bestimmten Art ist entscheidend für alles, was wir Denken nennen wollen, da sie in einem gewissen Sinne konstituiert, daß das Individuum weiß, was es tut.32
Denken wie ein Menschenaffe
Wir beginnen unsere Naturgeschichte der evolutionären Entstehung des einzigartig menschlichen Denkens mit einem Fokus auf den letzten gemeinsamen Vorfahren der Menschen und anderer gegenwärtig noch existierender Primaten. Unsere besten lebenden Modelle für dieses Geschöpf sind die engsten Primatenverwandten des Menschen, also die nichtmenschlichen Menschenaffen (im folgenden: Menschenaffen), zu denen die Schimpansen, Bonobos, Gorillas und Orang-Utans gehören. Besonders interessant sind die Schimpansen und Bonobos, weil sie sich zuletzt von der Linie des Menschen abgespalten haben, nämlich vor etwa sechs Millionen Jahren. Wenn die kognitiven Fähigkeiten unter den vier Arten der Menschenaffen ähnlich, beim Menschen aber verschieden sind, nehmen wir an, daß die Menschenaffen ihre Fertigkeiten vom letzten gemeinsamen Vorfahren (oder von einem noch früheren Wesen) konserviert haben, während Menschen etwas Neues entwickelten.
Unsere Charakterisierung der kognitiven Fertigkeiten dieses letzten gemeinsamen Vorfahren wird sich von empirischen Forschungen an Menschenaffen ableiten und in den eben entwickelten theoretischen Rahmen der individuellen Intentionalität gegossen werden: die Selbstregulation des Verhaltens, an der kognitive Modelle und instrumentelle Inferenzen beteiligt sind, in Kombination mit einer bestimmten Form der Selbstbeobachtung des Verhaltens. Da Menschen mit anderen Menschenaffen die jüngste Evolutionsgeschichte teilen – zusammen mit derselben grundlegenden Körperstruktur, denselben Sinnesorganen, Emotionen und derselben Hirnstruktur –, wird unsere Standardannahme beim Fehlen von Belegen die der evolutionären Kontinuität sein (de Waal, 1999). Das bedeutet, wenn Menschenaffen sich genauso wie Menschen verhalten, insbesondere in sorgfältig kontrollierten Experimenten, werden wir eine Kontinuität der zugrundeliegenden kognitiven Prozesse, die dabei beteiligt sind, annehmen. Die Erklärungslast liegt somit bei denen, die evolutionäre Diskontinuitäten postulieren, eine Herausforderung, die wir in späteren Kapiteln annehmen.33
Menschenaffen denken über die physische Welt nach
Kognitions- und Denkprozesse von Menschenaffen können sinnvollerweise aufgeteilt werden in diejenigen, die sich auf die physische Welt beziehen und durch ein Verständnis physischer Kausalität strukturiert werden, und in diejenigen, die sich auf die soziale Welt beziehen und durch ein Verständnis von Akteurskausalität oder Intentionalität strukturiert werden. Die Primatenkognition der physischen Welt entwickelte sich hauptsächlich im Kontext der Nahrungssuche (siehe Tomasello und Call, 1997, zu dieser theoretischen Behauptung und sie stützenden Belegen); das ist somit ihre »Eigenfunktion« (in Millikans Sinn [1987]). Um ihren täglichen Lebensunterhalt sicherzustellen, haben Primaten (wie Säugetiere im allgemeinen) folgendes entwickelt: die proximalen Ziele, die Repräsentationen sowie Schlüsse für (1) das Auffinden von Nahrung (was Fertigkeiten der räumlichen Navigation und des Verfolgens von Objekten erfordert), (2) das Erkennen und Kategorisieren von Nahrung (was Fertigkeiten der Merkmalserkennung und Kategorisierung erfordert), (3) das Quantifizieren der Nahrung (was Fertigkeiten der Quantifizierung erfordert) und (4) die Beschaffung oder Entnahme von Nahrung (was Fertigkeiten kausalen Verstehens erfordert). Mit Blick auf diese grundlegendsten Fertigkeiten der physischen Kognition scheinen sich alle nichtmenschlichen Primaten im großen und ganzen ähnlich zu sein (Tomasello und Call, 1997; Schmitt et al., 2012).
Worin Menschenaffen im Vergleich zu anderen Primaten ein besonders großes Geschick haben, ist der Gebrauch von Werkzeugen – den man so charakterisieren könnte, daß er nicht nur ein Verstehen von Ursachen einschließt, sondern auch deren wirkliche Manipulation. Andere Primaten sind zum größten Teil überhaupt keine geschickten Werkzeugbenutzer, und wenn sie es sind, dann typischerweise nur in einem einzigen, engen Bereich (z. B. Fragaszy et al., 2004). Im Gegensatz dazu sind alle vier Arten der Menschenaffen äußerst geschickt im flexiblen Gebrauch einer Vielfalt von Werkzeugen, unter anderem bei der Verwendung zweier Werkzeuge nacheinander bei einer Aufgabe, beim Heranholen eines Werkzeuges durch ein anderes (das dann benötigt wird, um Nahrung zu beschaffen) und so weiter (Herrmann et al., 2008). Klassischerweise wird ange34nommen, daß der Werkzeuggebrauch vom Individuum erfordert, daß es die kausale Wirkung seiner Werkzeugmanipulationen auf das Zielobjekt oder Zielereignis bewertet (Piaget, 1975), und daher deuten die Flexibilität und der Eifer, mit denen Menschenaffen erfolgreich neue Werkzeuge verwenden, darauf hin, daß sie eines oder mehrere allgemeine kognitive Modelle von Kausalität besitzen, die ihre Verwendung dieser neuen Werkzeuge leiten.