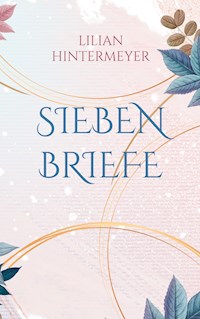Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Urlaub. Die schönste Zeit des Jahres. Für mich immer eine Zeit der gechillten Muse. Doch dieser Urlaub ist anders. Er ist mehr als sonderbar. Er fühlt sich eher wie ein praller, vollgestopfter Wäschesack an. Dabei sollte er doch erholsam und fluffig wie ein seidiges Schaumbad sein. Doch Pustekuchen! Nicht nur das ich immer wieder in meine schräge Vergangenheit abdrifte, nein, auch mein Mann taucht ständig, völlig unverhofft auf. Sie denken, das wäre nichts Besonderes? Nun ja, mein Mann Dariusz ist tot. Seit zwei Jahren. Plattgewalzt von einem LKW, während er auf dem Weg war, sich Zigaretten zu besorgen. Ein Umstand, den ich ihm bis heute nicht verziehen habe. Weder das Rauchen, noch das er tot ist. Was will er? Gerade jetzt, wo ich das Gefühl habe, mein Leben würde sich endlich langsam wieder normalisieren. Natürlich weiß ich, dass ich meinen Mann nicht wirklich sehe. Das wäre ja zu gruselig oder ich wäre verrückt. Bin ich aber nicht. Dennoch frage ich mich, warum mein Gehirn mir ausgerechnet jetzt, in meinem Urlaub, diesen üblen Streich spielt. Was will es damit erreichen? Mein Name ist Kornelia Korn und die Antwort offenbart sich mir, am Ende dieser zwei Wochen, die sich letztendlich anfühlen wie eine einzige popelige Sekunde. Eine Sekunde, die so lang wie ein ganzes Leben ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 495
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Montag, der 18.03.2019
Dienstag der 19.03.2019
Silvester 1993/1994
Mittwoch, der 20.03.2019
Donnerstag, der 21.03.2019
Samstag, der 09. November 2002
Freitag, der 22.03.2019
Samstag der 23.03.2019
Sonntag, der 24.03.2019
Montag, der 25. März 2019
Dienstag, der 26. März 2019
Mittwoch der 25. März
Donnerstag der 26. März
Der Weg ist das Ziel!
Alle Personen und Handlungen sind frei erfunden.
Etwaige Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
„Unmöglich“, sagt der klare Verstand.
„Glaube“, flüstert lächelnd der Geist.
Sirenen heulen in der Ferne. Dieses durchdringende Geräusch gesellt sich zu dem feinen, krisseligen Rauschen, dass ich eh schon in meinen Ohren habe. Ein Rauschen, das klingt, als ob mein Gehirn seinen Sendersuchlauf durchgestartet hätte. Allerdings habe ich irgendwie das Gefühl, dass dies ein unnötiges Unterfangen sein wird und das kein Kanal auf Sendung ist.
Woher ich dieses Gefühl habe? Keine Ahnung.
Es ist dunkel. Das macht mir schon ein bisschen Angst. Es dauert tatsächlich einige Zeit, bis ich bemerke, dass einfach nur meine Augen geschlossen sind.
Wie dumm von mir.
Obwohl ich mich gerne umschauen würde, bleiben meine Augen dennoch zu. Langsam fange ich an, diese Dunkelheit zu genießen. Sie passt hervorragend zu der Leere die momentan in meinem Kopf herrscht. Das ist ungewöhnlich, denn sonst ist mein Kopf bis unter die gewölbte Hirnschale vollgestopft mit irgendwelchen Gedanken. Gedanken aller Art. Ich konzentriere mich etwas. Nein, ich denke nicht nach…
…sondern ich richte mein inneres Auge auf diese Leere in meinem Kopf und versuche etwas darin zu erkennen…
Montag, der 18.03.2019
Piepiepiepiepiepiepiep…
Ohne nachzudenken verpasste ich meinem aufdringlichen Wecker einen harten, unfreundlichen Klaps.
Es schepperte laut, als er nach dieser äußerst rüden Behandlung auf den Boden knallte, doch das war mir egal. Ich hatte Urlaub, verdammt nochmal und da wollte ich endlich mal ausschlafen. Das der Wecker eigentlich nichts dafür konnte, schob ich beiseite, genauso wie den nervigen Gedanken, dass ich mir jetzt bestimmt einen neuen Wecker kaufen musste. Dabei wurde sein frühzeitiges Ableben ja von mir selbst in Kauf genommen. Ich hätte ihn gestern Abend nur ausschalten müssen.
Das hatte ich aber vergessen.
Ruhe seine digitale Seele in Frieden!
Mein Herz beschleunigte seinen Schlag, da es wohl dachte, ich wolle aufstehen. Das regte mich auf, da ich noch schlafen wollte. Nun schlug es noch schneller, da ich mich aufgeregt hatte und pumpte nun unermüdlich frisches Blut in mein Gehirn, dass nun auch den Schlaf aus seinen müden Windungen schüttelte und mich sofort mit nervigen Gedanken überschüttete, wie: Hast du die Mülltonne gestern rausgestellt? Ist die Waschmaschine abgestellt? Haben wir Brot zuhause? Wann war dein Friseurtermin? Wo hast du die elektronische Lohnsteuerbescheinigung nochmal hingelegt? Heute ist dein erster Urlaubstag! Der frühe Vogel fängt den Wurm! Du musst aufs Klo!
Mürrisch versuchte ich diese quäkenden Gedanken zu ersticken, in dem ich mir selber das Kissen auf das Gesicht drückte. Keine gute Idee. Nach sechzig Sekunden ging mir der Sauerstoff aus und ich zog das Kissen wieder freiwillig von meiner Nase herunter.
Doch mürrisch war ich immer noch, denn nun drückte natürlich, aufgerüttelt durch mein laberndes Gehirn, meine Blase und forderte mich zum sofortigen Aufstehen auf. Ich wollte aber nicht. Ich wollte doch noch schlafen. Ich hatte schließlich Urlaub!
Im nächsten Moment schoben sich meine Beine jedoch wie von selbst zur Bettkante.
„Scheiße!“
Wie gut, dass niemand anderes mit in meinem Bett schlief, denn die meisten Leute, die ich kannte, bevorzugten im Allgemeinen ein freundliches ‚Guten Morgen‘. Aber Gottlob schlief ich alleine. Also war es egal, wie ich den Tag begrüßte.
Deshalb schob ich ein weiteres, deftiges, „Scheiße“, nach. Mehr Nettigkeit war an diesem Morgen nicht drin.
War halt so.
Müde stippten meine kalten Zehen auf dem Boden herum, auf der Suche nach den fellgefütterten Hausschuhen. Doch die hatten sich verzogen.
Wahrscheinlich unter das Bett. Böse Schlappen!
Bevor ich mich noch weiter aufregte, ignorierte ich die beiden Fahnenflüchtigen lieber, stellte mich auf den kalten Linoleumboden und tapste barfüßig mit halbgeschlossenen Augen in Richtung Badezimmer.
Kurz vor dem Ziel, knickte mein Kurs überraschend ab und führte mich in die Küche. Meine Blase meldete sich wieder, diesmal stärker. Doch sie war selbst schuld, wenn sie jetzt warten musste. ZUERST wollte ich mir die Kaffeeversorgung garantieren, schließlich hatte ICH Urlaub und nicht SIE. Erst nachdem die Kaffeemaschine anfing friedlich zu blubbern, kam ich auch dem Wunsch meiner übervollen Blase nach und trottete Richtung Toilette. Während sich mein gequältes Hohlorgan laut plätschernd entleerte, betrachtete ich mir die Dusche, deren Glasscheiben von den vielen Kalkflecken schon ganz trübe war.
Interessierte mich das im Augenblick? Nö!
Um nicht noch den Gedanken ans Putzen aufkommen zu lassen, plumpste mein Blick auf die Mosaiksteinchen am Boden. Die Fugen waren schon ganz dunkel. Keine gute Idee herabzuschauen, denn jetzt hatte ich das Bedürfnis, mit einer ausgedienten Zahnbürste auf die Knie zu sinken und mit dem Schubbern anzufangen. Ehe dieser Drang Überhand gewann, stand ich schnell auf, zog meine Unterhose hoch und wusch mir eilig die Finger am Zahnpastaverschmierten Waschbecken.
Noch so ein Schandfleck der nach einer überfälligen Reinigung lechzte. Doch auch diese Bettelei prallte an mir ab. Ohne dem Waschbecken noch einen weiteren Blick zu schenken, verkrümelte ich mich schnell wieder in die Küche, wo schon der frisch aufgebrühte Kaffee lockte. Großzügig füllte ich mir den letzten sauberen Becher mit der heißen, koffeinhaltigen Brühe, gab noch zwei Teelöffel Zucker, als Energielieferant hinzu und einen Schuss Milch (für die appetitliche Farbe) und stellte mich damit ans Küchenfenster. Sofort sah ich einen riesigen Vogelschiss, der außen, unappetitlich mitten auf der Scheibe pappte. Also machte ich einen kleinen Schritt nach rechts, damit ich daran vorbeilinsen konnte und schaute hinunter auf die belebte Verkehrsstraße.
Die Kreuzungsampel ließ die Autos nur in Intervallen durch, dennoch war dort unten Betrieb wie auf dem Bahnhof. Die verschiedenen Fahrzeuge mit ihren angeknipsten Scheinwerfern sahen wie monströse Käfer aus, deren leuchtenden Kulleraugen sich durch die beginnende Morgendämmerung bohrten. Ich schnaubte abfällig, obwohl ich letzten Freitag ebenfalls noch zu dieser frühen Stunde mit dem Bus zur Arbeit gegondelt war. Doch heute hatte ich Urlaub und es ärgerte mich, dass ich nun am Fenster stand und mir diese blöden Pendler betrachtete, die nur ihre kümmerlichen Brötchen verdienen wollten. Eigentlich sollte ich in meinem warmen Bett liegen und von einem weißen Sandstrand und eisgekühlter Pinacolada träumen. Tat ich aber nicht. Ich stand kaffeeschlürfend am verkackten Küchenfenster. Scheiße! Sozusagen.
Langsam nippte ich an meinem Kaffee und versuchte damit meine schlechte Laune hinunterzuspülen.
Es gelang halbwegs.
Zumindest so lange, bis ich mich wieder meiner Küche zuwendete und die vollgestellte Spüle sah. Dieser Anblick, obwohl ich diesen Zustand selber herbeigeführt hatte, frustrierte mich. Leise schnaubend räumte ich die Spülmaschine ein. Es tat ja sonst keiner.
Da ich gerade dabei war, wischte ich auch so nebenbei mit dem feuchten Spüllappen die Arbeitsfläche und den kleinen Esstisch ab. So konnte ich wenigstens die Arme auf der Tischplatte auflegen, ohne dass mich kleine bösartige Krümel in den Ellbogen piksten. Ich setzte mich aber nicht, sondern trank meinen Kaffee im Stehen leer, goss mir neuen ein (mit Zucker und Milch) und flanierte zurück ins Schlafzimmer, wo ich mich vor den geöffneten Schranktüren positionierte und in den Wust hineinstarrte. Was zog ich heute an? Gute Frage. Nächste.
Ich kam mir fast vor, wie am ersten Schultag. Da wollte man ja auch mit seinen schönsten Sachen vor den anderen Kindern glänzen. Ein amüsiertes Lächeln umspielte meine Mundwinkel. Doch es war nicht mein erster Schultag, es war mein erster Urlaubtag und da war es doch eigentlich völlig egal was ich anzog.
Das Lächeln verschwand. Dennoch trieben meine Gedanken mit diesem kurzen Aufblitzen in die Vergangenheit zurück. Weit zurück. Ins Jahr 1983.
Ins Jahr meiner Einschulung. Ich war fast sieben Jahre alt, als ich endlich zur Schule durfte. Grund dafür war nicht etwa das ich blöd war, sondern mein Geburtstag. Ich hatte am 25. Oktober Geburtstag, also war ich in dem betreffenden August, im Jahr davor, noch keine sechs Jahre und wurde somit ein Jahr später eingeschult.
Deswegen gehörte ich immer zu den Ältesten in der Klasse. Doch das war nicht DAS, woran ich gerade gedacht hatte. Nein, mir ging etwas ganz anderes durch den Kopf…nämlich die zweite Schulwoche.
Denn hier hatte ich eine ziemlich schlimme Erfahrung gemacht, die sich allerdings auch als wahrer Glücksfall herausstellte. Ein Sechser im Lotto, sozusagen…oder anders formuliert, die goldene Nadel im stinkenden Misthaufen. Je nachdem, wie man es betrachtete.
1983
„Mama?“
„Was ist? Musst du schon am frühen Morgen nerven? Iss dein Brot und sei still!“
Eingeschüchtert senkte ich den Kopf und starrte auf das Honigbrot herab. Ein Honigbrot OHNE Butter darunter. Ich hasste Honigbrote ohne Butter. Da lief die klebrige Masse immer direkt durch die Luftlöcher der staubtrockenen Brotscheibe und tropfte auf den Teller oder auf meine Hand. Dennoch schwieg ich und biss schnell ein Stück von dem Brot ab. Trotz des Honigs, war es eine krümelige Masse in meinem Mund, die sich nur schwer kauen und runterschlucken ließ. Also kaute ich und kaute und kaute, um anschließend den Klumpen mit einem Schluck kalten Tee herunter zu spülen.
Eigentlich wollte ich meine Mutter nach Geld fragen. Geld, dass ich für die Schulfotos brauchte, die sie am ersten Schultag vom Schulfotografen von mir hatte machen lassen. Nun wollte der Mann seinen Lohn. Erst dann bekam ich die Bilder ausgehändigt.
Das trockene Honigbrot hätte mir allerdings schon die Antwort auf meine geplante Frage liefern können.
Aber ich wollte diese Fotos. Unbedingt. Es gab nicht viel Fotos von mir und dies wäre ein Foto, wo ich geschniegelt, gekämmt UND mit meiner selbstgebastelten Schultüte posierte. Es war bestimmt ein tolles Bild geworden. Dieser dringende Wunsch verlieh mir den Mut, noch einmal einen Vorstoß zu wagen.
„Mama, der Fotograf hat gefragt, ob ich ihm die zehn Mark für die Schulfotos mitbringen kann. Die sind nämlich schon fertig.“
Ehe ich antwortheischend nach oben schauen konnte, klatschte eine große, weibliche Hand laut auf meine Wange. Mein Kopf schnellte herum und aus meinem halb geöffneten Mund flogen kleine feuchte Brotkrümel heraus. Ein Fingernagel ritze mich kurz unter dem rechten Auge. Das tat weher, als der Schlag selbst. In dem Moment, als ich meine brennende Wange anfing zu reiben, ergoss sich bereits Mutters Tirade wie ein Wolkenbruch über mich.
„Geld. Geld. Geld. Was soll das? Bin ich etwa die Wohlfahrt? Du sitzt immer nur da und hältst die Hand auf und ich kann dann gucken, was ich machen soll. Aus deinem Mund kommt ständig nur: ich will, ich will, ich will. Soll ich mir die Penunsen etwa aus den Rippen schneiden oder meinst du, wir hätten im Garten einen Geldbaum, wo ich der lieben Madame etwas pflücken kann? Wir haben noch eine Woche bis Monatsende und im Portemonnaie herrscht jetzt schon Ebbe. Warum rufst du nicht mal deinen ach so tollen Vater an? Der hat deinen Unterhalt letzten Monat auch schon nicht überwiesen, da kann er ruhig die Fotos bezahlen. Ist sowieso Schwachsinn, diese bescheuerten Bilder. Die landen im Schrank und niemand hat was davon. Und essen kann man sie auch nicht.“
Fauchend, wie eine kampfbereite Katze, sprang sie auf. Der Stuhl hinter ihr kippelte gefährlich und schlug nach ein, zwei unschlüssigen Sekunden krachend auf den Boden hinter ihr. Doch das schien meine Mutter nicht zu stören. Sie starrte mich noch kurz böse an, schien dabei zu überlegen für was sie mich noch verantwortlich machen konnte, rannte dann aber überraschenderweise ohne ein weiteres Wort aus der Küche raus und ließ mich, mit meiner brennenden Wange alleine und verdutzt zurück. Ich schaute ihr mit zusammengekniffenen Augen nach. Aber SIE hatte die Bilder doch gewollt.
Warum bekam ICH jetzt eine gescheuert?
Und dass mein Vater, den ich ohnehin nicht kannte, kein Unterhalt gezahlt hatte, dafür konnte ich auch nichts.
Das war Erwachsenenkram. Ich war doch noch ein Kind. Eine Träne schmuggelte sich aus meinem rechten Auge. Eine weitere folgte ihr auf dem Fuß.
Doch ich weinte nicht, weil meine glühende Backe wehtat…ich weinte aus Wut.
Ich war wütend auf meine ungerechte Mutter und auch auf meinen abtrünnigen, geizigen Vater.
Immer gab Mama mir an allem die Schuld. Konnte sie nicht mal jemand anderes anblöken?
Ohne das restliche klebrige Brot noch zu essen, rutschte ich ebenfalls vom Stuhl herunter und trottete in mein Zimmer. In mein ziemlich trostloses Zimmer.
Zwar hatte ich alles, was ein Kind so brauchte…Bett, Kleiderschrank und ein paar Spielsachen vom Flohmarkt, doch alles war irgendwie zusammengewürfelt und die Tapeten sahen auch beschissen aus.
Altmodische Blumenranken. Igitt. Die stammten noch vom Vormieter. Meine Mutter hatte mir damals großspurig versprochen, ich würde eine neue Glitzertapete bekommen und einen schönen flauschigen Teppich, auf dem ich spielen konnte, doch nichts davon hatte hier Einzug gehalten.
Dieses Versprechen war nun auch schon ein Jahr her.
Ich vermutete, dass meine Mama dies einfach kurzerhand vergessen hatte. War ja auch bequemer…und billiger.
Also arrangierte ich mich mit diesen doofen Blumenranken, was mir an manchen Tagen allerdings ziemlich schwerfiel. Heute, nach dem Intermezzo in der Küche, war so ein Tag. Die Tapete kotzte mich von allen vier Seiten an und ich kotzte zurück. Bildlich gesprochen. Ohne mein Zimmer noch eines vernichtenden Blickes zu würdigen, schnappte ich meinen Ranzen, hoffte nebenbei, dass ich alle Hausaufgaben erledigt hatte und verließ die muffige Wohnung.
Ohne die zehn Mark. Sollte der blöde Fotograf die blöden Bilder eben behalten.
Das war mir doch so was von schnuppe!
Ziemlich geladen machte ich mich auf den Schulweg, der gute fünfzehn Minuten meiner Lebenszeit beanspruchte. Je näher ich der Schule kam, umso mehr Kinder sah ich. Die meisten waren mir fremd. Doch dann sah ich eine Klassenkameradin, die gerade aus dem hübschen roten Auto ihrer Mutter krabbelte. Etwas neidisch beobachtete ich die liebevolle Verabschiedung der beiden. MEINE Mutter hatte sich noch nie mit einem Küsschen von mir verabschiedet. Dieser Gedanke versetzte meinem kleinen Herz doch einen unangenehmen Stich, den ich jedoch ignorierte. Das Mädchen, Viola hieß sie, warf sich ihren nagelneuen Ranzen über die Schulter, sah mich und drehte sich, mit rollenden Augen kurzerhand weg. Ich wartete noch ein paar Sekunden, dann folgte ich ihr auf das Schulgelände. Etwas verloren schaute ich mich um.
Die meisten Erstklässler spielten lautstark Fangen, die Größeren lümmelten sich in den Ecken des Pausenhofes und hielten sich demonstrativ von dem Kleingemüse fern. Als ob wir verseucht wären.
Überall standen kleine Grüppchen, die schnatternd die Köpfe zusammenstecken. Auch Viola verschwand in solch einem Pulk. Nur ich stand da und wusste nicht wohin.
Um nicht doch noch von den anderen herumlaufenden Kindern umgerannt zu werden, trottete ich mit hängendem Kopf an die große zweiflüglige Tür.
Beim ersten Klingeln durften wir hinein. Dann wäre ich die Erste. Dieses Wissen zauberte ein kleines Grinsen auf mein Gesicht.
Ich musste auch gar nicht lange warten. Kurz darauf schrillte es bereits und ich riss augenblicklich die Glastür auf. Mit hüpfendem (gebrauchtem) Ranzen auf dem Rücken stürmte ich die Treppe nach oben in den ersten Stock. Dort war mein Klassenzimmer. Hier war es wesentlich hübscher, als bei mir Zuhause und es gab auch keine dämlichen Blumenranken-Tapeten. Dafür Tafeln.
Zwei Stück. Eine ausklappbare vorne und eine lange an der rechten Seite. Dort wurden die Hausaufgaben aufgeschrieben. Gut, im Moment aufgemalt, den offiziell konnte ja noch keiner lesen. Doch die meisten konnten dies bereits, wenn auch etwas stockend. Ich bildete da die große Ausnahme. Bei mir mussten die Lehrer in der Tat fast bei null anfangen. War halt so.
Gerade als das letzte Kind seinen Platz eingenommen hatte, betrat auch schon Frau Jager, meine Klassenlehrerin, den Raum. Zusammen mit guter Laune und ihrer Aktenmappe verströmte sie zu allererst einmal ihre Hiobsbotschaft. Für mich WAR es eine Hiobsbotschaft, für die meisten anderen weniger.
„SO, RUHE MEINE HERRSCHAFTEN, RUHE! NACH DER ERSTEN STUNDE SAMMELE ICH DAS GELD FÜR DEN FOTOGRAFEN EIN. ICH HOFFE, IHR HABT DARAN GEDACHT! UND JETZT DAS MATHEBUCH HERAUS!“
Alles murrte pro Forma. Ich glaube, so ist das heute noch. Wenn der Lehrer sagt: Mathebuch raus, dann murrte man. Ich murrte auch, doch nicht wegen dem Mathebuch. Ich murrte, weil ich einen Teil der Ansage erfüllt hatte und den anderen Teil leider nicht. Ich HATTE an das Geld gedacht, aber ich HATTE es eben nicht dabei. Während ich lustlos das Mathebuch aufschlug überlegte ich fieberhaft, wie ich mich aus dieser unangenehmen Situation herauswinden konnte, ohne von den anderen ausgelacht zu werden. Doch mir fiel partout nichts ein.
Dieses Unwissen verursachte ein leichtes, aber unangenehmes Kribbeln hinter meiner Stirn.
Neben mir kicherte es plötzlich und ich warf einen Blick zur Seite. Wurde etwa schon über mich gelacht?
Das leise Kichern kam von Viola, die eine Hand vor ihren hämisch grinsenden Mund hielt, ihre Nachbarin kurz anrempelte und auf die Schuhe ihres Vordermannes zeigte. In diesem Fall wohl eher das Vordermädchen.
Denn vor Viola saß ein rotblondes Mädchen, bekleidet mit grünkariertem Schottenrock, einem schwarzen ausgewaschenem Shirt, grünen Ringelsocken und blauen Jungenschuhen. Ziemlich abenteuerlich. Sogar für meinen Geschmack und der war schon nicht anspruchsvoll.
Ich war mir nicht sicher, wie dieses Mädchen hieß.
Sie war neu in der Stadt und ich hatte sie noch nie zuvor gesehen. Aber ich glaubte zu wissen, dass sie Gabriele hieß. Man sah Gabriele an, dass sie das Kichern hinter sich ebenfalls gehört hatte, denn sie straffte plötzlich den Rücken, lehnte sich zurück und zog ihre Füße dabei nach vorne. Ich fand es gemein von Viola, über Gabrieles Schuhe zu lachen. Bestimmt hatten ihre Eltern kein Geld für neue Schuhe. ICH wusste wie sich sowas anfühlte, denn meine Mutter hatte ja auch kein Geld. Aus diesem Grund erklärte ich mich spontan mit dem fremden Mädchen solidarisch und zischte Viola böse und demonstrativ laut an, „PSSSSSSST!“
Viola schaute mich erstaunt an, schüttelte ihr seidiges blondes Haar und verzog ihr Gesicht zu einer hässlichen Schnute.
„VIOLA! WÜRDEST DU BITTE AUFHÖREN FAXEN ZU MACHEN? KOMM AN DIE TAFEL!“
Die hübsche Viola zuckte erschrocken zusammen und erhob sich zögerlich. Dabei warf sie mir noch einen giftigen Blick zu, den ich genüsslich lächelnd an mir abtropfen ließ.
So! Das hatte die eingebildete Kuh nun davon.
Doch mein Übermut währte nur kurz, denn noch immer hatte ich keine passende Ausrede parat, die erklären würde, warum ich das Geld nicht dabeihatte.
Offensichtlich übertrug sich diese unruhige Gewissenslage auch auf meine Blase, denn ich musste ganz plötzlich dringend aufs Klo. Sofort sauste meine Hand nach oben,
„Frau Jager? Ich muss mal.“
Frau Jager war eine nette Lehrerin, die uns noch die nächsten vier Jahre begleiten würde, doch in diesem Moment wirkte sie leicht genervt.
War Voila etwa daran schuld?
Frau Jager schaute zur Uhr an ihrem Handgelenk und ich fragte mich unwillkürlich, was die Uhrzeit mit meiner vollen Blase zu tun hatte.
Sie blickte mich anschließend leicht tadelnd an, „Nimm Gabriele mit. Ihr wisst, ihr dürft nur zu zweit auf die Schultoilette.“ Sofort sprang die rotblonde Gabriele auf und grinste mich mit einem Zahnlücken-Lächeln an, „Das ist gut. Ich muss nämlich auch.“
Ich grinste zurück. Hand in Hand trollten wir uns aus dem Klassenzimmer, gefolgt von der obligatorischen Mahnung,
„UND BITTE NICHT TRÖDELN!“
Gabrieles Hand fühlte sich leicht klebrig an. Entweder hatte sie auch ein Honigbrot heute Morgen oder sie schwitzte zu viel.
Der Grund dafür war mir in diesem Moment aber völlig schnuppe. Lachend liefen wir zum Klo, wo ich mich sofort in eine der Kabinen einschloss um in aller Ruhe zu pullern. Gabriele besetzte das Klo rechts neben mir und grunzte aus tiefstem Herzen, „Die Viola ist eine doofe Kuh!“ Obwohl ich gerade angestrengt am pinkeln war, musste ich lachen. Aber das Lachen blieb mir eine Sekunde später im Hals stecken, als mir meine eigene Lage wieder vor Augen erschien. Deshalb endete mein Lachen mit einem schwermütigen Seufzen, „Ja, das stimmt. Aber sie hat bestimmt keine Probleme, dass Geld für die Fotos zu bekommen. Du musst nur mal ihre Schuhe anschauen.
Die haben sogar etwas Absatz. Bestimmt sind ihre Eltern stinkreich.“
Plötzlich wurde mir klar was ich da gesagt hatte. Erschrocken schlug ich meine Hand auf den Mund. Mist. Warum hatte ich nur die blöden Schuhe erwähnt?
Was, wenn Gabriele wusste, dass Viola über IHRE Schuhe gelacht hatte?
Heiße Schamesröte überzog mein Gesicht, dass Gabriele aber nicht sehen konnte. Ich hörte Kleidergeraschel neben mir und anschließend die Klospülung. Mit einem leisen Klicken öffnete sich die Tür neben mir und ich hörte Gabrieles unschuldigen Kommentar, „Hast du dein Geld vergessen?“ Ich schnaufte.
So konnte man es natürlich auch formulieren.
Etwas angesäuert betätigte ich ebenfalls die Klospülung und zerrt meine ausgeleierte Jeans nach oben. Dann trat ich ebenfalls aus der Kabine und ging rüber zum Waschbecken.
Gabriele saß auf dem Waschbeckensims, baumelte mit den auffällig bestrumpften Füßen und grinste wissend,
„Du hast es nicht vergessen, stimmts? Lass mich raten. Du hast nach dem Geld gefragt und direkt eine gescheuert bekommen.“
Ertappt und vor allem völlig perplex blickte ich auf,
„Woher weißt du das?“
Mir kam erst gar nicht in den Sinn, diese Aussage zu leugnen.
Sie stippte mit einer triumphierenden Miene und mit ihrem dünnen Zeigefinger unter mein rechtes Auge, „Ist noch ganz frisch. Also ist es von heute Morgen. Da ich nicht davon ausgehe, dass du dir freiwillig deine Zahnbürste ins Gesicht gerammt hast, kann es sich nur um einen Ring oder einen Fingernagel handeln.“
Erneut schoss heiße Schamesröte meinen Hals empor und färbte meine Wangen blutrot. Schnell senkte ich den Blick und fragte mich fieberhaft, wie sie das so schnell hatte erraten können. Gabriele musste ziemlich clever sein.
Doch die Verlegenheit schnürte mir noch immer die Kehle zu und ich schluckte hart ehe ich völlig verkrampft meine derzeitige desolate Lage zugab, „Ist halt doof, wenn man kein Geld hat.“
Ihr glockenhelles Lachen ließ mich abrupt verwirrt aufschauen.
Was war denn daran so komisch? ICH fand es auf jeden Fall NICHT komisch.
Gabriele rutschte leichtfüßig von dem schmalen Sims herunter und glättete unnötigerweise ihren furchtbaren karierten Rock, „Komm, wir müssen zurück. Sonst meckert die alte Ziege noch.“
Etwas verunsichert folgte ich ihr. Ich mochte es nicht sonderlich, dass sie die nette Frau Jager eine alte Ziege nannte, aber ich schwieg. Obwohl Gabriele eben das enge Zeitfenster erwähnt hatte, machte sie unverhofft einen Umweg. Naiv wie ich war, trottete ich einfach hinterher. Als wir am Lehrerzimmer vorbeikamen, hielt sie mich urplötzlich am Arm fest und legte mir ihren Zeigefinger auf die Lippen, „Pssst. Warte hier!“ Wusch! Weg war sie. Mit einem rumorenden Unwohlsein in meiner Magengegend schielte ich ihr hinterher und beobachtete, wie sie in den Tiefen des verbotenen Raumes verschwand. Ich wusste, dass kein Schüler ohne erwachsene Begleitung diesen Raum betreten durfte.
Gabriele WAR aber alleine.
Also? Was machte sie dort drin?
Wusste sie vielleicht nicht, dass man da nicht einfach so reinmarschieren durfte?
Etwas bange schaute ich mich um und starrte den langen Gang entlang.
Was, wenn nun ein Lehrer kam? Was sollte ich dann sagen? Dass sie beide sich verlaufen hätten? Das glaubte der doch nie.
Ehe ich mir ängstlich schwitzend, vorsichtshalber eine halbwegs plausible Erklärung zusammengebastelt hatte, erschien Gabriele glücklicherweise wieder. Erleichtert ließ ich die angehaltene Luft aus meinen Lungen entweichen.
„Was hast du denn da drin gemacht?“
Gabriele sagte nichts, sondern schob mir mit einem frechen Grinsen etwas in die Hand. Verdutzt starrte ich hinunter und erblickte einen bläulich schimmernden Geldschein.
Es waren zehn Mark.
Ich zischte leise, als ob ich mich verbrannt hätte und streckte ihr den Schein sofort wieder entgegen, „Spinnst du? Hast du den jetzt etwa geklaut?“
Sie zuckte nachlässig mit den Schultern, „Du hast ihn doch gebraucht und die meisten Erwachsenen haben so viel in ihrem Geldbeutel, dass ihnen nicht auffällt, wenn was fehlt. Außerdem sind es doch nur zehn Mark. Reg dich ab und bezahl später einfach deine Fotos.“
Mit einem abfälligen Grunzen, das wohl meiner Angst gegolten hatte, drehte sie sich auf den schiefgetretenen Absätzen herum und machte sich auf den Weg zurück in die Klasse. Mit einem mulmigen Gefühl setzte ich mich ebenfalls in Bewegung. Den Schein knüllte ich in meinen schwitzenden Handflächen einfach zusammen und stopfte ihn mir in die hintere Hosentasche.
Die kleine Diebin vor mir, packte gerade die Klinke der Schulklassentür, zwinkerte mir noch zu und riss sie selbstbewusst grinsend auf. Ich schlüpfte wie ein kleines graues Mäuschen eine Sekunde später ebenfalls hinein und verkrümelte mich mit gesenktem Kopf wieder auf meinen Platz.
Frau Jager schaute nur kurz auf und lächelte.
Ach Gott. Wenn sie wüsste? Dann würde ihr nettes Lächeln, wie ein fauler Apfel einfach auf den Boden plumpsen.
Ich schämte mich, doch gleichzeitig fühlte ich mich erstaunlicherweise auch unendlich erleichtert. Ich konnte jetzt die Bilder bezahlen und niemand würde mich auslachen, weil ich arm war. Und das alles verdankte ich einem rotblonden Mädchen, namens Gabriele,
die schräg vor mir saß und nun aufmerksam unserer Lehrerin lauschte, als ob nichts gewesen wäre.
Ich befingerte vorsichtig mein unmerklich ausbeultes Hinterteil und ganz spontan kam mir der Gedanke, dass noch NIE jemand etwas so Nettes für mich getan hatte, wie sie gerade.
Die nächsten zwanzig Minuten verbrachte ich wie hinter einem Nebelschleier, so dass ich dem Unterricht kaum folgen konnte, was zur Folge hatte, dass ich überhaupt nicht wusste, was Frau Jager gerade durchgenommen hatte. Doch das war mir jetzt mal gerade völlig egal.
Ein kurzes Läuten aus der Lautsprecheranlage verkündete schließlich das Ende der ersten Stunde und ein Kind nach dem anderen ging brav nach vorne, um das Foto-Geld abzuliefern und abgehakt zu werden. Als die Reihe an mir war, erhob ich mich zögernd. Gabriele drehte sich um und musterte mich neugierig.
Ihre blassblauen Augen schienen mich zu fragen:
Und? Was ist? Willst du mich jetzt verpetzten?
Ich starrte ihr noch eine Sekunde ins Gesicht, dann nickte ich unmerklich und stampfte entschlossen nach vorn, wo ich ohne mit der Wimper zu zucken, den geklauten Schein auf das Pult legte. Frau Jager schaute kurz hoch, lächelte mich unschuldig an und steckte den Schein in eine Box,
„Danke Kornelia!“
Ich lächelte schamlos zurück und begab mich wieder auf meinen Platz. Eigentlich hätte mich mein schlechtes Gewissen plagen sollen, tat es aber nicht. Zufrieden absolvierte ich den restlichen Morgen und bekam am Ende der letzten Stunde einen gefalteten Hochglanz‑ Karton in die Hand gedrückt, dessen Inhalt meine wunderschönen Einschulungsfotos waren.
Als eine der Letzten verließ ich das Schulgebäude und entdeckte Gabriele auf der Mauer, die das Schulgelände halbherzig vom Straßenverkehr abgrenzte. Sie winkte mir unbekümmert zu. Offensichtlich war sie froh, dass ich sie nicht verpetzt hatte und ich war auch froh darüber, denn ich fand Gabriele richtig cool.
Vielleicht mochte sie ja meine Freundin sein?
Unsicher grinsend trabte ich auf sie zu, „Danke, Gabriele!“ Mehr sagte ich nicht.
Ich erwähnte den Raubzug nicht und auch nicht, dass man dies eigentlich nicht tun sollte. Ich sagte einfach nur Danke. Gabriele hatte meine Haut gerettet und nur das zählte in diesem Augenblick für mich. Mit einem gekonnten Hopser verabschiedete sie sich von dem Mauerstreifen, grinste mich schelmisch an und hakte sich bei mir unter, „Willst du auch ein Stück Schokolade?“
Ich lachte, „Du hast Schokolade dabei? Wo hast du DIE denn auf einmal her?“
Gabriele blieb stehen, ruckelte den Ranzen herunter und kramte umständlich darin herum. Dabei gab sie mir, wenn auch unbewusst, einen Teil ihres Lebens preis, „Meine Oma steht oft hinten an der Ecke und wartet dort auf mich. Dann gibt sie mir mein Pausenbrot.
Mama und sie reden nicht mehr miteinander und sie hat Oma verboten mich zu besuchen. Also fängt Oma mich immer auf dem Schulweg ab. So kriegt die Mama das nicht mit. Heute hat sie mir noch eine Tafel Schokolade gegeben und das Geld für die Fotos. Wäre sie nicht gewesen, hätte ich genauso belämmert dagesessen, wie du heute Morgen.“
Sie hatte endlich die Schokolade gefunden und richtete sich triumphierend auf. Großzügig brach sie mir zwei Rippen ab und steckte sich selbst ein großes Stück in den Mund. Dann wuchtete sie den Ranzen wieder auf ihren Rücken und winkte auf einmal quer über die Straße. Ich folgte dem freudigen Winken mit meinen Augen und sah eine ältliche, blonde Frau, die einen besonders hübschen, wollweißen Poncho trug und zurückwinkte.
Gabriele lieferte auch gleich die Erklärung, „Das ist meine Oma. Sie wird die Fotos für mich aufheben, damit Mama sie nicht findet. Ich muss dann mal los. Bis Morgen, Kornelia.“
Etwas perplex blieb ich stehen und beobachtete zwei Minuten später die liebevolle Umarmung, die Gabriele auffing. Doch DIESER Anblick machte mich komischerweise überhaupt nicht neidisch. Im Gegenteil. Nachdem, was ich gerade erfahren hatte, gönnte ich Gabriele diese heimliche Zuneigung von Herzen.
Auch sie schien kein leichtes Los gezogen zu haben. Die beiden drehten sich um und verschwanden um die Ecke. Für mich wurde es auch langsam Zeit. Obwohl ich keine sehr große Lust verspürte nach Hause zu gehen, setzte ich mich in Bewegung.
Plötzlich tauchte der Gedanke an die wundervollen Fotos auf und zugleich die bange Frage, wo ich sie verstecken sollte. Denn ich MUSSTE sie ja verstecken.
Wie sollte ich meiner Mutter erklären, dass ich im Besitz dieser Fotos war…ohne Geld? Vielleicht konnte ich sie ja im Keller verstecken? Da ging meine Mutter so gut wie nie hin, oder? Nein, da war ihr es zu muffig.
Die Fotos würden allerdings in der feuchten Bruchstein‑ Katakombe bestimmt vergammeln. Außerdem war es dort irgendwie unheimlich und ich wollte mir die Bilder ja hin und wieder auch mal anschauen. Es blieb eigentlich nur mein Zimmer. Ich musste also dafür sorgen, dass meine Mutter so selten wie möglich das Zimmer betreten würde. Das konnte ich nur, indem ich meine Bude selbst aufräumte, selbst die Wäsche wegräumte und auch selbst mein Bett machte. Viel Arbeit für ein paar Bilder.
Aber es waren MEINE Bilder. MEIN Eigentum. MEIN geheimer Schatz.
Dafür würde ich schon ein Opfer bringen müssen. Während dieser intensiven Überlegungen bekam ich nicht mit, dass ich plötzlich vor dem Haus stand, in dem ich wohnte. Überrascht hob ich den Kopf und schaute die abgeblasste gelbe Fassade empor, bis hinauf in den dritten Stock, zu dem kleinen Fenster, hinter dem ich unsere altersschwache Küche wusste. Mein Herz fing an zu klopfen und ich trat zögerlich zur Haustür.
Während ich unschlüssig auf die fünf Klingelköpfe starrte, nagte ich auf meiner Unterlippe herum. Ich sah, wie sich mein Zeigefinger hob und den zweitletzten Knopf ansteuerte, von dem ich wusste, dass es unsere Klingel war.
Gerne hätte ich meinem Finger diese Geste verboten, doch ich konnte ja nicht ewig hier auf der durchgelatschten Fußmatte herumstehen. Der Finger senkte sich und drückte widerwillig den kleinen silbernen Knopf nach unten. Wie aus weiter Ferne ertönte ein helles Summen, dass sich in der dritten Etage in ein durchdringendes Schellen verwandelte. Ich konnte dieses aufdringliche Geräusch sogar in meinem Kopf hören.
Mein schwitzender Finger löste sich von der Klingel, doch das Schellen ließ überraschenderweise nicht nach...
2019
Verwirrt blinzelte ich in meinen Kleiderschrank, vor dem ich noch immer stand. Die eingestaubte Kindheitserinnerung verflüchtigte sich schlagartig, aber das Läuten setzte sich trotz allem aufdringlich fort und es dauerte noch eine weitere zähe Sekunde, bis mir klar wurde, dass es sich hier um mein Telefon handelte. Noch im Pyjama stürzte ich in den Flur und riss das schnurlose Telefon von seiner Ladestation, „KORN!
„Hallo Urlauberin. Und? Schon wach? Wie sieht es aus? Haste Bock auf ein Frühstück?“
Ich kannte die flapsig klingende Stimme. Sie zauberte mir sofort ein breites Lächeln auf mein Gesicht.
Wenn man an den Teufel dachte!
Es war Gabriele. Jene Gabriele, die gerade eben in meinen Erinnerungen herumgegeistert war.
„GABI! NA HALLO. DU RUFST ABER SCHON FRÜH AN.“
Am anderen Ende der Leitung ertönte ein abfälliges Grunzen, „Deswegen musst du mich ja nicht anblöken wie ein brunftiges Schaf. Ich bin ja nicht taub.“
Ich unterdrückte ein leises Kichern und reduzierte augenblicklich meine Lautstärke, „Tschuldigung, Süße. Ich habe gerade an dich gedacht.“
„So?“ Ein gespieltes Misstrauen schwappte mit diesem einen Wort in meine Ohrmuschel.
„Ja, ich habe eben an die zehn Mark für die Einschulungsfotos gedacht.“ Ganz automatisch hob ich den Kopf und betrachtete mir eine uralte Fotografie, die vor mir an der Wand hing. Es war an die 35 Jahre alt und schon leicht verblasst. Es zeigte mich mit einer bunten, selbstgebastelten Schultüte und ich grinste wie ein Honigkuchenpferd im Zuckerrausch.
Daneben hing das modernere Foto meines Sohnes, ebenfalls mit Schultüte, die ich ihm damals in mühsamer Kleinstarbeit nachts heimlich unter Mithilfe von zwei Tuben Kleber zusammengepfriemelte hatte.
SEINE Fotos waren jedoch ganz regulär bezahlt. Doch an MEINEM Einschulungsfoto haftete ein unaufgeklärtes Verbrechen und der Beginn einer jahrzehntelangen Freundschaft. DAS machte mein Foto zu etwas Besonderem, obwohl das Foto meines Sohnes auch etwas Besonderes war. Schließlich war er mein einziger Spross. Sozusagen der Kronprinz dieser zweiköpfigen Familie. Bevor meine Gedanken zu Personen schwenken konnten, die eben NICHT mehr zu meiner Familie gehörten und an die ich auch keine weiteren Gedanken verschwenden mochte, wendete ich meinen Blick ab und nahm Gabi kurzerhand mit in die Küche. Dort setzte ich mich an den ungedeckten Tisch mit dem plappernden Hörer in der Hand und frönte einem ungezwungenen Plausch, der nach einer viertel Stunde mit einer Verabredung endete, dass mich gegen zehn Uhr zu einem gemütlichen Frühstück in ein kleines Café auf den Schlossplatz führen sollte.
Als die telefonische Verbindung beidseitig gekappt wurde, lächelte ich noch immer.
Die Gabi Weiler. Meine beste Freundin. Ich liebte dieses verrückte Huhn.
Gabis fröhliches und sorgloses Naturell trieb meinen morgendlichen Enthusiasmus zur Höchstleistung an. Ich raffe mich tatsächlich dazu auf, etwas Kultur in meinem chaotischen Heim zu schaffen. Außerdem musste ich ja die zwei Stunden bis zur Verabredung überbrücken.
Also widmete ich meine folgende Aufmerksamkeit ganz dem lästigen Haushalt, der überfälligen Wäsche und den Wollratten unter meinen Heizkörpern.
Für Wollmäuse waren sie schon zu groß.
Gegen halb zehn verließ ich erleichtert und auch ein wenig stolz mein aufgeräumtes und gesäubertes Schneckenhaus und sprang wie ein übermütiges Füllen die Treppe hinab. Im Gepäck einen ausgewachsenen Hunger, vier gluckernde Kaffeetassen im Bauch und mein gefülltes Portemonnaie. Vielleicht schloss sich ja noch ein Shoppingtrip an das spontane Frühstück an?
Bei Gabi wusste man nie.
Das Zusammentreffen mit meiner besten Freundin tat mir gut. Wir fraßen uns giggelnd die Speisekarte rauf und runter, gurgelten dabei zwei Gläser Sekt und versanken gemeinsam in verklärten Erinnerungen. Das machte wesentlich mehr Spaß, als alleine durch die Vergangenheit zu schippern, so wie ich heute Morgen vor dem Kleiderschrank.
„Weißt du eigentlich, dass die Etepetete-Viola wie ein Hefekuchen auseinander gegangen ist und nun aussieht wie ein aufgeplatztes Sofakissen?“
Ich verneinte kauend und gab auch sonst keinen Kommentar dazu ab. Viola interessierte mich nicht sonderlich. Sie war in der Grundschule schon eine doofe Schnepfe gewesen und würde es heute bestimmt auch noch sein. Es gab Menschen, denen wurde Gehässigkeit, gepaart mit solider Gemeinheit schon in die Wiege gelegt. Viola war eine von denen. Jeder Gedanke an solche Menschen war ein Gedanke zu viel.
Das war meine Meinung.
Ich wollte an solche Leute, von denen leider einige fiese Exemplare meinen Lebensweg pflasterten, nicht denken…nicht an meinen ersten Urlaubstag.
Deshalb prostete ich Gabi einfach stumm zu und leerte in einem Rutsch mein noch halbvolles Sektglas. Gabi pfiff leise, „Man, du hast ja ein Zug am Leib. Man könnte meinen, du hättest Geburtstag und würdest dein biblisches Alter runterspülen wollen.“
Diese trockene Aussage ließ mich ungewollt losprusten, wobei mir prompt der letzte Schluck wieder aus der Nase herausschoss. Es prickelte furchtbar in meinen Nebenhöhlen, während ich mir verzweifelt kichernd schnell die Hand vor den Mund hielt und blindlings auf dem Tisch nach meiner noch unbenutzten Serviette tastete. Das ältliche Pärchen neben uns, warf mir einen scheelen Seitenblick zu, den Gabi mit einer komischen Schnute quittierte. Das brachte mich erneut zum Lachen, doch meine suchenden Finger hatten mittlerweile die Serviette ausfindig gemacht. Eilig presste ich sie auf mein Gesicht, bevor der nächste Schwall hervorspritzte. Ich musste einen wirklich unappetitlichen Anblick geboten haben, denn die Frau rutschte mit säuerlicher Miene auf ihrem Stuhl so herum, dass sie mir ihre kalte Schulter zeigen konnte. Ihr Mann, wenn es denn ihr Mann war, warf uns noch einen zornigen Blick zu.
Herrje, verstand der alte Knabe denn keinen Spaß?
Gabi verzog ihre schmalen Lippen zu einem lasziven Lächeln und hauchte dem alten Mann einen Luft-Kuss zu, den er jedoch ebenfalls gekonnt an seiner kalten Schulter abprallen ließ, was Gabi jedoch nicht störte. Sie wand ihre Aufmerksamkeit wieder meinen keuchenden und sekttriefenden Überresten zu, „Wenn du fertig bist, könnten wir dann mal ein Plänchen machen, was wir heute noch so anstellen könnten?“
Erstaunt blickte ich auf, wischte mir lautstark schnaubend über die Nase und nuschelte dazwischen, „Musst du denn nicht arbeiten?“
Meine Freundin winkte lässig ab, „Ich habe mich krankgemeldet…zur Feier des Tages. Außerdem macht das Abhängen mit dir viel mehr Spaß, als den ganzen Tag eingetrocknete, knobiverseuchte Essensreste von den Tellern zu kratzen.“
Gabi arbeitete seit ein paar Wochen als Küchenhilfe in einem kleinen griechischen Restaurant in der Nähe des Bostalsees. Ein Job, den sie von Anfang an hasste, wie ich wusste. Doch von irgendetwas musste sie ja schließlich ihre Miete bezahlen, auch wenn ich der Meinung war, dass ihr kümmerliches Kämmerlein in dem sie über einem Friseursalon hauste, keinen Cent Miete wert war. Das hatte ich ihr schon vor einem Jahren gesagt und ihr zugleich angeboten, bei mir einzuziehen.
Meine solide Vier-Zimmer-Wohnung hatte noch ein lauschiges Verlies frei. Doch davon hatte Gabi nichts wissen wollen. Sie liebte ihre Unabhängigkeit, fast genauso wie sie ihre schäbige Rostlaube liebte, die sie großspurig als Auto bezeichnete. Gabi war ein Freigeist, den niemand an die Leine legen konnte und genau das gefiel mir an ihr. Trotzdem machte mir ihre lockere Lebensweise zuweilen etwas Sorgen.
Sie wechselte die Jobs, wie andere Leute ihre Unterwäsche. Ob das ein guter Lebensstil war? Ich bezweifelte es.
Gerne hätte ich, gerade in diesem Augenblick, mein großzügiges, damaliges Angebot wiederholt, doch Gabrieles Kopf kreierte gerade andere Pläne.
„Wir könnten rüber nach Frankreich fahren und dort zum Mittagessen Flammkuchen essen. Was hältst du davon? Auf dem Rückweg kreuzen wir dann über Luxemburg und versorgen uns noch mit Zigaretten.“
Mit uns, meinte sie sich, denn ich rauchte nicht. Aber ich trank literweise Kaffee. So viel, dass man es auch schon fast als Sucht bezeichnen könnte.
Deshalb willigte ich ohne zu zögern ein, „Du Zigaretten, ich Kaffee!“ Gesagt, getan.
Wir bezahlten, was dem ältlichen Pärchen ein erleichtertes Seufzen von den zusammengepressten Lippen schlüpfen ließ. Gottlob ließ Gabriele dies unkommentiert. Arm in Arm schlenderten wir gutgelaunt aus dem Café und strebten einen grünorangefarbenen, mattlackierten Renault Clio älteren Semesters an.
Gabis langjährig gehüteter Augapfel.
Dieses museumsreife Schätzchen chauffierte uns ohne zu meckern oder Öl zu spucken die anfallenden achtzig Kilometer und durfte sich an einer dortigen Tankstelle kostengünstig sattschlürfen. Anschließend mampften wir einen Stapel hauchdünnen Flammkuchen-Fladen und befriedigten unsere Sucht nach günstigem Kaffee und billigen Zigaretten. Danach brachte uns eben jenes museumsreife Schätzchen am frühen Abend wohlbehalten und ohne die weißen Fähnchen zu hissen, wieder artig nach Hause.
Diese Karre musste Gabi ebenfalls sehr lieben.
Den Tag ließen wir zu guter Letzt mit ein paar Flaschen Portugiesischen Rotwein ausklingen, der uns beiden allerdings, unter Mithilfe seiner Promille, schätzungsweise so um Mitternacht die schwankenden Lichter ausknipste…
*
Sirenen heulen in der Ferne. Dieses durchdringende Geräusch gesellt sich zu dem feinen, krisseligen Rauschen, dass ich eh schon in meinen Ohren habe. Ein Rauschen, das klingt, als ob mein Gehirn seinen Sendersuchlauf durchgestartet hätte. Allerdings habe ich irgendwie das Gefühl, dass dies ein unnötiges Unterfangen sein wird und das kein Kanal auf Sendung ist.
Woher ich dieses Gefühl habe? Keine Ahnung.
Es ist dunkel. Das macht mir schon ein bisschen Angst. Es dauert tatsächlich einige Zeit, bis ich bemerke, dass einfach nur meine Augen geschlossen sind.
Wie dumm von mir.
Obwohl ich mich gerne umschauen würde, bleiben meine Augen dennoch zu. Langsam fange ich an, diese Dunkelheit zu genießen. Sie passt hervorragend zu der Leere die momentan in meinem Kopf herrscht. Das ist ungewöhnlich, denn sonst ist mein Kopf bis unter die gewölbte Hirnschale vollgestopft mit irgendwelchen Gedanken. Gedanken aller Art. Ich konzentriere mich etwas. Nein, ich denke nicht nach…
…sondern ich richte mein inneres Auge auf diese Leere in meinem Kopf und versuche etwas darin zu erkennen…
Dienstag der 19.03.2019
Den Beginn meines zweiten Urlaubstages hätte ich gerne aus meinem pochenden Gedächtnis gelöscht.
Geweckt wurde ich durch das hartnäckige Klingeln meines Telefons, dass sich in meinem Kopf allerdings anhörte, als ob jemand über Nacht mannshohe Bassboxen in meinem Schlafzimmer verteilt hätte, deren brummende Schallwellen sämtliche Fasern meines Körpers zum Vibrieren brachten, mein Gehirn miteingeschlossen.
Mit schmerzverzerrter Miene zog ich mir das dicke Kopfkissen über den Kopf, doch das Telefon klingelte erbarmungslos weiter.
Ein fremdes Stöhnen gesellte sich dazu. Überrascht riss ich unter dem Kissen die Augen auf. Nach und nach entblätterten sich einige Erinnerungsfetzen an den gestrigen Abend. Zumindest die Erinnerung an Wein…an viel Wein. Langsam schob ich das Kissen beiseite und lugte rüber. Zu meiner Überraschung lag ich nicht alleine im Bett. Ein rotblonder, völlig zerzauster Haarschopf bohrte sich in das zweite Kissen. Ein schlaksiger Frauenkörper, der sich wie ein Fragezeichen krümmte, gehörte zu diesem Wuschelkopf. Definitiv eine Frau!
Sie hatte mir den Rücken zugewandt, was mir nun die Möglichkeit gab, einen weiblichen Buckel zu betrachten. Dieser Buckel gehörte natürlich meiner Freundin Gabriele und sie schnarchte leise.
Ein weiterer Erinnerungsfetzten schwebte herbei.
Ach ja, wir hatten ja gestern gemeinsam gesüffelt. Holla die Waldfee. Und das nicht zu knapp.
Auf der einen Seite war ich heilfroh, dass sie hier übernachtet und nicht darauf bestanden hatte, nach Hause zu fahren. Auf der anderen Seite fühlte es sich doch komisch an nicht alleine in meinem Bett zu liegen. Ich schlief schon so lange solo, dass ich mich mittlerweile daran gewöhnt hatte, alleiniger Herrscher über meine Komfort-Matratze zu sein.
Plötzlich fiel mir ein, dass ja das Telefon eben geläutet hatte. Doch nun hatte es seine Bemühungen eingestellt und läutete nicht mehr.
Obwohl ich noch saumüde und auch total verkatert war, erhob ich mich vorsichtig, um meinen Brummschädel nicht allzu viel Erschütterungen auszusetzten und stahl mich lautlos aus dem Schlafzimmer. Nett wie ich war, schloss ich die Zimmertür hinter mir. So konnte Gabi noch in aller Ruhe weiterpennen. Mich wunderte allerdings schon, dass sie das Telefon nicht gehört hatte.
Auf Strümpfen tapste ich in Richtung Küche und kam dabei an meinem Telefonschränkchen vorbei. Der AB blinkte wie verrückt, als ob er eine gaaanz dringende Nachricht loswerden wollte. Zuerst wollte ich ihn ignorieren, doch meine Neugier war stärker, als mein alkoholbestäubtes Gehirn.
Ich drückte den Abhörknopf und befürchtete im selben Augenblick, dass es sich hier lediglich um einen nervigen Werbeanruf der Telefongesellschaft handeln würde.
Dem war aber nicht so, wie ich gleich darauf erleichtert feststellte. Eine männliche Stimme erklang.
„Hi Mum. Entweder schläfst du noch oder du bist schon unterwegs. Vielleicht stehst du auch gerade unter der Dusche oder sitzt auf dem Klo. Keine Ahnung. Ich wollte nur mal schnell vor der Arbeit fragen, wie es dir geht und ob du am Samstag zuhause bist. Ich hätte mal wieder Lust auf Dibbelabbes. Du kannst dich ja heute Abend mal melden. Hab dich lieb. Tschaui.“
Trotz ausgewachsenem Kater grinste ich. Das war mein Sohn gewesen. Jonathan. Ein guter Bengel.
Seit er flügge geworden war, rief er einmal wöchentlich an. Gut, wenn er Stress hatte, vielleicht einmal alle zwei Wochen. Okay, manchmal sogar erst nach drei Wochen. Mir fiel bei diesem Gedanken auf, dass Jonas, so nannte ich ihn meistens, wohl ziemlich oft Stress hatte, denn die Intervalle seiner Anrufe wurden immer länger.
Regelmäßige und vor allem KURZE Zeitintervalle waren wohl nicht sein Ding. Dies verstimmte mich nun etwas und ich trottete in die Küche, wo mein Automatismus den Tank der Kaffeemaschine füllte, ebenso den Filter und das dazugehörige Kaffeepulver. Meine Gedanken waren noch immer bei Jonas. Der kleine süße Bengel, der nun nicht mehr klein und süß war. Jonas war bereits 24 und arbeitete als IT-Spezialist bei einer großen Bankgesellschaft. Was er dort genau tat, konnte ich selbst heute noch nicht sagen, denn ich verstand von dem ganzen Krempel überhaupt nichts. Meiner Meinung nach saß er den ganzen Tag vor mehreren Monitoren, hämmerte auf dabei auf eine hauchdünne Tastatur ein und bekam dafür am Ende des Monats eine ansehnliche Lohntüte in die Hand gedrückt.
Oder er fummelte mit irgendwelchem Mikro-Werkzeug in einer Technik herum, die mein bloßes, alterndes Auge nicht mehr ohne Lupe erkennen konnte.
Doch es schien ihm Spaß zu machen und nur das zählte. Leider hatte ihn diese Arbeit weit von zuhause weggeführt, denn sein Lebensmittelpunkt lag nun bedauerlicherweise in Frankfurt. Seufzend ließ ich mich auf einen meiner Küchenstühle sinken, sprang jedoch direkt wieder auf, um aus meiner Medizinbox ein paar Kopfschmerztabletten herauszusuchen, von denen gleich zwei in meinem ausgetrockneten, pelzigen Rachen verschwanden. Ein Glas Wasser half den beiden hilfreichen Fremdkörpern auf die Sprünge.
Der Kaffee fing an seinen aromatischen Duft zu verbreiten. Da ich gestern Morgen aufgeräumt hatte, befanden sich meine ganzen Tassen nun wieder im Schrank und nicht mehr in der Spülmaschine. Ohne Hast suchte ich mir meinen Lieblingsbecher heraus, der, mit den verblassten Rosen und goss ihn voll. Zucker und Milch gesellten sich ebenfalls dazu. Dann ließ ich mich wieder auf den Stuhl sinken und verfiel in dumpfes Brüten.
Dabei drehte ich gedankenverloren den Becher in meiner Hand. Die Tasse war ein Muttertags-Geschenk meines Sohnes. Einen Muttertag, der schon ewig zurücklag.
Und mit dem Gedanken an den betreffenden verflossenen Muttertag, von dem ich nicht mehr wusste welcher es gewesen war, kehrte auch Jonas wieder in meinen Kopf zurück. Mein Sohn. Mein fleißiger, ehrlicher und anständiger Sohn. Und ehe ich mich versah, schlitterte ich 24 Jahre in die Vergangenheit…
Silvester 1993/1994
„…fünf…vier…drei…zwei…eins…heiiii…prost Neujahr!“
Gläser klirrten laut, als sie übermütig angestoßen wurden. Ich grinste wie ein Honigkuchenpferd auf Speed, was wohl auch daran lag, dass ich schon etwas angeschickert durch die Party schlingerte. Auf der anderen Seite des Raumes prostete mir ein fremder Mann zu. Er hatte mich die ganze Zeit schon im Visier. Das wusste ich, weil ich ihn ebenfalls schon seit einiger Zeit auf meinem Radar hatte. Er sah gut aus, in seinem weißen Hemd und der enganliegenden Jeans, die nicht wirklich viel der Fantasie überließ. Ich wusste, dass er der Freund eines Freundes von Gabi war. Soviel hatte ich schon herausbekommen.
Doch ich wusste weder seinen Namen, noch sein Alter. Aber er wirkte unglaublich männlich.
So männlich, dass es mich, unschuldiges Küken doch etwas einschüchterte. Deshalb hatte ich es bisher vermieden, einfach locker hinüber zu schlendern und ihn in ein harmloses Gespräch oder einen unbekümmerten Flirt zu verwickeln. Er stand einfach da, die Bierflasche lässig in seiner Hand und prostete mir zu.
Heiße Röte schoss mir ins Gesicht.
Verärgert über meinen überempfindlichen Körper drehte ich mich abrupt um und tauchte in der überschwänglichen, Polonaise tanzenden Menge unter. Doch ich kam nicht weit. Gabi fing mich plötzlich ab, warf ihre Arme um meinen Hals und verteilte dabei ungewollt klebrigen Sekt auf meinen Rücken.
„Alles Gute fürs neue Jahr, Schätzchen. Das wird ein gutes Jahr. Ein hervorragendes Jahr. Das fühle ich.“
Ihre glasigen Augen versuchten mich zu fixieren, doch ihr schwankender Körper erschwerte ihr dieses Vorhaben.
Lachend drückte ich meine beste Freundin an mich, „Alles Gute auch dir, Gabilein. Eine geile Party. Ist noch was von dem Punch da?“
Gabriele warf den Kopf giggelnd in den Nacken, schnappte sich einen vorbeilaufenden Mann und befahl,
„Hey, du. Meine Freundin will noch von dem Punsch.“
Eine Männerhand, deren Finger ein zarter blonder Flaum zierte, zupfte mir das Glas aus den sektverklebten Fingern. Ich schaute amüsiert hoch und sofort fror mein Grinsen im Gesicht ein.
Es war der Fremde, der mir zugeprostet hatte.
DER Fremde, dessen intensiver Blick im Augenblick eine Horde verrücktspielender Schmetterlinge in meinem Bauch aufscheuchte. Seine eisblauen Augen saugten sich an meinen braunen Augen fest. Ich schluckte und versuchte irgendeine schlagfertige Bemerkung herauszuwürgen, „Bitte einen Punsch!“
Im selben Moment hätte ich mich ohrfeigen können. War DAS etwa schlagfertig gewesen? Ganz sicher nicht. Der Fremde lachte, als ob ich gerade irgendetwas Geistreiches von mir gegeben hätte und verschwand mit meinem Sektglas.
Ich wollte mich schon verdrücken, als er wieder vor mir stand, auf mich runterschaute, sich vorbeugte und mir ins Ohr säuselte, „Ich glaube, heute Nacht ist ein Engel vom Himmel gefallen und ich habe ihn gefunden.“
Ich glotzte ihn dümmlich an. Was war denn das für eine tumbe, einfallslose Anmache?
Ich hatte ihn, ehrlich gesagt, für etwas kreativer gehalten. Doch sein gutes Aussehen und auch sein knackiger Apfel‑ Po übertünchten seine desolat angehauchte Fantasie.
Ich rang mir ein Lächeln ab und fragte mich im gleichen Augenblick, ob ER derjenige, welcher sein könnte. Ich meinte damit, mein erster Liebhaber. Ich war zu diesem Zeitpunkt noch Jungfrau. Ein Zustand der mir nicht sonderlich gefiel und den ich schleunigst ändern wollte. Unauffällig zupfte ich mein Glitzershirt weiter nach unten, um seinen hungrigen Augen mehr Aussicht bieten zu gönnen. Der freigelegte Ansatz meiner Brüste zeigte Wirkung. Er schob sein Becken näher an mich ran und nuschelte in seine Bierfahne hinein, „Ich bin der Ferdinand!“
Mit Mühe verhinderte ich ein lautes Auflachen, denn sofort erschien in meinem Kopf das Bild von ‚Ferdinand, dem Stier‘. Ein großer, ausgewachsener Stier, der es liebte an Blumen zu riechen und auch sonst eher der ruhige und friedliebende Typ war. Der Ferdinand, der jedoch vor mir stand, glich eher einem röhrenden Ferrari mit durchdrehenden Reifen. Name und Aussehen passten leider so gar nicht zueinander.
Ich beschloss kurzerhand ihn einfach Ferdi zu nennen. Immer noch besser als Ferdinand.
Höflich streckte ich ihm meine Hand entgegen, „Ich bin die Koko!“
Ich verbesserte mich eilig, „Kornelia!“ Sein Lächeln verbreiterte sich und entblößte schneeweiße, gerade Zähne, wie aus der Zahnpasta-Werbung.
Unbewusst fuhr ich mir mit der Zunge über meine eigenen Schneidezähne, die zwar sauber aber ganz sicher nicht SO strahlend weiß waren. Und plötzlich beugte er sich hinab und legte seine vollen, feuchtglänzenden Lippen auf meine. Im nächsten Moment spürte ich bereits seine forsche Zunge in meinem Mund, die sich tief in meinen Rachen schob. Ganz kurz unterdrückte ich einen Würgereiz. Ich schmeckte Bier und Tacos.
Es gab Schlimmeres. Um zu verhindern, dass seine Zunge mit meinem Zäpfchen Cello spielte, bog ich mich etwas zurück, was natürlich meine jugendlichen Brüste nach vorn wölbte, direkt in seine wartende Hand.
Und ja…an diesem Abend verlor ich tatsächlich meine Unschuld. Doch leider hatte der Alkohol einige wichtige Details weggeschwemmt, die ich eigentlich hatte später mit Gabi durchgehen wollen. Lediglich das kleine Fleckchen Blut in meinem Slip verriet, dass ich endlich zur Frau geworden war. Doch ich konnte ja schlecht am nächsten Morgen meine Unterhose umherschwenken und rufen: Seht her. Ich bin jetzt endlich auch erwachsen. Tatsächlich hielt ich Menschen, die Sex hatten, für Erwachsene. Dummer Gedanke, doch so dachte ich damals halt. Mit dieser allerersten Bett-Nummer in meinen jungen Leben, an die ich mich leider nur sehr vage erinnern konnte, wurden Ferdi und ich ein Paar.
Das er gute zehn Jahre älter war als ich, verdrängte ich großzügig. Auch Gabrieles Warnung schoss ich mit einem seligen Lächeln in den Wind. Ihr war Ferdinand nicht so ganz koscher. Sein großspuriges Auftreten ließ sie jedes Mal die Miene verziehen, wenn wir uns trafen.
Mehr als einmal ließ sie eine unsere Verabredung einfach platzen, worüber Ferdi schon fast froh schien. Ich hatte das Gefühl, als ob er Gabriele nicht sonderlich mochte.
Vielleicht lag es an ihren misstrauischen Blicken oder ihren bohrenden Fragen?
Keine Ahnung. Auf jeden Fall schlief unsere Freundschaft bedauerlicherweise schnell ein. Man könnte auch sagen, sie plumpste abrupt ins Koma. Das tat mit zwar Leid, doch ich änderte nichts daran…Ferdi zuliebe.
Wochen vergingen. Monate vergingen. Mein einst so üppiger Freundeskreis schmolz wie pappiger Schnee in der gleißenden Sonne und ich bemerkte dies noch nicht einmal. Ich hatte nur Augen für Ferdinand.
Er war da…immerzu.
Er holte mich von der Arbeit ab.
Er bestimmte, was ich anzog.
Er beschloss was ich aß.
Er schmiss meine Schminke weg, weil er meinte, ich würde wie eine Nutte aussehen.
Er machte mich auf die Pfündchen an meinen Hüften aufmerksam und striezte mich so lange, bis ich dreimal die Woche mit ihm ins Fitnessstudio pilgerte, obwohl ich Sport abgrundtief hasste.
Er überzeugte mich, dass ich dankbar sein konnte, weil ER sich meiner angenommen hatte.
Er hielt alles von mir fern, was mich von ihm ablenken und meiner Transformation zu einer Frau von Welt hinderlich sein könnte.
Und er schlug mich, wenn ich nicht parierte. Meine Mutter mochte ihn sehr.
Als dann das Unvermeidliche geschah und ich schließlich im Krankenhaus landete, mit einer schmerzhaft gebrochenen Rippe und einer ziemlich hässlichen Platzwunde an der Stirn, hervorgerufen durch harte Fäuste und einer leeren Bierflasche, da war er allerdings nicht da. Gabriele schon. Auf einmal stand sie an meinem Krankenbett, wie aus dem Boden geschossen und starrte mich mit einem undurchdringlichen Blick schweigend an. Ich schämte mich und wusste nicht warum. Doch, eigentlich wusste ich es schon, doch ich wollte es nicht zugeben. Deswegen trat ich die Flucht nach vorne an und fuhr ich sie ziemlich harsch an, „NUN SAG ES SCHON. DU HAST MICH GEWARNT UND ICH HABE NICHT GEHÖRT. SUHL DICH IN DEINEM BESSERWISSERISCHEM RECHT. DU HAST ES DIR REDLICH VERDIENT!“
Doch Gabriele tat etwas, womit ich in diesem Moment überhaupt nicht gerechnet hatte.
Sie weinte. Ohne Vorwarnung öffneten sich still ihre Schleusen und eine Träne nach der anderen lief über ihre blassen Wangen. Ich schluckte überrascht, schaute schnell zur Seite und spürte plötzlich auch Tränen, die sich hinter meinen Augäpfeln sammelten und nach draußen drängten. Doch ich blinzelte die kleinen Biester eisern zurück. Meine Freundin schniefte ungeniert, kam um das Bett herum und legte sachte den Arm um mich, „Ich liebe dich, du dumme Kuh! Und wenn du auch nur einmal daran denkst, zu diesem Riesen-Arschloch zurückzugehen, breche ich dir die restlichen Rippen.
Hast du verstanden?“
Die Tränen, die ich eben noch so tapfer zurückgehalten hatte, brachen nun doch hervor. Ich weinte nun auch. Ich weinte, wie ein kleines Kind. Ein dummes Kind. Ein Kind, das einen Riesenfehler begangen hatte und nun nicht mehr ein noch aus wusste.
Verzweifelt starrte ich auf meinen leicht hervorgewölbten Bauch und lenkte somit auch Gabis Blicke dorthin und obwohl sie eben noch halb zornig geheult hatte, lächelte sie nun zaghaft. Behutsam nahm sie meine Hand und legte sie, zusammen mit ihrer auf die Stelle, unter der ein neues Herz schlug. Ein unschuldiges Herz.
Das Herz meines Sohnes.
Sie sagte nur drei kleine Sätze, „Wir schaffen das. Du, ich und der Wurm. Wir schaffen das.“
Es gab keinen vernünftigen Grund ihr zu glauben, doch ich tat es. Mit ihrer Hilfe zeigte ich dieses Schwein an.
Der Arztbericht, die Aussagen meiner Freunde, die sich zwar von mir abgewandt, mich jedoch nie aus den Augen verloren hatten und die Tatsache das ich schwanger war, brachte Ferdinand sechs Monate auf Bewährung und die Auflage, dass er sich mir nicht mehr nähern durfte, ein. Dieses Urteil wurde genau vier Wochen vor Jonas Geburt gesprochen. Er würdigte mich im Gerichtssaal keines Blickes, worüber ich auch sehr froh war.
In dem Moment, als er abgeführt wurde, schlug Jonas in meinem Bauch einen freudigen Purzelbaum.
Zumindest fühlte es sich so an.
Doch von dem Zeitpunkt an, als ich den Vater meines Kindes bei der Polizei anschwärzte, redete meine Mutter nicht mehr mit mir, sie kochte auch nicht mehr für mich und meine Wäsche blieb ebenfalls von ihr unberührt.
Die Schwangerschaft musste ich ohne ihre klugen, mütterlichen Ratschläge hinter mich bringen, was nicht sonderlich schwer war, denn sie hatte in den letzten siebzehn Jahren sowieso selten ein gutes Wort für mich übriggehabt. Also empfand ich ihre kalte Wortlosigkeit als keine allzu große Strafe.
Trotz all dieser Widrigkeiten schaffte ich meine Prüfung zur Friseurgesellin mit Bravour. Dies verdankte ich Gabriele und ihrer Oma, denn die beiden nahmen mich hochschwanger auf. Am Tag meines Auszuges, ein paar Wochen vor meiner Niederkunft, versuchte ich noch einen letzten klärenden Vorstoß und watschelte mit geschwollenen Füßen und dem letzten Umzugskarton ins Wohnzimmer. Dorthin hatte sich meine Mutter verschanzt, als Gabi und ich anfingen, meine persönlichen Sachen zusammenzupacken.
Höflich klopfte ich an den Türrahmen und drückte die angelehnte Tür weiter auf. Meine Mutter saß kerzengerade auf der Couch, als ob sie einen Besenstiel verschluckt hätte. Vor ihr stand eine Flasche Martini und ein halb gefülltes Wasserglas indem sich jedoch bei genauerem Hinsehen sicher kein Wasser befand.
Das meine Mutter so unverblümt vor aller Welt trank verunsicherte mich ein klein wenig, hinderte mich jedoch nicht daran meine dicke Kugel in den Raum zu schieben und mich vor dem Couchtisch zu positionieren.
Den Karton stellte ich darauf ab.
Mama schaute stur an mir vorbei. Sie erinnerte mich in diesem Moment an ein ziemlich verzogenes, bockiges Kleinkind. Ich wusste, dies würde die letzte Möglichkeit in meinem Leben sein, mich ihr ehrlich mitzuteilen. Also raffte ich sämtliche kümmerlichen Reste meines Mutes zusammen, räusperte mich und begann, „Mama? Ich weiß, du bist sauer. Ich weiß zwar nicht warum, doch das ist auch eigentlich nicht mehr wichtig. Ich werde jetzt gehen und wir werden uns möglicherweise nicht noch einmal sehen. Ich weiß, dass ich immer eine Last für dich war und dass du mich für dein verkorkstes unzufriedenes Leben verantwortlich gemacht hast. Aber eines solltest du dabei nie aus den Augen verlieren. Nicht ICH habe entschieden, dass ich zur Welt komme, sondern DU. DU bist ganz alleine für dein Leben verantwortlich und du warst auch für mein Leben verantwortlich. Doch anstatt die Arschbacken zusammenzukneifen, hast du nur deinen Frust an mir ausgelassen. Als Kind habe ich es einfach hingenommen und möglicherweise hätte ich dies auch irgendwie, irgendwann entschuldigen können, auch wenn du mich jahrelang wie ein Stück Scheiße behandelt hast. Doch die Tatsache, dass du dich hinter einen Mann gestellt hast, der dein eigenes Kind krankenhausreif geprügelt hat und damit sogar den Tod deines Enkelkindes in Kauf genommen hättest…diese Tatsache kann ich dir nicht verzeihen. Niemals! Von dem Zeitpunkt an, wenn ich durch diese Tür trete, sind wir geschiedene Leute. Ab dann werde ich keine Mutter mehr haben und ich werde jegliche Verbindung zu dir leugnen. Ich wollte nur das du dies weißt und dich darauf einrichten kannst. Du wirst dir in Zukunft einen anderen Sündenbock suchen müssen. Ich wünsche dir trotzdem alles Gute in deinem weiteren Leben.“
Meine Mutter mied noch immer jeglichen Blickkontakt und schwieg beharrlich. Ich konnte einen resignierten Seufzer nicht unterdrücken. Hier war Hopfen und Malz verloren. Also schnappte ich mir die letzten Überreste meines hiesigen Lebens, dass ich gerade für beendet erklärt hatte. Ohne mich noch einmal umzuschauen, ließ ich meine lieblose Kindheit in den lieblosen Armen jener armseligen Frau zurück, die vor achtzehn Jahren eine für sie falsche Entscheidung getroffen hatte.
Sollte sie damit doch machen was sie wollte. Ich war fertig mit ihr.
Gabriele hatte die ganze Zeit über im Flur auf mich gewartet und nahm mir mitfühlend den Karton aus den Armen. Ich rang mir ein Lächeln ab, dass sie beruhigen sollte. Offensichtlich missglückte dieser Versuch, denn sie warf dem zurückliegenden Wohnzimmer einen bösen Blick zu, ehe sie für mich die Tür endgültig hinter mir schloss. Gabis Oma wartete unten vor dem Haus bereits ungeduldig auf uns. Voller Anspannung lehnte sie an ihrem tannengrünen Mercedes und nahm mich sofort in den Arm. Ich roch Lavendelseife und blumigen Weichspüler. Annegret, so hieß Gabrieles Oma, drückte mich fest an sich und klammerte sich an dasselbe Credo wie ihre Enkelin, „Wir schaffen das!“
Eine solche Oma hatte ich mir auch immer gewünscht und es war mir nun schon etwas peinlich, dass ich mir die Oma meiner besten Freundin quasi ausborgte. Doch für Annegret schien meine indirekte Adoption etwas Selbstverständliches zu sein.