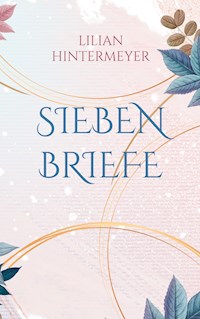Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Habt ihr euch auch schon einmal gefragt, warum eure Familie so ist, wie sie ist? Warum IHR so seid, wie ihr seid? Warum euer Leben so und nicht anders abläuft? Warum gerade IHR das Gefühl habt, euer Leben ist ein einziger anstrengender Hürdenlauf? ICH habe mir diese Fragen schon oft gestellt. Auch an jenem Tag, als ich die Wohnung meiner kürzlich verstorbenen Mutter ausräumen musste. Hier, inmitten trauriger Erinnerungen stolperte ich völlig überraschend und vor allem völlig unerwartet über Geheimnisse. Zwei Geheimnisse, die mich zutiefst erschütterten und die meine Mutter über Jahre hinweg sorgsam gehegt und gehütet hatte. Beide Geheimnisse rissen mir, im wahrsten Sinne des Wortes, den Boden unter den Füssen weg. Aber im Laufe jenes Tages lieferten sie mir auch viele Antworten. Antworten, deren Suche ich schon fast aufgegeben hatte. Ein großes Geheimnis führte mich in die lange zurückliegende, verstörende Vergangenheit meiner weiblichen Vorfahren und das andere Geheimnis, nur am Rande wie eine nachlässige Fußnote erwähnt, erwies sich als glücklicher Wegweiser in meine Zukunft. Doch von all dem ahnte ich noch nichts, als ich, eben an diesem Tag, im Frühjahr 2010, frisch geschwängert, müde und deprimiert den vertrockneten Blumenstock musterte, der mich an der Wohnungstür meiner Mutter empfing. Mein Name ist Muriel Braun und hätte ich geahnt was mich erwartet, wäre ich trotzdem eingetreten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 654
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alle Namen und Abläufe sind frei erfunden. Viele Örtlichkeiten sind fiktiv und reale Orte wurden von mir künstlerisch angepasst (diese Freiheit habe ich mir zugestanden). Überschneidungen einzelner Schicksale oder Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Nicht geeignet für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren.
Frei-geist Substantiv, maskulin [der]
Bedeutung: vor allem im 18. Jahrhundert eine verbreitete Bezeichnung für einen Vertreter, der sein Denken nicht von den traditionellen Sitten oder der offiziellen Religion bestimmen lassen wollte.
Anders formuliert: eine Person, die ganz besonders im Hinblick auf den allgemeinen Glauben, ihre eigenen Dogmen und Verhaltensregeln besitzt.
Familiengeschichte. Ahnen. Stammbaum.
Oftmals eine träge und zähe Thematik.
Die Wenigsten wissen etwas über ihre eigene Geschichte.
Über Schicksale, die sich vor langer Zeit abgespielt haben, die möglicherweise wegweisend für unsere Ahnen waren und die bei dir, bei mir, bei uns allen, enden.
Möglicherweise Familiengeheimnisse, die bereits vor Ewigkeiten unter dem Mantel des Schweigens gehüllt und totgeschwiegen wurden. Oder Verstrickungen, seelische Wunden und Schuld, die sich bis ins Heute ziehen, deren Zusammenhänge wir jedoch nicht erkennen, da wir uns ja nicht mit unserer Familiengeschichte beschäftigt haben.
Diese zu recherchieren, benötigt unglaubliche Geduld und etwas, wovon wir heute kaum noch etwas besitzen…Zeit.
In der Tat ist es mühselig, Details zu sammeln, zu sortieren und zuzuordnen. Es tauchen Namen auf, die uns nichts sagen und verursachen uns damit ein schlechtes Gewissen, da diese Person doch einmal zu der Familie gehörte. Personen, deren Leben möglicherweise äußerst interessante Züge aufzeigen würde. Personen, die uns vielleicht sogar recht ähnlich waren. Deshalb würde es sich in manchen Fällen bestimmt lohnen, etwas tiefer zu graben...oder überhaupt mal anfangen zu graben.
Wer hat sich nicht schon gefragt, warum seine Familie so ist, wie sie ist…mit all ihren Marotten und Macken?
Wer hat sich nicht schon einmal gefragt, wie das eigene Leben verlaufen wäre, wenn die Oma (oder die Mutter) sich nur ein einziges Mal anderes entschieden hätte?
Kleine Dinge, große Wirkung.
Ähnlich der Chaostheorie: Wenn irgendwo in China ein Schmetterling mit seinen Flügeln schlägt, könnte er damit (unwissentlich und natürlich rein theoretisch) einen Wirbelsturm in New York auslösen. In diesem Fall würde ein einzelner zaghafter Flügelschlag einen Ball ins Rollen bringen, der wiederrum andere Geschehnisse anstoßen würde, bis der Domino-Effekt die Welt umrundet hätte und in etwas ganz Großem gipfeln würde.
Wie gesagt, kleine Dinge, große Wirkung.
Was, wenn einer unsere Vorfahren auch eine Kleinigkeit getan hätte, die jedoch immense Auswirkung auf die Nachkommen gehabt hätte? Sogenannte unbequeme Freigeister, die überall anecken und sich eben NICHT ihrer Zeit gebeugt haben. Egal welche Konsequenzen dies nach sich gezogen hätte.
Eine faszinierende und auch irgendwie erschreckende Vorstellung.
Doch wir würden es nicht wissen…da wir ja keine Zeit haben, dies herauszufinden.
Schade eigentlich.
Aber was wäre, wenn sich doch jemand die Mühe machen würde und wenn dieser Jemand etwas zu Tage fördert, das wie ein übles Echo nachhallt und eigentlich nur schwer zu erklären ist. Wenn dieser Jemand ein System im Leben aller Ahnen erkannt hat und der den Kreis durchbrechen wollte…für zukünftige Generationen.
Was wäre, wenn DIR plötzlich ein Buch in die Hände fallen würde, dass deine Geschichte beinhaltet und die Quelle eines Übels offenbart?
Würdest du dies wissen wollen?
∞
Ende März 2010
Mit verkniffener Miene und verkrampfter Rückenmuskulatur gurkte ich in meinem altersschwachen Auto auf der überfüllten Autobahn herum.
Morgendlicher Berufsverkehr. Ein Fahrzeug nach dem anderen schälte sich langsam an mir vorbei, doch das ausgeleierte und glattgeschubberte Gaspedal meiner rollenden Schüssel schleifte schon fast auf den Asphalt.
Ich hatte die Höchstgeschwindigkeit von 108 Km/h bereits vor einer viertel Stunde erreicht. Mehr gab mein kleines Schätzchen leider nicht mehr her. Zwar hatte ich vollstes Verständnis für all die Menschen, die zu ihrer täglichen Arbeit hasteten, dennoch hasste ich sie.
Nicht die Menschen. Nicht wirklich.
Sondern deren Autos. Allesamt schienen sie über mehr schnaubende Pferdestärken zu verfügen, als mein kleiner rollender Briefkasten.
Briefkasten deshalb, weil mein Auto eben diese Ausmaße besaß, dazu noch quietschgelb lackiert war und deshalb eher einem altmodischen Briefkasten ähnelte, als einem fahrtüchtigen Auto. Ein Briefkasten auf Rädern.
Mich wunderte wirklich, dass noch niemand seine Post in eines meiner Seitenfenster gequetscht hatte.
Doch das kleine Auto war ausreichend für meine 1 Meter 56 und einen lustigen 3D-Aufkleber mit meinem Namen an der Klappe des Handschuhfachs: Muriel Braun (falls das Auto mal verloren ging). Wenn sich allerdings zu meinem Körper und meinem aufschlussreichen Namensschild noch mein Frust und ein Kasten Sprudel dazugesellten, würde es schon verdammt eng werden.
Alleine mein Frust vereinnahmte schon die Hälfte dieses Innenraumes. Ja, Frust hatte ich wahrlich zur Genüge.
Eigentlich hatte ich das Gefühl ständig frustriert zu sein und genau das frustete mich dann noch mehr.
Ein Teufelskreis, aus dem ich einfach nicht herausfand.
Müde rieb ich über meine Stirn.
Das Schlimmste war, ich konnte noch nicht einmal genau definieren, WAS mich genau frustete. Irgendwie war es die Masse an Kleinigkeiten, die den Frustpegel stetig im oberen Level hielt. Und mit Masse an Kleinigkeiten, meinte ich mein Leben. Alles an diesem Leben schien verkorkst. Durchfurcht von Fehlentscheidungen, Vorwürfen, schiefen Blicken, Misserfolg, Streit, Ermahnungen, Rechnungen und vor allem von dummen Menschen.
Bei diesem letzten Punkt musste ich hinter dem Steuer den Kopf schütteln. Bestimmt ein befremdlicher Anblick für die Autofahrer die sich gerade an mir vorbeischoben.
Eine Frau mittleren Alters, die hinter dem Lenkrad wie ein Wackeldackel den Kopf schüttelte.
Man konnte fast hören, was sie dachten.
Hat die etwa Parkinson? Durfte man SO überhaupt noch Auto fahren? Oder hat die einfach nur eine riesengroße, ausgewachsene Meise? Wo ist dein Gaspedal, Kleine?
Dieser Gedanke, was andere von mir denken mochten, ließ mich verärgert schnauben.
Ich war weder krank, noch hatte ich eine Meise...glaubte ich zumindest.
Der Ärger über die unbekannten Gedanken fremder Menschen führte meinen Gedanken zurück zu ‚Dumme Menschen‘.
Stopp, ich korrigierte mich. Nicht dumm, sondern engstirnig und scheuklappenbehaftet.
Man glaubte ja gar nicht, wie viel dieser Menschen es gab, deren Sichtweise noch nicht einmal bis zum eigenen gesprungenen Tellerrand reichte und die nichts Besseres zu tun hatten, als ihre verschrumpelte, einbalsamierte Sichtweise und nulldimensionale Meinung anderen aufzuzwängen. Mit anderen, meinte ich mich.
Dieses Verhalten gab MIR im Laufe der Zeit das Gefühl klein und wertlos zu sein. Als ob MEINE Denkweise, MEINE Einstellung völlig für den Arsch wären.
Ein Prozess, der mich wie ein steter Tropfen ausgehöhlt hatte. Wenn man jahrelang, jahrzehntelang nur kritisiert wurde, dann hatte man irgendwann keine Kraft mehr dagegen anzukämpfen. Man resignierte und fügte sich.
Schweigend.
Man schwamm einfach als namenloses Etwas mit seinen unterdrückten Gedanken mit.
Allerdings bewirkte dies, dass man dadurch zwangsläufig unglücklich wurde. Todunglücklich.
Als ich vor ein paar Wochen wieder mal in einem dieser deprimierenden, schwarzen Du-bist-Scheiße-Strudel feststeckte, ließ ich mich tatsächlich dazu hinreißen eine besondere Art der Beratung in Anspruch zu nehmen, bei einem besonderen Menschen.
Eine Art esoterischer Lebensberater oder Schamane.
Seelen-Diagnose, Geist-Heilung, das innere Kind bauchpinseln oder so ähnlich.
Was mich zu solch einem ungewöhnlichen Schritt veranlasste? Das wusste ich selbst nicht.
Aber zu meiner Verteidigung…ja, so verzweifelt fühlte ich mich. Ich wusste nicht wirklich, was ich mir von diesem Menschen mit dem klangvollen Namen Martin und seiner (hoffentlich) ungewöhnlichen Gabe erhoffte.
Einen Geistesblitz? Eine Offenbarung? Den allumfassenden Durchblick? Den Sinn des Lebens? Oder einen praktischen Fahrplan für mein Leben? Oder auch nur eine Art Bedienungsanleitung für die chaotische und nervige Außenwelt? Keine Ahnung.
Ich wollte doch einfach nur glücklich sein. Ich wollte das, was die meisten Frauen wollten. Einen Mann der mich liebte und der nicht das dringende Bedürfnisse verspürte, mir die sprichwörtlichen Flügel zu brechen. Dazu ein bisschen Leidenschaft, eine Prise Spaß, ein Job den ich voller Elan und Inbrunst bis zur Rente ausüben konnte (oder auch länger), ein schönes Haus, viel Geld, Weltfrieden…okay, das mit dem vielen Geld musste nicht unbedingt sein. Aber es sollte schon ausreichen für Futter und warme Füße.
Eigentlich nur Kleinigkeiten. Nicht Besonderes. Oder?
Was den Mann betraf, nun ja, dies schien mir schon ein fast unlösbares Problem zu sein.
Ich hatte im Laufe der Jahre bereits unzählige Frösche geküsst (und nein, ich bin keine Schlampe), doch keiner hatte sich als ein glänzender Ritter in weißer Rüstung entpuppt. Entweder waren es Riesenarschlöcher gewesen, die versucht hatten mich zu unterdrücken (notfalls unter Mithilfe einer saftigen Ohrfeige) und die immer alles besser gewusst hatten (was natürlich nicht der Fall war) oder er war ein Workaholic oder ein Trinker oder ein Zocker oder ein trinkender, zockender Workaholic oder ein Langweiler, ein Ignorant, ein ignoranter Langeweiler oder er war gar Muttersöhnchen (die sind besonders anstrengend).
Ach ja, ich war sogar mal mit einem weltfremden Traumtänzer liiert, der dachte nur von Luft und Liebe leben zu können. Bis er mein Konto leergeräumt hatte.
Ganz offensichtlich hatte ihn die Luft nicht satt gemacht.
Shit happens.
Und Liebe? Liebe war vielleicht nur eine Wunschvorstellung. Etwas, dass es eigentlich gar nicht gab. Eine Mär, von Menschen in die Welt gesetzt, die einen Sündenbock für ihr verkorkstes Leben suchten.
Doch möglicherweise half es, wenn ich meine Ansprüche etwas herunterschraubte und das Gefühl ‚Liebe‘ durch etwas Kleineres, etwas weniger Anspruchsvolles ersetzte?
Meiner letzten Beziehung räumte ich dann doch recht gute Chancen ein. Zumindest drei Monate lang. Clemens war nett, duschte regelmäßig, arbeitete, trank und rauchte nicht und seine Mutter wohnte in Frankreich.
Recht gute Voraussetzungen, nicht wahr?
Doch eines Morgens (dieser Morgen war vor einer Woche gewesen) schaute ich ihn an und da war…nichts.
Es war, als ob ich ein altes, verstaubtes Gemälde betrachtet, an dessen Rahmen die Patina der Realität klebte (in diesem Fall Rührei an seinem Mundwinkel).
Ich stellte fest, dass Clemens eigentlich nur bequem war.
Bequem, wie ein Paar ausgelatschte Schlappen.
Schlappen, die man eigentlich entsorgen sollte. Aber man sträubte sich, weil noch keine neuen Schlappen in Sicht waren. Plötzlich kam ich mir gemein und schäbig vor.
Der arme Mann ahnte nichts von meinen Gedanken und dachte, es wäre alles in Butter.
War es aber nicht. Und ehrlich gesagt, wollte ich SO nicht leben und IHM wollte ich so ein Leben auch nicht zumuten. Meine Entscheidung, mich zu trennen, empfand ich deshalb nur als Fair.
Clemens fand dies übrigens auch.
Guter, alter, bequemer Clemens.
Nun gut. Das war gelogen. Ehrlich gesagt, mein, ach so bequemer Clemens verwandelte sich schlagartig in ein Paar unbequeme High Heels, zickte herum wie eine überkandidelte Diva, beschimpfte mich als egoistisches Miststück und beschlagnahmte, quasi als Schmerzenzgeld (so drückte er sich tatsächlich aus) meine teure Espressomaschine. Dann rauschte er ab.
Als er wutschnaubend aus meinem Leben verschwand und ich anschließend alleine (und heulend) auf dem Klo hockte, fragte ich mich, ob es überhaupt einen Deckel für so einen verbeulten (besonderen) Topf wie mich gab.
Nur ein kleiner, unscheinbarer Deckel, der mich rundum abschloss. Kurz darauf stellte ich fest, dass ich schwanger war. Schwanger und Single.
Keine besonders gute Voraussetzungen für ein zufriedenes und sorgenfreies Leben.
Nun stolperte ich in Martins heilige Hallen, getrieben von meinem Unglück, blätterte ohne mit der Wimper zu zucken Hundertzwanzig Euro auf den Tisch und gab mich dem Schicksal einer bevorstehenden Beweihräucherung hin, denn viel schlimmer als jetzt gerade konnte es eh nicht werden.
Martin, der lebensberatende Esoteriker, war gefühlte zwanzig Jahre jünger als ich und obwohl seine warmen braunen Augen mich anlächelten, bezweifelte ich, dass jemand der fast halb so alt war wie ich, mein Leben in eine adäquate Richtung lenken konnte. Wie ich schnell herausfand, wollte er das auch nicht. Er schaute mich lange an, vielleicht fünf Minuten. Die längsten fünf Minuten meines Lebens und nuschelte dann unheilschwanger, „Du bist dir selbst im Weg.“
Rums. Na das war doch mal eine Aussage.
Etwas wehmütig dachte ich an die Hundertzwanzig Euro und rieb verlegen über meine Stirn. Sachte nahm er meine Hände, „Ich würde gerne einen Blick auf deine Seele, deinen Geist werfen. Dort finden wir die Wurzel des Problems. Doch dazu brauche ich deine Einwilligung.“
Ich grübelte kurz über sein höflich vorgebrachtes Anliegen nach und nickte dann. Er wollte meinen Geist besuchen? Da konnte er lange suchen. Meinen Geist hatte ich schon ewig nicht mehr gefühlt. Der hatte sich wohl bei all dem Scheiß in meinem Leben völlig resigniert ins angrenzende Nirwana verzogen. Aber vielleicht hockte er auch einfach irgendwo im hintersten Winkel meines Kopfes, dort wo die ganzen Kisten voller negativer Erinnerungen vor sich hin staubten, wimmernd, zusammengekauert und natürlich frustriert.
So wie seine Besitzerin. Aber bitte.
Tu was du nicht lassen kannst, lieber Martin.
Martin schloss die Augen. Ich ebenfalls. Zuerst. Ein bisschen schummelte ich jedoch. Aber dass auch nur, weil ich etwas verwirrt war. Martin hatte nichts von mir wissen wollen. Weder mein Alter, noch mein Sternzeichen und auch nicht meinen Wohnort oder was ich beruflich machte. Auch mein Familienstand schien völlig uninteressant für ihn zu sein.
Ich fragte mich ernsthaft, wie er mich analysieren wollte, wenn er so gar nichts von mir wusste.
Die Sekunden tropften dahin. Breiteten sich zu einer minutenlangen Lache aus und schienen in einem See zu enden. Ein Zeit-See, der meine Gedanken in ein dunkles, luftleeres Vakuum schwemmte.
Ich entspannte mich und plötzlich hörte ich wie aus weiter Ferne seine dunkle, sonore Stimme, „Du hast einen großen Geist. Eine energiegeladene Seele. Doch sie ist angebunden.“
Ich runzelte die Stirn. Was? Meine Seele war angebunden? Wie denn das?
Aber immerhin schien er meinen Geist gefunden zu haben. Das war doch schonmal was.
Martin sprach weiter, „Es sieht so aus, als ob dein Geist mit einem Gummiband an einem Baum festgebunden wäre.“
Ich hatte Mühe, nicht laut loszulachen, beherrschte mich eisern, schwieg und lauschte.
„Ich sehe, wie du nach vorne preschst. Das Gummiseil spannt sich, aber du läufst weiter. Dann kommt der Punkt, an dem du merkst, es wird schwierig. Du bemühst dich. Und dann...gibst du auf. Du hast das Gefühl, du schaffst es nicht und das Gummiseil zieht dich zurück.
Du leistest noch kurz Gegenwehr und dann gibst du nach. Du lässt dich zurück zu dem Baum ziehen.“
Verdutzt schnaubte ich leise, denn irgendwie kam mir seine Metapher über mein Leben, so bescheuert sie auch klang, doch irgendwie vertraut vor. Es stimmte. Oft genug hatte ich gegen andere Meinungen und gegen Unterdrückung angekämpft und dann kam ich an einen Punkt, wo ich einfach nachgab. Ich machte einen Schritt zurück. Mental gesehen.
Diese Situation, die sich wie ein roter Faden durch mein Leben zog, nun so bildlich vor Augen geführt zu bekommen, erschreckte mich.
Aber es weckte auch Mitleid. Mitleid mit mir selbst.
DAS war nun nicht unbedingt DAS, was ich vorhatte hier zu finden. Ich wollte kein Mitleid mit mir selbst haben.
Ich wollte etwas entdecken, dass dieses vermaledeite Gummiseil, geknüpft von was aus immer, durchschnitt.
Das mich endlich nicht mehr zurückhielt. Eine Art Krücke mit der ich im Leben weiter humpeln konnte. Mitleid schien mir hier kein sehr gut gewähltes Werkzeug.
Doch ich schwieg weiter.
„Der knorrige Baum symbolisiert dein Umfeld.
Menschen, die du in dein Leben gelassen hast. Andere Seelen, die erkannt haben, wie stark du eigentlich bist und die Angst vor dieser Kraft haben, obwohl sie sich an deiner Energie laben. Sie haben dich angebunden. Doch DU gabst ihnen erst die Möglichkeit dazu. Du gabst ihnen dieses Gummiseil in die Hand, mit dem sie dich festgebunden haben. Das Gummiseil ist ein wichtiger Bestandteil. Zwar trägst du es, doch es wurde nicht von dir geknüpft.“ Aha, also doch die böse Außenwelt. Zumindest hatte der Schuldige jetzt einen Namen.
Es entstand eine Stille, die mich dazu bewog, ihn durch die Wimpern hinweg anzublinzeln.
Irgendwie klang das, was er sagte, ja doch schon ziemlich abgefahren. Doch ich hatte zu diesem Zeitpunkt überhaupt keine Ahnung, was noch auf mich zukommen sollte. Hätte ich es gewusst, wäre ich dann trotzdem geblieben? Wahrscheinlich.
Martins Augen waren noch immer geschlossen.
Seine Miene wirkte tiefenentspannt, doch sein Magen grummelte leise. Gerade als ich mich fragte, ob er vielleicht vergessen hatte zu frühstücken, redete er leise weiter, „Ich spüre eine starke Kraft, doch sie ist nicht positiv. Es hat etwas mit dem Gummiband zu tun, dass dich zurückhält. Es scheint ein großer Schmerz damit verbunden...eine Schuld oder eine Art Fluch...etwas das seit Generationen weitergegeben wird. Von Frau zu Frau.
Ich sehe deine weiblichen Ahnen. Sie alle stehen da und schauen dich an. Alle scheinen ein ähnliches Schicksal erlitten zu haben. Eine Last. Eine Bürde. Etwas, das von Generation zu Generation weitergereicht wird. Etwas, dass schon lange darauf wartet aufgelöst zu werden.“
Erneute Stille. Ich ließ seine Worte, so skurril sie auch klangen, sacken.
Plötzlich fühlte ich, wie er meine Hände drückte und ich hob automatisch meine Augenlider. Martins warme braune Augen musterten mich mit leicht geneigtem Kopf, „Möchtest DU diejenige sein, die das Gummiband zerschneidet? Die die Bürde auflöst? Möchtest DU diejenige sein, die den Bann deiner weiblichen Ahnen bricht? Mit Hilfe der Elohim?“
Mit großen Augen nickte ich stumm.
Wer sollte es denn sonst machen?
Immerhin klang es nach einer halbwegs sinnvollen Tätigkeit und ich bekam ja Unterstützung von Elohim…wer immer das war. Jetzt musste ich nur noch wissen, wie ich das anstellen sollte.
Martin schloss wieder seine Augen und wühlte sich in diesem Augenblick wohl tiefer in meinen Geist oder in meinen seelischen Abfall.
„Ihr seid alle miteinander verknüpft. Ihr sucht und findet euch. Zu allen Zeiten. Vor allem drei Seelen können nicht ohne den anderen. Obwohl das irdische Verhältnis sich stets schwierig gestaltet, kommt ihr immer wieder zusammen. Es herrscht eine große Liebe zwischen euch.
Aber diese Bürde hält euch von dem Frieden ab, den ihr euch so sehr wünscht. Ich gehe weiter zurück. Die Frauen lächeln mich alle an.“
Irgendwie erleichterte es mich zu wissen, dass meine Vorfahren wohl keine eingebildeten Schnepfen zu sein schienen.
Unverhofft stöhnte Martin und ließ abrupt meine Hände los. Erschrocken riss ich erneut die Augen auf, doch Martin schien völlig abwesend. Seine beiden Hände legten sich auf die Brust, als ob sie schmerzen würde, „Ich sehe tiefe Trauer und Schuld. Es ist etwas Schreckliches geschehen. Etwas, dass nach Vergebung lechzt. Schuld, die die Kraft eurer Seelen einschließt. Schuld, die euch dazu gebracht hat, die Kraft eurer Seelen zu verleugnen, weil ihr glaubt, es nicht verdient zu haben. Deshalb sucht ihr immer wieder Seelen, die euch unterdrücken, weil ihr glaubt, dies ist die Strafe für die Schuld, die auf euch lastet.“
Stille. Ich schluckte wie betäubt. Dann überschlug sich seine Stimme fast.
„Ich sehe eine Frau. Eine junge Frau. Sie ist anders. Sie ist stark. Sie ist frei. Und das ist in der Zeit, in der sie lebt, nicht gern gesehen. Mit ihrem Verhalten und ihrer Denkweise stößt sie immer wieder auf Widerstand. Auf Hass. Ich sehe, wie jemand unterdrückt wird. Eine andere Frau. Die beiden sind eng verbunden. Diese andere Frau hat ein schlimmes Schicksal. Der Mann an ihrer Seite ist eine dunkle, namenlose Seele. Eine hilfesuchende Seele.“
Seine Stimme schraubte sich einige Oktaven höher, „Er missbraucht sie. Missbraucht auch die Kinder. Er bricht ihren Geist. Er bringt große Schande über die Familie. Das findet die Frau heraus. Ich höre ihr Weinen und ihr Schluchzen. Sie weiß nicht was sie tun soll. Sie ist unglaublich verzweifelt. Als ob sich ein Stigma auf ihrer Stirn eingebrannt hätte. So unglaublich verzweifelt. Sie gibt sich die Schuld. ER redet ihr diese Schuld ein. Ihre Schwester versucht sie zu retten, doch diese Frau...ich glaube nicht, dass DU diese Frau bist, aber du kennst sie...diese Frau tut etwas Schreckliches. Sie macht sich verantwortlich für das Leid ihrer Kinder. Diese große Schuld verwirrt ihren Geist, bis sie, ertränkt vom eigenen Schmerz eine Todsünde begeht. Aber sie sieht es nicht als Sünde. Für sie ist es das ausmerzen des Bösen. Ein Bereinigen. Sie sieht keinen anderen Ausweg, als sich und die Kinder umzubringen. Feuer. Die zurückgebliebene Schwester...sie glaubt, es wäre alles ihre Schuld, weil sie sich nicht angepasst hat. Weil SIE anders ist und weil sie ihrer Schwester nicht hatte helfen können. Auch die Menschen machen sie verantwortlich. Doch sie haben Angst vor ihr und trauen sich nicht, sie umzubringen. Sie spüren ihre Kraft. Sie ist allgegenwärtig. Ich sehe Dunkelheit. Ich sehe Verzweiflung. Diese Frau versucht zu fliehen. Da ist Blut an Füßen und ich sehe…“, an dieser Stelle stockte er kurz und schnaubte leicht verblüfft, „..sie gibt zwar auf...dennoch...dennoch ist da Hoffnung.
Komisch. Ich weiß nicht woher, doch ein Funken Hoffnung, es könnte sich möglicherweise um eine Seele aus der Ahnenreihe handeln...sie geht auf Wanderschaft.“
Völlig verblüfft hatte ich Martins verkrampftes Gesicht die ganze Zeit angeschaut. Kleine Schweißbäche rannen an seiner Schläfe herab. Der Besuch in meinem Geist schien ihn mächtig anzustrengen. Dann schlug er die Augen auf und wischte sich leicht fahrig über den glänzenden Nasenrücken. Seine Mundwinkel hoben sich zu einem feinen Lächeln, „Dieser winzige Funke, diese Seele aus der Ahnenreihe, sie hat dich offensichtlich hierhergeführt. Ich werde nun das weiße und goldene Licht der Elohim durch deine weibliche Ahnenreihe senden, um sie zu heilen und die Schuld aufzulösen.“
Keine Bitte, sondern eine klare Ansage.
Erneut ergriff er meine Hände und schloss die Augen. Ich tat es ihm nach. Ein Gefühl der Ehrfurcht überkam mich und in meinem Innern fühlte ich, völlig überraschend, unglaubliche Liebe, als ich mir all die vergangenen Frauen vorstellte, die nun Vergebung erfuhren. Vor allem, diese Eine. Vor meinem inneren Auge konnte ich sie ganz deutlich sehen. Klar, als ob sie leibhaftig vor mir stehen würde. Ihre Augen waren geschlossen. Den Kopf leicht in den Nacken gelegt. Ihr langes Haar wehte in einer nicht vorhandenen Brise und als das helle gleißende Licht in ihre schwer atmende Brust eindrang, kullerten mir tatsächlich ein paar Tränen die Wangen.
Ich sah und fühlte in diesem einen Augenblick tatsächlich die unendliche Erleichterung dieser gequälten Seelen und auch große Dankbarkeit. Nicht für Martin, sondern für etwas anderes…etwas Größeres, dass ich jedoch nicht benennen konnte.
Das Martin meine Hände losließ, bekam ich erst gar nicht mit. Erst als er mich leicht an der Schulter berührte, öffnete ich die Augen. Der Versuch eines Lächelns misslang. Stattdessen schluchzte ich kurz und senkte, irgendwie beschämt den Blick. Martin fasst mich sachte am Kinn und hob meinen Kopf, damit ich ihm in die Augen schauen konnte.
Er lächelte, „Es ist vollbracht. Vergebung ist gekommen und Vergebung ist angenommen worden. Der Bann ist gebrochen. Ich werde deinen Geist nun verlassen. Ich danke dir, für die Ehre, die du mir mit deinem Vertrauen entgegengebracht hast.“
Ich nickte, ribbelte kurz über meine Stirn und erhob mich schwerfällig, „Danke.“
Was sollte ich sonst sagen? Da mir dies aber doch zu wenig erschien schob ich schüchtern nach, „Willst du denn nicht wissen, wie mein Name ist?“
Er lächelte weiter, „Das ist nicht nötig. Ich kenne nun deine Seele. Eine wunderschöne, unglaublich kraftvolle Seele. Ein großartiger Freigeist. Geh jetzt und lebe.“
Ohne ein weiteres Wort und noch immer tief ergriffen über das eben gehörte verließ ich diesen seltsamen Menschen. In diesem Augenblick nahm ich alles was er gesagt hatte für bare Münze. GERADE weil er im Vorfeld nichts, absolut nichts von mir wusste.
Ich kombinierte einige seiner Aussagen.
Bei dem Funke, von dem er gesprochen hatte, könnte es sich möglicherweise um meine äußerst frische Schwangerschaft handeln. Mein noch ungeborenes Kind, von dem noch niemand außer mir etwas wusste.
Wäre doch möglich. Oder nicht?
Jetzt im Nachhinein, zurück in der Gegenwart, hier in meinem altersschwachen Wagen, schien mir diese Begebenheit jedoch schon etwas weit hergeholt. Dieser Gang, von dem ich mir so viel versprach, hatte nichts in meinem Leben geändert. Es gab keine Posaunen und Fanfaren, die eine neue, problemfreie Ära eingeläutet hatten. Ich empfand mein Leben immer noch als beschissen und kläglich. Außer der Tatsache, dass ich mittlerweile im vierten Monat schwanger war. Dies konnte ich jedoch nicht wirklich in die positive Spalte meines Lebens eintragen, da ich Clemens, den Vater, leider nicht ausfindig machen konnte. Die letzte Information, die ich auftreiben konnte, war ein Flug nach Indien. Hier verlor sich seine Spur.
Alles erschien mir im Augenblick schwierig...zu kompliziert, zu vage und unausgegoren.
Schwere Gedanken, die man nicht unbedingt während dem Autofahren wälzen sollte.
Deshalb versuchte ich mich wieder auf das aktuelle Geschehen zu konzentrieren.
Schon längst hatte ich die Autobahn verlassen und latschte nun, doch etwas verwirrt auf die Bremse. Ich war an meinem Ziel angelangt. Argwöhnisch schielte ich die grauschwarze Fassade des Mehrfamilienhauses zu meiner Rechten auf. Dort, ganz oben im fünften Stock wohnte meine Mutter. Beziehungsweise hatte sie gewohnt.
Vor vier Wochen war sie gestorben.
Ich schloss die Augen und konnte sofort ihr Gesicht sehen, dass jahrzehntelange Sorgen akkurat zerfurcht hatten. Ihr schlohweißes Haar war an diesem Tag, wie an all den anderen Tagen auch, straff zurückgekämmt und zu einem altmodischen Dutt am Hinterkopf zusammen gezwirbelt. Ich hasste diese Frisur. Warum? Keine Ahnung. Vielleicht vermittelte sie mir das Gefühl, dass auch meine Mutter nie hatte auffallen wollen. Im Nachhinein betrachtet, hatte sie sich in meinen Augen nahezu unsichtbar durchs Leben geschlängelt.
Bloß nicht auffallen oder gar anecken. Hatte aber irgendwie nie so richtig funktioniert.
Schon früher hatte mich ihre passive Art, ihre stumme, schweigsame Art auf die Palme gebracht. Selbst wenn sie kritisiert worden ist, hielt sie die Lippen fest zusammengepresst und verschluckte das Kontra, dass ihr auf der Zunge brannte. Das konnte ich fühlen. Wie kleine Spitze Nadeln, die sich in meine Haut bohrten.
Mehr als einmal hätte ich sie am liebsten geschüttelt, damit ihr dieses Kontra einfach mal aus dem Mund purzelte. Doch ich presste ebenfalls schweigend die Lippen zusammen und schwieg.
Vielleicht hatte es etwas mit ihrer Vergangenheit zu tun?
Als der zweite Weltkrieg ausbrach war sie zwölf Jahre gewesen und ich wusste nur, dass meine Oma, als sogenannte Trümmerfrau nicht viel Zeit für sie gehabt hatte. Meine Mutter war sozusagen ein Trümmermädchen. Es musste schwer für sie und meine Oma gewesen sein.
Männer oder Väter (auch meiner) wurden komischerweise nie erwähnt (oder vielleicht auch verschwiegen). Ich konnte meine Mutter auch nie dazu bewegen, mir irgendetwas aus dieser Zeit zu erzählen.
Egal wie oft und wie viel ich auch bohrte und nervte.
Eigentlich hatte ich überhaupt keine Ahnung von meiner Familiengeschichte.
Es war, als ob all unsere Vorgänger sich geschämt und geschwiegen hätten.
So wie meine Mutter und letztendlich auch ich.
Auf jeden Fall flogen bei uns zuhause hin und wieder die Fetzen. Als ob sich die alltägliche und immerzu präsente Passivität zwischendurch wie eine atomare Explosion entladen musste.
Dabei habe ich meine Mutter sehr geliebt und sie mich.
Das wusste ich.
Nun war sie tot und ich musste mich um ihre kleine gemietete Mansardenwohnung kümmern. Alles sollte entsorgt werden, da ich mir eine zweite Miete auf Dauer natürlich überhaupt nicht leisten konnte. Der Vermieter zeigte wirklich Verständnis für meine Lage und beharrte nicht auf die drei Monate Kündigungsfrist.
Sobald ich die Räume entkernt hatte, brauchte ich keine Miete mehr zu bezahlen. Genau DAS war mein Plan für heute. Mir blieben zwei Tage, bis der April anbrach und erneut ein klaffendes Loch in meine mageren Finanzen riss. Frustriert durch all die negativen Gefühle, Gedanken und Erinnerungen würgte ich den Motor ab, stieg aus und kletterte die steilen, durchgetretenen Stufen nach oben. Im dritten Stock hüllte mich der Duft von frittierten Pommes ein. Ich mochte diesen Geruch gerade nicht und hielt die Luft an, bis ich die vierte Etage passiert hatte. Die letzten Stufen erklomm ich nur langsam. Ein kleiner Ficus, mein letztes Geburtstagsgeschenk, empfing mich mit verdorrten braunen Blättern, die sich um den einfachen grünen Blumentopf herum verteilten.
Automatisch bückte ich mich und drückte meinen Zeigefinger in die Erde. Sie war staubtrocken.
Er war jetzt nur noch ein armes, verendetes Bäumchen.
Leise seufzend sperrte ich die Haustür auf. Gleich darauf zog ich leicht angewidert die Nase kraus.
Was für ein abgestandener Muff.
Konnte meine Mutter denn nicht mal lüften?
Nein, konnte sie nicht. Sie war tot. So tot wie das letzte Geburtstagsgeschenk draußen im Flur.
Ich seufzte noch einmal und drückte die weißlackierte Haustür mit dem Rücken zu. Dann schaute ich mich um.
Auf andere würde die Wohnung verlassen wirken. Auf mich nicht. Meine Mutter hatte einen spartanischen Einrichtungsgeschmack. Nur das Nötigste.
Hier in dem kleinen Vorraum waren drei einfache Haken an der Wand angebracht. Daran hingen ein Schirm, eine Winterjacke und eine zweiteilige Regenjacke, deren Innenfutter sich unter Mithilfe von Reißverschlüssen lösen konnte. Somit hatte man auch gleichzeitig eine dünne Übergangsjacke. Darunter standen drei Paar Schuhe. Zum einen Sandalen, ein altmodisches Paar Schnürschuhe und Winterstiefeletten. Das war‘s.
Etwas zögerlich löste ich mich von der Tür und betrat das Wohnzimmer, mit der kleinen Kochnische in der linken Ecke. Auch hier herrschte penible Ordnung, vielleicht oder gerade mangels Dekoration.
Eine Dreisitzer-Couch, ein kleiner Tisch, ein Fernsehschrank mit Röhrenfernseher. Darauf ein Kofferradio und ein ausgefranster aber sauberer Teppich.
An dem einzigen Fenster in diesem Raum hingen kleine Bistrogardinen. Dies hatte meiner Mutter immer gereicht.
Ich verstand es.
Wer sollte einem schon hier im fünften Stock in die Fenster reinglotzen?
Ich drehte mich einmal um die Achse. Die aufgeräumte Küchenzeile kam in mein Blickfeld.
Der Kühlschrank brummte leise. Die Spüle glänzte blankgescheuert. Es gab einen Hochschrank, eine Abzugshaube, die besagte blankgescheuerte Spüle und ein weiterer Unterschrank. Der Inhalt dieser Schränke war mir bekannt. Ich musste nicht reinschauen. Meine Mutter besaß Geschirr und Besteck für sechs Leute. Einen großen Topf, zwei kleine Töpfe, einen Milchtopf und eine Pfanne ohne Deckel. Dazu kamen ein paar Plastikschüsseln, eine eckige Kuchenform inklusive Rührgerät. Das Rührgerät hatte sie vorletztes Weihnachten von mir bekommen.
Unter der Spüle lagen sechs Geschirrtücher, sechs Spüllappen, Spülmittel, Glasreiniger, kleine Mülltüten, große Mülltüten, Brotpapiertüten und zwei Mikrofasertücher, die ich ihr ebenfalls einmal mitgebracht hatte, weil ich sie äußerst praktisch fand.
Mein Blick streifte den brummenden Kühlschrank.
Obwohl ich wusste, was mich erwartete, öffnete ich ihn neugierig und wurde auch erwartungsgemäß enttäuscht.
Es war drin, was schon immer drin gewesen war. Eine Packung Käse, ein Becher Margarine, eine Packung Salami. Ein paar Eier. Vier Fruchtjogurt.
Kirschgeschmack. Etwas Backfett. Zwei Packungen Milch.
Eine Packung O-Saft. Eine Tüte Möhren, die jedoch schon ganz verschrumpelt waren und zu guter Letzt die obligatorische kleine Stiel-Kasserolle mit den Resten der letzten Mahlzeit. Zum Aufwärmen für den nächsten Tag.
Doch dieser nächste Tag lag schon vier Wochen zurück.
Ich nahm den Topf ohne reinzuschauen aus dem Kühlschrank und steckte ihn leicht angeekelt in die kleine Mülltonne, neben dem Kühlschrank. Das Essen darin hatte bestimmt schon so viel Haare angesetzt, dass es zum Friseur musste. So etwas wollte ich mir nicht wirklich betrachten.
In einem schmalen Spalt zwischen Mülleimer und Wand, kauerte ein Besen und ein Handfeger. Einen Staubsauger besaß meine Mutter nicht. Vielleicht hätte sie ja einen dieses Weihnachten bekommen?
Ich verwarf diesen blödsinnigen Gedanken, da sie eh keinen Staubsauger mehr brauchte.
Sie war ja tot.
Ich schnaufte genervt (oder frustriert?) und ging langsam zum Badezimmer. Ein kleiner Raum, dem man vor ungefähr zehn Jahren eine Nasszelle hinzugefügt hatte.
Davor hatte meine Mutter noch nicht einmal eine Dusche besessen. Aber ein Waschbecken und das hatte ihr damals gereicht. In der heutigen Zeit eigentlich unvorstellbar. Für meine Mutter nicht. Neben der Duschzelle klemmte die Toilette und darüber ein Regalbrett mit den Utensilien, die sie benötigt hatte. Sieben Handtücher, sieben Waschlappen, sechs Gästehandtücher, Seife, Zahnpasta+ Zahnbürste (beides in einem sauberen Wasserglas), Shampoo, eine ausgefranste Nagelbürste, eine neu aussehende Nagelschere und fünf Rollen Klopapier.
Gegenüber klammerte sich das winzige Waschbecken an der weiß gekachelten Wand fest. Darüber ein eckiger, einfacher Spiegel (ohne Putzstreifen). Das siebte Gästehandtuch hing neben dem Spiegel an einem weißen Klebehaken.
Und die Waschmaschine unter dem Fenster. Das war‘s.
Ich trat den Rückzug an und begab mich in die Schlafkammer.
Hier standen lediglich ein Einzelbett (Metall), ein Beistelltisch mit Tischlampe und ein Zweitüriger Kleiderschrank, dessen Inhalt mir auch sehr vertraut war.
Wenn ich beide Türen öffnen würde käme folgendes zum Vorschein:
Eine Garnitur Bettwäsche, sieben Unterhosen, sieben Strumpfhosen, sieben Paar Socken, drei Büstenhalter, sieben weiße Unterhemden, drei Blusen (weiß, grau, schwarz), drei wadenlange Röcke (grau, blau, schwarz), und zwei Kleider (eines davon für sonntags, natürlich in schwarz). Dann fiel mir ein, dass ich dem Bestatter dieses Kleid gegeben hatte um es meiner Mutter für die letzte Reise anzuziehen. Also hing jetzt nur noch ein Kleid (beige) im Schrank. Dazu gesellte sich eine hellgraue selbstgestrickte Weste, zwei Stoffhosen (braun, blau) die mindestens schon acht Jahre alt waren und an denen noch das Etikett hing, weil meine Mutter Hosen verabscheute und drei Pullunder (blau weiß gepunktet, grau, braungestreift), die ICH absolut grauenhaft fand. Doch meine Mutter hatte sie im Frühjahr und Herbst stoisch getragen. Jahr für Jahr.
Egal wie sehr ich auch moserte.
Mit zitternden Fingern öffnet ich den Kleiderschrank trotzdem und fand alles genauso vor wie ich es mir gedacht hatte. Doch dann sah ich tatsächlich ein mir noch unbekanntes Teil.
Einen farbenfrohen Sommerschal.
Ein äußerst irritierender Anblick.
Wann hatte sie sich den denn gekauft?
Etwas verwirrt strich ich sachte über den leichten Stoff, zog ihn dann entschlossen von der Stange und schlang ihn um meinen Hals. Den würde ich behalten.
Als Andenken an die sture alte Dame, die mir nun so unendlich fehlte.
Nur wenige hatten verstanden, warum meine Mutter so spartanisch gelebt hatte. Doch ich wusste warum. So war sie immer in der Lage gewesen, schnell die Zelte abzubrechen, wenn die Zeit zum Weiterziehen gekommen war.
Als ich noch klein war, sind wir oft umgezogen.
Und plötzlich fiel mir auf, dass ich genauso lebte...aus demselben Grund. Auch ich hätte problemlos als Nomade durchgehen können.
Wie sehr sich unsere Leben doch ähnelten.
Mühsam schluckte ich die aufsteigenden Tränen hinunter und lenkte meinen Blick (und meine melancholischen Gedanken) auf das gemachte Bett.
Blumenbettwäsche. Altmodisch aber gepflegt.
Das dicke, bauschige Federbett sah allerdings aus, als ob sich ein überfressener Troll darunter versteckt hätte. Ich hatte nie verstanden, wie meine Mutter unter solch einem Ungetüm schlafen konnte. Mich hätte es vermutlich zu Mus gequetscht, so schwer fühlte es sich an. Als kleines Kind hatte ich immer Angst, die Decke könnte mich nachts einmal auffressen. Blöder Gedanke, doch ich war noch ein Kind gewesen.
Plötzlich fingen meine Knie an zu zittern. Kraftlos ließ ich mich auf die Bettkante sinken und hatte sogleich das Gefühl als ob die massige Decke mich erbost wieder runterschubsen wollte. Ich ignorierte dieses Gefühl, seufzte und war in Gedanken bereits am Ausräumen.
Einiges konnte ich spenden. Vieles würde jedoch auf dem Müll landen und für die Möbel hatte ich für den nächsten Tag eine Entrümplungsfirma angeheuert.
Das hieß, ich hätte noch einen Tag Zeit um durchzufegen und das Kapitel ‚Mutter‘ mit einer Schlüsselübergabe zu beenden. So war das Leben. Mit dem Beseitigen der persönlichen Anhäufungen endete alles.
Wer würde meine Dinge einmal beseitigen?
Dieser Frage lenkte meine Gedanken ganz kurz zu dem Kind, dass sich unter meinem Herzen breitmachte. Ob sie dann auch so traurig sein würde, wie ich jetzt gerade?
Hoppla. Sie? Vielleicht würde es ein ‚Er‘ werden. Oder?
Ich seufzte noch einmal schwermütig, schob den Gedanken an mein zukünftiges Kind zur Seite und spürte sofort wieder den unwilligen Druck der bauschigen Bettdecke in meinem Rücken.
Verärgert stand ich auf, riss die schwere Decke vom Bett und pfefferte sie auf den Boden.
Dabei stieß ich unverhofft mit dem Fuß gegen irgendetwas, dass unter dem Bett lag.
Verblüfft verharrte ich mitten in der Bewegung und vergaß auch die Wut auf die bescheuerte Bettdecke.
Meine Mutter hatte nie etwas unter dem Bett.
Auch genau wie ich. Seltsam.
Langsam ging ich in die Hocke und linste unter das Bettgestell. Da lag tatsächlich was. Etwas, dass ich mit meinem versehentlichen Tritt nach hinten an die Wand befördert hatte. Es schien sich um eine Art Kiste zu handeln. Zuerst stierte ich einfach nur blöde. Dann legte ich mich flach hin, streckte neugierig den Arm aus, um die unbekannte Kiste ans Tageslicht zu befördern, was mir auch gelang. Anschließend hockte ich bestimmt eine geschlagene viertel Stunde auf dem Boden und starrte die Kiste einfach nur an.
Sie wirkte wie ein Fremdkörper in dieser Wohnung.
Etwas, dass hier nicht hingehörte, weil es so untypisch war für meine Mutter.
Und da war noch etwas anderes… Etwas Unterschwelliges.
Etwas, was mir eine Gänsehaut verursachte.
Es schien, als ob meine Mutter ein Geheimnis vor mir gehabt hätte. Meine Mutter? Ein Geheimnis?
Warum hatte ich diese Kiste noch nie gesehen? Warum hatte meine Mutter nie von ihr gesprochen oder sie wenigstens mal am Rande erwähnt? Was war darin?
Geld? Versicherungsunterlagen?
Dieser Gedanke reizte mich, trotz der ernsten Lage, zum Lachen. Die Unterlagen meiner Mutter hatten sich schon immer in meinem Besitz befunden.
Der Ordner wurde früher in meinem Kinderzimmer, im Kleiderschrank, ganz hinten gelagert und als ich damals (vor gefühlten hundert Jahren) auszog, um irgendwie den Versuch zu starten, auf meinen eigenen wackeligen Beinen zu stehen, nahm ich sie automatisch mit. Gottlob.
So hatte ich die Unterlagen ihrer kleinen Lebensversicherung direkt parat und blieb nicht noch auf den Beerdigungskosten hocken.
Doch nun war hier diese Kiste.
Diese ominöse Kiste. Diese fremde Kiste. Eine Kiste mit definitiv unbekanntem Inhalt.
Also...was hatte meine Mutter zu verbergen versucht?
Unsicher kaute ich heftig auf meiner Unterlippe herum.
So lange bis sie tierisch schmerzte und sogar blutete.
Fluchend presste ich direkt meine Hand drauf und rappelte mich mit eckigen Bewegungen hoch, um ins Badezimmer zu laufen.
Die Kiste kippelte, sackte mit einem Ruck nach vorn und der Deckel sprang auf. Geschockt blieb ich stehen.
Meine Augen klebten auf dem, was hervorquoll. Papiere.
Viele Papiere. Alte gelblich verfärbte Papiere. Papiere, bei denen sofort das Wort ‚Papyrus‘ vor meinem inneren Auge wie eine Leuchtreklame blinkte. Antike Schriftrollen, nur gefaltet. Papiere, die aussahen, als ob sie bei der kleinsten, minimalsten Erschütterung in ihre Einzelteile zerbröseln würde. Vorsichtig atmete ich deshalb durch den Mund, damit aus meiner Nase keine kräftige Atemwolke rausschoß und beugte mich vor.
Natürlich vergaß ich meine Lippe. Erst als ein dicker roter Tropfen leise klatschend auf einem dieser wertvoll aussehenden Blätter landete, zuckte ich zurück und fluchte. So ein Mist.
Wenn Mutter dies sah, würde sie sofort wissen das ich rumgeschnüffelt hatte und total ausrasten.
Oh...nein, das würde sie nicht. Sie war ja tot.
Erneut stieß mich dieser Gedanke in einen tiefen dunklen Schlund. Ich war alleine.
Niemand mehr da, der an meinem Kragen herumzoppelte, der naseweise Etiketten aus meiner Kleidung herausschnitt, der mich auf einen dringend benötigten Haarschnitt hinwies, der die Nase rümpfte, weil ich meine Bettwäsche ungebügelt aufzog, der mich an meine jährlichen Vorsorgetermine erinnerte (egal ob Frauenarzt oder Zahnarzt), der vergebens versuchte mir das Stopfen von Socken beizubringen oder der mir die Vorzüge von Proteinreicher Nahrung unter die Nase rieb.
Ich war alleine. Mein Blick fiel auf den Blutstropfen auf dem alten Papier. Langsam drehte ich mich um und schlich mit hängenden Schultern ins Badezimmer.
Dort wusch ich mir das Gesicht und trocknete es mit Klopapier, dass ich anschließend die Toilette runterspülte.
Das Gästehandtuch neben dem Spiegel zu benutzten widerstrebte mir. Alleine schon wegen dem Blut. Erst als ich sicher war, dass die Lippe notdürftig verarztet war und kein Blut mehr hervorquoll, trottete ich zurück ins Schlafzimmer, sank auf den Boden und brütete einige Minuten dumpf vor mich hin, bis ich entschlossen den Rücken straffte, das oberste Schriftstück packte und dies äußerst vorsichtig auseinanderfaltete. Zuerst dachte ich, meine Augen hätten ein Problem. Doch dann wurde mir klar, dass es sich um Briefe handelte. Alte, sehr alte Briefe, die in altem, sehr altem Deutsch verfasst waren, wovon ich, auch weil sie unglaublich verblasst waren, nur einzelne Worte entziffern konnte. Hier stand ‚ist‘ und da ‚sein‘. Hieß das hier ‚Rinder‘? War der Verfasser ein Bauer gewesen? Oder sollte es ‚Finder‘ heißen?
Ebenso erfolglos versuchte ich die Adressaten zu lesen.
Einmal stach mir der Name ‚Luzie‘ ins Auge. Vielleicht sollte es aber auch ‚Luzern‘ heißen? Doch meine Mutter war noch nie in der Schweiz gewesen.
Vielleicht war Oma mal dort gewesen?
Unbewusst pfiff ich durch die Zähne. Das mussten wirklich alte Schinken sein. Ob sie wertvoll waren?
Nun neugierig geworden schnappte ich mir das nächste Schriftstück. Dann noch eins und noch eins. Einige (recht lesbare) schienen von meiner Großmutter zu sein. Der Inhalt bewegte sich überwiegend um häusliche Ratschläge. Doch ob diese Briefe wirklich für meine Mutter gedacht waren, konnte ich nicht erkennen. Unter all diesen uralten Briefen fand ich auch viele amtlich aussehende Dokumente, Tabellen, wie Auszüge aus einem längst vergangenen Register. Doch welches Register erschloss sich mir leider nicht, da ich, wie gesagt, die Schrift kaum entziffern konnte. Je weiter ich vordrang umso größer wurde das Fragezeichen in meinem Gesicht.
Drei schmale Bücher, die an Tagebücher erinnerten, wurden kurz von mir aufgeschlagen und gemustert.
Ebenfalls steinalt und für mich nicht zu entschlüsseln.
Was war das alles hier und warum hatte meine Mutter diesen Kram aufgehoben?
Und dann sah ich ein weiteres Buch. Na ja, eher ein Block.
DIN A4. Relativ aktuell, wie ich vom Zustand schließen konnte. Gut, ein wenig zerfleddert war er schon, dennoch sah er aus, als ob er für mich verwertbar wäre. Ohne Umschweife schnappte ich danach und schlug ihn auf.
Ein Umschlag plumpste heraus, direkt in meinen Schoß.
Verblüfft legte ich den Block zur Seite und griff nach dem besagten Kuvert. Sofort begann mein Herz an zu rasen.
Mein Name stand in leicht verschnörkelter Schrift drauf.
Ich erkannte diese Schrift sofort.
Definitiv die Züge meiner Mutter.
Ein Brief von meiner Mutter? An mich? Warum?
Obwohl mir die Neugier förmlich die Fingernägel wegbrannte, zögerte ich.
Was hatte meine Mutter mir zu sagen?
Jetzt, nach ihrem Tod.
Ich sah, dass meine Finger wahnsinnig zitterten, als sie den Brief aus dem Umschlag zogen und das Blatt Papier leicht widerstrebend auseinanderfalteten und obwohl ich mich vehement wehrte, begannen meine Augen den Inhalt langsam aufzusaugen.
Meine liebe Muriel, wenn du dies hier liest, bin ich nicht mehr da. Ich vermute, du sitzt gerade in meinem Schlafzimmer auf dem Boden, all die alten Briefe und Dokumente chaotisch um dich verstreut und wunderst dich.
Diese Dinge gehören alle zu unserer Geschichte. Sie sind Zeitzeugen, die von Generation zu Generation weitergereicht werden. Genau wie das Schicksal, dass all die Frauen vor uns geteilt haben. Ich, meine Mutter, ihre Mutter, deren Mutter und so weiter.
Sie alle haben dazu beigetragen, dass du heute hier sitzt und dies liest. Doch ICH habe mich entschlossen, dass du die Letzte sein wirst, die unsere aller Schicksal teilen soll. Da ich weiß, dass du die Briefe und Dokumente wohl nicht richtig lesen und auch keine Verknüpfung herstellen kannst (wie solltest du auch), habe ich unsere Geschichte aufgeschrieben. Ich saß sehr lange daran, doch ich habe es für dich getan. DU, wirst diejenige sein, die den Kreis durchbricht. DEIN Leben wird (hoffentlich) anders verlaufen und anders enden als Unseres.
Ich werden dir unser düsteres Familien-Geheimnis enthüllen...ein Fluch, der seit Generationen auf uns lastet. Ein Fluch, der Vergeben werden muss. Ich weiß, das klingt alles ziemlich konfus. Das fand ich früher auch. Doch je älter ich wurde…na ja…, was, wenn doch ein Körnchen Wahrheit darin steckt? Wenn du die Geschichte liest, wirst du hoffentlich verstehen.
Ich liebe dich.
Wir alle lieben dich.
Deine Mama Martha und Deine Großmütter Maria, Barbara, Maria, Charlotte und EbbaZutiefst verwirrt ließ ich den Brief zurück in meinen Schoß sinken. Tausend Fragen stürmten auf mich ein.
Tausend Fragen, auf die ich nicht eine Antwort parat hatte. Ein Geheimnis? Ein Fluch? Wo war ich denn hier?
In einem mystischen Krimi? Und was soll der Käse mit meinen ganzen Großmüttern? Die haben mich doch nicht einmal gekannt. Wie kam meine Mutter dazu, zu schreiben, sie würden mich lieben? War Mama etwa zum Schluss senil geworden, ohne dass ich etwas bemerkt hatte? Waren ihre Blutdrucktabletten etwa zu stark gewesen? Konnten Blutdrucktabletten überhaupt solchen psychotischen Quatsch hervorbringen?
Irgendwie zweifelte ich daran. Dann fiel mein Blick auf den Block, den ich achtlos neben meinem Knie abgelegt hatte. Ich zögerte.
Hatte ich wirklich Bock das zu lesen? Hatte ich nicht schon genug Probleme am Hals?
Schwanger. Ohne Partner. Keine richtigen Freunde, weil niemand ihr Wesen verstand (oder verstehen wollte).
Eine Arbeit, die mich nicht ausfüllte. Nicht falsch verstehen. Die Arbeit ermöglichte mir schließlich meine Unabhängigkeit, ein Dach über dem Kopf und einen vollen Kühlschrank. Doch war er nicht das, was ich eigentlich wollte. Allerdings wusste ich nicht einmal, was ich wollte. Ich stand mitten auf einer imaginären Kreuzung und wusste einfach nicht, welche Richtung ich einschlagen sollte.
Dies schien mir das größte Dilemma. Nicht zu wissen wo ich hinwollte oder hingehörte.
Ich fühlte mich wie die herausgerissene, verlorene Seite eines Buches…ein kleiner zusammenhangloser Fetzen einer Geschichte, die ich selbst nicht kannte.
Mit zusammengekniffenen Augenbrauen musterte ich den Block.
Eine verlorene Seite? Der Fetzen einer Geschichte?
Irgendwie ahnte ich plötzlich, eher unterschwellig, dass dort alle (oder doch viele) Antworten, die ich dringend suchte, zu finden wären.
Unverhofft packte mich die Angst.
Wollte ich wirklich wissen was darin stand? Wollte ich?
Es dauerte ungefähr zehn Sekunden, dann fiel die Entscheidung.
Ich wollte (oder musste).
Entschlossen nahm ich den Block und schlug den Deckel auf.
Das erste, was ich las, war die Überschrift und eine ominöse Widmung…
Freigeist
Dieses Buch widme ich Muriel, meiner Tochter.Möge es sie immer daran erinnern, dass, ein Freigeist zu sein, etwas Gutes ist!
Zögerlich aber neugierig geworden las ich weiter...
Alles nahm seinen Anfang im Jahre 1781 auf dem kleinen Weidenhof im Hunsrück…
∞
Die grobgezimmerte Holztür des Aborts klappte laut und schnitt damit den scharfen Geruch nach Fäkalien ab, was Ursula dankbar zur Kenntnis nahm. Langsam, mit watschelndem Schritt, trippelte sie zurück zur kleinen Kate, die mitten auf einem durchgeweichten Hof, ihr heimatliches Dasein fristete. Blinzelnd schaute sie in den trüben Himmel und hing ihren Gedanken nach. Doch das plötzliche lautstarke Gerangel ihrer Buben, drinnen im Haus, riss sie sofort wieder aus ihren beginnenden Tagträumereien. Verstimmt durch die unwirsche Störung ihrer Brut, drehte sie sich zu dem ärmlich wirkenden Gemäuer um, „Hedda, kannst du den Jungen endlich eine Schale Suppe geben, bevor sie mit aufs Feld müssen?“ Ursula strich sich seufzend über den vorgewölbten Bauch und drückte ihren schmerzenden Rücken durch. Die Schulterpartie brannte wie Feuer und sie würde sich eigentlich gerne noch einmal hinlegen.
Doch das war unmöglich, wie sie wusste. Heute war Waschtag und die Leintücher mussten im großen Zuber ausgekocht werden und wenn ihr Mann mit den Jungs am Ende des Tages von der Feldarbeit nach Hause kamen, wollten sie eine anständige Mahlzeit. Und dem Vieh war es auch egal, wie sie sich heute fühlte. Es wollte einfach nur Futter. Ursula seufzte ergeben. Das Gezeter der Jungs flammte erneut auf. Genervt presste sie die Lippen zu einem schmalen Strich und warf dem kleinen Bauernhaus einen bösen Blick zu.
Drinnen, im Haus, verdrehte Hedda, ihre älteste Tochter, die Augen und drückte gefrustet die rosige Zitze der braunen Kuh fest zusammen, was ein erbostes Muhen auslöste. Sofort lockerte sie den groben Griff am weichen Euter der Kuh und tätschelte kurz, aber liebevoll die Flanke des Tieres, „Tut mir leid, Elsa. War nicht so gemeint! Trotzdem danke für die Milch!“
Eilig rappelte sie sich von dem dreibeinigen Holzschemel hoch und zerrte den, zur Hälfte gefüllten Eimer unter dem Bauch der Kuh hervor.
Die Milch schwappte gefährlich und Hedda mahnte sich zur Ruhe. Nur nichts verschütten!
Von draußen ertönte wieder die energische Stimme ihrer Mutter, „HEDDA!“
Das junge Mädchen horchte erstaunt auf. Das klang ungewöhnlich schrill, oder irrte sie sich da? Doch dann zuckte sie mit den Achseln. Bestimmt war nichts. In der letzten Zeit war ihre Mutter des Öfteren gereizt und launisch. Dies hatte bestimmt mit der bevorstehenden Geburt zu tun, vermutete Hedda. Wieder ein Baby.
Eigentlich freute Hedda sich auf den neuen kleinen Erdenbürger, doch ihr war auch bewusst, dass ihr Arbeitspegel dann enorm steigen würde. Schließlich musste ihre Mutter sich dann zusätzlich um den Winzling kümmern und hatte dann nicht mehr allzu viel Zeit zum Kochen und Waschen. Einiges davon würde Ursula dann auf ihre älteste Tochter abwälzen, was sie ohnehin die letzten Monate bereits getan hatte. Doch Hedda war es gewohnt zu gehorchen und erledigte ohne zu murren (meistens jedenfalls) alle Arbeiten, die man ihr auftrug.
Aber niemand verlangte, dass sie dies toll finden musste, was sie auch nicht tat. Aber sie war ein Mädchen und es war eben ihre Pflicht. Erneut erklang vom Hof die grelle Stimme ihrer Mutter, „HEDDA?“
Das Mädchen schniefte leise vor sich hin und stakste vorsichtig mit der noch warmen Milch nach nebenan, in den Hauptraum, wo die Jungs mit ihren zotteligen, ungekämmten Köpfen schon fast im Topf hingen und nuschelte für sich, „Ja, ja…ich mach ja schon, Mutter!“
Dann wurde ihr bewusst, dass ihre Mutter sie ja nicht verstehen konnte und wahrscheinlich noch immer auf eine Antwort wartete. Deswegen huschte Hedda schnell zum kleinen Fenster der Stube, riss es eilig auf und schob ihren blondgelockten Kopf hindurch, „Ja, Ma…!“
Der Rest ging in einem entsetzten Keuchen unter. Ihre Mutter kniete im schlammigen Morast des Hofes und hielt sich mit schmerzverzerrtem Gesicht den dicken Bauch. Doch eigentlich war es das Blut, dass den hellen, groben Stoff des Rockes stetig durchtränkte und sich in Windeseile ausbreitete, das Hedda schockiert nach Luft schnappen ließ.
Ursula hob den Kopf und ihr hilfloser Blick heftete sich auf das junge Mädchen, dass sie vom Haus her, durch die kleine Öffnung mit großen Augen anstarrte, „Hilf mir, Hedda! So beeil dich doch!“
Hedda schlug mit einem lauten ‚Rums‘ das Fenster zu, ignorierte ihre dumm glotzenden Brüder und hechtete mit fliegendem Rock nach draußen. Gerade als Ursula die Augen verdrehte und nach hinten zu kippen drohte, erreichte Hedda ihre Mutter und fing sie in letzter Sekunde auf. Vorsichtig, den kalten Schlamm ignorieren, sank sie auf die Knie und legte mit zitternden Händen, den Kopf ihrer Mutter auf ihrem Schoss ab, „Mama…was ist?“ Ihr Blick rutschte nach unten, zu Ursulas Beinen. Der tiefrote Fleck durchtränkte schon fast den gesamten Vorderbereich. Panik machte sich bei Hedda breit, doch sie schluckte tapfer, als sie ihrer Mutter ins Gesicht schaute, „Ich bin bei dir, Mutter. Keine Angst!“
Ursulas fahle Lippen formten nur einen Satz, „Ich glaube, das Baby kommt!“
Hedda schaute panisch um sich und war versucht, nach Hilfe zu schreien, doch sie wusste, es würde keine Hilfe kommen…von wem auch? Ihren Brüdern? Ihrem Vater?
Ihr war bewusst, dass nur SIE ihrer Mutter helfen konnte…helfen MUSSTE!
Deswegen legte sie vorsichtig Ursulas Kopf ab und krabbelte, den kalten braunen Matsch zwischen ihren Fingern ignorierend, neben sie. Zaghaft hob sie den Rock ihrer Mutter ein Stück an und linste drunter. Was sie sah, ließ sie entsetzt zurückweichen und ihre Gesichtsfarbe wechselte von Rot zu weiß, dann wieder zu rot. Hilflos warf der Frau vor sich einen Blick zu und ihr traten die Tränen in die Augen, als sie die bebenden Lippen ihrer Mutter erblickte, „Du musst mich reinbringen Hedda!
Schnell!“ Doch Hedda schüttelte langsam den Kopf und flüsterte, „Es ist zu spät!“
Nach einem kurzen Moment des Zögerns kniete sie sich wieder neben Ursulas Kopf.
Zärtlich strich sie das wirre und verschmutze Haar aus der schweißnassen Stirn der hochschwangeren Frau, „Ich kann den Kopf schon sehen! Ich muss es rausziehen… glaube ich, oder?“
Ursula schlug flatternd die Lider nach oben. Dabei löste sich eine Träne aus ihrem Augenwinkel und rann seitlich herab. Schwach nickte sie und überließ ihrer Tochter die Führung. Was sollte sie auch sonst tun…kraftlos, zitternd und von Schmerzen durchgeschüttelt. Hedda betrachtet noch einmal das wachsbleiche Gesicht ihrer Mutter und krabbelte wieder runter zu Ursulas Beinen. Sie zog tief Luft und lüftete wieder den Rock.
Der Anblick des winzigen, blutverklebten Köpfchens, zwischen den halbgeöffneten, bleichen Schenkeln ihrer Mutter, wirkte abstoßend und brutal auf das junge Mädchen. Doch sie biss eisern die Zähne zusammen.
Behelfsmäßig wischte sie ihre dreckverschmierten Hände an ihrem eigenen Rock ab und griff dann mit zitternden Fingern nach dem Köpfchen, das sich irgendwie schleimig und glitschig anfühlte. Hedda schloss die Augen und unterdrückte einen aufkeimenden Würgereiz.
Der Gestank nach Blut und Kacke raubte ihr fast den Atem. Mit beiden Händen packte sie das winzige Wesen an den Wangen und zog leicht. Sofort schoss ein Schwall heißes Blut hervor und schwappte über ihre Hände. Doch sie ließ nicht los. Sie MUSSTE dieses Kind irgendwie aus dem Bauch ihrer Mutter bekommen. So würde sie ihre Mutter nicht ins Haus schaffen können…nicht mit halb heraushängendem Balg… Schweißbäche rannen ihr den Rücken hinab und durchtränkten die dünne Bluse, die sie sich heute Morgen schnell übergestülpt hatte. Auch ihre blonden Locken waren feucht und ringelten sich klebrig in ihrem nassen Nacken. Keuchend zog sie noch einmal. Weiteres Blut quoll hervor. Hedda stand die Panik schon auf der Stirn.
Soviel Blut!
Verbissen setzte sie ihr Werk fort und ignorierte das schmerzhafte Stöhnen aus dem Mund ihrer Mutter. Sie musste dieses vermaledeite Kind endlich da rauskriegen!
Sie zerrte erneut!
Himmel, so komm doch endlich!
Hedda ruckte noch einmal, diesmal kräftiger und mit einem schmatzenden Geräusch glitt das glitschige Bündel, zusammen mit halb geronnenem Blut und Fruchtwasser aus dem aufgedunsenen Leib heraus.
Erschrocken durch die plötzliche Leichtigkeit, ließ Hedda das Köpfchen los und plumpste nach hinten in den Matsch, was ebenfalls ein schmatzendes Geräusch verursachte.
Ihr Hintern war nun völlig durchweicht und auch die vordere Partie ihres Rockes war durchtränkt von feuchtem Schlamm und Blut. Doch das war Hedda in diesem Augenblick völlig egal.
Überrascht starrte sie auf das kleine Wesen, dass zwischen den Beinen ihrer Mutter lag. Erst als dieses Wesen kurz ein winziges Ärmchen hob, löste sich die Starre aus Heddas Gliedern.
Eilig robbte sie zurück und zog schon fast ehrfurchtsvoll das Baby aus den nassen Rockfalten ihrer Mutter hervor.
Behutsam, mit zitternden Fingern, hob sie ihren eigenen Rock an und wickelte das nackte Kind darin ein. Genau in diesem Augenblick erschien Joseph, ihr Vater am Scheunentor, der an einem ledernen Zügel den launischen Ackergaul, Klopfer, hinter sich herzerrte. Verdutzt blieb er stehen, als er beide im Hof liegen sah.
Doch nach ein, zwei Sekunden des verblüfften und fragenden Starrens, schien er endlich zu begreifen und es kam Leben in ihn. Die Zügel fielen unbeachtet zu Boden und mit großen Schritten eilte er zu seiner Frau. Ohne auf den Dreck zu achten, fiel er auf die Knie und hob schon fast zärtlich Ursulas Kopf sachte an. Sein zweiter Blick galt seiner ältesten Tochter, „Was ist passiert?“
Hedda, noch völlig überwältigt von dem eben Erlebten, schaute ihren Vater nur mit großen, glasigen Augen an und wusste nicht, was sie ihm antworten sollte.
Stattdessen zog sie schweigend, quasi als Antwort auf seine Frage, einen Rockzipfel zur Seite und gab damit den Blick auf das Neugeborene frei. Joseph betrachtete sich kurz das reglose Bündel und lenkte seine Aufmerksamkeit und Fürsorge direkt wieder seiner Frau zu, „Geh, mach Wasser heiß und leg die Decken zurecht, Hedda. Koche hurtig Tee und schicke den Anton auf der Stelle zur Waldmühle, die Elsbeth holen.“
Hedda starrte ihren Vater, dessen Wangenknochen mühsam mahlten, einfach nur stumm an, ohne sich zu rühren.
Diese Situation überforderte sie völlig und sie war verwirrt. Noch nie hatte sie eine Geburt miterlebt. Noch nie hatte sie so viel Blut gesehen. War das normal?
Sie wusste es nicht, denn bei den Geburten ihrer Brüder wurde sie von den anwesenden Frauen aus den Nachbargehöften, immer nach draußen geschickt und musste dann stundenlang warten, bis sie wieder hineindurfte. Doch dann hatte ihre Mutter immer schon, gewaschen und fein säuberlich zugedeckt in ihrer Schlafnische gelegen und hatte ein sauberes, gewickeltes Kindlein im Arm gehalten. Oder eine der helfenden Bäuerinnen kam mit einem eingeschlagenen Bündel aus dem Haus und verschwand im angrenzenden Hain.
Zurück kam sie ohne Kind. Egal wie, sie durfte immer erst ins Haus zu ihrer Mutter, wenn alles vorbei war. Das eine Geburt allerdings so grausam sein konnte, hätte sie nicht im Geringsten für möglich gehalten. Kinder zu bekommen sollte doch etwas Wundervolles sein, dachte sie…oder nicht? Joseph ahnte nichts von den chaotisch herumwirbelnden Gedanken seiner Tochter. Er sah nur, dass Hedda nicht reagierte und sich in Bewegung setzte, um ihrer Mutter endlich zu helfen.
Warum kann dieses vermaledeite Gör nicht gehorchen?
Er holte aus und versetzte seiner Tochter eine Ohrfeige.
Nicht allzu fest. Nur so kräftig, dass Hedda erschrocken die Augen aufriss und endlich die Worte ihres Vaters verstehen konnte, „Mach Wasser heiß und schick den Anton zur Elsbeth…und zwar sofort! Hast du mich verstanden?“ Hedda zuckte zusammen und nickte.
Mühselig rappelte sie sich, mit dem Baby auf dem Arm, auf und eilte zurück ins Haus, wo sie von ihren neugierig starrenden Brüdern stumm empfangen wurde. „Anton, lauf rüber zur Waldmühle. Die Elsbeth soll sofort kommen. Und du…“, sie zeigte mit ihrem Ellbogen auf Ludwig, „…nimm Klopfer und mach das du schon mal aufs Feld kommst. Vater wird ganz sicher bald nachkommen! Und Anton kommt dann direkt von der Mühle rüber zu euch!“
Anton und Ludwig glotzten auf Heddas hochgehobenen Rock, der ihre nackten Beine entblößte. Nur Friedrich kauerte weiter am Kochtopf herum und versuchte an die blubbernde, dünne Suppe zu kommen. Doch Friedrich war auch erst drei Jahre alt (nun ja, nicht ganz, aber bald).
Was kümmerte es ihn, was da draußen auf dem Hof los war? Er hatte (immer) Hunger und nur DAS war im Augenblick wichtig für ihn. Die beiden anderen Jungen dagegen waren schon etwas älter. Der Ludwig war fast sechs und der Anton sieben. Beiden Buben konnte Hedda ansehen, dass sie überhaupt nicht verstanden, was gerade hier passierte. Mit verkniffener Miene stakste sie in die Ecke zum Brotkorb, fischte aus einem Leintuch den restlichen, halben Brotlaib heraus und drückte ihn Ludwig in die Hand, „Hier, dass könnt ihr euch später auf dem Feld teilen!“
Noch immer standen die Jungen vor ihr und glotzen sie mit großen Augen an. Genervt zerrte Hedda an ihrem Rock und ließ dabei um ein Haar das Kind darin fallen.
Erschrocken packte sie zu und drückte das reglose Bündel wieder vorsichtig an sich.
Jetzt nur nicht die Nerven verlieren! Hedda…ganz ruhig…!
Sie atmete einmal kräftig aus und versuchte mit geschlossenen Augen ihr wild pochendes Herz zu beruhigen. Dann öffnete sie die Augen wieder und schaute Anton eindringlich an, „Die Mama braucht jetzt ganz dringend Elsbeths Hilfe…als nimm endlich die Beine in die Hand, bevor der Vater dir eine Trachtprügel verpasst, die du so schnell nicht vergessen wirst!“
Antons Hände zuckten automatisch nach hinten und bedeckten schützend seinen Po, ließ ihn aber im gleichen Atemzug wieder los.
Ohne ein weiteres Wort stürmte er zur Haustür, riss sie auf und verschwand im trüben Morgen, ohne auf seine Eltern im Hof zu achten. Heddas Blick richtete sich nun ernst auf ihren anderen Bruder, „Und du nimmst jetzt gefälligst Klopfer und machst dich auf den Weg zum Acker. Nimm dir ein paar Karotten mit, falls Klopfer mal wieder bockt!“ Ludwig schielte neben die Kartoffelkiste, neben dem Eingang, dorthin, wo der Korb mit dem Gemüse lag. Er LIEBTE Karotten. Vielleicht dürfte er sich auch eine nehmen? Hedda sah den gierigen Blick ihres kleinen Bruders und musste sich, trotz der ernsthaften Situation, ein Schmunzeln verkneifen, „Ja, du kannst dir auch eine mitnehmen…aber nur eine kleine!“
Diese Einladung ließ Ludwig sich nicht zweimal sagen. In Windeseile versenkte er drei Mohrrüben in seiner weiten Hosentasche (zwei für den Gaul) und trat genau in dem Augenblick heraus, als sein Vater, mit seiner Mutter auf dem Arm, eintreten wollte. Ängstlich schielte Ludwig auf das blutdurchtränkte Kleid seiner Mutter und die finstere Miene seines Vaters. Ohne einen Mucks von sich zu geben, schlüpfte er an Joseph vorbei, raste ums Haus herum, schnappte sich den zickigen Gaul, der mürrisch schnaubend und mit seinen Hufen scharrend, gewartet hatte und machte sich zusammen mit dem Braunen auf den Weg zum Feld. Wenn er Glück hatte, könnte er sich ja das größte Stück vom halben Brotlaib abreißen. Es war ja keiner da, der kontrollieren würde.
Innerlich frohlockte Ludwig und vergaß bei diesem Gedanken sogar fast den schrecklichen Anblick, den seine Mutter geboten hatte. Was interessierten IHN auch Frauensachen? Das konnte die Hedda erledigen.
Die war ja auch schon fast eine Frau…seiner Ansicht nach, zumindest eine Halbe. Trotzig griff er in die Tasche, beförderte eine Möhre zu Tage, brach sie entzwei und gab dem schnaubenden Klopfer die eine Hälfte. Die andere steckte er sich selbst in den Mund.
Währenddessen legte Joseph vorsichtig seine Frau auf der Strohmatratze ab. Ursulas Kopf kippte kraftlos nach hinten und entblößte dabei die weißbläulich schimmernde Haut am Hals. Joseph kniete neben ihr und schaute über seine Schulter. Sein Blick erfasste Hedda, die mit völlig verdreckten Kleiderschößen und nackten Füssen mitten im Raum stand und ihn ängstlich anstarrte.