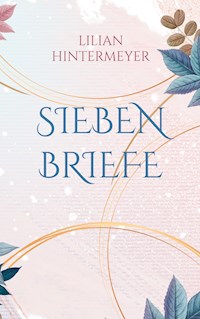Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Für alle, die sich fragen: Ist der Himmel wirklich so toll, wie alle behaupten? Die klare Antwort lautet, NEIN! Bestes Beispiel bin ich! Anabelle! Schon vom Leben nur getreten und gebeutelt, erleide ich, als krönenden Abschluss sozusagen, einen äußerst dummen Unfall und sterbe. Da bin ich gerade mal 25 Jahre und muss meine vierjährige Tochter zurücklassen. Im Himmel angekommen, stelle ich zu meinem Entsetzen auch noch fest, dass sich alle irdischen Probleme klammheimlich an meine Fersen geheftet und sich mit eingeschlichen haben. Nix ist mit Abhängen, Frohlocken und Manna knabbern. Man, bin ich sauer. Zu Recht! Aber weglaufen kann ich nicht. Wohin soll ich denn? Und was wird aus meiner Tochter? Werde ich den Himmel mit all seinen Anforderungen meistern? Und was kommt überhaupt danach?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 618
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wo bin ich? Oh…Gott sei Dank, ich bin nicht alleine. Hallo! Du…ja, DU! Weißt DU vielleicht wo ich bin? Nein? Schade! Möchtest du mir nicht etwas Gesellschaft leisten? So ganz alleine fühl ich mich ein bisschen unwohl. Ich könnte dir ja was erzählen. Ich rutsch auch ein Stück. Komm, setzt dich! Willst du eine Geschichte hören? Hm…nur welche? Ich hab’s! Ich erzähl dir von mir…naja, oder besser von meinem Leben. Hast du Lust? Vielleicht fällt mir ja später wieder ein, wo ich hier bin…
Inhaltsverzeichnis
Der Himmel
Trauer
Nebenan
Schuldgefühle Teil 1
Schuldgefühle Teil 2
Sinnieren, Philosophieren und Spionieren
Unglück & Glück
Jo & Dirk
Cyrille & Emma
Betty und Jamie
Klartext
Johanna & Anabelle
Der Anfang
Von Jo
Also… am besten beginne ich ganz am Anfang. Du hast doch nichts dagegen?
Nun denn, ich wurde am 23.02.1947 bei Bremen geboren. Ich habe keine Geschwister und meine Mutter ist bei meiner Geburt gestorben. So sagte man mir. Leider. Meinen Vater habe ich nie kennengelernt. Ebenfalls leider. Ich weiß noch nicht mal wie er hieß.
Mein besonderes Kennzeichen sind meine Augen. Sie sind…nun ja…komisch. Sie sind nämlich verschieden farbig. Das eine Auge ist blau und das andere braun. Vielleicht habe ich das ja von meinem Vater. Möglich. Niemand konnte mir das je sagen. Doch egal…
Ich wuchs auf dem Land in einem kleinen Dorf bei Bremen bei meiner Großmutter Johanna auf. Das Dorf war so klein, wie so viele Dörfer im Land, das es noch nicht mal Straßennamen gab. Bei uns hatten die Häuser Namen wie zum Beispiel: Sanders Annersch Haus oder Stritzebeckersch Haus. Warum auch nicht?
War doch einfach, oder nicht. Ich finde schon.
Alle kannten sich untereinander. Jedes Kind ging in jedem Haus ein und aus. Ich hatte eine sehr schöne Kindheit, obwohl der 2. Weltkrieg erst zwei Jahre vorbei und die Nachwehen davon noch zu spüren waren. In unserer Dorfmitte stand eine große Trauerweide unter deren tief herabhängenden Ästen sich die Kinder immer trafen um miteinander zu spielen. Und immer gab es einen Bauern, der uns Kindern frische Kuhmilch oder einen leckeren Apfel gab.
Allerdings gab in diesem Dorf auch einen Wehrmutstropfen, ein Mädchen namens Martha, die mich immer wieder ärgerte, nur wegen meiner Augen. Okay, sie waren ungewöhnlich, ja klar, aber Martha hatte dafür unglaubliche Segelohren! Und da ihre Mutter ihr das Haar immer sehr kurz schnitt, weil Martha ständig Läuse hatte (woher, wusste niemand), war es so ziemlich das erste was man sah, wenn sie um die Ecke bog. Ich glaube, sie hätte doch lieber meine zweifarbigen Augen gehabt.
Meine Großmutter war Witwe. Ihr Mann fiel im ersten Weltkrieg und sie hatte danach auch nie wieder geheiratet. Aus dieser Ehe ging eine Tochter hervor. Simone. Meine Mutter.
Großmutter und Simone hatten kein einfaches Verhältnis und 1927, als Simone 17 Jahre alt war, verschwand sie einfach sang- und klanglos und ließ meine verzweifelte Großmutter in dem Dorf zurück.
Zwanzig Jahre und ein Krieg vergingen bis sie sich wiedersahen.
Eine Woche vor meiner Geburt stand sie auf einmal vor Großmutters Tür. Ausgemergelt, ausgezehrt, dunkle Ringe unter den Augen und hochschwanger. Mit 37…für damalige Verhältnisse ein biblisches Alter für eine Gebärende.
Meine Großmutter hatte nie erfahren wo sie die letzten Jahre gelebt hatte oder was in Simones Leben geschehen war. Und Großmutter hatte sie auch nicht danach gefragt.
Aber offensichtlich waren die Entbehrungen der letzten Jahre, in ihrem Leben so groß gewesen, dass der geschwächte Körper meiner Mutter meine Geburt nicht überlebte. Ohne viel Tamtam nahm meine Großmutter, mich kleinen Säugling auf, obwohl sie damals selbst schon 67 Jahre alt war. Das war früher halt so. Sie hatte ja sonst niemanden mehr auf der Welt. Und ich ja auch nicht.
So schwierig das Verhältnis zwischen meiner Großmutter und Simone gewesen sein mochte, so wundervoll war unser Verhältnis. Ich liebte meine Oma heiß und innig und sie mich auch.
Als Martha mich mal wieder geärgert hatte und ich weinend nach Hause lief, nahm sie mich auf den Arm, setzte sich mit mir in der kleinen Stube, in der immer ein frischer Strauß Veilchen stand (außer im Winter, da waren es getrocknete Veilchen), in den alten Schaukelstuhl und wiegte mich. Die Standuhr tickte laut (daran kann ich mich ganz genau erinnern), die Veilchen verströmten einen intensiven Duft und sie strich mir sanft durch das braune, glatte Haar.
„Hat Martha dich wieder mal geärgert, mein Liebchen?“ Mit rotgeränderten, verweinten Augen und verstopfter Nasen nickte ich betröppelt. Ich bettete meinen Kopf an ihre warme, tröstende Schulter.
Großmutter nahm ein spitzenbesticktes weißes Taschentuch aus ihrer blau karierten Schürze und putze mir vorsichtig die Nase, während ich gedämpft schniefte, „Warum kann ich nicht Augen haben wie alle anderen. Sie könnten doch braun sein oder blau.
Aber beides ist doch doof.“
„Na, na, Anabelle“. Ihr kleines, von Falten zerfurchtes Gesicht verzog sich zu einem Lachen. „So bist du halt. Du konntest und kannst dich auch heute nie entscheiden was du willst. Wenn du zum Bespiel Hunger hast, aber auch aufs Klo musst…was ist dann, hm? Wie oft habe ich dich essend auf dem Klo erwischt?“ Sie schüttelte lächelnd den Kopf.
Ich verzog das Gesicht. „Und wie war das, als du seilspringen wolltest, ich dich aber gebeten habe den Salat zu waschen?“
Ich hielt die Hand vor den Mund und kicherte auf ihrem Schoß.
Ja, daran erinnerte ich mich noch:
Ich hatte den Kopf umständlich in zwei Hälften geteilt, draußen vor der Tür in den Wassereimer getunkt und jeweils eine Hälfte in ein leinenes Tuch geschlagen. Dann nahm ich mein Springseil, packte beide Tücher wie kleine Säcke in die Hände und fing an Seil zu springen. Oma kam leicht verärgert aus dem Haus gerannt und wollte wissen was ich da mache und wo der Salat sei.
Und ich sprang und hüpfte mit den beiden Salatsäckchen in den kleinen Händen und meinte nur mit einem unschuldigen Augenaufschlag: Den Salat habe ich nass gemacht und jetzt schleudere ich ihn den Dreck raus.
Großmutter starrte mich damals mit ungläubigem Blick an und ihre Mundwinkel hatten verdächtig gezuckt. Sie machte auf dem Absatz kehrt und ging ins Haus.
Ich hätte schwören können, dass ich sie im Kartoffelkeller laut Lachen gehört habe.
Schmunzelnd legte sie dann die Arme um mich, „Siehst du…“, lachte sie „…und genauso konntest du dich bei deiner Geburt halt nicht entscheiden welche Augenfarbe du möchtest…und hast halt beide genommen.“ Sie fing an, sachte zu schaukeln und zog meinen Kopf zurück an ihre Schulter. Ihre silbernen Locken, die sie meistens mit einem roten Kopftuch zu bändigen versuchte, ringelten sich seidig über ihren Ohren und kitzelten mich an der Nase. Oft betrachtete ich dabei ihre Perlenohrringe, kleine Tropfen, die sanft hin und her schwangen. Sie mochte diese Ohrringe sehr. Oma musste meinen Blick bemerkt haben, „Die habe ich von meiner Mutter bekommen, damals, als sie starb und wenn du groß bist bekommst du sie.“ Ich überlegte angestrengt und hatte daraufhin energisch den Kopf geschüttelt. Oma schaute mich verdutzt an, „Warum denn nicht? Gefallen sie dir nicht?“
„Doch, aber wenn du sie mir gibst, dann stirbst du…wie deine Mutter…also will ich sie nicht und dann kannst du für immer bei mir bleiben.“ Ich umklammerte sie mit meinen Ärmchen. „Ach, Liebchen…“ Großmutter seufzte.
Die große Standuhr tickte laut (Ticktack, Ticktack, Ticktack) und die Veilchen verströmten ihren intensiven Geruch. Irgendwie tröstlich. Irgendwie beruhigend. Irgendwie Oma! Dieser Duft blieb mir mein ganzes Leben im Gedächtnis.
Jahre später, als ich älter und sie nicht mehr bei mir war, fand ich ein Parfüm das genauso roch wie Großmutters Stube und Großmutter selbst. Es war ein grüner Glasflakon und es hieß Mille Fleur. Und wann immer ich später traurig war oder mich einsam fühlte, hüllte ich mich in diesen einzigartigen Duftkokon. Wenn ich dann die Augen schloss, konnte ich fast die Umarmung meiner Großmutter spüren, während sie mich in dem alten Schaukelstuhl wiegte und leise summte…ach Liebchen…
Sie starb 1962. Ich war damals gerade 15 Jahre alt … und von jetzt auf gleich, alleine. Was hatte ich denn erwartet? Das sie ewig leben würde? Ja, wenn ich ehrlich bin, hatte ich genau das erwartet! Ihr Tod machte mich böse…so richtig böse…und dann tieftraurig!
Ihrer Beerdigung war sehr einfach, so wie sie. Die nächsten Nachbarn waren an diesem Tag auf dem Friedhof anwesend. Der Tod war in dieser Zeit noch was völlig Normales und das Leben ging halt weiter. Warum auf einem Friedhof rumstehen, wenn das Feld bestellt werden konnte oder das Vieh versorgt werden musste? Die Sonne schien milde und ein Schwarm Vögel trällerte vergnügt in einem nahestehende Baumwipfel. Irgendwie unpassend fand ich damals. Sollte der Himmel nicht weinen angesichts eines solch tragischen Verlustes?
Der alte Friedhof war von einem verwitterten Holzzaun umgeben.
An einigen Stellen wackelte schon die ein oder andere dünne Holzlatte oder sie fehlten ganz. Man hatte ihr ein Grab in der hintersten Ecke ausgehoben, dort wo die Tannen Schatten spendeten und eine kleine, mit grünem Moos überzogene, Bank stand. Der Pfarrer sprach wohl tröstliche Worte, die aber bei mir ungehört verhallten. Die engsten Nachbarn standen neben mir und Martha hielt meine Hand… aber ich war die letzte Blutsverwandte hier… es gab ja nur noch uns beide… naja, ab da gab es nur noch mich.
Da stand ich also an ihrem Grab. Alleine gelassen! Zornig!
Kann man als 15-jährige überhaupt begreifen das auf der ganzen Welt niemand mehr da ist, der sich um einen kümmert? Der einen liebt? Dass es keinen Ort auf der Welt gibt, wohin man flüchten konnte? Dass es keinen Ort mehr gibt, der sich wie Daheim anfühlt?
Als der Pfarrer fertig war, gingen die Nachbarn und auch Martha ließ meine Hand los. Sie drehte sich noch kurz zu mir um, als wollte sie etwas sagen. Tat es dann aber doch nicht.
Meine Augen waren staubtrocken, genau wie meine Kehle. Ich blickte nach oben. Ungeweinte Tränen brannten hinter meinen Augen…oder waren es die hellen Sonnenstrahlen, die mich blendeten?
Heiß, schien die Sonne erbarmungslos auf meinen Kopf… auf den kleinen Veilchenstrauß, den ich verzweifelt in meiner Faust knetete. Schuldbewusst schaute ich hinunter, eine Haarsträhne hatte sich aus meinem Zopf gelöst und fiel mir dabei ins Gesicht… na wenigstens haben die kleinen Blüten den Anstand, traurig ihre Köpfe hängen zu lassen.
Ich warf die Blumen ins Grab. Ein paar Blütenblätter klebten noch in meiner verschwitzen Hand.
Ich rieb sie an meinem Rock ab und biss die Zähne fest zusammen.
Ich war so wütend! So furchtbar wütend!
Es müsste blitzen, donnern, wie aus Eimern schütten… es müssten hunderte Menschen gramgebeugt unter ihren schwarzen Schirmen und Mänteln mit ihrem Schmerz ringen, um dieser einzigartigen Frau die Ehre zu erweisen.
Aber ich bin allein …und ich weine nicht.
Natürlich konnte ich nicht alleine in Großmutters Haus leben.
Und die Nachbarn hatten alle genug Mäuler zu stopfen. Der Pfarrer nahm mich später mit ins Pfarrhaus und stellte mich einem Herrn Braun vor, „Das ist Herr Braun, er leitet ein Mädchenheim in Bremen.“ Herr Braun war groß, trug einen braunen Anzug (ha, wie passend!) und hatte eine stinkende Pfeife im Mundwinkel an der er umständlich nuckelte, „Ist sie das?“
Er stand auf und ging um mich herum. Begutachtete mich, wie ein Stück Vieh. Der Pfarrer setzte sich hinter seinen abgewetzten Schreibtisch, faltete die Hände vor seinem leicht vorgewölbten Bauch und nickte, „Ja, das ist unsere kleine Anabelle und laut dem Kirchenregister hat sie keine Anverwandten mehr.“
Herr Braun blieb vor mir stehen, zog an seiner Pfeife und paffte mir unhöflich den Qualm ins Gesicht. Ich kniff die Augen zusammen und musste ein Husten unterdrücken.
„Wo sind deine Sachen?“
Ich blickte ihm verwirrt ins Gesicht, „Meine Sachen…?
„Oh, Moment…“, der Pfarrer ging nach nebenan ins Esszimmer und kam mit einem kleinen Köfferchen zurück. „Maria, die Nachbarin, war so lieb und hat ein paar Sachen von Anabelle eingepackt.“ Ich starrte den Koffer an.
Es war Großmutters Koffer. „Dann komm, ich will noch vor der Dunkelheit ankommen.“ Ankommen? Aber wo denn?
Herr Braun nahm meinen Koffer und schob mich, wie ein unhandliches Möbelstück, vor sich her, aus dem Pfarrhaus raus.
Draußen stand ein grauer Wagen, der mir vorher gar nicht aufgefallen war. Er wies mich an, auf dem Beifahrersitz Platz zu nehmen, stellte mir den Koffer auf den Schoß und schloss die Tür.
Der Pfarrer lächelte aufmunternd, „Viel Glück Anabelle.“
Herr Braun startete den Wagen und wir fuhren los. Raus aus dem Dorf, wo ich aufgewachsen war, vorbei an der großen Trauerweide in der Dorfmitte… Martha saß darunter, angelehnt an den knorrigen Stamm. Als sie den Wagen kommen sah stand sie jedoch auf. Unsere Blicke trafen sich. Wir fuhren langsam an ihr vorbei und ich drehte den Kopf. Eine Brise bauschte leicht die hängenden Äste…! Sie hob die Hand und winkte zaghaft… der Wind zerzauste ihr kurzes Haar…ich blickte lange zurück. Ich sah Martha und das Dorf nie wieder.
„Kleine, ich weiß das ist jetzt eine schwierige Zeit für dich, aber du begreifst ja wohl das du noch nicht alleine leben kannst… tzzz, von was auch. Du wirst die nächsten zwei, drei Jahre bei mir im Kinderheim verbringen. In deinem Alter kannst du dich da schon nützlich machen.“ Er schaute auf seine Uhr.
„Gott, schon so spät, ich wollte eigentlich schon längst zurück sein…wir kommen zu spät zu Abendessen.“ Essen war so ziemlich das letzte an was ich in diesem Moment dachte, „Ich habe keinen Hunger.“
Er sah mich mitfühlend von der Seite an. Ich schaute ihm kurz in die Augen, senkte den Blick und betrachtete meine Hände, die gefaltet auf Großmutters Koffer lagen. Ich versuchte durch den Deckel ins Innere zu blicken. Was hat Maria wohl eingepackt?
Hatte sie an Omas Decke gedacht, die immer in der Stube lag?
Die, mit der hübschen Stickerei?
Nach einer kleinen Ewigkeit, so schien es mir, hielt der Wagen plötzlich. Herr Braun stieg aus und öffnete meine Tür, „So, wir sind da!“ Seine Hand wies auf ein großes, unscheinbares, graues Gebäude, deren unterste Fensterreihe hell erleuchtet war. Ich nahm meinen Koffer, der sich bleischwer anfühlte und folgte ihm.
Er schloss die Tür auf, „Willst du wirklich nichts mehr essen?“ Ich schüttelte stumm den Kopf. „Na gut, dann bring ich dich nach oben in dein Zimmer.“
Eine steile Treppe führte hinauf in den zweiten Stock. Es roch leicht moderig und an einigen Stellen löste sich die Tapete von der Wand und offenbarte alten bröckeligen Putz. Im Zimmer standen sechs Betten. Das hinterste, unterm Fenster sollte meines werden.
Herr Braun drehte sich um, „Gute Nacht, Mädchen und … nimm es nicht so schwer.“ Er klopfte mir väterlich auf die Schulter, schnaufte kurz, drehte sich um und ließ mich allein.
Mein Blick wanderte im Zimmer herum. Kahl. Unpersönlich. Aber sauber. Mein Koffer! Ich kniete mich auf den Boden und öffnete ihn schnell. Oh, bitte lieber Gott, lass Großmutters Lieblingsdecke darin sein. Ich wühlte und wühlte, kippte verzweifelt den Inhalt des Koffers auf den Boden.
Nichts! Sie war nicht da!
Mühsam stemmte ich mich hoch und ließ mich auf das Bett sinken…meine Arme und Beine schmerzten und ich war müde, sooo müde. Ich wollte nur noch schlafen…ganz lange…am besten für immer.
Mein Kopf sank auf das Kissen. Ich schob mir die Schuhe von den Füssen und legte mich hin. Kraftlos versuchte ich die Decke unter mir hervor zu zerren, was mir nur zum Teil gelang. Egal, sie war eh kratzig und roch auch nicht nach Veilchen.
Fremde Menschen. Fremde Geräusche. Fremdes Bett. Fremde Düfte.
Gott, ich fühlte mich so einsam, damals… meine Augen brannten.
Irgendwann muss dann ich doch wohl völlig erschöpft eingeschlafen sein.
Später in der Nacht wurde ich wach. Orientierungslos schaute ich mich um. Wo bin ich? Ach ja. Das Kinderheim! Das Zimmer war dunkel, aber ich hörte leises rascheln und atmen. Die anderen Mädchen mussten wohl gekommen sein als ich schlief.
Ich drehte mich auf den Rücken und starrte an die Decke. Mein Atem ging schwer. Der Wind pfiff draußen um die Häuserecken.
Voller Sehnsucht dachte ich an Großmutters Decke, die wohl noch immer an dem alten Schaukelstuhl hing. Cremefarben war sie, mit grünen Ranken und Veilchen am Rand. In die Mitte hatte Großmutter unsere Namen gestickt: Anabelle & Johanna.
Ich saß damals, ich mochte drei oder vier Jahre alt gewesen sein, jeden Abend zu ihren Füßen vor dem Schaukelstuhl und sah ihr zu, wie sie diese Decke nähte. Für ein kleines Mädchen wie mich, war es unbegreiflich, wie jemand mit Nadel und Faden solch zarte Gebilde erschuf.
Vor meinen Augen ließ sie eine wundervolle Welt aus Blätterranken und Blüten (natürlich Veilchen) entstehen.
Später, als die Decke fertig war, lag sie immer auf dem alten Schaukelstuhl in der Stube, wo die Veilchen auf dem Tisch standen. Wann immer meine Großmutter nun in ihrem Schaukelstuhl saß, strickte, mir Geschichten erzählte oder vorlas, lag diese Decke entweder auf ihren Knien oder sie wickelte mich darin ein. Irgendwann duftete diese Decke nach Veilchen…wie die Stube in Großmutters Haus…wie Oma selbst.
Die Erinnerung tat weh.
Ich drehte mich zur Wand und rollte mich wie eine Schnecke zusammen.
Jetzt ist die Decke verloren für mich…einfach weg…so wie meine Oma. Ich glaube in diesem Moment begriff ich, das ich auf der ganzen Welt niemanden mehr hatte.
Ein tiefes Schluchzen drückte sich nach oben in meine zugeschnürte Kehle und raubte mir die Luft… Tränen bahnten sich ihren Weg nach draußen…endlich weinte ich.
Irgendwann später, waren Minuten vergangen oder Stunden, ich wusste es nicht, legte sich eine Hand von hinten auf meine Schulter und ein kleiner, schmaler Körper schob sich dicht an mich ran. Magere Arme legten sich, wie ein feiner Schutzring, um mich und ich roch eindeutig Pfefferminz.
Unendlich langsam wurde mein Körper herumgedreht, mein Kopf an eine zierliche, knochige Schulter gelehnt und fremde Hände strichen mir sachte durch das Haar, “Schschscht!“
Unaufhörlich wurde ich immer wieder von Weinkrämpfen geschüttelt…die ganze Nacht hindurch…während SIE mir den Rücken und den Kopf sanft streichelte und leise und beruhigend summte. Meine Tränen durchweichten nicht nur das Kopfkissen, sondern auch ihr Nachthemd. Dennoch blieb sie bei mir.
Am nächsten Morgen konnte ich wegen dieser ganzen Heulerei kaum die Augen öffnen. Ganz verquollen und rot hoben sie sich von meinem blassen, fleckigen Gesicht ab.
Die Augenlider wund vom vielen reiben…! Etwas verlegen suchte ich nach Worten und auch nach dem Gesicht der Person, die mir in meiner schwersten Nacht, so liebevoll beigestanden hatte.
Ich blickte in zwei klare, blaue Augen, die mich unter einer fuchsroten unglaublich voluminösen Mähne ansahen. Der Mund mit den kirschroten Lippen, öffnete sich zu einem schiefen Lächeln und ich sah, dass ihr linker Schneidezahn etwas schief saß.
Die schmale Hand, die mich die ganze Nacht getröstet hatte, streckte sich mir nun entgegen, „Hallo, ich bin Betty…“, und so begann unsere wundervolle Freundschaft.
Betty hieß eigentlich Bettina. Aber immer, wenn sie vor dem Spiegel stand, ihre wilde, dunkelfuchsfarbene Afromähne schüttelte, die Hände in die knochigen Hüften stemmte, säuselte sie affig, „Schau dir das doch mal an. Das sieht doch wirklich nicht aus wie eine Bettina…“, sie drehte sich einmal, zweimal um ihre eigene Achse, das Haar flog, „Das ist eindeutig eine Betty. Findest du nicht auch?“
Ich nickte amüsiert. Was für ein verrücktes Huhn! Ja, nur eine Betty konnte so sein wie sie…also blieb sie es dann auch, für den Rest ihres Lebens.
Betty war fast drei Jahre älter als ich und nach knapp einem halben Jahr fand sie Arbeit in der Personalabteilung einer kleinen Baufirma in Bremen. Sie verließ das Kinderheim.
Es war mir schleierhaft, wie sie am Tage ihres Vorstellungsgespräches, ihre unglaubliche Mähne bändigte, aber als sie aus dem Badezimmer kam (nach gefühlten zwei Stunden), ringelten sich kleine, zierliche, dunkelrot, seidig glänzende Löckchen bis zu ihren Schultern hinab. Wow. Der Hammer. Und natürlich bekam sie die Stelle. Der Tag des Abschiedes kam und meine Laune dümpelte bereits im Keller. Doch ich wollte meiner Freundin den Abschied nicht zu schwer machen, „Ich wünsch dir alles Gute, Betty.“ Meine Stimme klang allerdings nach genau dem Gegenteil. Betty war zu meiner Familie geworden. Fast schon eine Ersatzmutter. Ich liebte sie. Und nun ließ sie mich auch alleine. Da ich erfahrungsgemäß ziemlich nah am Wasser gebaut hatte, kullerten mir natürlich dicke Krokodilstränen die Wangen herunter, „Ach, Betty, ich werde dich furchtbar vermissen. Mit wem soll ich denn jetzt die Nächte durchquatschen oder Kuchen aus der Küche stibitzen?“
„Du kannst mich doch immer besuchen. Mit dem Zug ist es nur eine halbe Stunde und am Wochenende habe ich doch immer frei.
Ich besorg uns auch Kuchen für unseren Mitternachtsimbiss…obwohl…“, sie schielte auf meine Hüften, „…du das ein oder andere Stück mal weglassen könntest, du kleiner, strammer Mops!“ Sie zwickte mich liebevoll in mein kleines Hüftröllchen. Wir grinsten uns breit an.
„Rippengestell!“
„Bockwurst!“
„Bohnenstange!“
„Pummelchen!“
„Hungerhacken!“
„Eine kleine Dickmadam, fuhr mal mit der Eisenbahn. Eisenbahn die krachte, Dickmadam die lachte!“ Wir kicherten nervös.
Rangen erst nach Worte und dann nach unserer Fassung.
„Ich habe dich lieb, Anabelle!“ Eine feste, kurze Umarmung, „Ich dich auch…und nun mach das du wegkommst.“ Mit einer Hand scheuchte ich sie übertrieben umständlich aus dem Zimmer. Ich wollte nicht, dass sie sah, wie sehr ich litt.
Betty hatte eine kleine Mansardenwohnung in der Nähe ihrer Arbeit gefunden und tatsächlich durfte ich sie am Wochenende immer besuchen. Herr Braun, der Heimleiter hatte nichts dagegen, solange ich meine Aufgaben unter der Woche im Heim pflichtbewusst erfüllte. Ihre Vermieterin, Frau Bongart, war eine nette alte Dame mit einem graumelierten Dutt auf ihrem Kopf.
Sie war Witwe, wie so viele Frauen in dieser Zeit. Ihre beiden Töchter wohnten in Bayern und kamen nur sehr selten zu Besuch.
Eigentlich fast gar nicht. Vielleicht schloss sie Betty und mich deshalb gleich in ihr Herz. Wenn ich am Freitagabend bei Betty ankam, mussten wir immer mit ihr zu Abend essen, was uns nicht wirklich schwer fiel…denn Frau Bongart kochte ausgezeichnet. In ihrer kleinen Küche zauberte sie wahrhaft fürstliche Gerichte. Nur ihre Knödel ließen zu wünschen übrig. Die sollte sie besser von ihrem Speiseplan streichen.
Nach knapp 2 ½ Jahren hatte Betty es geschafft, mir eine kleine Stelle in der Versandabteilung ihrer Firma zu besorgen.
Mittlerweile hatte ich das 18. Lebensjahr erreicht und wurde vom Heimleiter, aufgrund der äußerst positiven Arbeitsaussicht, höchstpersönlich in die Freiheit geschubst. Naja, Betty, die ja in der Personalabteilung arbeitete, erfuhr natürlich als erste, wann eine Stelle frei wurde. Und so wie sie mich in den höchsten Tönen anpries und lobte, war es kein Wunder das ihr Chef mich einstellte. Es verstand sich natürlich von selbst, dass ich bei Betty einzog. Frau Bongart war mehr als begeistert. Jetzt hatte sie wieder zwei Mädels die sie bemuttern und betüdeln durfte.
Als wir ein paar Monate zusammengewohnt hatten, wir mampften gerade unseren Mitternachtsimbiss, Bienenstich, den Frau Bongart uns netterweise vor die Tür gestellt hatte, druckste sie rum, „Du Ana…ich habe da jemanden kennengelernt…!“
„Scho? Wem bem?“, brachte ich mümmelnd mit übervollem Mund hervor. Gott, war der Kuchen gut!
Betty blickte verträumt auf ihre Kuchengabel, „Er heißt Julius. Hat wundervolles weiches blondes Haar und es duftet nach Apfel. Wir haben uns in der Mittagspause getroffen. Er arbeitet in Bremen und ist hier zu Besuch bei seinen Eltern. Er hat mich…uns…am Samstag eingeladen zum Hochzeitstag seiner Eltern…ich weiß nicht mehr den wievielten“, sie zuckte mit den Schultern, „…aber die ganze Familie ist da. Ist das nicht toll?“
Ihr Enthusiasmus übertrug sich leider nicht auf mich, „Julius? Er heißt Julius? Wer nennt sein Kind den freiwillig Julius?“ Ein weiteres großes Stück Bienenstich wanderte in meinen Mund.
Himmel, der Kuchen war aber auch so was von lecker!
Betty kicherte, offensichtlich hatte sie mein Desinteresse nicht bemerkt und leckte an dem Stück Bienenstich auf ihrer Gabel, „Hast du mir überhaupt zugehört? Wir sind am Samstag auf einer…auf seiner Familienfeier eingeladen. Und nur damit du’s weißt, ich nenn’ ihn Jules…!“ Ich glotze Betty ziemlich dümmlich an. Dann brachen wir in Gelächter aus.
Julius war 10 Jahre älter als Betty (und genauso dürr). Aber die beiden hatten sich gesucht und gefunden. Vom ersten Moment an konnte man die tiefe Liebe zwischen den beiden fühlen. Für Jules war ich von Anfang an Bettys kleine Schwester und nie schloss er mich aus.
Dann kam der besagte Samstagabend. Ganz hibbelig wurde jedes einzelne Kleidungsstück begutachtet und anprobiert. Aufgeregt schnatterten wir durcheinander, bis wir uns endlich, am späten Nachmittag einig waren, wer was anzieht. Wir hatten bereits vormittags um zehn Uhr angefangen, den Kleiderschrank zu plündern! Und nun war es 18 Uhr.
Betty trug letztendlich ein smaragdgrünes Kleid, das ihre roten Haare wundervoll zu Geltung brachte. Ihre Mähne bändigte sie mit einem zarten grünweiß gepunkteten Schal. Ich entschied mich für einen himmelblauen, wadenlangen Rock, der meine Kuchenhüfte kaschierte und eine weiße Bluse mit eleganter Spitzenbordüre, die ich mit einem, zum Rock passenden Schälchen aufpeppte. Frau Bongart klatschte begeistert in die Hände, als wir endlich die Treppe nach unten kamen oder besser, königlich schritten.
Julius stammte aus einer großen Familie…offensichtlich sehr fruchtbare Menschen.
Seine Eltern, Sarah und Ronald, nahmen uns herzlich in die Arme (wir durften sie gleich duzen) und stellten uns alle vor… …aber erst nachdem wir mit Saft und Wurstschnittchen versorgt waren. Unglaublich viele Menschen und die sollen ALLE zur Familie gehören?
Für Betty und mich unfassbar, da wir beide Einzelkinder und Waisen waren.
So etwas kannten wir gar nicht.
Sarah und Ronald hatten insgesamt sechs Kinder. Julius war der jüngste und der letzte Unverheiratete. Alle seine fünf Geschwister, ich glaube Peter, Uta, Ralf, Barbara und Jeremias, hatten jeweils zwischen drei und fünf Kinder… Herold, Richard, Julia, und, und, und…unmöglich sich an diesem Abend alle Namen zu merken. Es waren auf jeden Fall seeehr viele Menschen anwesend.
Am späten Abend, Jules brachte uns mit seinem Auto heim, lagen Betty und ich völlig geplättet auf unseren Betten. Fassungslos schüttelten wir unsere Köpfe. Für Menschen wie uns, die mehr oder weniger alleine durchs Leben krebsten, war diese Familie so…voluminös…so riesig…so… unglaublich viel…aber auch wahnsinnig nett und liebevoll. Wir mochten einfach alle. Und sie mochten uns ebenfalls.
„Du Betty?“ „Ja, Ana…?“ „Ich glaube, ich weiß jetzt warum Sarah und Ronald ihren letzten Sohn Julius genannt haben…!“ Ich sah sie verschmitzt an.
Betty stemmte sich etwas hoch und sah leicht skeptisch/interessiert zu mir rüber: „Oje, was hat denn dein hübsches Köpfchen da für eine These aufgestellt?“ Sie nahm einen Schluck Cola und gurgelte leicht. Ein kleiner Kuchenkrümel (unser Mitternachtsimbiss!) hing in ihrem Mundwinkel.
Ich zuckte betont gelangweilt mit der Schulter, drehte mein eigenes Glas in der Hand: „Das liegt doch auf der Hand! Sooo eine große Familie…sooo viele Kinder… ich glaube einfach das… das alle anderen…normalen… Namen schon vergeben waren…es war für Julius einfach nichts anderes mehr übrig, als...naja…Julius!“
Betty glotze mich an, fing plötzlich an mit den Armen zu rudern, prustete und gluckste, bis ihr die Cola aus der Nase schoss. „Du blöde Gans…“, lachte Betty, rieb sich über den Mund, griff sich ihr Kissen und kam unter lautem Gelächter auf mich zu. Ich liebte die Kissenschlachten mit Betty. Doch auch die würden bald vorbei sein.
Betty und Jules heirateten ziemlich bald. Solch schnelle Entschlüsse waren eher ungewöhnlich für Betty, die sich normalerweise mit jeder Entscheidung massig Zeit ließ. Oft Tage, Wochen oder sogar Monate. Bei Julius musste sie wohl von Anfang an ein sehr gutes Gefühl gehabt haben.
Im Nachhinein war ich mir ziemlich sicher, dass beide schon wussten, dass ihre Liebe bald von etwas ‚Kleinem’ gekrönt werden wurde. Betty war schwanger.
Ihre ausgesprochen romantische Hochzeit, in einer kleinen, malerischen Kapelle auf dem Land, wurde nur im kleinen Kreis der Familie gefeiert…naja…klein ist bei dieser Familie wohl der falsche Ausdruck.
Sie zogen in ein schmuckes Häuschen ganz in der Nähe unserer kleinen Mansardenwohnung, die ich nun alleine behausen musste. Frau Bongart war untröstlich und verlegte ihre überschüssige Mutterliebe nun ganz auf mich (und meine Hüften).
Ein paar Monate darauf wurde Betty Mutter. Ein kleiner rothaariger Junge namens Gabriel quäkte von nun an in ihrem Leben. Ich vergötterte den Kleinen. Aber trotz unseres engen Kontaktes und Frau Bongarts Zuwendung, verbrachte ich dennoch viele Abende alleine …! Natürlich hatte ich auch Verabredungen, immerhin war ich eine junge, gesunde Frau…aber nie war etwas Ernstes darunter.
Noch nicht ganz ein Jahr später wurde Betty noch mal Mama (ich sagte doch, dass Julius aus einer sehr fruchtbaren Familie stammte). Diesmal den kleinen Frederick… sooo zuckersüß und ebenfalls rothaarig! Ich sah wie Betty aufblühte, wie Jules sie verwöhnte und wie sehr er sie und die Kinder liebte…und ich gönnte den beiden das Glück von Herzen. Als kleine Schwester und Tante Ana, gehörte ich ja dazu. Außerdem war ich ein hervorragender Babysitter, auch wenn es zuweilen Kuchen zum Abendessen gab. Und doch fehlte in meinem Leben etwas. An manchen Abenden, wenn ich von der Arbeit nach Hause fuhr, mal nicht bei Frau Bongarts aß und nicht babysittete, fühlte ich mich doch sehr einsam. In solchen Nächten vermisste ich meine Großmutter Johanna besonders, ihre Stimme, ihren Duft und ihre Blätterrankendecke. Dann hüllte ich mich in meinen Veilchenduftkokon (Mille Fleur!) und schlief wehmütig ein.
Als ich nicht ganz 20 war, lernte ich Eddy kennen, einen total verkorksten Musiker. Es war zwar nicht die große Liebe, aber er versüßte mir einige einsame Nächte. Frau Bongart konnte ihn gar nicht leiden und war immer etwas verstimmt, wenn er bei mir auftauchte. „Kind, der is nix für dich…so’n Taugenichts bringt dich nur in Schwierigkeiten!“
Frau Bongarts sollte Recht behalten.
Wie alt Eddy war oder von wo er kam, weiß ich schon gar nicht mehr. Allerdings reichte die Zeit, die ich mit ihm verbrachte aus, um schwanger zu werden. Als ich Eddy dann von der Schwangerschaft erzählte, machte es *Puff* und weg war er.
Wohin? Keine Ahnung.
Nach ein paar Monaten brachte ich dann meine kleine Tochter zur Welt. Betty (zu dem Zeitpunkt wieder schwanger!) war bei ihrer Geburt dabei und hielt meine Hand. Sie hatte meine Kleine auch als erstes auf dem Arm und legte sie mir sanft auf die Brust.
„Sie ist wunderschön, Anabelle…wirklich wunderschön!!“ Stolz und ehrfürchtig betrachtete ich meinen kleinen Engel, der gerade vom Himmel gefallen war, „Ja, das ist sie.“
Ich nannte den kleinen Zwerg Johanna…nach meiner geliebten und schmerzlich vermissten Großmutter. Endlich war da jemand, der nur mir alleine gehörte…mir ganz alleine. Ich war glücklich!
Johanna war ein süßes, pflegeleichtes, drolliges Ding, das sogar Frau Bongarts Herz im Sturm eroberte, obwohl sie mir die Eddy-Geschichte noch immer nachtrug. Ihr hellblondes Haar wellte sich dicht an ihrem Kopf bis hinab zum Nacken und sie duftete so gut nach…Baby… Wenn sie lachte hatte sie niedliche Grübchen auf der Wange und wenn sie wütend oder traurig war wurden ihre sanften braunen Rehaugen, schwarz wie Kohle. Und kacken konnte sie, wie ein Weltmeister!
Nach einem halben Jahr bekam Betty ihr drittes Kind (wie gesagt, sehr fruchtbar!). Emilie. Emilie war nicht rothaarig. Sie hatte das blonde Haar ihres Vaters.
Emilie und Jo, ich kürzte Johannas Namen aus Bequemlichkeit einfach ab, wuchsen zusammen auf…wie Schwestern. Betty liebte Jo wie ihre eigenen Kinder und es war für sie selbstverständlich, dass sie Jo zu sich nahm, wenn ich arbeiten musste. Wenn ich damals schon gewusst hätte…(Seufz) Wie dem auch sei. Betty, ihre drei Kinder, Gabriel, Frederick und Emilie, ihr Mann Jules, so wie Jo und ich, verbrachten sehr viel Zeit miteinander. Eine große, glückliche Familie.
Alles schien perfekt. Ich hatte endlich, nach so langer Zeit, das Gefühl angekommen zu sein.
Wenn ich geahnt hätte was auf uns zukommt… nun, ich hätte es trotzdem nicht verhindern können.
Ich fing wie jeden Morgen um sieben an zu arbeiten, also musste ich Jo spätestens um halb sieben zu Betty bringen. Mit dem Fahrrad brauchte ich ungefähr zehn Minuten bis zur Arbeit.
Normalerweise machte ich Jo um zehn nach sechs wach, „Aufwachen, mein Engel…“, wickelte sie in ihre Lieblingsdecke, packte sie in meinen kleinen Bollerwagen, der hinten am Fahrrad hing und brachte sie rüber…zwei Straßen weiter. Dort konnte Jo in Emilie’s Zimmer (Jo hatte dort ein eigenes Bett) noch ein bisschen weiterschlafen (was sie dann auch immer tat).
Meist trank ich dann mit Betty und Julius in der Küche noch schnell einen Schluck Kaffee, bis Betty uns, Jules und mich, lachend aus dem Haus scheuchte und uns zur Arbeit schickte.
Mittags um halb vier kam ich dann meinen kleinen Sonnenschein abholen. Meist musste ich sie hinterm Haus von der Schaukel pflücken…sie liebte das schaukeln. Betty hatte bereits gekocht und wir aßen alle zusammen an ihrem großen runden Esstisch in der Küche. Vom Küchenfenster aus konnte man über Bettys Rosenbüsche, die ihr ganzer Stolz waren, in den Vorgarten blicken. Jules kam meistens erst so gegen sechs nach Hause.
Manchmal sogar noch später. Als Mitinhaber einer Rechtsanwaltskanzlei musste er oft Überstunden machen.
Bevor ich mit Jo dann nach Hause fuhr, musste ich zuerst Jo und Emilie mit ernster Miene lauschen wie sie sich lautstark über die blöden Jungs in der Nachbarschaft beschwerten, „…der Thomi ist ja so gemein…der hat Emilie ein Bein gestellt und sie hat sich das ganze Knie weh gemacht!“ Oder alternativ, „… der Karl, mit dem spiel ich nie mehr, immer macht er meine Sandkuchen kaputt…der ist richtig doof!“
Oder ich musste diverse Tiere (Elefanten? Hunde? Igel?) aus Papier, Kastanien oder Pfeifenreiniger bewundern oder ich musste ihre selbstgemalten, kunterbunten Kunstwerke würdevoll bestaunen, von denen niemand sagen konnte, war es nun ein Hund mit sieben Beinen, dem eine Eistüte aus der Stirn wuchs oder ein Haus ohne Dach, aber dafür mit Hasenohren, dessen Bewohner große Ähnlichkeiten mit kleinen Ferkeln aufwiesen.
Meine ganze Küche hing schon voll kleiner Picassobilder, alle von Jo.
Betty und ich lachten jedes Mal, wenn schon wieder ein ‚Das-hab-ich-nur-für-dich-gemalt’ Bild an die Wand gehängt werden musste. Ihre Küche sah genauso zugepflastert aus wie meine.
Alles schien so perfekt… bis zu jenem Tag… der 15. März…
Jo hatte einen Tag vorher gerade den 4. Geburtstag gefeiert… ihre Kinderparty war ein Knaller. Wir hatten noch richtig Glück mit dem Wetter. Es hätte noch viel schlimmer in der Wohnung aussehen können. Erst am späten Nachmittag zog sich der Himmel zu und die übermütigen Spiele wurden daraufhin zwangsläufig nach drinnen verlegt. Am frühen Abend, es fing gerade an zu regen und stürmischer Wind zog auf, wurden schließlich alle Kinder abgeholt. Sobald das letzte fidele Kind weg war, plumpste ich wie ein Sack Mehl auf den Küchenstuhl.
Den Kopf in die Hände gestützt, konnte ich nur noch leise stöhnen und wimmern. Oh Gott, mein Rücken…unglaublich was solch kleine Erdenbewohner für eine Energie aufbringen konnten und was diese kleinen Stimmbänder zustande brachten! Meine Ohren hatten fast geblutet. Aber…Jo hatte ihren Spaß. Sie kam strahlend in die Küche gehüpft, in der ich meine imaginären Wunden gerade leckte, „Danke Mami, das war die tollste Feier die ich je hatte!“ Jo umarmte mich stürmisch, düste ins Badezimmer und kam dann nach ein paar Minuten doch sichtlich erschöpft, mit kleinen Äuglein wieder heraus. Den Schlafanzug an, die Zähne geputzt und ihre neue Puppe auf dem Arm.
Meine Kleine! Nein…meine Große! Ich platzte fast vor Stolz.
„Und dein Geschenk find ich am schönsten. So eine schöne Puppe hat keiner von meinen Freunden. Sieh mal, sie kann die Augen auf und zu machen.“ Immer wieder ließ sie die künstlichen Puppenaugen klackern, so faszinierend fand sie dies. Meinen protestierenden Rücken ignorierend, nahm ich Jo (und ihre Puppe) auf den Schoß und knuddelte sie einmal kräftig, „Habe ich doch gern gemacht, mein Engel…du weißt doch, für dich tu ich alles.“
Ich stand mit Jo auf dem Arm auf. Meine Knie knackten protestierend. Langsam schlurfend brachte ich Jo in ihr Zimmer und legte sie ins Bett.
„Ich hab dich lieb, Mami…“, seufzte sie leise und schlief sofort ein. Ich zog ihr die Decke hoch, strich ihr sanft übers Haar und küsste sie auf die Stirn, „Alles Gute zum Geburtstag, mein Engel.“
Beim Hinausgehen löschte ich das Licht. Betty und Jules (er hatte sich extra für diesen Tag freigenommen) hatten zwar angeboten mir beim Aufräumen zu helfen, aber ich hatte sie nach Hause geschickt. Ihre drei Schlingel mussten ja auch ins Bett gebracht werden. Gott sei Dank hörte Frau Bongart schlecht, sonst wäre diese Feier bestimmt nicht so ausgelassen und laut geworden.
Ich grinste in mich hinein. Also gut. Auf in den Kampf.
Nach drei Stunden, vier vollen Mülltüten, den Kühlschrank voller nicht verzehrter Reste, weigerten sich meine Füße auch nur noch einen Schritt zu machen. Meine zitternden Hände und mein verkrampfter Rücken schlossen sich ihnen an. Mein Schädel hämmerte: Genug. Genug. Genug.
Unglaublich, was eine Horde kleiner unschuldiger Kinder einer winzigen wehrlosen Wohnung antun konnten. Selbst der Herd starrte mich vorwurfsvoll an. Ausgepowert fiel ich in mein Laken und ich glaube nicht das ich schlief…ich denke ich fiel vor lauter Erschöpfung einfach in Ohnmacht. Diese Nacht war kurz. Der Wind rüttelte an den Fensterläden. Ein unruhiger Schlaf.
Ich war an diesem Morgen ein paar Minuten später dran als sonst, was nach einem solchem Geburtstags-Kraftakt nicht wunderlich war. Ich packte Jo, wie immer in ihre Decke, legte sie in meinen Bollerwagen (Gott sei Dank regnete es nicht mehr) und stieg aufs Rad. Jo blinzelte mich unter ihrem Deckenzipfel an.
„Schlaf weiter, Schatz, wir sind gleich bei Tante Betty.“
Sie kuschelte sich tiefer in ihre Decke und schloss die Augen.
Ihren kleinen neuen Katzenrucksack hielt sie fest umklammert.
Ich stutzte kurz.
Wieso hatte sie den Rucksack dabei? Ach, egal.
Der Wind blies und wirbelte wie verrückt Blätter um meine Beine.
Ich schaute nach oben. Grauschwarze Wolkenfetzen wurden von heftigen Böen über den Himmel gezerrt.
Kommt Leute…Regen kann ich jetzt gar nicht gebrauchen.
Als ich zwei Straßen weiter um die Ecke bog, stürzte gerade Jules aus dem Haus, den Kaffeebecher noch in der Hand. Ich grinste schadenfroh. Da hat wohl noch jemand ein paar Minuten verschlafen?
Er sah mich, hob seine Hand, in der er die Aktentasche trug, und versuchte zu winken. Der Wind riss ihm augenblicklich die Worte von den Lippen. „Mo…ich…ge…Be…üss.“ Ich zuckte die Schulter, hob meine Hand und winkte einfach mal zurück.
Die Decke fest um Jo und ihren Katzenrucksack gewickelt, eilte ich über den Kiesweg zum Haus.
Sie öffnete ihre wunderschönen braunen Augen und lächelte mir verschmitzt zu. „Gleich kannst du wieder ins Bett, mein Schatz.“
Ich lächelte sie an.
Betty stand bereits im Türrahmen. Das, alte, löchrige Fliegengitter schwang hektisch hin und her und quietschte erbärmlich in den Angeln. Mit einer Hand hielt sie ihren grünen Morgenmantel am Kragen geschlossen und mit der anderen winkte sie uns zu. Ihr rotes Haar stob wild in alle Richtungen.
Sie trat zur Seite um uns Platz zu machen und atemlos stolperte ich eine Sekunde später in den hellen Hausgang, dessen rechte Seite mit unzähligen Kinderschuhen bevölkert war.
„Du bist spät dran heute Morgen, Ana. Wir hätten doch bleiben sollen, um dir beim Aufräumen zu helfen.“ Jo, noch halb dösig, streckte die Arme nach Betty aus.
„Nein, nein, war gar nicht sooo schlimm…“, wiegelte ich beruhigend ab, „…war halb so wild!“ Betty warf mir einen skeptischen Seitenblick zu, „Noch ein Schluck Kaffee?“
Bevor ich verneinen konnte griff Jo in ihren Katzenrucksack, „Mami, ich habe dir gestern ein Bild gemalt…, weil mein Fest war richtig toll und die Puppe is so schön…und weil du so lieb bist und weil du die beste Mami der Welt bist…hab ich extra für deine Arbeit gemalt.“
Wow, du liebe Güte. Gab’s heute Morgen Buchstabensuppe im Angebot? Was für eine Ansprache am frühen Morgen.
Betty lachte hell auf, „Stimmt ja, hatte ich völlig vergessen dir zu erzählen!“ Sie schaukelte leicht mit Jo auf ihrer Hüfte und sah sie an, „Als wir dich letzte Woche auf der Arbeit besucht haben, war Jo völlig erschrocken wie dein Schreibtischplatz aussieht…wie meinte sie?“ Betty versuchte Jos kindliche Stimme nachzuahmen, „… da sind ja gar keine Buntstifte und keine Bilderbücher…es ist ja alles so grau…ich mal Mami ein schönes großes buntes Bild, das kann sie hier übern Schreibtisch hängen.“ Ihre Stimme normalisierte sich wieder, „Und deswegen…“, sie wirbelte einmal mit Jo auf dem Arm herum, lachte sie strahlend an, gab ihr einen kleinen Nasenstüber, „…hat die kleine Jo ja auch zum Geburtstag viele, viele Buntstifte bekommen. Stimmt’s, du kleiner Fratz?“ Jo nickte eifrig, „Jawohl!“
Ich war gerührt. Doch ich hatte es eilig und so kroch das schlechte Gewissen aus mir heraus, „Kleine Maus, Mami nimmt das Bild morgen mit zur Arbeit…ich bin heute schon etwas spät…okay?
Morgen…versprochen!“ Ich strich ihr über die Wange. Jo’s Augen verdunkelten sich enttäuscht, „Biiitte…Mami…“, und sie hielt mir das Bild hin. Angesichts eines solch bettelnden Blickes (und dem Zeitdruck im Nacken) gab ich mich geschlagen und griff danach.
Schwups…eine plötzlich auftauchende Windböe funkte dazwischen, wirbelte mitsamt abgerissenem Laub, durch die offene Eingangstür und riss mir das Bild aus der Hand, packte es, wirbelte es flatternd hoch in die Luft und beförderte es dann wedelnd Richtung Vorgarten.
Jos Augen weiteten sich entsetzt, „Mami, Mami, das Bild…das ist doch für DICH…!“.
Ihr Blick wurde unendlich traurig und ein enttäuschter Seufzer kam über ihre Lippen, als sie den verrückten Höhenflug ihres Kunstwerkes beobachtete. Der Anblick tat mir in der Seele weh.
Scheiß auf die paar Minuten… Vom selbstgeschaffenen Druck der Stempeluhr befreit, lachte ich auf, strich über ihre rosigen Wangen und gab ihr einen dicken Schmatzer, „Du hast Recht, Mäuschen…das ist MEIN Bild, was fällt dem blöden Wind ein, mir MEIN Bild zu mopsen?“
Ich stampfte gespielt empört mit dem Fuß auf. Jo fing an, hinter vorgehaltener Hand, zu kichern. Ich drehte mich um, hechtete sportlich über Bettys Rosenbüsche, quer über dem Rasen vorm Haus…das Bild immer zappelnd über meinem Kopf…ich sprang hoch…griff danach…und fluchte leise in mich hinein. Fast hätte ich es gehabt!
Doch das Bild segelte gleich darauf knapp an meiner Hand vorbei, nur um mit einer eleganten Pirouette wieder nach oben zu flattern. Ich gab nicht auf!
Angetrieben von meinem eigenen Ehrgeiz (und dem erwartungsvollen Blick meiner Tochter) ging die Jagd nach dem bemalten Papier weiter.
Jo und Betty standen im Türrahmen und feuerten mich kräftig an, „Ja, los Mami, du schaffst es.“ „Los Ana, gib alles!“ Ihr fröhliches Gekicher wehte mir entgegen.
Lachend winkte ich ihnen zu und rief gegen den Wind: „Hab’s gleich! Warte…!“ Achtlos hüpfte ich über die niedrige Gartenmauer… zack…ein loser Stein hinter der Mauer auf dem Bürgersteig…nanu, wo kommt der denn her…Stolper. Wackel.
Ausfallschritt.
Ich wankte und ruderte mit den Armen, „Nix passiert…“. Ich lachte noch übermütig über meine eigene Tollpatschigkeit. Das Blatt kreiste über meinem Kopf…ich sprang…ach, verflixt, beinahe. Noch etwas mehr nach rechts…aber jetzt.
Mit einem Riesensprung, der alles andere als elegant war, schnellte ich nach vorne und pflückte endlich MEIN Kunstwerk aus der Luft.
„AAANAAABEEELL…“
„Was i……“
Reifenquietschen….
„MAAAAMIIIIIII…“
Jo
Ein dumpfer Schlag in meine Seite…den Boden tief unter mir….
Jo
Ein schriller Schrei in der Stille….
Jo
Dunkelheit….
Jo
Ach ja, ich habe dir noch garnicht gesagt, wie ich heiße. Mein Name ist Anabelle…Anabelle Huth… und es war der 15. März 1972, genau 6:47 Uhr als ich starb.
*
Tja, so war das! Und jetzt hast du mich gefunden…hier…wo ich selber nicht sagen kann, wo ‚Hier‘ eigentlich ist. Du vielleicht?
Auf jeden Fall bin ich froh, nicht alleine zu sein…offensichtlich im Niemandsland…
Aber ich bin so müde und ich will nach Hause…am besten ich schlafe mal ein bisschen und später…
*****
Der Himmel
Willkommen
Wo bin ich nur?
Oh mein armer Kopf.
Bin ich etwa eingeschlafen?
Tausend, abertausende Gedanken und Bilder strapazieren jede einzelne meiner Gehirnzellen, dehnen und blähen sie auf bis mir, gleich einem Urknall, Millionen Sternchen vor den Augen blitzen.
Alles Bilder und Fragmente aus meinem Leben. Was soll das?
Ich setze mich auf, greif mit einer Hand an die Stirn, streich mir kurz durchs wirre Haar und massiere meine pochende Schläfe.
Was ist passiert?
Mein Kopf dröhnt. Du meine Güte, ich fühle mich, als ob mich ein Panzer überrollt hätte. Schwankend baumelt mein Kopf zwischen meinen Knien … ein Panzer?
Ich erstarre mitten in der trägen Bewegung. Nein, kein Panzer!
Mein Kopf schnellt hoch, die Augen mitsamt meinem malträtierten und geschockten Gehirn wollen aus ihren Höhlen quellen… ein Auto…kein Panzer…es war ein Auto!
Jo! Oh mein Gott, Jo…wo ist Jo?
Nur die Ruhe! Bei Betty!
Danke, lieber Verstand!
Erleichtert sackte ich zusammen und schnaufe ich tief durch.
Okay, jetzt mal in aller Ruhe. Mein Blick wandert ziellos umher.
Streift eine Wand vor mir. Dann eine Wand hinter mir und schwarze finstere Löcher rechts und links, neben mir. Doch halt…die rechte Schwärze ist gar nicht ganz schwarz. Ganz weit, in der Ferne ist ein winziges, stecknadelgroßes, weißes Pünktchen.
Oder bilde ich mir das etwa nur ein? Mist, man kann hier kaum was erkennen, alles so diffus und schemenhaft. Mein Kopf versenkt sich wieder zwischen meinen Knien. Unruhige Gedanken schwirren wie Bienen um einen Honigtopf. Angestrengt überlege ich.
Also gut. Da waren Jo und Betty…dieses verflixte Bild…und ein Auto…
Oh mein Gott…
Aus meiner Kehle drängt sich ein tiefes Stöhnen. Mit beiden Händen umschlinge ich hilflos meinen Kopf und wanke leicht. Das darf doch nicht wahr sein…ich bin angefahren worden???
Ich bin angefahren worden!!!
Ich Esel, bin tatsächlich einfach so auf die Straße gelaufen und bin angefahren worden. Wie kann man nur so blöd sein. So unglaublich dämlich…
Wütend hämmere ich mit der Faust auf den Boden.
Die Wut brodelt langsam schleichend in mir hoch, pulsiert wie brennende Lava im Vulkan.
Jedes kleine Kind lernt, erst nach rechts und nach links zu schauen bevor es über die Straße rennt. Sogar Jo….
Mein Herz setzt aus. Eiseskälte kriecht mir furchtsam, wie kalter Glibber das Rückgrat hinauf.
Sag jetzt nicht sie musste mit ansehen wie ich überfahren worden bin. Lieber Himmel…ich muss zu ihr…ich muss zu Jo…und ihr sagen, dass es mir gut geht.
Hektisch schaue mich noch mal um. Das stecknadelgroße helle Pünktchen flackert leicht wie ein Stern am Himmel. Himmel?
Jeder Muskel in meinem Körper verliert an Festigkeit. Wie ein knochenloser Fleischklumpen sackt mein Körper zusammen.
Ich glaube, ich bin tot! Ich bin tot. Das kann doch nicht sein. Ich bin doch erst 25. Ich will nach Hause! In meine Wohnung, in mein Bett mit der geblümten Bettwäsche, die ich selbst genäht habe und gestern erst frisch aufgezogen hab! Ich will zu Jo!
Ein Schauer durchrüttelt mich…ich stemme mich kraftlos in eine halbwegs sitzende Position…zitternd reibe ich meine Waden …eine dicke stachelige Gänsehaut bedecken sie. Ich betrachte meine Beine genauer.
Scheiße…ich bin tot und hab mir noch nicht mal die Beine rasiert.
Na toll. Und wieso habe ich überhaupt nackte Beine? Hatte ich nicht Hosen an? Ich war doch auf dem Weg zur Arbeit!
Meine Hände tasten den Rest meines Körpers, gefolgt von meinen ungläubigen Augen. Nackt? ICH BIN NACKT? Leute, das kann doch nicht euer Ernst sein…ich soll nackt und mit stacheligen Boxerwaden in den Himmel?
Ich kann ein frustriertes Seufzen nicht unterdrücken.
Naja…heißt es nicht irgendwo: man geht wie man gekommen ist?
Klar, ein Baby ist ja auch nackt, wenn es zur Welt kommt…aber wenigstens hat es butterzarte Haut.
Leicht angesäuert rappele ich mich auf. „Autsch!“
Irgendetwas prallt heftig, von meinem Ellbogen traktiert, an die Wand.
Was war das?
Erschrocken strecke ich in einer Drehung meinen lahmen Arm aus, um das aufzufangen, was offensichtlich hinter mir ins Schwanken geraten ist. Ein lautes Scheppern. Die Augen weit aufgerissen, mit pfeifendem Atem, visiere ich den kaum erkennbaren Gegenstand an. Ich blinzele dümmlich… …einmal…zweimal…, „Hä?“
Ziemlich verdattert blicke ich zu Boden, „Was ist denn das? Ein Garderobenständer? Echt jetzt?“ Meinem Blick nach zu urteilen hätte es auch ein dreiköpfiges, Zigarre rauchendes Schaf sein können. Doch dann erstarre ich. Irgendjemand oder irgendwas baumelt daran. Ach du heilige Makrele! Auch das noch. Habe ich etwa jemanden verletzt?
Vorsichtig, notdürftig meine Blöße bedeckend, tastet meine Hand zaghaft in Richtung unbekanntes Wesen und greife mir den Kleidungszipfel der mir am nächsten liegt. Leichtes rütteln.
„Hallo? “ Wenn es doch nur ein Ticken heller wäre!
Ich rüttele heftiger…und plötzlich halte ich, was auch immer, in den schwitzigen kalten Händen. Verwirrt betrachte ich das herabfallende, schwere Stück Stoff. Frottee?
Meine Augen registrieren dieses Detail, aber mein Verstand hat wohl einen kurzen Aussetzer. Ein Kurzschluss in jeder einzelnen Gehirnzelle. Peng!
Das ist doch…ein Bademantel? Im Ernst? Ein Bademantel? Und noch weiß dazu…da sieht man doch jeden Fleck drauf! Herrje, als wenn ich sonst keine Probleme hätte. Aber egal. Besser wie gar nichts.
Umständlich, aber auch erleichtert schlüpfe ich hinein und knote in den langen Gürtel zu. Doppelt…und fühle mich auch gleich sicherer.
Schon viel besser. Meine Hand befingert neugierig den unbekannten Stoff. Hmm! Kuschelig. Ein kontrollierender Blick unter und um mich rum. Naja, halbwegs passabel. Zumindest soweit ich was sehen kann. Kein Pariser Modell…und eine schmale Taille macht er sicher auch nicht, aber wenigstens reicht er bis zu den Knöcheln runter und verhindert den Blick auf meine Stachelschweinbeine.
Noch immer ärgere ich mich über meine Nachlässigkeit.
Unrasierte Beine…unmöglich! Doch schnell vergesse ich meinen morgendlichen Fauxpas und schaue mich erneut um.
Man, ist das duster hier. Wie ein Pfadfinder, strecke ich meinen angelutschten Zeigefinger in die Luft und teste ob von irgendwoher ein Luftzug kommt.
Früher beim Weitspucken hatten wir das immer gemacht um zu prüfen von wo die Luft kommt. In den Gegenwind zu spucken kann ziemlich ins Auge gehen. Im wahrsten Sinne des Wortes.
Doch ich kann nicht spüren. Nicht den kleinsten Hauch!
Vorsichtig sinke ich auf die Knie. Meine Hände wandern tastend über den Boden und die gegenüberliegende Wand. Erkunden!
Ersetzten mir quasi die Augen, denn sehen kann man ja nicht viel.
Also! Wände? Glatt. Boden? Glatt. Geruch? Nichts. Staub?
Fehlanzeige. Penibel sterile Umgebung! So, so.
Mein Mund ist oft schneller als mein Verstand und so platzt es spontan aus mir raus, „DAS HAT MAN GERNE…NE PUTZFRAU BESCHÄFTIGEN, ABER KEIN GELD FÜR STROM!“
Verdammt, ich will Licht! Und ich bin ziemlich sauer! Hört man das?
Zornig ramme ich meine Hände tief in die Taschen und zerre sie erschrocken wieder heraus. Nanu? Was ist das? Vorsichtig greife ich wieder hinein und ziehe. Plop.
Leicht hysterisches Kichern windet sich kribbelnd durch meinen Hals.
„Tzzz…Schlappen?“ Unter wildem unkontrolliertem Gelächter stülpe ich mir, von einem Bein aufs andere hüpfend, die flauschigen Puschen über die nackten Füße und trabe endlich mal los. Richtung stecknadelgroßen hellen Pünktchen. Wohin auch sonst?
Ich lege ein gutes Tempo vor. Das stecknadelgroße helle Pünktchen hat mittlerweile die Größe einer Untertasse.
Man, als ob man Siebenmeilenstiefel an hätte… tschuldigung… Siebenmeilenschlappen!
Der Gedanke bringt mich doch ein bisschen zum Schmunzeln.
Nach ungefähr zwanzig oder auch vierzig (riesigen) Schritten erkenne ich langsam die Umrisse meines angestrebten Zieles und fühle so etwas wie Erleichterung.
Aha. Eine Tür! Gott sei Dank!
Weiterlaufen. Eine große Tür, wie es scheint. Noch ein paar vorsichtige Schritte mit meinen tauben Füßen in den puscheligen Schläppchen.
Nein, die Tür ist nicht groß. Sie ist Gigantisch…und weiß lackiert.
Durch das eingesetzte Milchglas scheint gleißend helles Licht.
Verunsichert betrachte ich nun die Wände und den Boden, die ich nun sehr gut sehen kann. Sollte ich mich wundern? Nein!
Klar…alles weiß…wie auch sonst.
Ich bücke mich, um alles näher in Augenschein zu nehmen.
Vielleicht finde ich ja doch noch ein Staubkorn, eine Spinnwebe oder einen fettigen Fingerabdruck am Türrahmen? Doch nichts!
Aber an der Tür fällt mir auf, dass der Griff im Vergleich zur Tür winzig klein erscheint und so garnicht passt. Ich schaue weiter!
Nanu! Keine Klingel? Kein Türklopfer? Noch nicht mal ein popeliger Briefschlitz? Was ist das denn? Wenn sie nun abgesperrt ist?
Ich schlucke betroffen!
Passiert dies mit Leuten, die nicht in den Himmel kommen? Sie stehen vor verschlossener Tür und rütteln hilflos am Türknauf?
Kein schöner Gedanke…
Aber Moment! Was ist das?
Neben dem erstaunlich zierlichen Türgriff hängt ein kleiner grüner Zettel. Mit Tesafilm befestigt! Wow! Sehr fortschrittlich.
Eingeschüchtert, aber neugierig beuge ich mich vor und lese:
BITTE DRÜCKEN
Den Kopf in den Nacken gelegt, kichere ich kurz, aber heftig.
Dann kratze ich die kümmerlichen Reste meines verbleibenden Mutes zusammen, schließe fest die Augen, nehme einmal tief Luft und trete resolut ein.
Als erstes fällt mir auf…naja…nicht viel. Enttäuscht spähe ich nach rechts und links.
Ist das alles? Wo sind die tanzenden Engel? Wo die Posaunen und Harfen? Wo ist mein Empfangskomitee? Das soll der Himmel sein?
Ich setze vorsichtig einen Fuß vor den anderen. Meine geliehenen Puschen geben bei jedem vorsichtigen Schritt ein gedämpftes >Fluff< von sich, als meine Fußsohlen die Luft aus der gepolsterten Einlage pressen. Doch ich bin mit etwas anderem beschäftigt.
Ein riesiger Raum breitet sich vor mir aus. Vielleicht zwei oder drei Fußballfelder groß. Schwer einzuschätzen, überlege ich, da alles weiß ist. Wirklich ALLES! Ein ewig langer Tisch zieht sich vor mir in einem gewaltigen Halbkreis entlang. Die hintere Wand besteht nur aus Türen…soweit ich das von hier sehen kann. Vor mir befindet sich EIN Stuhl. Weiß. Mein Blick wandert von den kahlen, nackten, weißen (!) Wänden zur Decke.
Keine Lampen.
Ahhh, wohl so eine Art indirekter Beleuchtung…wow …ultramodern.
Die komplette Decke erstrahlt in einem hellen aber warmweißen Licht. Ansonsten ist der Raum leer. Stopp, nicht ganz! Ein kleiner schwarzer Kasten, etwa die Größe einer Zigarettenschachtel liegt vor mir auf dem Tisch und scheint mich neugierig anzustarren.
Zaghaft, mit vor Aufregung feuchten Händen setze ich mich auf den einzigen Stuhl, der hier herumsteht. Die Knie fest zusammengepresst. Ist denn hier keiner? Wo sind denn alle?
Nervös knibbele ich an meiner Nagelhaut rum. Autsch, das tut weh. Blöde Angewohnheit von mir. Genauso blöd wie Nägelkauen.
Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr…. erschrocken zucke ich zusammen, mein Herz pocht wild gegen meinen Brustkorb. Ich schaue hektisch nach rechts. Nichts!
Panisch wirbelt mein Kopf herum, nach links. Ein gigantischer, (natürlich) weißer Stuhl kommt mit Karacho innen, an der Tischkante entlang, überraschend auf mich zugeschossen und bleibt abrupt vor mir stehen. Ich stiere die hohe, mir zugewandte Rückenlehne an. Ich schlucke laut und beuge mich etwas vor, „Gott?“ Unsicher warte ich.
Langsam schwingt der Stuhl herum. Ein kleiner rundlicher Mann mit roten Bäckchen, einer silbernen Brille mit runden Gläsern auf seiner Knubbelnase, dahinter braune, warme Augen, umgeben von tausend Lachfältchen, sitzt da, mit einem Minitablett in den Händen und lässt kichernd seine kurzen Beine baumeln. Sogar die Sohlen seiner weißen Lederschuhe sind klinisch weiß.
„Du bist Gott?“, frage ich sicherheitshalber noch mal.
Vielleicht hört Gott ja schlecht. Wer weiß?
Den skeptischen Klang in meiner Stimme kann ich allerdings irgendwie nicht verbergen. Nervös kratze ich an meinem Bein.
Das kratzende Geräusch ist unangenehm laut in der Stille. Heiße Schamesröte überzieht mein Gesicht, mein Körper versteift sich und ich streiche meinen Bademantel verlegen wieder glatt.
Der kleine Mann schielt nach vorne über seinen Brillenrand und wirft einen Blick auf meine Beine, „Nein, ich bin nicht Gooott!“
Warum zieht er das Wort so blöd in die Länge? Soll das etwa komisch sein?
Der kleine Mann (nicht Gott!) schielt wissend auf meine Waden, die ich tunlichst unter dem dicken Soff des Bademantels verstecke und sagt im gleichen Atemzug, „Felix, ich bin Felix und ich heiße dich hier herzlich willkommen! Und diese kleine Unannehmlichkeit…“, er deutet mit seinem Zeigefinger auf meine angerauten Beine, „…das wird in ein paar Tagen verschwunden sein…“, und schmunzelnd setzt er noch hinzu, „…ich kenn doch die kleinen Problemchen bei euch Frauen…ist doch immer dasselbe!“ Verständnisvolles Grinsen verbreitert seine Wangen.
Dann schaute er endlich auf und streckt er mir seine pummelige Hand entgegen. Automatisch, ohne Nachzudenken, greife ich nach ihr, um ihm die Hand zu schütteln.
Es gibt ja trotz allem keinen Grund unhöflich zu sein.
Er packt mich überraschend fest am Handgelenk, dreht meine Handfläche nach unten und presst sie auf das kleine weiße Tablett in seiner Hand. Blitzschnell, wie von einer Tarantel gestochen, ziehe ich meine Hand zurück, als ob der kleine Kasten kochend heiß wäre. Verunsichert und verwirrt wische ich meine Hand an meinem Bademantel ab und glotze den kleinen Mann (Felix) mit großen Augen an, „Was soll das hier?“
Zu blöd, dass ich das Zittern in meiner Stimme nicht verbergen kann.
Um von meiner Nervosität abzulenken, richte ich meinen Zeigefinger schon fast anklagend auf das ominöse Tablett, „Und was ist das hier?“
Herrje, ich schwitze wie ein Schwein. Gott, bin ich nervös. Oh verflucht…nicht Gott…der hört doch alles…oh man, nicht fluchen, sonst fliegst du raus. Ruhig bleiben. Tief durchatmen… Felix lächelt nachsichtig, rückt seine silbrige Brille auf der Nasenspitze zurecht, legt seine zusammengefalteten Hände auf den Tisch und beugt sich wieder vor. Das Deckenlicht schimmert auf seiner Kopfhaut, die durch sein dünnes Haar schimmert.
„Langsam, langsam junges Frollein. Eines nach dem andern. Erst mal schauen wir nach, wer du bist.“ Er räuspert sich umständlich, lehnt sich zurück in seinen Sessel und rutscht mit seinem Allerwertesten in eine bequeme Position. „Z?“ Natürlich kann ich meine Klappe NICHT halten, „Wer ist Zett?“ Felix hebt den Zeigefinger vor die gespitzten Lippen, „Pscht!“
Und dann… „Guten Morgen, Felix. Was kann ich für dich tun?“ Eine angenehme Frauenstimme hallt durch den Raum. Habe ich etwa jemanden übersehen? Ich versuche an Felix vorbei zu schauen.
Wo ist die Frau? Doch Felix unterbricht mein Suchen, „Ähm, scanne den Handabdruck und gib mir die Infos hier in den Empfangsraum 37.“ „Kommt sofort!“
Ein leises Surren von oben. Du lieber Himmel, ich weiß gar nicht wo ich hinblicken soll. Aus einem schmalen Schlitz an der Decke (ist mir vorhin gar nicht aufgefallen), schiebt sich so langsam, wie der Kopf einer Schildkröte, hinter Felix, ein großes Bild herab. Ein schwarzer Untergrund mit weißen Sternen. Mein aufgeregter Herzschlag beruhigt sich.
Wie originell.
„Ich bin soweit, Felix.“ Wieder diese sonore Singsangstimme. „Ich danke dir, Z.“ Und zu mir gewandt, „Nun dann schauen wir mal, mit wem wir es hier zu tun haben, nicht wahr?“ Ein belustigtes Kichern folgt dieser leicht dahingesagten Aussage, dann klappt er die schwarze Zigarettenschachtel auf, die mir vorhin schon aufgefallen war und drückt darin einen Knopf. Das Bild oben verschwimmt und es erscheint…? Ich staune…mein Leben!
Name, Geburtsdaten, Ereignisse, sogar Bilder sind zu sehen.
„Boah…ist das etwa…“, ich zeige aufgeregt, mit zittrigem Finger auf das Bild (oder besser Fernseher), „…ist das etwa…?“
Offensichtlich kann ich keinen Satz mehr vernünftig beenden.
Stattdessen schaue ich ziemlich verdatterter zur Decke, dorthin, wo mein Leben im Augenblick in Fakten, Daten und Zahlen auseinandergedröselt wird.
„Ja…“, er fischt ein Taschentuch aus seiner Jacke, poliert akribisch seine ohnehin fleckenlosen Brillengläser, setzt sie wieder auf, rückt sie zurecht und beugt sich weit vor und stiert ebenfalls auf den Fernseher, „…meine liebe Anabelle. DAS ist dein Leben. Alles direkt bereit zum Abruf!“ Mit stolzgeschwellter Brust sinkt er, offensichtlich hochzufrieden, in den Sessel zurück.
„Aber…WAS ist das alles?“ Ich zeige auf den Fernseher, die schwarze Zigarettenschachtel (die ja keine Zigarettenschachtel war) und auf das kleine weiße Tablett, das Felix beiläufig zur Seite gelegt hat.
Ich will Antworten. Und zwar sofort!
„Das ist Z!“ Ungeduldig winke ich ab. „Ja, ja, das sagtest du schon.
Aber was oder wer ist Zett?“ Leicht irritiert zuckt Felix mit den Schultern. „Das ist unser Computer.“ „Kompiuter? Hä?“
Felix dreht sich zum Monitor um und fängt an, mit zusammengezogenen Augenbrauen meine Daten in Windeseile zu überfliegen. Überraschend für mich, plötzlich hält sich vor Lachen seinen kleinen runden Bauch. „Verzeihung…!“ Tränen kullern seine Pausbäckchen herunter. „Tut mir leid…!“Schniefend greift er nach seinem Taschentuch. Nachdem er sich, noch immer kichernd, über die Augen wischte, schnäuzt er zweimal kräftig rein und steckt es wieder weg. Igitt. Hoffentlich war es nicht dasselbe Taschentuch, mit dem eben seine Brille geputzt hat. Ich schüttele mich innerlich und mein Mund verzieht sich leicht angewidert.
„Entschuldigung…du kennst ja noch keinen Computer. Du bist ja 1972 gestorben.“ Ja, eben erst, du Blödmann. Mit bösem Blick funkele ich ihn an.
Der kleine Kerl, in seinem lächerlichen weißen Anzug, lacht, wobei sein kugeliger Bauch lustig auf und ab wippt. Dann belehrt er mich, „Okay, also, vereinfacht dargestellt, ist ein Computer nichts anderes als ein großes technisches Gehirn. Und in diesem Gehirn speichern wir seit über 40 Jahren alle Daten der Neuzugänge und Abgänger ein und können jederzeit per Knopfdruck verschiedene Daten wieder abrufen.“ Er schnaubt kurz und rollte drollig seine Augen nach oben.
„Du glaubst ja gar nicht wie anstrengend das früher war.
Du meine Güte…“, er lehnt sich zurück und seufzt angestrengt, als ob ihm alleine schon der Gedanke an vergangene Zeiten den Schweiß auf die Stirn treiben würde.
„Wenn ich an all die Aktenberge von früher denke…zu viert…“, er hält, wie zum unterstreichen, vier Finger hoch, „…zu viert hatten wir es kaum gepackt, das Chaos in den Griff zu bekommen. Und nun schau dich um…!“