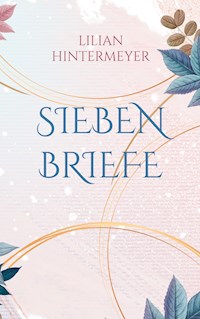Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Mensch und die Erde stehen mittlerweile am Abgrund. Mittendrin, die zurückgezogen lebende Elisabeth. Ihr bisheriges Leben endet jäh am Todestag ihrer Eltern. Auf dem Friedhof, überkommt sie eine furchtbare Vision. Ein grausamer schwarzer Engel trachtet ihr nach dem Leben. Doch war dies wirklich eine Vision? Als sie in Laufe der nächsten Tage nur knapp zwei weiteren Anschlägen entkommt, findet sie sich plötzlich in der merkwürdigen Gesellschaft dreier Wesen wieder, die behaupten Engel zu sein und die ihr den Untergang der Menschheit und des Garten Eden vorhersagen. Allerdings machen sie Elisabeth auch Hoffnung. Neben den sieben Siegel der Offenbarung, existiert noch das unbekannte achte Siegel. Hier, auf der letzten Seite, auch Emuna genannt, soll das wahrhaftige Wort des großen Schöpfers, den Erlöser der Menschen benennen. Die Person, die sich der Vernichtung der Menschheit entgegensetzt und Elisabeth soll Teil dieser Prophezeiung sein. Doch auch der gefallene Engel Lucifer weiß von der Existenz des heiligen Orakels. Seine Suche führt ihn ebenfalls zu Elisabeth. Es entbrennt ein Wettlauf gegen die Zeit, der viele Opfer fordert, bis Elisabeth sich am Ende einsam und alleine und ohne jede Hoffnung in einer völlig fremden Landschaft wiederfindet. Sind die Menschen nun verloren?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 693
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wenn ich nach hinten schaue, bin ich voller Dankbarkeit.
Wenn ich nach vorne schaue, bin ich voller Visionen.
Wenn ich nach oben schaue, bin ich voller Kraft.
Wenn ich nach innen schaue, entdecke ich Frieden.
(Indianisches Gebet)
Wir schreiben das Jahr 2035. Noch immer existiert in der Welt Korruption, Gewalt und Machtgier. Noch immer klafft die Schneide der Schere zwischen Arm und Reich weit auseinander und noch immer strebt ein Teil der Menschheit nach noch mehr Macht und noch mehr Geld, während ein anderer Teil unter der Knute der ungerechten Knechtung fasst zusammenbricht. Hunger und Kriege beherrschen weite Landstriche. Selbst die Erde scheint sich gegen die Menschen verschworen zu haben. Dürre, Tsunamis, Hurrikans, Erdbeben, Hochwasser, Hitzeperioden, Vulkanausbrüche und Seuchen erschweren den über acht Milliarden Menschen zusätzlich das Leben. Doch ihr schmerzhaftes Aufbäumen gegen den Parasiten, der sie bevölkert und ausbeutet, bleibt unbeachtet.
Verängstigte und innerlich blinde Menschen laufen wie eine verwirrte Schafherde Endzeitpropheten hinterher. Lassen sich einlullen von falschen Idealen und werfen sich betend auf die Knie um Gott oder wenn auch immer, um Gnade anzuflehen, während sie ihren Müll in die Natur werfen und ihre massigen Protzautos sich an dem letzten Quäntchen Öl laben, dass die Erde noch zu bieten hat.
Andere Gruppen meucheln alles dahin, was nicht ihrem Glauben entspricht. Das allerdings ist kein neues Phänomen. Dies haben die Menschen schon immer getan. Von Beginn der Zeit. Denkt jemand anders, sieht er anders aus, dann muss er plattgemacht werden.
Beispiele dafür gibt es in Hülle und Fülle.
Das begann schon in der Steinzeit und hat bis heute nicht aufgehört.
Vermutlich hat dieses Verhalten seinen Ursprung in unserem Rauswurf aus dem Garten Eden. Diese Vermutung gilt natürlich nur, wenn man an eine höhere, an eine göttliche Macht glaubt. Eine Macht, die der Mensch anbetet und die so unendlich viele Namen trägt.
Namen, die ihm natürlich der Mensch aufs Auge gedrückt hat. Ob diese Macht das so gewollt hat? Vermutlich nicht.
Doch das scheint auf der Erde keinen zu interessieren.
In all diesem Chaos, dem Schmerz, dem Leid vegetieren wir dahin und klammern uns verzweifelt an das Leben, dass wir doch so oft verfluchen.
Unsere Seelen verkümmern, wie ein blühender Strauch in der Wüste. Wir verharren in der Untätigkeit und schielen dabei auf unseren Nebenmann, dem es ja so viel besser geht. Und anstatt vor der eigenen Haustür zu kehren, hadern wir mit diesem neidvollen Blick unserem Schicksal. Ein Schicksal, dass in unseren eigenen Händen liegt. Doch ändern wir etwas? Und sei es nur unsere Einstellung? Nein.
Und genau diese Passivität ermöglicht es einigen Wenigen, sich zu erheben und die Freiheit, die Würde und den Respekt mit Füßen zu treten.
Man möchte der Menschheit verzweifelt zurufen, „Wehrt euch und steht für das ein, was euer Name beinhaltet. Die Menschlichkeit!“
Aber anscheinend verhallt dieser Ruf ungehört. Schade!
Es gab im Laufe der Jahrtausende schon einige, die genau DAS versucht haben. Das wohl populärste Beispiel ist Jesus. Ob er wirklich der Sohn Gottes war, kann niemand beweisen. Doch ich bin mir sicher, es gab ihn. Vielleicht hieß er nicht wirklich Jesus, sondern Joshua oder Alwin, aber er war ein Mensch, der erkannt hat, dass nur die Menschlichkeit die Spezies Mensch retten kann.
Ihm ging es nicht um Macht, um Geld oder große Besitztümer. Ihm ging es um Respekt, Achtung vor allen Geschöpfen und Liebe.
Eigenschaften, die kein Geld kosten, keine Übung erfordern und keine Zeit in unserem Alltag kosten. Es sind Eigenschaften die wir bloß durch die innere Einstellung erhalten. Wenn da doch nur nicht der blöde Nachbar mit dem dicken Auto wäre. Oder mit seinem größeren Haus, seinen noblen Kleidern und dem edlen Geschmeide, mit dem er sich und seinen Clan behängt. Sein Job ist ebenfalls viel toller als unsere und er fliegt auch dreimal im Jahr in Urlaub. Das ist doch ungerecht! Oder nicht?
Doch niemand sieht seine verkümmerte Seele. Niemand sieht den verfressenen habgierigen Ehrgeiz, der ihn so viel Zeit seines Lebens kostet, dass er noch nicht einmal seine eigenen Kinder richtig wahrnimmt. Niemand sieht die brodelnde Unzufriedenheit in seinem Herzen. Er selbst sieht sie auch nicht. Er ist den ganzen Tag damit beschäftigt, das Monster ‚Ego‘ zu füttern und wir sehen nur das schicke Auto, die Designer-Klamotten und das große Haus.
Wisst ihr überhaupt was ‚Ego‘ bedeutet? Es kommt aus dem lateinischen und heißt ‚Ich‘. Die Erklärung des mit einhergehendem, abgeleitetem Wort ‚Egoismus‘ wird im Duden mit der Erklärung ‘Eigeninteresse, Eigennützigkeit‘ aufgefüllt. Ist DAS die richtige Vorgehensweise, wenn ich meinen Platz mit acht Milliarden Menschen teilen muss? Wohl kaum.
Dazu gibt es natürlich den Gegenpart. Das Wort ‚Human‘. Dies stammt ebenfalls aus dem lateinischen und leitet sich ab aus ‚humanus‘ was so viel heißt wie ‚menschlich, menschenfreundlich‘. Es hat aber noch eine weitere, sehr interessante Bedeutung, nämlich die Anlehnung an das lateinische Wort ‚humus‘, was so viel wie ‚Erde‘ bedeutet.
Das Menschliche geht also einher mit unserer Erde. Ein Schelm, der Böses dabei denkt.
Der Mensch tut sich offensichtlich seit Beginn seiner Zeit schwer in seiner geistigen Entwicklung. Immer weitere Neuerungen und Erfindungen vernebeln ihm den Blick auf das Wesentliche. Ihn selbst und seine Mitmenschen.
Ergo müsste dies sein Untergang sein. Er schaufelt sich quasi sein eigenes Grab.
Wäre es nicht schade, wenn wir uns selbst so unrühmlich vom Antlitz dieser Erde ausradieren würden? Mit dieser Frage komme ich wieder zu Menschen wie Jesus. Dabei gibt es auch viele andere Menschen, die das gleiche oder ein ähnliches Ziel verfolgt haben. Die Namen Anne Frank und Sophie Scholl werden den meisten ein Begriff sein. Ebenso Nelson Mandela, Mutter Teresa und Konfuzius. Auch den Dalai-Lama oder Mahatma Gandhi dürften viele kennen. Es gibt aber auch Namen die weniger bekannt sind und die dennoch für den Erhalt der Erde und der Menschlichkeit stehen, wie zum Beispiel Jane Goodall oder Rosa Luxemburg. Die Liste ist lang und würde wahrscheinlich den Rahmen in diesem Vorwort sprengen. Sie sollen nur zeigen, dass es in jeder Epoche zu jeder Zeit Menschen gab, die sich gegen die schnöde Ignoranz aufbäumten und nach Höherem, nach Wertvollerem strebten. Der Menschlichkeit und der Liebe.
Und es gibt noch eines, was all diese Menschen verbindet. Der Glaube. Ein jeder von ihnen besaß den Glauben an etwas Größeres, an etwas, dass wir weder sehen, riechen noch schmecken können. Dieser Glaube beschert uns Hoffnung. Ohne Hoffnung würde alles den Bach runtergehen. Und das wollen wir nicht. Also glauben wir und hoffen.
Doch woran glauben wir und worauf hoffen wir?
Dass jemand kommt und die ganze Scheiße, in der wir bis zum Hals stecken, einfach mit einem Handstrich wegfegt? Dass jemand auf einem weißen Pferd heran rauscht und uns rettet? Jemand, der das Gute verkörpert und das Böse zum Teufel jagt?
Eine Art Erlöser-to-Go? Passend für unsere schnelllebige Welt?
Der einmal mit dem Finger schnippt und schon sind die Meere wieder sauber, die Bäche klar, die Wiesen grün und üppig, die Wälder gesund, alle haben Nahrung und es herrscht Einigkeit und Frieden auf der Welt?
Eigentlich ein wunderschöner Glaube, doch die Vergangenheit hat uns gelehrt, dass eben solche Ritter in weißer Rüstung eher als unbequem empfunden werden, weil man ja seine eigene innere Einstellung ändern müsste.
Sind wir, also die Menschheit, überhaupt noch zu retten?
Wird es jemals einen Menschen geben, der freiwillig die Zügel an sich nimmt und die Menschheit aus ihrem sicheren Untergang hinausführt? Ein Mensch, der über das Gute und das Böse entscheidet. Ein Mensch, der den Fortbestand der Menschheit gewährleistet. Ein Mensch voller Glauben und Hoffnung.
Gibt es so jemanden? Und wenn ja, wo ist er?
Wo war Gott?
DAS war genau die Frage, die Elisabeth sich in diesem Moment stellte, hier am Ort der Hoffnung, wo sich die Hoffnung verlor und sie mit geschlossenen, brennenden Augen auf der abschüssigen Wiese lag, eine erstaunlich angenehme Brise auf ihrer Haut fühlte und das Summen verschiedener Insekten an ihr Ohr drang. Die letzten Wochen hatten sie in einen Zustand katapultiert, der zwischen Hoffnung und Hoffnungslosigkeit, zwischen, maßloser Angst und Faszination hin und herpendelte. Sie hatte Dinge gesehen, die eigentlich nicht existieren konnten. Sie hatte Menschen kennengelernt, auf die das Wort ‚Mensch‘ überhaupt nicht zutraf. Sie hatte allerdings auch Menschen getroffen, deren Güte und altes Wissen sie zutiefst berührt hatte. Trotzdem war ihr Glauben an die Realität dermaßen durchgeschüttelt worden, dass sie fast den Verstand verloren hatte. Ihr wurde zudem die Situation vor Augen geführt, mit der die Welt gerade kämpfte. Und obwohl sie sich nicht als gläubige Christin betiteln würde, presste sie in diesem Augenblick ein göttliches Relikt an ihren Bauch, eingewickelt in antik wirkendes Leder, dessen Inhalt nicht von Menschenhand geschrieben und das unendlich lange Zeit von auserwählten Menschen gehütet worden war.
Doch der Preis war hoch gewesen. Vielleicht sogar zu hoch?
An dieser göttlichen Information klebte das Blut vieler Menschen und auch Nichtmenschen.
Besonders EIN Verlust traf Elisabeth tief. Der Verlust eines Wesens, dass sich tief in ihrem Herz verankert hatte und dass sie so unsagbar liebte. Ein Wesen, dass von Geburt an, an ihrer Seite gewesen ist und sie beschützt hat. Ein Wesen, dass so uralt, wie das Leben selbst gewesen war. Ein Wesen, entsprungen aus dem sagenumwobenen Garten Eden, dass sich für sie geopfert hatte und letztendlich doch vom Bösen selbst vernichtet worden war. Eine Träne löste sich aus Elisabeth Augenwinkel, rann an der blassen Schläfe herab und tropfte in das grüne Gras. Ihr verwundetes Herz krampfte sich schmerzhaft zusammen.
Ihr Gedanke galt in diesem Moment nur einem Mann. Einem Mann, der kein Mann im eigentlichen Sinn gewesen war, sondern einer der fünf Engel der ersten Stunde. Von den betreffenden fünf Wächter-Engeln, war er der Letzte. ER gehörte zu den fünf Wächter-Engel die in grauer Vorzeit miterlebten, wie Luzifer seine glühenden Ketten sprengte und sich gegen Ende ihres furchtbaren Krieges auf die Menschheit stürzte. Gemeinsam verließen die Fünf den Garten Eden und begaben sich ebenfalls unter die Menschen, nicht nur um sie zu schützen. Ihre Aufgabe bestand auch darin, den letzten Erlöser zu finden. Den Menschen, der sich ohne Furcht dem Kampf gegen das Böse stellte. Denn nur ER wäre in der Lage, die Waage zwischen Gut und Böse wieder ins Lot zu bringen.
Die Auswirkungen des verheerenden Krieges zeigte sich sowohl in der Menschenwelt, als auch in der Welt der Engel. Doch das Schlimmste war, dass nun Millionen und Abermillionen Seelen vor den Toren Garten Edens standen und keinen Zutritt mehr hatten. Lucifer hatte den plötzlich unbewachten Garten Eden versiegelt.
Die Tatsache das Elisabeth nun alleine hier auf der Wiese lag, vermittelte ihr das Gefühl versagt zu haben. Das ALLE versagt hatten. Es gab nun keinen Ritter in weißer Rüstung mehr und somit gibt es auch keine Hoffnung. Die Menschheit würde untergehen. So jedenfalls fühlte es sich in diesem Augenblick für Elisabeth an. Eine weitere Träne löste sich aus ihrem Augenwinkel. Ganz deutlich konnte sie fühlen, wie auch sie an der Schläfe herabrann, um letztendlich den Weg zur Mutter Erde zu finden. Wem DIESE Träne galt, konnte Elisabeth nicht sagen. Der Menschheit oder ihrer verlorenen Liebe? Sie hatte keine Ahnung, aber sie wusste, eigentlich war es unwichtig. Wichtig war hier und jetzt, ihre Hoffnungslosigkeit in den Zaum zu bekommen. Dabei halfen ihr die letzten Worte ihres Geliebten. Worte, erst hervorgebracht vor zwei Tagen. Worte, so leise gesprochen, dass Elisabeth sie kaum hatte hören können.
Worte, die sich tief in ihre Seele eingebrannt hatten.
Worte, die wie ein Abschied klangen, als ob er geahnt hätte, dass die Zeit ihrer Trennung unausweichlich näher rückte. Als ob er ihren Abschied vorhergesehen hätte.
Worte, an die Elisabeth sich nun klammert, so wie an die alte Lederhülle auf ihrer Brust. Sie hatte das Gefühl, IHM mit der Erfüllung seines Wunsches, irgendwie nahe zu sein. Ganz genau erinnert sie sich an diesen einen, diesen besonderen, diesen letzten gemeinsamen Moment. Als sie beide vor zwei Tagen auf der Rückbank des Autos nebeneinandersaßen, nahm er sie in die Arme und schaute ihr mit einem Blick voller Liebe tief in die Augen, „Ich weiß nicht was mit dir gerade geschieht. Ich weiß nicht, was überhaupt geschehen wird oder wie dies alles einmal endet. Doch du musst mir versprechen, egal was geschieht…du musst mir versprechen, niemals die Hoffnung zu verlieren. Denn das ist etwas, was ich nun weiß. DU darfst niemals die Hoffnung verlieren, denn wenn die letzte Hoffnung stirbt, wenn DEINE Hoffnung stirbt, ist alles, wofür wir jemals gekämpft haben, verloren. Dann ist der Garten Eden verloren. Dann sind die Menschen verloren. Dann sind die Engel verloren. Aber vor allem…DU wärst verloren. Bitte, Lizzy…verliere NIE die Hoffnung. Ich liebe dich so unsagbar und ich will, dass du lebst. Würdest du mir dieses Versprechen geben, kleine Lizzy?“
Eine Bitte, die nun wie eine schwere, bleierne Bürde auf Elisabeths schmalen Schultern lastete. Seine samtene Stimme und die Erinnerung an die letzten Wochen verhallten langsam in ihrem Kopf und sie schlug die Augen auf. Den weit geöffneten Blick in die blaue Tiefe des Himmels versenkt, hauchte sie tieftraurig, „Ich verspreche es!“
Vier Wochen zuvor…
Tief versunken öffnete Elisabeth das schmiedeeiserne Tor zum Friedhof. Es war ein Donnerstag mitten im Mai. Genauer gesagt, der 16. Mai. In ihrem Shopper ruhten, achtsam mit dünnem Papier umwickelt, ein Strauß Blumen. Sonnenblumen. Die hatte Vera, ihre Adoptivmutter, heiß und innig geliebt. Früher, als sie noch lebte.
Leider war sie vor genau zehn Jahren bei einem dramatischen Autounfall ums Leben gekommen. Zusammen mit ihrem Mann Michael, Elisabeths Adoptivvater. Ein Verlust, den Elisabeth nie richtig verwunden hatte. Dreizehn Jahre waren ihr nur mit diesen beiden herzensguten Menschen vergönnt gewesen. Dreizehn wundervolle Jahre, in denen sie fast vergessen hatte, wie beschissen ihr Leben vor der Adoption gewesen war. Dreizehn Jahre, in denen sie den Glauben an Wunder in sich bewahrt hatte. Denn der Verlauf, der zu dieser ungewöhnlichen, doch recht späten Adoption geführt hatte, glich in der Tat einem kleinen Wunder. Immerhin war Elisabeth bei der Adoption bereits 15, fast 16 Jahre. Ein recht fortgeschrittenes Alter, um noch einmal in einer fremden Familie Fuß zu fassen. Doch Vera und Michael überschütteten Lizzy, wie sie damals genannt wurde, mit so viel Liebe, dass es fast schon unheimlich war. Möglicherweise lag es daran, weil sie keine eigenen Kinder bekamen.
Ob die Natur dies so eingerichtet hatte oder ob sich die beiden nie Gedanken über eigene Kinder gemacht hatten, konnte Elisabeth bis heute nicht sagen. Dies war ein Thema, dass die beiden wohl nicht mit Elisabeth hatten erörtern wollen. Auch nicht, als sich nach einer schweren Unterleibsentzündung vor knapp zwölf Jahren herausstellte, dass Elisabeths Eileiter dermaßen in Mitleidenschaft gezogen worden waren, dass sie wohl niemals wieder den Sinn erfüllen würden, zu dessen Zweck sie eigentlich gedacht waren. Elisabeth würde niemals Mutter werden, zumindest nicht von leiblichen Kindern. Komischerweise hatte ihr diese Hiobsbotschaft damals keinen Schock versetzt. Sie hatte es einfach so hingenommen. Schicksal eben.
Vielleicht hatte sie es auch einfach so ruhig hingenommen, weil sie nie das Gefühl gehabt hatte, als ob ihr bei ihren Adoptiveltern etwas fehlen würde. Michael, Vera und Veras Mutter Helen hüllten sie in eine familiäre Atmosphäre, die seinesgleichen gesucht hat. Doch heute, zehn Jahre nach dem Tod der Beiden bedauerte Elisabeth die nicht vorhandenen Geschwister. Helen, ihre Ersatzoma war ihrer Tochter und ihrem Schwiegersohn ein knappes Jahr später gefolgt. Offiziell war ein Schlaganfall schuld, tief in ihrem Innern vermutete Elisabeth jedoch ein gebrochenes Herz. Vera war Helens einziges Kind gewesen. Nach Veras Tod, verfiel die alte Dame mit den lustig wippenden, eisgrauen Korkenzieherlocken zusehends, bis Elisabeth sie eines Morgens tot im Bett aufgefunden hatte.
Von diesem Tag an war Elisabeth wieder alleine gewesen. Alleine mit drei Buchläden, die ihren Eltern gehört hatten und deren Angestellte nun ihr Vertrauen und ihre finanzielle Zukunft in die Hände einer 25-jährigen jungen Frau legen mussten. Elisabeth hatte zwar immer mal wieder in einem der Läden ausgeholfen, doch sie selbst hatte ihren eigenen Weg immer in der Schriftstellerei gesehen. Der große Durchbruch war zwar auch noch nach vier Büchern ausgeblieben, dennoch verkauften sich ihre Werke überraschend gut. Nicht zuletzt, weil Vera und Michael sie tatkräftig unterstützt hatten.
Bevor Elisabeths Gedanken sich tiefer in die Vergangenheit hineinwühlen konnten, bemerkte sie, dass sie wohl die falsche Abzweigung genommen hatte. Sie befand sich nun in dem ältesten Teil dieses Friedhofes. Einem Teil, in dem sie sich noch nie aufgehalten hatte. Warum auch? Es lag ja keiner hier den Elisabeth kannte. Nach einem prüfenden Blick auf einen verwitterten, moosüberzogenen Grabstein neben ihr, entziffert sie mühsam das Datum: Juni oder Juli 1772. Erstaunt lupften sich ihre feingeschwungenen Augenbrauen.
Wurden die Gräber denn nicht nach 25 Jahren eingeebnet?
Mit einem fragenden Blick richtete Elisabeth sich wieder auf und schaute sich scheu um. Erst jetzt fiel ihr auf, dass sich niemand sonst hier aufhielt. Sie war mutterseelenalleine zwischen all diesen fossilen Hinterlassenschaften des Todes.
Leicht fröstelnd zog sie die Schultern nach oben und warf einen prüfenden Blick zum Himmel.
Hatte nicht gerade noch die Sonne geschienen? Und warum, zum Teufel noch mal, waren die Tannen so hoch. Gab es denn keinen Gärtner, der das Grünzeug im Zaum halten sollte?
Irgendwie wirkte dieses Fleckchen Erde, als ob es von aller Welt vergessen worden wäre. Unbehaglich schlug Elisabeth den Kragen ihres leichten Mantels hoch und warf erneut einen Blick um sich. Wo war sie eigentlich hergekommen und wo ging es wieder raus? Innerlich schimpfte sie mit sich selbst. Das kam davon, wenn man seinen zügellosen Gedanken freien Lauf ließ. Etwas zittrig schnaufte sie durch, „Reiß dich zusammen, Elisabeth. Du musst nur dem Weg folgen. Geh einfach den Weg entlang!“ Mit gesenktem Kopf raffte sie ihre Tasche enger an sich und stampfte los. Den Blick stur auf die kleinen Kieselsteine gerichtet, die sich durch die scheinbar wahllos angelegten Grabstätten schlängelten. Dann gabelte sich plötzlich ohne Vorwarnung der Weg. Gezwungenermaßen hob Elisabeth den Kopf um sich besser zu orientieren. Vor ihr erhob sich eine massiges rundes Sandsteinpodest. Ganz automatisch krochen Elisabeths Augen langsam nach oben. Es handelte sich offensichtlich um eine Statue, die man auf einen Sockel gestellt hatte. Der Stein war im Laufe der Jahre (oder Jahrhunderte) schwarz angelaufen und glänzte, als ob ein feiner Wasserfilm ihn überdecken würde. Als erstes kamen ein paar Füße in ihr Sichtfeld.
Sie steckten in merkwürdigen Riemchensandalen, deren Schnallen sich bis zum Knie hinaufzogen. Darüber kamen ein paar muskulöse Oberschenkel zum Vorschein, die jedoch von einem Wams halb verdeckt wurden. Elisabeth schnaubte überrascht, angesichts der äußerst detailreichen Abzeichnung der Bein-Muskulatur. Ihr Blick wanderte weiter hoch, über schmale Hüften, einen angedeuteten Gürtel, dem gepanzerten Brustgeschirr und blieben an den erhobenen Armen der imposanten Statue hängen. Lederriemen, natürlich in Stein gemeißelt schnürten in den angeschwollenen Bizeps. Elisabeth schluckte und legte entschlossen den Kopf in den Nacken. Sie wollte unbedingt das Gesicht dieses Mannes sehen. Allerdings streiften ihre Augen nur flüchtig über das geschwärzte Antlitz. Ihre Aufmerksamkeit wurde unverhofft auf etwas ganz anderes gelenkt. Flügel. Riesengroße, schwarzglänzende Schwingen breiteten sich zu beiden Seiten aus. Schwingen, die eigentlich proportional gar nicht zu der Statue passten und Elisabeth fragte sich im gleichen Moment, warum die Statue, aufgrund des Gewichtes nicht einfach nach hinten kippte. Lag es vielleicht an dem leicht vorgebeugten Oberkörper? Der Steinmetz, der diese Arbeit verrichtet hatte, musste sehr viel Ahnung von der statischen Schwerkraft besessen zu haben, oder besser gesagt, wie man der Schwerkraft ein Schnäppchen schlug. Elisabeth war tief beeindruckt. Erst jetzt schwenkten ihre Augen zurück zu dem Gesicht.
Sofort stockte ihr der Atem. Sie schaute in ein Gesicht, dass schöner nicht sein konnte. Ehrlich gesagt hatte Elisabeth noch NIE so etwas Schönes gesehen. Solche Anmut, gepaart mit einer Wildheit, die Elisabeth fast körperlich fühlen konnte. Dies verschlug ihr schier den Atem. Ihre weit aufgerissenen Augen glitten über die markanten Züge des Unbekannten, deren schwarze Steinaugen sie spöttisch zu mustern schienen. Eine Gänsehaut breitete sich auf ihren Armen aus und ihre Kopfhaut begann zu kribbeln. So stark, dass es sich schon fast unangenehm anfühlte. Langsam wanderte ihr Blick zu den vollen Lippen, die, wie vom frühen Morgentau benetzt glänzten. Lippen, wie sie sinnlicher nicht sein konnten. Lippen die schimmerten, als ob sie noch feucht von fordernden Küssen wären.
Sofort erschien in Elisabeths Kopf das Bild eines Mannes, dessen heiße Lippen sie voller elektrisierender Leidenschaft küssten und dann leise keuchend eine feuchte Spur ihren Hals hinabzogen. Blitze zucken hinab in ihren Unterleib und setzen ihn in Flammen. Ihre Brustwarzen verhärteten sich und ihr Puls schnellte nach oben. Elisabeth schluckte knackend und senkte verwirrt den Kopf. Was war denn nur los mit ihr? Sie, als gestandene Frau von 38, stand mitten auf einem alten Friedhof und ließ sich von einer schäbigen Steinfigur antörnen. Wenn das mal nicht krank war.
Du bist einsam.
Erschrocken wirbelte Elisabeth herum, „Wer hat das gesagt?“ Ihr flirrender, ängstlicher Blick spähte umher, doch niemand war zu sehen. Eine leichte, kühle Bö rauschte durch die tiefhängenden Zweige der haushohen Tannen. Die schweren und auch ungewöhnlich zahlreichen Zapfen wippten vorsichtig. Elisabeth entspannte sich minimal. Offensichtlich waren ihre Nerven nur etwas überspannt. Ein klein wenig Nervosität und schon hatten ihr ihre Sinne einen geschmacklosen Streich gespielt. Sie lachte unsicher, „Das ist ja in dieser gruseligen Friedhofsidylle auch kein Wunder. Also nachts würden mich keine zehn Pferde hierher schleifen können.“ Entschlossen rückte sie ihre Tasche wieder auf der Schulter zurecht.
„Aber vielleicht könnte ich dich in Versuchung bringen.“
Sämtliches Blut sackte auf einen Schlag aus ihrem, nun kreidebleichen Gesicht. Unendlich langsam drehte sie sich um. Die kleinen Kiessteine knirschten dabei übernatürlich laut, doch das fiel Elisabeth in diesem Moment nicht auf. Als ob sie unter einem Bann stehen würde, schob sich ihr Kopf in den Nacken. Ihr Verstand kreischte. Dann blickte sie in zwei schwarzglänzende Augen, die von oben auf sie hinabsahen. Den sinnlichen Mund zu einem grausamen Lächeln verzogen. Beide Arme weit oben in der Luft. In den großen, zusammengeballten Händen erhob sich ein langes, breites Schwert. Bereit, auf sie herabzustoßen.
Ihre ungläubig geweiteten Augen klebten an den gemeißelten Händen. In Gedanken nahm sie bereits die Beine in die Hand und rannte um ihr Leben. Doch ihre Füße waren wie fest verwurzelt. Halb wahnsinnig vor Angst schaute sie wieder in das göttliche Gesicht, das auf eine grausame Weise noch immer wunderschön war. Die vollen Lippen öffneten sich leicht. Elisabeths Verstand klinkte sich aus und drei Dinge auf einmal überlappten sich. Ein massiver dunkler Schatten fegte jäh über ihren Kopf und zauste ihr das Haar ins Gesicht. Ihre Stimmbänder befreiten sich gewaltsam aus ihrer Lähmung und sie schrie gellend. Und ihre willenlosen Füße setzten sich schlagartig in Bewegung. Wie von Sinnen bahnte sich Elisabeth einen Weg durch das Gestrüpp und die tiefhängenden Zweige der Tannen.
Obwohl sie keinerlei Verfolgungsschritte hinter sich hören konnte, meinte sie ein dunkles, spöttisches Lachen zu hören. Ein Lachen, dass sich auf ihrer Haut wie Eiswasser anfühlte. Äste schlugen ihr ins Gesicht, doch das spürte sie kaum. Sie wollte nur weg. Weg von dieser furchtbaren Statue, raus aus diesem altertümlichen Schrecken. Obwohl ihr in diesem Moment glasklar war, dass es sich nur um eine Einbildung gehandelt haben konnte, raste ihr Herz panisch. Elisabeth hatte Angst.
Todesangst. Die Flucht, vorbei an umgestürzten Grabsteinen, Hecken, umgefallenen Randsteinen und verwilderten Büschen schien eine Ewigkeit zu währen, obwohl es sich in Wirklichkeit nur um ein paar läppische Sekunden handelte.
Unvermittelt rannte sie in gleißende Sonnenstrahlen und bremste abrupt ab. Keine Sekunde zu früh. Noch zwei weitere Schritte und sie hätte in ihrer Panik eine alte Oma über den Haufen getrampelt. Keuchend stützte sie sich vornübergebeugt auf ihren Schenkeln ab und blickte die alte Frau an, die ihren gehetzten Blick kopfschüttelnd erwiderte. Elisabeth versuchte hastig zu retten, was noch zu retten war. Mit zitternden Daumen wies sie über ihre Schulter, „Man, das war wirklich ein Mordsvieh. Hatte bestimmt Tollwut. Sowas habe ich noch nie gesehen. Ein Kopf wie eine zerrupfte Bulldogge. Muss ich unbedingt der Friedhofsverwaltung sagen.“ Mit einer linkischen Geste, als ob sie einen nicht vorhandenen Hut lüften wollte, nickte sie der alten Frau zu, „Ich hoffe, ich habe sie nicht allzu sehr erschreckt. Vielleicht sollten sie heute lieber nicht gießen.“ Elisabeth warf noch einen schnellen, bedeutsamen Blick über ihre Schulter und trat dann den Rückzug an, „Ich gehe dann mal. Auf Wiedersehen!“
Mit einem Ruck drehte sie sich auf dem Absatz herum und stakste von dannen. In ihrem Rücken konnte sie hören, wie jemand hastig die Gartenutensilien zusammenraffte und mit eiligen kleinen Trippelschritten in die entgegengesetzte Richtung flüchtete. Sofort meldete sich Elisabeths schlechtes Gewissen. Bestimmt hatte sie der alten, unschuldigen Frau einen Höllenschreck eingejagt. Das hatte sie ganz sicher nicht gewollt.
Arme Frau! Leise seufzend schlich sie den gepflegten Pfad entlang, bis sie schließlich doch noch beim Grab ihrer Eltern ankam.
Erst beim Blick auf die Vase, in der ein verwelkter Blumenstrauß vor sich hin darbte, fiel Elisabeth auf, dass ihre Tasche verschwunden war. Mit plötzlichem Herzklopfen schaute sie in die Richtung aus der sie gekommen war.
Bestimmt hatte sie die Tasche auf der Flucht vor dem Steinmonster verloren.
Obwohl nichts an dieser Situation komisch war, musste Elisabeth plötzlich laut lachen. Es klang allerdings doch leicht hysterisch.
Klar. Ein Steinmonster. Wo waren sie denn? Etwa in einem Steven-Spielberg-Film? Was immer sie dermaßen erschreckt hatte, es war bestimmt kein Steinmonster gewesen. Ein fantasievolles Hirngespinst. Eine groteske Fata Morgana. Ein schauderhaftes Schattenspiel oder einfach nur ein unspektakulärer, winziger Migräneschub, aber ganz sicher kein frauenfressendes Steinmonster.
Noch immer lachend schüttelte Elisabeth den Kopf. Dennoch verspürte sie nicht den geringsten Drang, ihre Handtasche suchen zu gehen. Sie würde einfach bei der Friedhofsverwaltung anrufen. Sollten DIE doch ihre Tasche suchen. Ihr Kopf nickte zustimmend. Elisabeth bückte sich entschlossen und ihre leicht zittrigen Hände schoben ein paar abgefallene Blätter vom Grabstein, als ihr plötzlich siedend heiß einfiel, dass nicht nur die Blumen in der Tasche gewesen waren, sondern auch ihr Handy, Ihr Portemonnaie und ihre Haustürschlüssel.
Verärgert biss sie sich auf die Unterlippe, richtete sich auf, stemmte die Hände in die Hüften und nuschelte lautstark, „Was für eine verfickte Scheiße!“
„Ähm…bitte, was?“ Erschrocken wirbelte Elisabeth herum. Dabei fielen ihre Arme herab, ebenso wie ihre Kinnlade, die sie jedoch gleich darauf wieder zuklappte.
Heiße, verlegene Röte schoss ihr ins Gesicht und ließ ihr Gesicht leuchten, wie eine reife Tomate, „Entschuldigung…ich…es tut mir leid…sie sind…ich bin…ich habe…!“ Lachend half der Fremde aus, „Sie haben möglicherweise ihre Handtasche verloren?“ Der Mann vor ihr gab sich noch nicht einmal die Mühe, sein amüsiertes Grinsen zu verbergen. Dabei schwenkte er vergnügt den braunen Schopper, „Ich habe jede weibliche Seele abgeklappert, die mir hier über den Weg gelaufen ist. SIE sind die letzte Hoffnung die ich habe. Gehört diese heimatlose Tasche vielleicht ihnen?“ Elisabeth war froh, dass er ihre verbale Entgleisung offensichtlich mit Humor nahm und rang sich ein hoffentlich freundlich wirkendes Lächeln ab, als sie den verlegen gesenkten Blick leicht anhob und vorsichtig nach oben schielte. Zum zweiten Mal an diesem Tag verschlug es ihr fast die Sprache.
Der stattliche Finder war bestimmt 1 Meter neunzig groß.
Da konnte Elisabeth mit ihren mageren 1 Meter 62 nicht mithalten. So musste sie den Kopf schon in den Nacken legen, um dem vergnügt grinsenden Mann überhaupt ins Gesicht schauen zu können. Dabei taxierte sie unbewusst und mit angehaltenem Atem seine Schulter, aus denen KEINE Flügel sprießten.
Erleichtert seufzte sie kaum hörbar und wagte nun auch endlich einen Blick in das Gesicht des Fremden, „Danke.
Das IST in der Tat meine Tasche. Ich habe sie…“, vage wedelte Elisabeth nach links, „…ich habe sie dort drüben wohl irgendwie verloren.“ Ihr Blick surrte unstet über seine Wange und sein glattrasiertes Kinn, in dessen Mitte sich eine feine Kerbe entlang zog.
Als ob der liebe Gott höchstpersönlich seinen Finger dort abgelegt hätte.
Bei diesem Gedanken biss Elisabeth sich sofort auf die Zunge.
Was war denn heute mit ihr los? Vielleicht hatte sie ja Fieber?
Ziemlich hohes Fieber?
Da der Fremde nichts von ihrem wirren Gedankengut mitbekam, reichte er ihr einfach mit einem schelmischen Grinsen die Tasche, „Irgendwie verloren…so, so. Naja. Ist ja auch egal. Ich habe sie gefunden und nun ist sie wieder hier!“ Elisabeth griff dankbar nach ihrem Eigentum und quetschte ein gequältes Lächeln hinterher, „Ich danke ihnen. Das war sehr nett, dass sie sich auf die Suche gemacht haben, obwohl sie bestimmt was Besseres zu tun haben, als auf einem Friedhof verlorene Taschen nachzuhechten und ihren Besitzerinnen zurückzugeben.“
Ganz ohne Vorwarnung stiegen Elisabeth plötzlich Tränen in die Augen, die sie hastig wegzublinzeln versuchte.
Offensichtlich jedoch nicht schnell genug, denn der Fremde beugte sich rasch vor und umfasste sachte ihren Oberarm, als ob er befürchtete, Elisabeth würde hier auf dem Friedhof, vor seinen Augen aus den Latschen kippen, „Alles in Ordnung mit ihnen? Sie sind ja ganz blass um die Nase. Soll ich einen Krankenwagen besorgen oder irgendjemanden anrufen?“
Vorsichtig zog er Elisabeth an sich heran. War es diese schützende Geste, die dafür sorgte das die Schleusen sich mit einem Schlag öffneten oder doch das noch bebende Nervenkostüm. Elisabeth wusste es nicht und sie konnte den Tränenstrom auch nicht mehr zurückhalten.
Schluchzend warf sie sich an die fremde Männerbrust und weinte hemmungslos, ohne Rücksicht, dass sie damit das graue Hemd des Mannes durchnässte. Der Fremde versteifte sich kurz und tätschelte etwas unbeholfen ihren Rücken. Die ganze Situation war Elisabeth so unglaublich peinlich, aber sie konnte einfach nicht mit dieser dämlichen Heulerei aufhören. Als ob sich die Niagarafälle hinter ihren Augäpfeln aufgestaut hätte, schossen die Tränen in einem wahren Sturzbach hervor. Minutenlang.
Erst als der Fremde sie sanft ein Stück von sich schob und ihr etwas linkisch versuchte ins verquollene Gesicht zu schauen, ebbten die lauten Schluchzer zögerlich ab. Sie musste schrecklich aussehen. Hektisch blinzelte Elisabeth die letzten nassen Ausläufer zurück, zog geräuschvoll die Nase hoch und wischte sich mit dem Ärmel ihres leichten Mantels über das Gesicht.
Wahrscheinlich verschlimmerte dies ihr Aussehen. Ganz sicher verschlimmerte dies ihr jetziges Aussehen. Auf dem Ärmel klebte nämlich, wie ein höhnisches Indiz, gut sichtbar, die Hälfte ihres schwarzen Mascaras. Die andere Hälfte verteilte sich dann bestimmt unter ihren geschwollenen Augen.
„Geht es wieder?“ Die sanfte Stimme des Taschenfinders legte sich wie Balsam auf ihr überhitztes Gemüt.
Schniefend nickte Elisabeth, „Danke. Alles gut. Wirklich.“
Der fremde Mann erwiderte nichts darauf, deshalb hob Elisabeth den Kopf, um ihm als Beweis ein Lächeln zu schenken. Ihr Blick traf auf silbrig schimmernde Augen.
Augen, in denen man als Frau gerne ertrinken mochte, sofern man nicht gerade aussah wie ein durchgeprügelter Pandabär. Im Augenblick sahen diese seltsamen Augen voller Sorge auf Elisabeth herab und wie von Zauberhand tauchte ein blütenweißes Papiertaschentuch vor ihre Augen auf. Elisabeth schnappte danach und verbarg damit sofort das schlimmste Desaster, „Danke.“
Dann würgte sich noch hervor, „Sorry!“
Vorsichtig wagte sie einen Blick auf das Hemd vor ihr.
Der nasse Fleck, verursacht von ihren Tränen und ihrer laufenden Rotznase war nicht zu übersehen. Die Verlegenheit in ihrem Bauch breitete sich wieder wie eine unkontrollierbare Wasserlache aus und sie wies auf den verräterischen nassen Fleck, „Nochmal sorry.“
Dann schnäuzte sie kräftig in das Taschentuch und ließ es anschließend leicht beschämt in ihrer Jackentasche verschwinden.
„Soll ich sie irgendwohin begleiten. Vielleicht nach Hause?“ Bestimmt war dieses Angebot nur gut gemeint, doch bei Elisabeth schrillten sofort sämtliche Alarmglocken. Sie kannte den Kerl doch gar nicht.
Was, wenn er ein verrückter Axtmörder war, der sich auf dem Friedhof seine unschuldigen Opfer aussuchte, um sie in ihren eigenen vier Wänden in kleine Filets zu verhackstückeln?
Hektisch winkte sie ab, „Nein, nein. Es geht schon. Ehrlich. Ich…ich…ich habe nur Hunger und wenn ich Hunger habe, weine ich...manchmal…!“
Was war denn das für eine dämliche Ausrede?
Doch auf die Schnelle war ihr einfach nichts Besseres eingefallen. Der fremde Mann gluckste leise, „Hunger?
Okay. Nichts für ungut.“ Es war ganz offensichtlich, dass er verstanden hatte. Dann wies er auf die Handtasche, die Elisabeth noch immer vergessen in der Hand schwenkte, „Sie sollten die Blumen bald ins Wasser stellen. Sonst können sie sie gleich auf den Komposter werfen.“
Elisabeth presste stur die Lippen zusammen und erwiderte nichts darauf. Dies fasste der Mann wohl als Ende dieser skurrilen Situation auf, denn er reichte ihr nun höflich die Hand, die Elisabeth nur widerwillig ergriff. Seinen warmen Händedruck garnierte er mit einem guten Rat, „Gehen sie nach Hause, Elisabeth und gönnen sich ein Glas Rotwein. Das wirkt Wunder.“
Ehe Elisabeth reagieren konnte, drehte er sich um und entfernte sich mit weitausschweifenden Schritten den Kiesweg entlang und verschwand nach ein paar Sekunden hinter einer hohen Thuja-Hecke. Irgendwie fühlte Elisabeth sich erleichtert, gleichzeitig aber auch enttäuscht.
Was, wenn er doch kein verrückter Axtmörder gewesen war, dann ging ihr gerade ein Flirt durch die Lappen.
Möglicherweise sogar ein Date! Sie hatte schon so lange kein Date mehr gehabt. Die letzte Verabredung lag schon…? Ja, wie lange war es eigentlich her? Ach, egal. Auf jeden Fall schon so lange, dass sie sich nicht mehr erinnern konnte.
Doch nun war es zu spät. Der nette Mann mit den faszinierenden Augen war fort. Seufzend öffnete Elisabeth ihre Handtasche und betrachtete die leicht mitgenommenen Blütenköpfe. Der Mann hatte Recht.
Wenn die Blumen nicht bald Wasser bekämen, würden sie endgültig den Geist aufgeben. Also zog sie den Strauß raus, befreite ihn von der lästigen Papierhülle, zupfte den verwelkten Strauß aus der Vase und stopfte die halbwegs frischen Blumen hinein. Dann eilte sie noch an den nahegelegenen Brunnen, füllte eine der grünen Friedhofs-Gießkannen mit Wasser und flitzte zurück ans Grab. Den ersten Schluck erhielten natürlich die Blumen, den Rest des Wassers spendete Elisabeth großzügig an die flachen Bodendecker, die dreiviertel der Grabfläche bedeckten und somit Elisabeths botanischen Künsten nur ein Minimum an Können abverlangte. Als sie fertig war, richtete Elisabeth sich auf und wollte die Gießkanne wieder zurück zum Brunnen bringen, doch sie stand am Grab und rührte sich nicht. Die feinen Nackenhärchen richteten sich auf und sie überkam das unheimliche Gefühl, dass jemand (oder etwas?) sie beobachtete. Mit einem mulmigen Gefühl in der Magengrube taxierte sie ihre Umgebung, indem sie sich langsam, unendlich langsam um die eigene Achse drehte. Jedoch ohne irgendwas Auffälliges auszumachen. Trotzdem hatte sie es plötzlich sehr eilig. Ohne dem Grab ihrer Eltern noch einen letzten Blick zu gönnen, schnappte sie sich ihre Handtasche, eilte mit weitausholenden Schritten zum Brunnen, warf die Kanne einfach auf die Wiese und peilte schnurstracks den Ausgang an. Das schmiedeeiserne Tor in der Ferne wirkte wie ein Rettungsanker auf Elisabeth.
Ein Tor, hinter dem Sicherheit wartete. Warum sie dieses Gefühl hatte, konnte Elisabeth nicht sagen, denn nichts in ihrer Umgebung wirkte in irgendeiner Art und Weise verdächtig, geschweige denn gefährlich. Trotzdem legte sie auf den letzten Metern noch einen gepflegten Spurt hin, riss das Eisentor auf und hechtete erleichtert auf den Gehweg, der an einer vielbefahrenen Straße lag. Jetzt erst fühlte sie sich sicher. Noch einmal warf sie einen Blick über die Schulter und fragte sich nicht zu ersten Mal an diesem Tag, was heute eigentlich mit ihr los war. Dann zuckte sie mit den Schultern und beschloss dem Rat des netten Mannes mit den Silberaugen zu folgen. Ein Glas Wein, zuhause auf der Couch, eingemummelt in eine kuschelige Decke würde ihr wirklich bestimmt guttun.
Ein leises Lächeln umspielte ihre Mundwinkel, dass jedoch eine Sekunde später einfror.
Ihr Gehirn suchte sofort hektisch nach dem Auslöser dieser Reaktion und dann fiel es ihr ein. Das Kopfkino lief an und sie erlebte vor ihrem inneren Auge den Grund ihrer Besorgnis.
Eine Männerhand streckte sich ihr entgegen, begleitet mit den Worten, „Gehen sie nach Hause, Elisabeth und gönnen sich ein Glas Rotwein. Das wirkt Wunder.“
Ihr Herzschlag beschleunigte sich in Sekundenschnelle und die kleinen Zahnräder in ihrem Gehirn griffen hektisch ineinander und ratterten auf Hochtouren.
Woher hatte der Mann ihren Namen gewusst? Hatte er sie beobachtet? Hatte er sie auf ihrer Flucht vom Friedhof ebenfalls beobachtet? War sie deswegen so in Panik geraten? Und was war mit dieser monströsen Statue? War der angeblich nette Finder ihrer Handtasche auch dafür verantwortlich? Hatte man ihr Drogen verabreicht? Jetzt reiß dich aber mal zusammen, Elisabeth. Deine Fantasie galoppiert gerade mit dir durch.
Zittern atmete Elisabeth ein paarmal kräftig durch und wischte sich kleine, kalte Schweißperlen von der Stirn. Offensichtlich half der zusätzlich einverleibte Sauerstoff, denn die hochschäumende Panikattacke flachte ab und rationales Denken setzte wieder ein. Für all dies gab eine logische Erklärung. Die fiel ihr zwar im Moment nicht ein, doch es gab sie sicher…die logische Erklärung. Jetzt sollte sie ihren verwirrten Körper erst einmal nach Hause schaffen. Und das ohne irgendwelche Fantasiewesen oder gutaussehende Männer.
Noch etwas wackelig auf den Beinen, machte sich Elisabeth auf den Weg zur nächsten U-Bahnstation, wo im Zehn-Minuten-Takt die rollenden Waggons Menschen von A nach B beförderten. Den Weg dorthin, nutzte sie, um ihre aufgewühlten Emotionen unter Kontrolle zu bringen, in dem sie gezielte Atemübungen machte, die sie in ihrem Meditationskurs gelernt hatte. Übrigens die einzige Freizeitbeschäftigung, die Elisabeth ausübte.
Allerdings war es ganz sicher kein Ort, um mit dem anderen Geschlecht anzubandeln. Erstens ruhte dort jeder stillschweigend in seiner inneren Mitte und zweitens waren es ausnahmslos Frauen, die diesen Kurs besuchten.
Dennoch genoss Elisabeth die wöchentlichen Zusammentreffen, obwohl sie vermutete, dass sie selbst noch meilenweit von ihrer sagenumwobenen inneren Mitte entfernt war. Aber diese Atemübungen waren in der Lage, sämtliche überhitzten Systeme in Elisabeths Körper herunterzufahren und sie in eine Art Entspannung zu lotsen, die noch nicht einmal die Tiefschlafphase erreichte. Als sie den Zug bestieg, fühlte sich Elisabeth bereits seltsam gelöst. So war sie in der Lage, sich in aller Seelenruhe die mitfahrenden Passagiere zu betrachten und ohne dass es ihr bewusst war, legte sie sich schon einige Lebensgeschichten zurecht.
Die junge Mutter, mit dem kleinen Jungen, der unaufhörlich auf sie einplapperte. Bestimmt war sie alleinerziehend und musste jeden Pfennig zweimal herumdrehen. Darauf ließen zumindest ihre Schuhe schließen, deren Sohlen an den Fersen schon völlig schiefgetreten waren. Auch die Kleidung des Jungen erzählte von einer gewissen Geldknappheit.
Möglicherweise war sie gerade auf dem Weg zum Amt, um Kleidergeld zu beantragen. Kleidergeld, dass sie nicht in Kleidung, sondern in Essen investieren würde.
Allerdings war sich die Frau nicht sicher, ob der Zuschuss bewilligt werden würde. Das könnte die steile Sorgenfalte zwischen ihren Augenbrauen hervorgerufen haben und ihr teilnahmsloses Schweigen, obwohl sie gerade in eine kindliche Wortschwallblase eingehüllt war.
Elisabeths Blick wanderte weiter und blieb an einem alten Mann hängen. Sein Oberkörper war nach vorn gebeugt.
So weit, dass sein Kopf fast zwischen den Knien baumelte. Elisabeths Blick taxierte in Sekundenschnelle, die Kleidung, die Haare, die Schuhe, die Atmung und die Haltung. Dabei konstruierte ihr Gehirn eine weitere fiktive Lebensgeschichte.
Dieser Mann war verheiratet. Das erzählte der goldene Ring an seinem Finger. Seine Frau litt jedoch an Alzheimer und wohnte in einem Heim. Von dort kam er gerade. Er achtete darauf, dass seine Schuhe geputzt waren, weil seine Frau in lichten Momenten kontrollierte, wie er alleine zurechtkam. Dies erklärte auch das Hemd, dessen gestärkter Kragen aus dem pflegeleichten hellbrauen Blouson herauslugte. Das ergraute Haar war gepflegt, wenn auch eine Nuance zu lang.
Möglicherweise hatte ihn seine Frau heute darauf angesprochen. Doch Elisabeth vermutete eher nicht.
Der Mann wirkte, als ob seine Frau heute keine lichten Momente gehabt hatte und das schmerzte ihn.
Die zusammengesunkene Haltung, in der er gerade verharrte, könnte dazu passen.
Eine traurige Lebensgeschichte, fand Elisabeth.
Deswegen schaute sie sich weiter um, doch ehe sich eine nächste Lebensgeschichte aus dem Fantasienebel schälte, erkannte sie ihre Haltestelle. Der Zug ruckelte unangenehm beim Abbremsen. Elisabeth krallte sich am Haltegriff fest. Dann öffneten sich mit einem leisen Zischen die beiden Türen und sie hüpfte leichtfüßig hinaus. Noch ehe ihre Schuhe den Bahnsteig berührten, hatte sie die vermeintlich alleinerziehende Mutter und den vermeintlich einsamen Ehemann schon vergessen.
Ihre Gedanken sprangen von einer Sekunde auf die nächste in ihr heimeliges Zuhause, dass auf sie wartete.
Sie hatte noch einen etwa Fünf-Minütigen Fußmarsch vor sich, dann erschien das kleine Einfamilienhaus, dass sie früher zusammen mit ihren Adoptiveltern bewohnt hatte.
Seit dem Tod der beiden, wohnte sie alleine dort, obwohl es für eine Person viel zu groß war. Aber sie hatte es noch nicht übers Herz gebracht, über einen Verkauf nachzudenken. Selbst nach zehn Jahren wollte sich Elisabeth keine Gedanken darüber machen. Dies war ihr Elternhaus. Vera und Michael hatten dieses ehemals schmucklose Gebäude in ein warmes Heim verwandelt.
Ein Zuhause, dass sie mit Elisabeth geteilt hatten.
Hier hingen noch so viele Erinnerungen in der Luft (und auch in den Schränken). Erinnerungen, die für immer verloren wären, wenn sie das Haus zum Verkauf anböte.
Ohne zu zögern stieg Elisabeth die vier schattigen Steinstufen nach oben und sperrte die Haustür auf. Stille empfing sie. Stille und ein Flur, der seit fast zwanzig Jahren keiner Veränderung unterzogen worden war.
Elisabeth fand dies gut. Sie mochte keine Veränderungen.
Ihr war es am liebsten, wenn alles so blieb wie es war.
Gut, einige Dinge veränderte das Leben, beziehungsweise der Tod, doch die hautnahe Umgebung unterlag IHREM Zepter und deshalb ließ sie alles beim Alten. Gewohnheit gab Sicherheit und Elisabeth mochte Sicherheit. Auch der Ablauf ihres Heimkommens unterlag einer gewissen Gewohnheit. Sie zog ihre Jacke aus und hängte sie an die leicht altmodisch wirkende Garderobe, an denen auch noch eine Strickweste von Michael, ihrem Vater, hing.
Früher roch diese Weste immer nach seinem After Shave.
Old Spice. Doch die Jahre hatten diesen vertrauten Duft einfach absorbiert. Nun muffelte die Weste nach Staub und Wohnung. Dennoch blieb sie an ihrem Haken hängen. Das war ihr Platz. Früher wie heute. Elisabeths große Tasche wurde auf dem niedrigen Schuhschrank abgestellt. Dorthin, wo sie schon immer hingewandert war. Anschließend betrat sie die Küche.
Ein geschmackvoll eingerichteter Raum im Landhausstil.
Bäuerliche Utensilien, wie lasierte Steinkrüge mit Zwiebelornamenten und Strohblumen, unterstrichen dieses gemütliche Ambiente.
Genauso wie die blau-beigefarbenen Raffgardinen, die Elisabeth nun vorsichtig zur Seite schob um einen prüfenden Blick nach draußen zu werfen. Warum sie dies tat, wusste sie selbst nicht. Sie hatte dies schon immer getan. Anschließend trollte sie sich in den zweiten Stock.
Dort lag ihr ehemaliges Kinderzimmer, dass noch heute als ihr Schlafzimmer diente, obwohl Michaels und Veras Schlafzimmer um einiges größer geschnitten war. Doch deren Raum wurde von Elisabeth höchstens einmal im Monat betreten, nämlich dann, wenn sie staubwischte und staubsaugte.
Ansonsten war diese Reliquie aus vergangener Zeit tabu.
Zwischen dem verlassenen Elternschlafzimmer und ihrem Zimmer lag das Badezimmer. Eine kleine Wohlfühloase. Der einzige Raum in diesem Haus, der sich einer Umgestaltung hatte unterziehen müssen und das auch nur, weil das Waschbecken eines Morgens vor ungefähr sechs Jahren, einfach aus der Wand herausgebrochen war. Gut…vielleicht hätte Elisabeth nicht ihr ganzes Gewicht draufstützen sollen, als sie im Spiegelschrank nach der Zahnseide fischte, die ganz nach hinten gerutscht war. Plötzlich gab das Becken unter dem ungewohnten Gewicht nach und krachte laut scheppernd zu Boden. Die darunterliegenden Fliesen überlebten diese Attacke leider auch nicht. Deswegen hatte Elisabeth dies zum Anlass genommen, um ein paar Modernisierungsmaßnahmen ins Auge zu fassen und auch umzusetzen. Seitdem erstrahlte der Raum in einer eierschalenweißen Grundfarbe, gepaart mit einer anthrazitfarbenen begehbaren Duschecke und einem anthrazitfarbenen Boden. Augenschmeichelnde Farbtupfer bildete ein ausschweifender Farn unter dem Fenster, der dieses feuchtwarme Klima sichtlich genoss und Elisabeth mit einem üppigen Wuchs belohnte.
Handtücher in Grün und Beige komplettierten die Dekoration. Die Möbel stammten aus einer hübschen Bambus-Kollektion. Passend dazu sendete ein meditierender Stein-Buddha auf dem Fensterbrett sein Zen in diesen Raum. Elisabeth liebte ihr Badezimmer.
Doch in diesem Moment war nicht das hübsche Badezimmer ihr Ziel, sondern ihr eigenes Zimmer. Hier strippte sie sich aus den Straßenklamotten und schlüpfte in einen lindgrünen Nicki-Anzug, den sie aus ihrem gut organisierten Kleiderschrank herauszog. Dazu passend bekamen ihre Füße plüschige Pantoffel übergestreift. Dies war zwar ein äußerst legerer Aufzug, doch Elisabeth erwartete keinen Besuch und musste auch nicht mehr das Haus verlassen. Mit der getragenen Kleidung auf dem Arm, verließ sie ihr Schlafzimmer wieder und beförderte diese sofort in den Keller. Die kleine Waschküche empfing sie in einem penibel sauberen und aufgeräumten Zustand. Ebenfalls eine Marotte, die Elisabeth sich nach dem Tod ihrer Eltern angeeignet hatte. Alles in diesem Haus lag und stand an einem angestammten Platz. Dies half nicht nur bei der Suche, sondern gab Elisabeth ebenfalls Sicherheit. Dass es sich bereits um einen ausgewachsenen Fimmel handeln könnte, der eventuell Besuche bei einem Therapeuten sinnvoll machen würde, kam ihr gar nicht in den Sinn und auch keinem anderen, da ja selten jemand zu Besuch kam. Besucher brachten ihre kleine, häusliche Ordnung ins Ungleichgewicht.
Zumindest empfand Elisabeth dies unterschwellig so.
Dennoch fühlte sie sich selten so richtig einsam. Die gesellschaftliche Leere füllte Elisabeth in ihrem Arbeitszimmer einfach am Laptop aus. Ein wertvolles Utensil in ihrem Leben. Dort auf dem Desktop und auf diversen externen Speicherplatten tummelten sich eine Unmenge von Menschen. Fiktive Romangestalten, die Elisabeth ihr aufregendes Leben zur Verfügung stellten.
Aufregende Leben, konstruiert in Elisabeths Gehirn. Hier tobte sie sich gedanklich aus. Beim Schreiben ihre Romane war sie in der Lage, sich mental so in den jeweiligen Protagonisten zu versetzten, dass sie SEINE Abenteuer erlebte, SEINE Gefühle fühlte, mit SEINEN Freunden Zeit verbrachte, SEINE Feste feierte und Orte besuchte, die sie in ihrer realen Welt niemals zu Gesicht bekommen würde.
Eine fast perfekte Welt. Aber eben nur fast.
Nachts, wenn sie dann alleine in ihrem King-Size-Bett lag und sich schlaflos von einer Seite auf die andere rollte, da wäre ein echter Mensch an ihrer Seite doch schon angenehm. Aber Menschen waren unzuverlässig.
Menschen taten einem weh und enttäuschten. Menschen logen und betrogen. Und sollte man wirklich auf Menschen treffen, die einem wohlgesonnen waren, raffte der Tod ihn gnadenlos hinweg.
Die Romanfiguren jedoch enttäuschten Elisabeth niemals.
Hier fühlte sie sich IMMER willkommen und gut aufgehoben, zumal sie sich problemlos aus der Geschichte zurückziehen konnte, wenn sie das Gefühl hatte, es reichte. Außerdem war da noch ihre Meditationsgruppe, die ihr den Glauben verlieh, sich selbst genug zu sein. SIE selbst war die einzige Konstante in ihrem Leben und nur auf sich selbst konnte sie sich verlassen. Doch nichts von diesen Gedanken belastete Elisabeth im Augenblick. Sie trollte sich zurück in ihre heimelige Küche, schob sich ein schnelles Essen in die Mikrowelle (Brokkoli-Auflauf) und öffnete eine Flasche ihres Lieblingsweines.
Ein Kalifornischer Rosé, dessen liebliche Blume sie vor zwei Jahren zu einer ausgesprochenen Weinliebhaberin mutieren ließ. Zusammen mit einem Weinglas und der geöffneten Flasche schlurfte sie zurück ins Wohnzimmer.
Das angrenzende altmodische Eichenholz-Esszimmer ignorierte Elisabeth. Sie aß immer im Wohnzimmer, auf der XXL-Couch. Dort war es viel gemütlicher. Außerdem konnte sie dabei fernsehschauen. Im Hintergrund pinkte es leise. Das Signal, dass ihr Abendessen gar, beziehungsweise heiß war. Sofort eilte Elisabeth in die Küche, stürzte die undefinierbare Masse auf einen Teller und begab sich zurück ins Wohnzimmer. Hier schaltete sie die Glotze ein, füllte das Weinglas bis oben hin, schmiegte sich, mit dem Teller auf dem Schoss in die Ecke der großen Couch und begann zu essen. Allerdings schenkte sie ihrem Mahl keinen Blick, sonst wäre ihr wohl der Appetit vergangenen.
Auf dem Bildschirm flimmerte eine Doku, die möglicherweise sogar interessant wäre, wenn da nicht der heutige Tag in Elisabeths Kopf herumspuken würde. Ein eigenartiger Tag, den sie nun mit einem großen Schluck Wein Revue passieren ließ.
Was war da auf dem Friedhof passiert? Wieso hatte sie diese Vision gehabt, dass der steinerne Rache-Engel sie angreifen wollte? War es überhaupt ein Rache-Engel gewesen? Woher waren diese plötzlich auftauchenden fleischlichen Gelüste gekommen? Und wer war der Finder ihrer Handtasche gewesen? Aber vor allem, WOHER hatte er ihren Namen gewusst?
Fragen über Fragen, die Elisabeth nun zu analysieren versuchte. Während sie angestrengt grübelte, dabei blicklos den flackernden Bildern auf der Mattscheibe folgte, leerte sich nicht nur ihr Teller, sondern auch die Flasche Wein. Dies fiel ihr allerdings erst auf, als sie ihr Glas erneut füllte und bestürzt feststellte, dass es der letzte Tropfen war, den sie sich gerade ausgeschenkt hatte, „Na holla…die Flaschen werden aber auch immer kleiner!“ Natürlich wusste Elisabeth, dass sich der Inhalt der Weinflasche nicht geändert hatte, dennoch versuchte sie damit ihr erbostes Gewissen mit dieser klitzekleinen Lüge zu beschwichtigen.
Es gelang sogar…naja, halbwegs. Ihr Gewissen grunzte nur kurz und wand sich dann schmollend ab. Elisabeth war dies nur recht. So konnte sie ihre analytischen Gedanken ordnen und auch laut aussprechen, „Es ist vielleicht gar nicht so abwegig, dass mir meine Augen einen solchen Streich gespielt haben. Immerhin ist heute der Todestag von Vera und Michael. Das macht mich emotional angreifbar und wird dazu geführt haben, dass mein Gehirn einen Aussetzer hatte. Ich befinde mich schließlich den größten Teil meines Lebens in einer Fantasiewelt. Vielleicht hat es die belastende Realität und meine Trauer, damit kompensieren wollen? Na klar. Es kann nur so sein. Und das dämliche Kribbeln ist lediglich entstanden, weil ich mich schon lange nicht mehr beim Sex auspowern konnte. Eine rein chemische Reaktion von vernachlässigten und energieaufgeladenen Synapsen. Das heißt nicht, dass ich große Steinstatuen geil finde.“
Wie zur Bekräftigung ihrer Vermutung nickte Elisabeth und nahm noch einen Schluck, ehe sie ihre Analyse weiter in den leeren Raum warf, „Und der gutaussehende Mann hat natürlich in meine Handtasche geschaut. Das würde ich ja auch machen. Und in meinem Geldbeutel hat er dann den Ausweis gefunden. Dort hat er mein Bild gesehen und auch meinen Namen. Bestimmt hatte er eigentlich vorgehabt, die Tasche bei der Friedhofsverwaltung abzugeben. Nur durch Zufall war er dann quasi über mich gestolpert. Gott, und ich Idiot fange dann auch noch an zu heulen. Aber das waren nur die angespannten Nerven. DIE waren auch daran schuld, dass ich ihm sagte, ich würde aus Hunger heulen. Was für ein Käse. Der dachte bestimmt, ich hätte nicht mehr alle Latten am Zaun.
DESWEGEN war er auch so eilig verschwunden. Der arme Kerl ist lediglich vor mir geflüchtet.“
Diese Erkenntnis frustrierte Elisabeth. Warum konnte sie in solchen Ausnahmesituationen nicht gleich rationell denken? Warum immer erst Stunden später? Wütend kippte sie den Rest des Weines hinunter und spürte plötzlich eine bleierne Schwere hinter ihren Augenlidern.
Ups, der letzte Schluck war wohl schlecht gewesen.
Unsicher stemmte sie sich von der Couch hoch. Dabei kippte der benutzte Teller auf den dicken Teppich.
Elisabeth schenkte ihm einen mürrischen Blick. Doch sie ließ den kleinen Dreckspatz einfach liegen und wankte die Treppe nach oben, wo sie, ohne die Decke aufzuschlagen, einfach auf ihr Bett fiel und sofort einschlief…nichts ahnend, dass ihr Leben, so wie sie es kannte und gewohnt war, vorbei war.
Aber selbst WENN sie es gewusst hätte, würde sich nichts an dem weiteren Verlauf ihres Lebens ändern. Ihr Schicksal war zwar nicht in Stein gemeißelt, aber festgeschrieben.
In der Ferne schlug die Kirchturmuhr zehn Mal.
*
Der Tag danach fing wurde recht unspektakulär von ihrem Wecker eingeläutet. Pünktlich um sieben raffte sich das kleine Elektrogerät auf und fing pflichtbewusst an zu Piepsen. Wie jeden Morgen. Elisabeth räkelte sich erst einmal ausgiebig und gähnte dabei laut und ungeniert.
Dann warf sie dem leuchten Zifferblatt des Unruhestifters einen genervten Blick zu, „Ist ja schon gut! Ich bin wach, also reg dich ab!“ Zack!
Im nächsten Moment landete ihre Hand unsanft auf dem Knopf. Sofort verstummte das unangenehme rhythmische Piepsen und Elisabeth schnaufte erleichtert durch. Dann schälte sie sich aus dem Bett und strebte einen Tagesablauf an, der sich seit Jahren nicht verändert hatte und bei dem sie auch nicht vorhatte ihn einer Veränderung zu unterziehen. Ihr erster Gang führte auf die Toilette, dann ans Waschbecken wo sie sich nicht nur die Hände wusch, sondern auch ihren Zähnen eine gründliche Schrubb-Massage mit einer elektrischen Zahnbürste zuteilwerden ließ. Anschließend trippelte sie die Treppe nach unten, riss die Haustür auf und fummelte blind an der äußeren Hauswand entlang. So lange, bis sie die Zeitungsröhre fand und die darin steckende, zusammengerollte Tageszeitung herausziehen konnte. Natürlich könnte sie die neuesten Nachrichten auch online abrufen, doch dann würde ihr das Papierrascheln beim morgendlichen Kaffee fehlen. Noch während sie zurück in die Küche schlurfte, rollte sie die Zeitung auf und warf einen Blick auf die Schlagzeile, die ihr in fetten Lettern mitteilte: Bürgerkrieg in Italien!
Elisabeth rollte mit den Augen. Warum mussten negative Nachrichten immer auf der ersten Seite prangen? Konnte man den ahnungslosen Leser nicht erst mal mit etwas Positiven zum Weiterlesen motivieren? Hatte sie nicht Letztens eine Reportage über afrikanische Rancher gesehen, die mit selbstloser Hingabe und einem Hungerlohn die Tierreservate gegen Inverstorhaie verteidigten? Jene skrupellosen Menschen, die diese letzten Schutzgebiete plattmachen wollten, um die Erde noch mehr auszubeuten, als es sowieso schon in den letzten hundertfünfzig Jahren geschehen war? Warum gab es keine Schlagzeilen über DIE mutigen Menschen, die dies vehement verhinderten? Die ihr Leben dem Schutz der Natur verschrieben hatten? Oder Greenpeace?
Die schipperten zu Tausenden seit Jahren auf den Ozeanen umher und zogen gewaltige Filter hinter sich her um den ganzen Dreck aus dem Wasser zu holen, den der Mensch hineinkippte. DAS war doch mal eine Schlagzeile wert, oder nicht? Doch solche Nachrichten suchte man vergebens und wenn man sie dann doch fand, dann höchstens auf Seite sechs oder acht, in einer schmalen, unscheinbaren Randspalte. So etwas nervte Elisabeth tierisch. Frustriert warf sie die Zeitung auf den Küchentisch und bereitete sich dann ihr Frühstück zu.
Zwei Tassen Bohnenkaffee und zwei Scheiben Vollkornbrot mit Hüttenkäse und Erdbeermarmelade.
Dazu reichte sie sich selbst noch ein paar Scheiben Salatgurken. Nie gab es etwas anderes.
Während Elisabeth an ihrem Frühstück knabberte, vertiefte sie sich in die reißerische Lektüre der schriftlichen Medien. Zwei Namen sprangen ihr sofort ins Auge. Luigi Marchetti und Sergio Galli. Diese beiden Männer beherrschten in den letzten Wochen die Titelseiten und auch die Nachrichten. Der eine, weil er mit Hilfe des Meinungsfreien Militärs die Macht an sich reißen wollte und der andere, weil er dies zu verhindern versuchte. Allerdings unter der fragwürdigen Mithilfe der italienischen Unterwelt. Eine Organisation, die der früheren Mafia sehr ähnelte, in seiner Machart allerdings noch rabiater vorging. Also war es im Grunde genommen egal, für was man sich als unschuldiger Bürger entschied.
Beide Varianten waren gleichermaßen Kacke und würde dem Volk ein schweres Joch auf die gebeutelten Schultern legen. Aber der feine italienische Bürger stellte sich in den letzten Wochen auf die wackeligen Hinterfüße und wehrte sich. Nicht nur gegen EIN Monster, dass ihn aussaugen wollte, sondern gegen zwei.
Elisabeth konzentrierte sich nun auf das mitgelieferte Foto. Es war auf den ersten Blick nicht zu erkennen um was es sich handeln sollte, deswegen las sie den winzigen Untertext und erschrak. Die qualmenden Trümmer, die sie sich gerade betrachtete, waren die Überreste des Vatikans. Quasi die Heimat der katholischen Kirche. Nur war es nun keine Heimat mehr, sondern ein fürchterliches Schlachtfeld. Obwohl Elisabeth nicht tief religiös war, traf sie diese Nachricht wie ein Faustschlag in die Magengrube.
Diese Reaktion verwirrte sie schon ein bisschen, doch dann wurde ihr klar, warum sie so betroffen war. Die Zerstörung des Vatikans empfand sie als Angriff an den Glauben im Allgemeinen. Einen friedlichen Glauben, auf den, ihrer Meinung nach, jeder ein Anrecht hatte. Doch was war mit dem Papst, dem Oberhaupt der katholischen Kirche? Lebte er noch? Und die ganzen Kardinäle in ihren bestickten Roben? Lebten die noch? Und überhaupt…wurde nicht die Ur-Bibel im Vatikan aufbewahrt? Gab es überhaupt so etwas wie eine Ur-Bibel? Vielleicht hätte sie sich doch in früheren Tagen, in ihrer Jugend, etwas intensiver mit dem religiösen Glauben befassen sollen? Die letzte Frage ihres beunruhigten Gewissens ignorierte Elisabeth einfach. In ihrem Leben war noch nie Platz für Religion gewesen.
Früher war sie damit beschäftigt, einfach nur zu überleben und später hatte sie den Schwerpunkt ihres Lebens in ihre Romane gelegt. Trotzdem fand Elisabeth die Nachricht über die Zerstörung des Vatikans unvorstellbar grausam. Eilig schlug sie die Seite zwei und drei auf, in denen die ganze Brutalität in einzelne Scheibchen zerlegt worden war, um sie dem Leser häppchenweise zu servieren. Laut las sie sich selbst vor, „Marchetti-Anhänger und Galli-Befürworter rollten wie eine unaufhaltsame Lawine aufeinander zu. Dabei hinterließen sie eine Schneise der Verwüstung. Unzählige Autos wurden dabei in Brand gesetzt. Versprengte Mitläufer plünderten Geschäfte und zerstörten das verbleibende Inventar.
Verzweifelte Bürger bewaffneten sich mit herkömmlichen Gartengeräten wie Schaufeln, Äxten und Harken, um ihre Familien und ihr Hab und Gut zu beschützen. Die italienische Polizei konnte diesem Mopp, der sie von allen Seiten einkesselte kaum etwas entgegensetzen. Nach bisherigen Angaben starben bei diesem Aufeinandertreffen mehr als dreitausend Menschen. Die meisten Opfer befinden sich unter den Zivilisten. Eine Kirche, die viele in ihrer Verzweiflung offensichtlich als Zuflucht nutzten, wurde in Brand gesetzt. Alleine hier vermuten die Behörden hunderte Tote. Darunter möglicherweise viele Alte und unschuldige Kinder.
Bürgerkriegsähnliche Zustände, die das Einschreiten des Militärs von Nöten gemacht hätten. Jedoch trafen die schwerbewaffneten Truppen erst ein, als bereits der Vatikan gestürmt und mit Brandbomben attackiert wurde. Verängstigte Augenzeugen berichten von einer Art Hinrichtungswelle, der eine bisher noch unbekannte Anzahl an Kardinälen zum Opfer fielen. Ob hier die Marchettis oder die Gallis dafür verantwortlich sind, ist unklar. Einer nicht bestätigten Aussage zufolge sollen sich unter den Meuchelmördern jedoch auch uniformierte und vermummte Personen befunden haben. Rom scheint wie ein Startschuss zu einer unvorstellbaren Welle der Grausamkeit gewesen zu sein. Im ganzen Land bricht das Chaos aus. Innerhalb von wenigen Stunden wurde die Gerechtigkeit ausgehebelt. Tod und Zerstörung machen sich breit. Italien brennt. Die Menschlichkeit fand am gestrigen Tag ein jähes Ende.“
Langsam sackte die Zeitung auf den Küchentisch zurück. Dann ertönte ein lauter Schluchzer. Es dauerte ein paar Sekunden bis Elisabeth bewusst wurde, dass sie selbst so laut geschluchzt hatte. Mit zitternden Händen wischte sie sich eilig die laufenden Tränen von der Wange und erhob sich hölzern. Dabei streifte ihre Hüfte die aufgeschlagene Zeitung. Raschelnd fiel sie zu Boden. Elisabeth ließ sie einfach liegen. Ihre Gedanken verweilten in dem europäischen Stiefelstaat, der im Augenblick von einer brutalen Faust zusammengequetscht wurde und quasi am Ausbluten war.
Vor einem Jahr hatte es schon einmal solch ein furchtbares Massaker gegeben. Betroffen war damals Dubai. Die ehemals sprudelnde Ölquelle der Welt, neben Russland. Doch das Öl im Schoß der Mutter Natur war nicht unerschöpflich. Vor ein paar Jahren reduzierte sich schlagartig die abgezapfte Menge und die Preise schossen ins unermessliche. Öl war zu diesem Zeitpunkt fast wertvoller als Gold. Und obwohl es zwischenzeitlich viele bahnbrechende Erfindungen gab, die das Ausbeuten der Erde reduzierten, gab es noch immer Stellen an denen Öl gebraucht wurde. Die stark angestiegenen Preise verursachten beinahe einen Börsencrash und die Finanzwelt stand Kopf. Elisabeth erinnerte sich noch genau. Die Preise in den Läden explodierten und es wurde gehamstert bis das Portemonnaie qualmte. Ihr eigener Vorratsraum quoll heute noch über. Doch was dann geschah, damit hatte niemand gerechnet.
Eine Armee Rebellen, zusammengewürfelt aus vielen unterschiedlichen Nationalitäten hatten dieses kleine Land einfach überrannt und unzählige wohlhabende Scheiche mit ihren Familien auf grausamste Weise hingerichtet. Als der albtraumartige Spuk vorüber war, hinterließen die mordenden Schergen nur verbranntes Land, ein zerstörtes Burj al Arab, DAS weltweit luxuriöse Hotel und zehntausende verstümmelte Leichen. Elisabeth hatte damals den Bericht nicht weitergelesen und wusste bis heute nicht, ob man die Verantwortlichen hatte ausmachen und zur Rechenschaft hatte ziehen können.
Wie so oft, legte die Politik einen undurchdringlichen Schleier des Schweigens über diese Angelegenheit. Ja, genauso hatte man es genannt: eine Angelegenheit.
Auch damals war Elisabeth tief betroffen gewesen, doch heute fühlte sie zusätzlich zu dem Entsetzen auch Angst.
Angst, dass die Welle der Gewalt auch nach Deutschland schwappen könnte. Dubai war weit weg gewesen, doch Italien lag ja fast in der Nachbarschaft. Hier ging es zwar nicht um Öl aber um Geld. Geld und Macht, die das untergruben, was jedem Menschen eigentlich von Geburt an zustand: menschliches Recht. Dieses Recht wurde allerdings in vielen Ländern mit den Füssen getreten, so auch seit vielen Jahren in Italien. Das ehemals wunderschöne Italien, mit der traumhaften Toskana, wehrte sich nun. Ihre Eltern hatten früher alle zwei Jahre in Sizilien für drei Wochen geurlaubt und waren sonnengebräunt und zutiefst erholt zurückgekehrt.
Elisabeth hatte sie jedoch nie begleiten wollen.
Sie hatte nie das Bedürfnis gehabt, sich mit hunderten fremden Menschen in einen engen Flieger zu quetschen und stundenlang, tausende Meter über dem sicheren Erdboden, in der Luft herumzuschaukeln, nur um anschließend an einem feinkörnigen Sandstrand eine abgestandene kalte Cola zu schlürfen. Ihr dazugehöriges Credo lautete stets: Wenn Gott gewollt hätte, dass die Menschen fliegen, dann hätte er ihnen ein paar zusätzliche Flügel verpasst. DAS war Elisabeths Meinung! Aber vielleicht fehlte ihr auch einfach nur das Fernweh-Virus. Wie dem auch sei, Elisabeth war in ihrem ganzen Leben noch nicht verreist und an diesem jungfräulichen Reise-Zustand wollte sie auch in Zukunft nichts ändern.