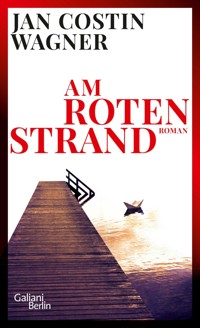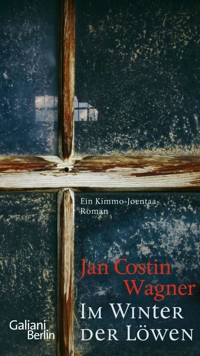19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Ben-Neven-Krimis
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Ben Neven, leitender Kriminalermittler, glücklich verheiratet, Familienvater, von Kolleginnen und Kollegen hochgeschätzt, ist einer von den Guten. Niemand weiß von seinem Doppelleben, niemand weiß, dass Neven einmal wöchentlich einen Parkplatz weit von zu Hause ansteuert. Um dort Adrian zu treffen, einen minderjährigen Jungen. Während der Sommer verblasst und der Herbst anbricht, verstrickt sich Neven immer tiefer und auswegloser im Dickicht seines ungeheuerlichen Doppellebens. Und Adrian lernt die gleichaltrige Vera kennen, die ihm ein ganz anderes Leben zeigt. Ein Leben, das er nicht kannte und das er vor seinem Vater, der ihn zur Prostitution zwingt, verbergen muss. Sowohl Ben als auch Adrian müssen radikale Entscheidungen treffen, um die unhaltbare Situation zu ändern. Doch jeder Schritt ist ein Schritt am Abgrund. Wenn Neven sich jemandem anvertraut, steht seine Existenz auf dem Spiel. Und Adrian müsste sich von seinen Wurzeln und seinem alten Leben komplett lossagen. Werden sie einen Ausweg finden? Und wenn ja, um welchen Preis? Eine fein austarierte, hochmoralische Meditation über Menschen am Abgrund, die uns nach dem letzten Satz sprachlos und doch mit geschärftem Blick zurücklässt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 204
Ähnliche
Jan Costin Wagner
Einer von den Guten
Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Inhaltsverzeichnis
Über Jan Costin Wagner
Über dieses Buch
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
Inhaltsverzeichnis
Motto
Eins
Zwei
Drei
Vier
Fünf
Sechs
Epilog
Dank von Herzen an
Inhaltsverzeichnis
»planned an escape
had to stay
in a place we used to know«
(heaven’s bay)
»whyever he came
nothing to lose, nothing to win
taking a photo of the lens«
(hitting the road)
Inhaltsverzeichnis
Eins
Während der Kriminalpolizist Ben Neven nach Dortmund fährt, um Böses zu tun, denkt er schon die Rückfahrt mit, setzt sie voraus, die Erschöpfung, die Müdigkeit, die Abwesenheit von Lust und dass alles so sein wird, als wäre es nicht wirklich passiert.
Weil es so sein wird, kann er sich jetzt auf die Lust konzentrieren, die gegenwärtig ist, aber nicht unerträglich. Sie wird auch nicht unerträglich werden, denn bald wird er sie abbauen, tilgen.
Er lässt das Radio laufen, ein Mann und eine Frau besprechen einen Krieg. Ben lauscht beiläufig den Worten, die gewechselt werden, und begreift erst nach einer Weile, dass die Frau Militärexpertin ist und der Mann Moderator. Vertauschte Rollen. Vorausgesetzt, man denkt konventionell. So wie er, Ben. Die Erkenntnis, dass es die Frau ist, die den Krieg erklärt, hat ihn überrascht. Zu konventionell gedacht, denkt er. Wieder mal. Zu einfach. Nichts ist einfach. Das Leben schon gar nicht. Sicher ist nur der Tod.
Was für ein Mist, denkt er. Seine Gedanken. Mist. Dreck. Und der Krieg.
Als er in der Ferne schon das Erlebnisbad aufragen sieht, knallblau, mit der riesigen Wasserrutsche, verliert er doch noch die Kontrolle über sich, nur kurz, nur für Sekunden. Er drischt, während der Fahrt, auf das Lenkrad ein. Er stößt einen Schrei aus. Wie Kriegsgeheul. Wie damals, als sie Indianer gegen Cowboys gespielt haben. Er hatte immer Angst, weil Schulfreunde aus der Nachbarschaft gesagt haben, sie hätten durchbohrte Waffen. Er hat nie verstanden, was das heißt. Aber es klang gefährlich. Er hatte nur diese kleine schwarze Spielzeugpistole. Aber die Freunde ja auch. Es war nur Gerede. Spurwechsel. Er fährt Schlangenlinien. Schreit einen Mann an, der im Fahrzeug neben ihm einen Finger an die Stirn legt.
»Du Sack!«, schreit Ben Neven, obwohl der Wagen auf der Nebenspur schon außer Sicht ist.
Ben ist rechts abgebogen, hat die Ausfahrt genommen, die zum Erlebnisbad und zu dem großen Parkplatz führt, auf dem er den Jungen finden wird. Er beruhigt sich. Spürt die kommenden Minuten voraus. Die kommende halbe Stunde.
Er folgt dem Weg, den die Wasserrutsche weist, sie ragt wie ein monumentales Bauwerk über ihm auf, wie ein Monster, ein Schlangenmonster. Ben hört das Lachen der Kinder, die da rutschen und springen und schwimmen, durch das geöffnete Beifahrerfenster. Wie jedes Mal, wenn er hier fährt, wenn er hier ankommt, denkt er an seine Tochter Marlene und an seine Frau Svea. Wie jedes Mal ist es ein Gedanke, der zugleich nah und fern ist. Wie jedes Mal stellt er sich vor, dass Marlene in die Rutsche hineinspringt, lachend, das Leben feiernd, das Leben liebend.
Marlene soll in Frieden aufwachsen. In Frieden leben. Nicht im Krieg. Sie soll glücklich sein. Für immer.
Er denkt an die Frau, die den Krieg erklärt hat. Im Radio läuft inzwischen seichte, austauschbare Musik. Ist der Krieg schon vorbei? Die Schlacht schon geschlagen. Der Tod schon gestorben.
Er, Ben, fühlt sich sehr lebendig. Hellwach. Der Tod kann warten. Und wenn er kommt, wird er ihn kaltmachen. Den Tod töten.
Jetzt erst mal leben.
Der Junge ist da, wartet auf der Schwelle zur Siedlung, neben dem grauen Basketballfeld, vor den Hochhäusern. Er trägt das blaue T-Shirt, das er meistens trägt. Die graue Jogginghose. Bens Blick streift die Uhr. Die unausgesprochene Vereinbarung gilt. Immer derselbe Tag, zur selben Zeit. Der Junge hat es verstanden, obwohl sie nicht darüber gesprochen haben. Sie sprechen wenig. Der Junge versteht kaum Deutsch. Das ist gut. Ben Neven möchte nicht sprechen. Der Junge hebt den Arm. Die Andeutung eines Winkens. Ein Lächeln huscht über Bens Gesicht.
Vielleicht ist er zu hart mit sich selbst. Der Junge ist einverstanden. Warum betrachtet er selbst es als böse? Er muss nochmal darüber nachdenken, später.
Er lässt den Wagen weiterrollen, rechts von ihm ist die Wasserrutsche, links von ihm kommt eine kleine Gruppe auf Fahrrädern auf ihn zu. Sie passieren ihn, fahren einfach an seinem dunkelblauen Dienstwagen vorbei, zwei Frauen, zwei Männer, drei Kinder. Vielleicht befreundete Familien. Nochmal einen Ausflug machen, schwimmen, Spaß haben, bald kommt der Herbst. Der Winter.
Ben stoppt den Wagen, lächelt, hofft, dass der Junge das Lächeln verstehen wird. Dass er es lesen kann. Alles soll im Einvernehmen passieren, im Einklang. Danach sind wir Freunde. Der Junge erwidert das Lächeln. Flüchtig, aber es war da. Alles ist gut, denkt Ben. Der Junge steigt ein. Lässt sich auf den Beifahrersitz gleiten, sein Blick streift das Geld, das in der Ablage liegt. Mehr Geld als sonst. Der Junge sieht ihn fragend an.
»Heute länger«, sagt Ben.
Der Junge runzelt die Stirn.
»Heute … länger …«, sagt Ben Neven. Es kommt leicht über die Lippen, leichter, als er dachte. So leicht, dass es der Junge verstehen wird. Oder?
Der Junge nickt.
»Du hast beim letzten Mal gesagt, dass es dann fünfzig Euro mehr wären, ja? Fifty and fifty. Hundert. Okay?«, sagt Ben.
Der Junge nickt.
Ben lächelt. Sie erreichen den Parkplatz am Wald. Etwa vierzig Meter entfernt steht ein anderes Auto, ein Pick-up.
Ben Neven fährt bis ans andere Ende des Parkplatzes, legt so viele Meter wie möglich zwischen sich und den Pick-up. Dann fährt er noch einige Meter weit in den Wald hinein, bis er sicher ist, dass sein Wagen vom Parkplatz und von der Straße aus nicht mehr zu sehen ist. Die Sonne bricht in schmalen hellorangen Streifen durch die Bäume. Der Junge streift seine Kleider ab, scheint seine Gedanken zu lesen. Er ist so schmal, dass er mühelos auf die Rückbank klettern kann.
Ben Neven steigt aus und wieder ein, sieht den Jungen auf der Rückbank liegen. Fantasie, die gleich Realität sein wird. Er sieht alles wie überbelichtet, gestochen scharf, während der Junge die Augen schließt.
Auf der Rückfahrt ist er erschöpft, müde, wie ausgehöhlt, entkernt, die Lust hat sich zurückgezogen. Es fühlt sich an, als wäre nichts passiert.
Oder?
Etwas ist heute anders. Was macht den Unterschied? Ein Blick des Jungen, der ihn gestreift hat?
Ben Neven ist sich nicht sicher. Der Gedanke, jemals wieder diesen Parkplatz neben dem Erlebnisbad anzusteuern, ist so weit weg wie nichts anderes in seinem Universum.
Er, Ben Neven, ist eine Insel. Auf dieser Insel befindet sich kein Parkplatz. Kein Erlebnisbad. Es ist eine karge Insel. Felsen, fein begrünt. Umschlossen von Wasser, vom Meer. Tosende Wellen. Aber abgedämpft, Ben hört nichts. Er ist taub. Taubstumm.
Der Gedanke zieht sich zurück, so wie sich die Lust zurückgezogen hat. Nein, das stimmt nicht, das trifft es nicht. Die Lust hat sich nicht zurückgezogen, sie ist abgestorben, im Bruchteil einer Sekunde. Leben, sterben, leben. Müde, erschöpft. Das ist alles wie immer. Wie in den vergangenen Wochen, als er hierherkam, um den Jungen zu treffen. Um die Lust auszuleben und abzutöten. Er ist müde, erschöpft, er ist wie betäubt, sediert. Watteweich, später Sommer, freie Fahrt, der Gedanke an einen langen Schlaf, bald.
Alles wie immer.
Aber eines ist anders heute. Jetzt, in diesem Moment.
Heute fühlt es sich zum ersten Mal nicht so an, als wäre nichts passiert.
Vor der Stadt fährt er ab, auf die Autobahnraststätte. Der weite Parkplatz ist kaum belegt, vereinzelte Fahrzeuge stehen unter der Abendsonne. Sein Kollege Christian Sandner hat eine Nachricht geschickt. Warum? Ben hat sich heute freigenommen. Ich kann tun und lassen, was ich will, denkt er. Was will Christian?
Wollte dich auf dem Laufenden halten. Wir haben einen 73-jährigen katholischen Pfarrer identifiziert. Er hat seit 1996 (oder früher) ihm anvertraute Jungen missbraucht. Er ist der Nutzer, der in den vergangenen Jahren sogar mehr Beiträge eingestellt hat als Holdner. Den wir unbedingt finden wollten. Wir haben ihn. Drei seiner Opfer haben heute eine erste Aussage gemacht. Es ist ein verdammter »Mann Gottes«! LG, Christian.
Ben liest die Nachricht dreimal durch. Pfarrer, 73, 1996, Jungen, ihm anvertraut, missbraucht, wir haben ihn. Ein verdammter Mann Gottes!
Er lehnt sich zurück. Schlafen, eine halbe Stunde, eine Stunde. Nichts spricht dagegen. Warum hat Christian ihm diese Nachricht geschickt? Es scheint ihm wichtig zu sein. Dass sie diesen Nutzer ermittelt haben, diesen Täter, diesen Mann, diesen Pfarrer. Ist das ein Sieg, ein Triumph? Es passt gar nicht zu Christian, dass er so aus sich herausgeht. Hat Christian ihm jemals eine Nachricht mit Ausrufezeichen geschrieben?
Ein Kalauer drängt sich auf.
Nicht jeder Priester ist ein Kinderschänder. Nicht jeder Polizist ist es nicht.
Ben Neven lacht. Ein Witz, den er vermutlich nur sich selbst erzählen wird. Obwohl. Vielleicht sollte er ihn bei Gelegenheit im Kolleginnen- und Kollegenkreis anbringen. Einfach so, beiläufig. Vermutlich würde er den einen oder anderen Lacher ernten. Den einen oder anderen fragenden Blick.
Er möchte nachhause fahren, aber die Zeit ist nicht reif. Er sollte erst zuhause ankommen, wenn Marlene und Svea schlafen. Marlene und Svea. Er denkt bewusst an sie. Denkt daran, dass er sie liebt. Er hält den Gedanken fest, tastet ihn ab, vergewissert sich, ist sich sicher.
Für eine Weile betrachtet er die Menschen, die in einiger Ferne ihre Wagen betanken, in der Raststätte verschwinden, wieder herauskommen. Manche essen Eis.
Ben weiß, dass er nicht er selbst ist. Dieser Mann, der im Wagen sitzt, in seinem Körper, ist ein anderer. Das ist nicht gut, nicht normal. Das darf nicht sein. Ben reißt keine Witze. Ben tut niemandem weh. Hat er dem Jungen wehgetan?
Er fragt sich, was der Junge macht. Vielleicht Fußball kicken auf dem Bolzplatz, neben dem grauen Basketballfeld, neben dem Erlebnisbad, im Schatten der Hochhäuser. Oder Eis essen, so wie die Leute, die aus der Raststätte herauskommen, schlendernd, für eine Weile nicht in Eile. Das muss der Spätsommer sein, er macht die Menschen träge, verlangsamt sie. Spätsommerabend. Aber die Zeit ist noch nicht reif, um nachhause zu fahren.
Er startet den Wagen, fährt, gefühlt einfach geradeaus, bis er endlich Landmanns Haus in der Ferne schon sehen kann, weit außerhalb der Stadt, wo es Wasser gibt, am blauen See, vor der Kulisse des Industrieparks am anderen Ufer.
Er lässt den Wagen ausrollen, denkt wieder an den Jungen. Der Gedanke verschmilzt mit der Erinnerung an das, was passiert ist. Heute ist da zum ersten Mal eine Erinnerung, eine, die sich aufdrängt, die Raum beansprucht, eine, die ihm in den Knochen hängt.
Mit der Erinnerung kehrt auch die Lust zurück. Für Momente stellt er sich vor, direkt zurück nach Dortmund zu fahren, kurz vor der Stadt abzubiegen, in den Vorort. Der Junge wird da sein, wird ihm entgegenkommen. Zögerlich. Fragend. Nochmal? Wieder wir beide, du und ich?
Ben fasst sich zwischen die Beine. Das ist gestört, das ist wahnsinnig. Er ist nicht er selbst. Er lacht, schon wieder, das Lachen eines Fremden, während er das vertraute Haus von Landmann betrachtet, dem einzigen Menschen, dem er am liebsten alles sagen würde. Alles, bis ins kleinste Detail. Sogar die Dinge, die er sich selbst noch verschweigt, möchte er Landmann offenbaren.
Nicht wirklich natürlich, nur in der Fantasie. Tatsächlich ist es undenkbar.
Er steigt aus, geht auf das Haus zu. Er klingelt, Landmann öffnet nicht. Ben weiß, warum, denn in aller Regel sitzt Landmann im Garten auf einem der weißen Gartenstühle am weißen Tisch, dann hört er das Klingeln nicht. Heute ist keine Ausnahme von der Regel, nicht in dieser Hinsicht, denkt Ben, während er ums Haus herum in den Garten läuft und Landmann schon am Tisch sitzen sieht, den Blick auf das stille Wasser des Sees gerichtet.
»Hallo, Ludwig«, ruft Ben.
»Ben, wie schön«, sagt Landmann.
Ben setzt sich auf den anderen Stuhl, der dort bereitsteht, so als hätte Landmann gewusst, dass er kommen würde. Was weiß Landmann? Diese Frage stellt sich Ben in jüngster Zeit häufiger. Eigentlich immer, wenn er bei ihm ist. Manchmal stellt Ben sich vor, dass Landmann ohnehin schon alles weiß. Dass es deshalb eigentlich ein Leichtes wäre, alles auszusprechen. Landmann würde nicken. Im stillen Einverständnis würden sie hier sitzen. Schweigen.
Was dann?
»Wie geht es dir?«, fragt Landmann.
»Das wollte ich eigentlich dich fragen«, sagt Ben.
Landmann lächelt. »Ganz gut«, sagt er.
Landmann, Bens langjähriger Vorgesetzter bei der Polizei in Wiesbaden, den Kollegen früher hochachtungsvoll den Mathematiker nannten, hat vor einiger Zeit seine Tochter Barbara verloren. Hat ihren Tod nicht kommen sehen, hat nicht gesehen, wie sie abgeglitten ist, wie sie sich entfernt hat. Vielleicht weiß er auch über Ben nicht das Geringste. Gar nichts. Ben lässt seinen Blick auf ihm ruhen. Gar nichts. Oder? Wenn niemand irgendwas weiß, ist es wie nicht vorhanden. Es existiert nicht.
Der einzige Mitwisser ist der Junge, und solange Ben das möchte, wird der Junge eine Fantasie bleiben, ein Schemen. Etwas, das es nur auf Bens Insel gibt, und nur dann, wenn Ben es will.
»Das freut mich«, sagt Ben.
»Wie ist es bei euch? Wie kommt die Ermittlung voran?«
»Gut«, sagt Ben. »Alles … klart sich auf. Also … alles wird langsam klarer, sichtbarer. Wir haben …«
Landmann wendet sich ihm zu. »Ja?«
»Wir haben Kinder aus schlimmen Situationen herauslösen können. Das Netzwerk ist komplett trockengelegt. Viele der Täter werden überführt werden, andere … werden sich sicher gut überlegen, ob sie nochmal … so ins Risiko gehen.«
Landmann nickt.
»Heute wurde ein Mann ermittelt, der die meisten Beiträge auf der Plattform verantwortet«, sagt Ben. »Offenbar. Es ist verwirrend, der Mann ist 73 Jahre alt. Und vermutlich jahrzehntelang nicht gestoppt worden. Anscheinend weiß er, wie Computer funktionieren, und hatte einen Mitteilungsdrang, der ihm jetzt zum Verhängnis wird. Ein ehemaliger katholischer Pfarrer.«
Landmann schweigt.
»Die Bilder, die er eingestellt hat, haben keine Anmutung an eine Kirche oder Ähnliches. Offenbar hat er Kinder vorwiegend im häuslichen Umfeld missbraucht.«
»73 Jahre alt. Jahrzehntelang nicht gestoppt worden. Ich frage mich, was ich eigentlich gemacht habe, als ich noch Polizist war«, sagt Landmann.
»Vermutlich war das früher ein riesiges Dunkelfeld«, sagt Ben. »Bei diesen Delikten hat erst die Verlagerung ins Digitale breitflächige Ermittlungen möglich gemacht. Und die bleiben schwierig genug.«
Bei diesen Delikten …, denkt Ben.
»Trotzdem. Je mehr du mir von diesem Fall berichtest, desto mehr frage ich mich, warum das alles zu meiner Zeit nicht greifbar wurde«, sagt Landmann.
»Hm«, sagt Ben. Nicht greifbar. Dabei sitzt er, Ben, nur eine Armlänge entfernt.
»Wie geht es Marlene und Svea?«, fragt Landmann.
»Gut«, sagt Ben. »Svea fliegt viel, hat aber gerade ein paar Tage Pause. Sie ist inzwischen Purserette, also … sie leitet die Flugbegleiterinnen an. Für Marlene hat gerade die Schule wieder begonnen. Die Sommerferien sind zu Ende.«
»Und?«, fragt Landmann.
»Hm?«
»Mag sie die Schule?«
»Ach so. Ja, doch, sie geht gerne hin. Hat alle ihre Freundinnen in der Klasse und eine nette Klassenlehrerin.«
»Das ist schön«, sagt Landmann.
Vielleicht ist es so, denkt Ben plötzlich: Frauen erklären den Krieg, Männer führen ihn. Nein. Auch das zu konventionell, zu einfach. Nichts ist einfach. Sicher nur der Tod. Zum Beispiel der von Barbara, Landmanns Tochter. Suizid. Obwohl ihr Vater sie geliebt hat.
»Worüber denkst du nach?«, fragt Landmann.
Ben wendet sich ihm zu.
»In letzter Zeit frage ich mich manchmal, worüber du nachdenkst«, sagt Landmann. »Du wirkst verändert.«
»Ja?«
»Vielleicht hat es mit dieser Ermittlung zu tun. Das hast du selbst mal angedeutet.«
»Ja. Möglich. Tatsächlich denke ich viel darüber nach«, sagt Ben.
Landmann schweigt. Ben spürt, dass sein Blick auf ihm ruht.
»Aber da ist noch was anderes«, sagt Landmann.
Ben wartet.
»Mit dir und Svea alles in Ordnung?«
Es ist ungewöhnlich, dass Landmann diese Frage stellt. Landmann nimmt immer Anteil, aber er ist auch sehr diskret, behutsam.
»Ja, alles gut«, sagt Ben.
Ben denkt an den Jungen. Den nackten Jungen. Auch Ben war behutsam. Hat ihn behutsam geführt. Er verspürt keinen Schmerz. Dann kann auch der Junge keine Schmerzen haben. Oder?
»Ben«, sagt Landmann.
Ben hebt den Blick. Landmann lächelt.
»Ich mache uns eine Flasche Weißwein auf«, sagt Landmann. »Schön, dass du vorbeigekommen bist.«
Später, nach einem Glas Wein, fährt Ben Neven nachhause. Nach seiner Ankunft bleibt er im Wagen sitzen. Betrachtet das Haus. Er sieht Sveas Silhouette in der Küche. Marlene wird vermutlich schon schlafen. Weil die Schule wieder angefangen hat. Sein Blick streift die Uhr, kurz vor elf.
Er steigt aus, läuft. Fischt den Schlüssel aus der Jackentasche.
Dann steht er im Flur. Hat er die Tür so leise geöffnet, dass Svea nichts gehört hat?
»Hallo? Jemand da?«, sagt er leise. Die Worte kommen als schiefer Singsang über seine Lippen. Er hat Svea nicht gesagt, dass er heute freigenommen hat. Hat einfach Pause gemacht, ohne es an die große Glocke zu hängen.
»Hey, da bist du ja«, sagt Svea, sie lächelt müde. »Ich wollte gleich schlafen gehen.«
»Okay.«
»Wie war dein Tag?«
»Na ja, wir kommen voran«, sagt er.
»Gut«, sagt Svea. »Gut, wenn ihr das alles aufklärt.«
»Ja«, sagt Ben.
»Marlene hat Hausaufgaben gemacht und schläft. Langsam kommt sie aus dem Ferienmodus raus. Morgen schreiben sie Mathe.«
»Ja?«
»Ja, hat mich auch gewundert. Die Schule hat ja gerade erst wieder begonnen. Das ist so ein Leistungstest. Weil der Lehrer prüfen will, wie weit sie sind. Weil die Klasse neu zusammengestellt wurde.«
»Okay«, sagt Ben. »Ich war noch auf einen Sprung bei Landmann.«
»Schön, wie geht es ihm?«
»Ganz gut. Ja, doch, er wirkte … ganz gut.«
»Ich denke oft an die Sache mit seiner Tochter«, sagt Svea.
Die Sache, denkt Ben. Es ist schwer in Worte zu fassen. Manche Dinge sind schwer in Worte zu fassen. Er nickt.
»Ich gehe gleich nochmal runter und sortiere ein paar Unterlagen«, sagt er.
»Mach das«, sagt sie.
»Papa«, sagt Marlene. Er wendet sich um, sieht Marlene auf der Treppe stehen, im Pyjama.
»Doch noch wach?«, sagt er lachend.
»Ja, weil ich in den Ferien immer so lange auf war. Aber jetzt kann ich schlafen, glaube ich.«
»Gut«, sagt er.
Svea lächelt. Sie hat denselben Subtext gehört wie er. Marlene kann schlafen, weil Papa endlich da ist. Alles gut. Die Welt in Ordnung.
»Bis morgen«, sagt Marlene. Ohne einen Hauch von Zweifel daran, dass der Morgen kommen wird.
»Bis morgen, mein Schatz«, sagt Ben.
Am Morgen danach fühlt sich Adrian besser. Wieder mehr bei sich, mehr so, als wäre er wirklich da.
Gestern, als der Mann in seinem dunkelblauen Schlitten angekommen ist, und auch, nachdem er weggefahren war, hat er alles so gemacht wie immer. Ist seinem Ritual gefolgt, das darin besteht, die Welt wie einen Ort zu betrachten, den es nicht gibt, und sich selbst wie eine Person, die einfach nur Stoff ist. Materie. Das hat sein Freund Eugen mal gesagt. Er weiß nicht mehr genau, in welchem Zusammenhang, aber es klang gut.
Alles sei nur Materie. Alles sei nur Zeug.
Eugen ist für eine Weile abgereist, in irgendeine andere Stadt in Deutschland, deshalb ist Adrian im Moment allein, wenn die Männer kommen. Manche kommen wöchentlich, andere auch nur alle zwei oder drei Wochen. Einer kommt alle drei Tage. Der von gestern kommt seit einiger Zeit wöchentlich. Immer zur selben Zeit, am selben Tag. Kein böser Mann, eher unsicher. Adrian hat das Gefühl, erwachsener zu sein als dieser Mann. Würden sie dieselbe Sprache sprechen, könnte er ihm vielleicht ein paar Dinge erklären. Ein paar Dinge über das Leben.
Adrian frühstückt, Cornflakes mit Milch und diesen bunten Zuckerstreuseln, davon wirft er heute besonders viel in die kleine Schüssel. Eugen ist weg, aber Lucian, Adrians Vater, und dessen komischer Freund, Marian, sind noch da. Sie sitzen unten vor dem Haus, auf einer Bank vor der Trinkhalle, und spielen saufend Karten. Adrian hat sie gesehen, hat gleich nach dem Aufstehen nachgeschaut, ob er eine Weile für sich haben wird, und sein Herz hat einen Sprung gemacht, als er gesehen hat, dass es so sein wird. Vielleicht sogar eine längere Weile, denn wenn sein Vater und Marian vor der Trinkhalle saufend Karten spielen, kann das dauern.
Manchmal fragt sich Adrian, ob Lucian wirklich sein Vater ist oder irgendwas anderes. Irgendwer. Irgendein Fremder.
Adrian hat ihm gestern nur die fünfzig Euro gegeben, die mit dem Mann im dunkelblauen Schlitten abgesprochen waren. Die anderen fünfzig, die der Mann noch draufgelegt hat, hat er behalten. Spontan, einem Impuls folgend. Bevor er wusste, was passiert, war das Geld noch da, in seiner Hosentasche.
Es ist schön, allein in der Wohnung zu sein. Er stellt sich vor, dass die anderen einfach weg sind, Lucian und Marian vor der Trinkhalle, für immer Karten spielend. Und Eugen, in einer anderen Stadt, irgendwas Schönes machend. Fitness. Das hat Eugen ihm gesagt. Wenn er könnte, würde er in einem Fitnessstudio arbeiten und den Leuten erklären, wie die Geräte funktionieren. Da Eugen erst zwölf ist, wird das noch eine Weile warten müssen, aber irgendwann, in zehn Jahren oder so … Warum nicht?
Eugens Stiefvater hat in Rumänien drei Fitnessstudios, eines davon ist in der kleinen Stadt, in der sie gelebt haben. Ziemlich runtergekommen, diese Studios, aber die Geräte sind nagelneu, wie auch das Haus von Eugens Stiefvater nagelneu ist. Eine echte Villa, eine Art Schloss, mit Türmen und so, mitten in dieser von Schlaglöchern durchzogenen Straße, in der sonst nur Bruchbuden und Baracken stehen, unter anderem die, in der Adrians Familie lebt.
Eugens Stiefvater ist inzwischen so eine Art König in diesem kleinen schwarzen Dorf, das im Herbst immer geflutet wird, weil bei jedem Regen der Fluss über die Ufer tritt und keine Feuerwehr oder sonst irgendwas kommt, um zu helfen. Karg der Sommer, matschig der Herbst, eiskalt der Winter. Adrian ist fast froh, jetzt nicht dort sein zu müssen. Eugens Stiefvater ist der König, und es ist, als wären alle anderen Untergebene, sogar sein Vater Lucian. Jedes Mal, wenn Adrian mit seinem Vater bei Eugens Stiefvater war, hat sein Vater einen Buckel gemacht. Wie ein Mädchen, hat Adrian gedacht, als würde er gleich einen Knicks machen.
Durch das Fenster fällt das Sonnenlicht herein. Adrian isst seine Cornflakes, dann geht er raus. Es gelingt ihm, an Lucian und Marian vorbeizukommen. Ist auch nicht so schwer. Die beiden sitzen wie Statuen vor der Trinkhalle, wie erstarrt im Spiel, schwitzend, als würde die viel zu heiße Sonne sie bald zum Schmelzen bringen.
Adrian hätte nichts dagegen, nicht das Geringste.
Er hat ein paar Sachen zusammengepackt, läuft zum Schwimmbad. Heute zieht er es durch. Heute wird er auf der Wiese direkt neben der Wasserrutsche liegen, allein.
Vor einer Weile ist er mal hier gewesen, mit Eugen und seinem Vater und Marian. Er hatte das Gefühl, dass das so eine Art Fest sein sollte, eine Art Belohnung für gute Umsätze oder so, die beiden Erwachsenen haben sich aufgespielt, als wären sie Kumpel, nette Leute, bis sein Vater dann Eugen eine schallende Ohrfeige verpasst hat, nur weil der sein Mango-Eis hat fallen lassen. Und als Adrian für einen Moment dachte, er selbst würde jetzt dazwischengehen, würde seinen Vater konfrontieren, würde die Worte sagen, die ihm noch nie über die Lippen gekommen sind, hat sein Vater ihn angesehen wie ein Mörder. Ein Killer. Und Adrian hat geschwiegen und darüber nachgedacht, dass sein eigener Vater, Lucian, ihn umbringen würde, einfach so, sollte es nötig erscheinen, sollte es Sinn ergeben.
Aber es ergibt keinen Sinn. Glücklicherweise. Nicht, solange Adrian das Geld bringt, das sein Vater angeblich zu Nadja, seiner Mutter, nach Rumänien schickt. Adrian hat eher den Eindruck, dass er den größten Teil davon versäuft und an Automaten verspielt. Aber das kann täuschen. Vielleicht reicht es für beides. Manchmal arbeitet sein Vater auch, auf dem Bau oder auf den Feldern. Eine Woche arbeiten, eine Woche saufen. Adrian fragt sich, ob seine Mutter, Nadja, eigentlich noch schwanger ist. Oder ist das Baby schon da? Lucian hat nichts erwähnt. Würde er es erwähnen? Keine Ahnung, denkt Adrian.
Auch seine Mutter ist eine Fremde geworden. Sie hat neben ihm gestanden, als er in dem kleinen Feuerwehrauto im Karussell gesessen hat, bei dem Jahrmarkt, im Sommer irgendwann. Da war Adrian noch klein. Vielleicht fünf. Seitdem ist sie immer trauriger geworden und am Ende fremd.
Wenn sie mit seinem Vater telefoniert, bittet sie ihn manchmal, das Handy an Adrian weiterzureichen. Dann hört er ihre Stimme. Sie fragt, wie es ihm geht.
»Gut«, sagt Adrian.
»Schön«, sagt sie.
Beim nächsten Mal muss er sie fragen, ob das Baby schon da ist. Er war so in Gedanken versunken, jetzt ist er fast schon an der Kasse. Er ahnt den prüfenden Blick der Frau voraus, die hinter dem Glas sitzt. Nestelt an seiner Hose, fischt den Fünfzig-Euro-Schein heraus.