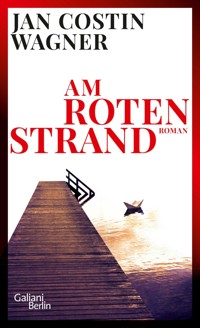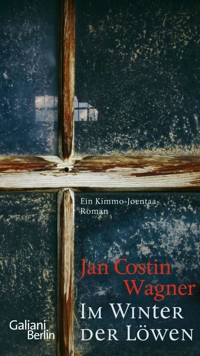9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
"Ein exzellenter Krimi aus der Sicht eines eiskalten Täters erzählt." Stern Mark Cramer ist schlichtweg anders. Denn Mark Cramer ist jenseits von Gefühl und Moral. Und Mark Cramer geht kalten Blutes immer aufs Ganze. Im Spielcasino bleibt er ungerührt, wenn der Rest des Saales ob seiner Einsätze atemlos auf den Lauf der Kugel starrt - und man ahnt, daß es nichts Gutes verheißt, als er im französischen Ferienparadies Cap Ferret über die Schwelle der Villa des in die Jahre gekommenen Schauspielerstars Fraikin tritt, dessen Biographie er schreiben soll ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 268
Ähnliche
Jan Costin Wagner
Nachtfahrt
Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Inhaltsverzeichnis
Über Jan Costin Wagner
Über dieses Buch
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Motto
Erster Tag
1. Kapitel
2. Kapitel
Zweiter Tag
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
Dritter Tag
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
Vierter Tag
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
Fünfter Tag
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
Sechster Tag
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
Siebter Tag
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
Inhaltsverzeichnis
Für Niina
Inhaltsverzeichnis
»… und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser …«
Inhaltsverzeichnis
Erster Tag
1
Mittags komme ich an am Ende der Welt.
Ich miete mich ein in einem Hotel, sehe durch das Fenster meines Zimmers einen dunkelblauen Streifen des Ozeans hinter der goldenen Sanddüne, auf der Urlauber einen Ball hin und her werfen.
Ich lege mich auf das schmale Bett, schließe die Augen und amüsiere mich mit dem Gedanken, Fraikin warten zu lassen, Fraikin, der mich erwartet mit wachsender Ungeduld, um mir seine Geschichten zu erzählen, endlich wieder einer, der sich dafür interessiert, interessieren muss, endlich einer, der an seinen Lippen hängen wird, ja, noch eine Anekdote und noch eine von den vielen, die Fraikin zu erzählen hat. Fraikin, der plant, die Nachwelt mit seinem ereignisreichen Leben zu langweilen.
So stelle ich mir Fraikin vor, den ich nicht kenne, Fraikin, der mich beauftragt hat, seine Biografie zu schreiben.
Ich muss wohl eine Weile eingenickt sein, denn als ich die Augen öffne, schwitze ich, das T-Shirt, die Hose kleben an der Haut. Ich bleibe so liegen ein, zwei Minuten, gestatte meinem Zustand, sich weiter zu verschlechtern, wieder der Schüttelfrost, dann richte ich mich ruckartig auf, zerre die Kleider von meinem Körper, werfe sie in die nächste Ecke, schalte die Dusche an und lasse lauwarmes Wasser an mir herunterlaufen.
Ich gehe hinaus, ein Hitzeschauer, als ich auf die Straße trete, mein Gesicht, mein Nacken brennt schon. Mein erster Eindruck von Cap Ferret: kleines Dorf am Meer, überall schneeweiße Ferienbungalows mit sonnigen Namen, gut gelaunte, braun gebrannte Urlauber.
Ich laufe auf der Avenue de l’Ocean in Richtung der Sanddüne, auf der sich vor einer Weile Urlauber einen Ball zugeworfen haben (vielleicht sind es auch Einheimische gewesen), aber die sind schon gegangen, ins Hotel, hinunter an den Strand, zum Essen, wohin auch immer. Ein schmaler Steg führt mich hinauf auf den höchsten Punkt der Düne, der Wind bläst mir ins Gesicht, keine hundert Meter entfernt begraben die Wellen des Meeres Schwimmer und Surfer, die gleich wieder auftauchen, lachend, Strichmännchen im Atlantik.
Ich gehe langsam weiter, die Düne hinab, entledige mich der Turnschuhe, der Sand brennt, angenehm.
Ich stehe am Rand des Wassers, die Wellen schlagen sanft gegen meine Beine, dieselben Wellen, die wenige Meter weiter lachende Schwimmer durch die Luft wirbeln. Ein Gedanke aus Kinderzeiten kommt mir, loszuschwimmen Richtung Horizont, nachzuprüfen, was dahinter ist, oder ob es sich tatsächlich um das Ende der Welt handelt.
Ich stehe frontal gegen den Wind, spüre das kalte Wasser an meinen Oberschenkeln und denke, dass ich Geschichten schreiben könnte über die Tankstellenkassiererin mit den starren Augen, leer, blau, die an mir vorbeisah, als ich ihr den 200-Francs-Schein reichte zwischen Orléans und Bordeaux.
Oder über den Fahrer des weißen PKW, deutsches Kennzeichen, der schlief, tief, träumte, auf dem Fahrersitz, im trüben Schein der Parkplatzlampe. Den ich aus seinem Fahrzeug hätte locken und erdrosseln können, nachts um drei Uhr, wenn ich nicht selber müde gewesen wäre und eine kurze Pause benötigt hätte. Den ich hätte ermorden können, ohne jemals zur Rechenschaft gezogen zu werden.
Ich schenkte ihm das Leben. Ich frage mich, wohin er fuhr.
Ich werde keine Geschichten schreiben, wahrscheinlich.
Ich spüre das Wasser an den Oberschenkeln, sehe die weite Fläche des Meeres und denke an Fraikin, den ich nicht kenne und der glaubt, dass ich darauf brenne, seine Biografie zu schreiben. Und ich denke an Röder, ganz kurz. Röder, der lächeln und mir auf die Schulter klopfen würde, Röder, der sagen würde: Ein Anfang, mein Lieber, Fraikin war mal ein Großer, vergiss das nicht.
Aber Röder ist weit weg.
Der Wind treibt mir eine Träne ins Auge, die an meiner rechten Backe herunterläuft und klebt.
2
Den Abend verbringe ich im Hotel, weil ich weiß, dass Fraikin auf mich wartet und möglicherweise seinen Unmut an seiner Ehefrau auslässt, die ich nicht kenne, die er aber erwähnte in jenem Telefongespräch, das wir führten, kurz bevor ich mich ins Auto setzte und losfuhr.
Ich sitze im Speisesaal des Hotels, der gedämpft beleuchtet ist. Draußen hat es zu regnen begonnen, man kann kaum hinausschauen durch die Scheiben, ich frage mich, wo die Hitze geblieben ist, die den Sand unter meinen Füßen brennen ließ, kaum zwei Stunden ist das her.
Ich lasse mir Fleisch, Kartoffeln und Wein schmecken, plaudere mit der für meinen Tisch zuständigen Hoteldame, die immer nur lacht, egal, was ich sage, sogar wenn ich schweige. Das Hotel ist spärlich belegt, im hintersten Winkel speist ein Ehepaar, Engländer, wenn ich die Wortfetzen richtig verstanden habe, am Nebentisch sitzt ein Mann meines Alters, vielleicht etwas älter. Ich schätze ihn auf Mitte dreißig, werde ihn bei Gelegenheit fragen, obwohl es mich nicht interessiert.
Während die Bedienung mir den Nachtisch reicht, kommt noch einer, einer mit langen weißen Haaren, tiefen Furchen im Gesicht, der Mann ist sechzig und fühlt sich wie dreißig, denke ich unwillkürlich, nein, will sich wie dreißig fühlen, ein vorschnelles, ungerechtes Urteil, aber ich bin es gewohnt, vorschnell zu urteilen, hastig endgültige Bilder zu entwerfen. Ich liebe es, Charaktere einfach aus der Luft zu greifen, hier ein schmales Gesicht, dort ein harter Zug um den Mund, so machte ich das in meinen kleinen Geschichten (Röder gefiel das alles sehr gut, damals).
Der Weißhaarige lächelt, die Augen leuchten, die Dame an der Rezeption macht ein schiefes, amüsiertes Gesicht in seine Richtung, ein Gesicht, das missbilligend und wohlwollend zugleich ist und das er nicht sehen kann, weil er ihr den Rücken zukehrt. Er ist ganz Dynamik und Unternehmungslust und kommt auf meinen Tisch zu, ich weiß nicht, warum.
Sein Name sei Fignon, Bernhard Fignon, sagt er, er habe schon gehört, dass ich aus Deutschland komme, er spreche sehr gerne Deutsch, habe mal in Nürnberg gelebt, na ja, das sei lange her, aber gelernt ist gelernt, drückt meine Hand, klopft mir auf die Schulter.
Guten Abend, sage ich.
Ich müsse ihn heute Abend ins Casino begleiten, unbedingt, er werde jetzt essen, gegen 22 Uhr möchte er losfahren, Richtung Bordeaux, er wäre sonst alleine gefahren, ja, er mache keinen Hehl daraus, er sei ein Spieler, ein Trinker, ein Wahnsinniger, wenn ich so wolle, aber wir werden viel Spaß haben, verspricht er.
Wunderbar, sage ich, zehn Uhr. Warum soll ich nicht ins Casino gehen. Es spielt ohnehin keine Rolle, was ich tue, wichtig ist nur, Fraikin warten zu lassen, der in seinem Ferienhaus sitzt und möglicherweise seine Frau beschimpft, weil ich nicht komme.
Ich gehe hinauf in mein Zimmer, ziehe meinen schwarzen Anzug an und verbringe die Zeit, die noch totgeschlagen werden muss, auf meinem Bett, dahindämmernd. Mein Zimmer ist alles in allem braun und weiß, braun die Fliesen am Boden, weiß der Kleiderschrank an der Wand, braun der Holztisch, weiß die Tapete, braun das Bett, weiß das Laken, braun die Tagesdecke, weiß das Waschbecken, braun der Duschvorhang, weiß die Zimmerdecke, die ich anstarre für eine ganze Weile, bis ich auf die Idee komme, dass es möglicherweise bald zehn Uhr ist und ich in der Halle erscheinen muss, um mit Bernhard Fignon ins Casino zu fahren. Ich suche nach meiner Uhr, die ich verlegt habe. Sie findet sich schließlich in meiner Jackentasche, ich weiß nicht, wie sie dahin kam, es ist 21.43 Uhr.
Ich nehme mein Geld, alles, was ich habe, und gehe hinunter, vorzeitig, finde Fignon bereits wartend vor, glühend vor Ungeduld. Er plaudert mit der Rezeptionsdame, redet gestikulierend auf sie ein, und sie lächelt nur und nickt. Dann sieht er mich, stößt einen lang gezogenen Ausruf der Begeisterung und Erleichterung aus und kommt auf mich zu. »Da sind Sie ja, mein Freund. Kommen Sie, wir fahren.«
Ich bin derjenige, der fährt, Fignon sitzt breit auf dem Beifahrersitz und lobt mein Fahrzeug, er selbst besitzt leider nur einen Kleinwagen, mit dem er angereist ist aus Paris, wo er lebt und irgendein Handwerk betreibt, ich verstehe nicht genau, welches. Ich stelle das Radio lauter, um Fignon das Reden zu erschweren, aber Fignon redet weiter, ist nicht zu bremsen, schreit auch, wenn es sein muss.
Ich konzentriere mich auf die Straße, fahre absichtlich mit hoher Geschwindigkeit in die kleinen Kreisel, aber das stört Fignon nicht, er scheint es gar nicht zu bemerken. Einmal verliere ich um ein Haar die Kontrolle über den Wagen, die Reifen quietschen, wir enden fast im Straßengraben, und Fignon sagt nur: »Das war knapp.«
Ich lache mit kurzen Pausen für den Rest der Fahrt, die noch etwa zwanzig Minuten dauert, ich lache, Fignon redet, ich fahre 170 Stundenkilometer auf der Landstraße, die Musik ist so laut, Fignon redet und redet … Als wir im Parkhaus unter dem Casino zum Stillstand kommen, stehen mir die Tränen in den Augen, Lachtränen natürlich, die kleben auch, ich habe mich amüsiert.
Im Casino berührt mich sofort das feierliche Stimmengewirr, dazwischen die strengen Ansagen der Croupiers, das alles hören wir schon, als wir die weinroten Stufen der Treppe hinaufsteigen, die in goldenem Licht liegt. Wir betreten das Casino durch eine breite Flügeltür, Fignon hüpft hin und her beim Anblick der Spieltische, er hat mir schon im Auto versichert, dass er ein sehr gutes Gefühl habe, er werde gewinnen heute und »dann, mein Freund, machen wir kräftig einen drauf«.
Ich achte nicht weiter auf Fignon, lasse ihn mit seiner Begeisterung alleine und schlendere an den Tischen entlang, beobachte die Gesichter, die unbeteiligten der Croupiers, die fiebrig-erhitzten der bedauernswerten Menschen, die ihre Hoffnung auf eine kleine Kugel und eine Zahl setzen.
Ich könnte Geschichten schreiben über die junge Frau mit den gelben Zähnen, die aus dem Kichern nicht herauskommt und ständig versucht, sich unauffällig in den Besitz fremder Gewinne zu bringen. Über den fetten Mann im gelben Anzug, der glaubt, ihm gehöre die Welt, weil er mit 100-Francs-Chips um sich werfen kann.
Ich werde es nicht tun, wahrscheinlich.
Irgendwann verliere ich die Lust am Herumstehen, am unbeteiligten Zusehen und gehe, um mein Geld, alles, was ich habe, in Chips umzutauschen, kleine Chips aus Plastik, die man eigentlich in den nächsten Müllkorb werfen könnte, wenn nicht eine Zahl darauf stünde, die ihren Wert anzeigt.
Ich bitte den jungen Mann hinter dem Wechselschalter, mir Tausenderchips zu geben und lege ihm 35.900 Francs hin, alles, was mir der Bankbeamte gab, als ich mein Konto leerte in Deutschland, kurz bevor ich losfuhr. Alles, abgesehen von den 74 Francs in meiner Hosentasche, die reichen nicht, um das Hotel zu bezahlen.
Den jungen Mann, so scheint es, trifft fast der Schlag, sogar der Fette im gelben Anzug ist so weit nicht gegangen. Ich lächle, fühle mich gut, während der Mann mir ungeschickt die Chips zuschiebt, ein Tausender fällt auf den Boden. Ich verzichte darauf, ihn aufzuheben.
Ich gehe mit meinem ganzen Reichtum zum Tisch, an dem der fette Gelbe sitzt, direkt neben dem Croupier, dem er dann und wann mit Gönnerblick ein Trinkgeld zukommen lässt. Fignon, der beim Black Jack steht, auf- und abhüpfend, erhitzt grinsend, sieht mich von Weitem, winkt mir zu, registriert mit dem geübten Blick für das Sensationelle die Geldmenge in meinen Händen und rennt in meine Richtung, mit weit aufgerissenem Mund. »Was machen Sie da, mein Freund, das sind ja Tausender, um Gottes willen!«
Ich lächle nur, stelle mich neben den fetten Gelben, warte, bis die Kugel eine Zahl findet. Der Gelbe gewinnt und wirft dem Croupier einen Hunderter zu.
Ich errege einiges Aufsehen, eine alte Frau in geschmacklosem Kostüm kreischt, als ich 30.000 Francs, den Höchsteinsatz, auf die Zahlen Vier bis Sechs lege, warum ich diese Zahlen wähle, weiß ich nicht, ich verbinde nichts mit ihnen, sie sagen mir nichts. Dem fetten Gelben fallen fast die Augen aus dem Kopf, er läuft rot an, die junge Frau, die an seiner Schulter hing, lässt ihn los. Der Croupier, ebenfalls etwas irritiert, wirft die Kugel, Fignon schreit entsetzt, das könne ich nicht machen, was sei denn in mich gefahren. »Ich bitte Sie, zumindest eine Drittelchance müssen Sie wahrnehmen bei diesem Einsatz, mein Freund!« Das alles ist sogar Fignon, dem Verrückten, zu viel. Er macht Anstalten, die Chips zu verrücken, schaut mich an wie ein Hund, der seinen Herrn vor einer Dummheit bewahren will. Ich tue ihm den Gefallen, schiebe meinen Einsatz in das Drittel der Zahlen Eins bis Zwölf, kurz bevor der Croupier »Rien ne va plus« verkündet und die Kugel langsam ausrollt.
Ich schaue gar nicht hin, es interessiert mich nicht, wie die Zahl lautet, es interessiert mich wirklich nicht (und diese Erkenntnis versetzt mir einen Magenstoß, ich spüre Brechreiz für einen Moment), dann grölt Fignon, der fette Gelbe sitzt zerschlagen auf seinem Stuhl (obwohl er einige Hundert Francs gewonnen hat), ein erregtes Raunen geht um den ganzen Tisch, von anderen Tischen kommen Neugierige. Die junge Frau an der Schulter des Fetten schaut mich an, mit großen Augen, und Fignon grölt noch immer: »Gewonnen, gewonnen, gewonnen!«
Gewonnen, tatsächlich, die Kugel blieb in der Sieben liegen, der Croupier schiebt 90.000 Francs in meine Richtung, und ich muss wieder lachen, wie im Auto, als Fignon redete, die Musik dröhnte und wir fast im Straßengraben gelandet wären.
Fignon verliert völlig die Kontrolle, seine Pupillen weiten sich vor Erregung, das hellblaue Hemd klebt an seinem stark behaarten Bauch, man kann den Nabel durchschimmern sehen. »Gewonnen, gewonnen«, schreit er immer wieder, und sein Gesicht verzerrt sich, ein Schleier legt sich über seine Augen, er droht ohnmächtig zu werden, als ich ihm Plastikchips im Wert von 10.000 Francs in die Hände lege, zum Zeichen meiner Dankbarkeit, den Gewinn habe ich schließlich ihm zu verdanken.
»Aber nein, mein Freund, das ist Ihr Geld, aber nein, aber nein«, stammelt er glückstrahlend, will gar nicht mehr aufhören, und er hätte wohl auch nicht mehr aufgehört, wenn ich nicht die verbliebenen 80.000 Francs zurückgeschoben hätte auf den Spieltisch, was ihn endlich veranlasst, den Mund zu halten, denn dazu fällt ihm gar nichts mehr ein.
Der ganze Saal hallt wider vom kollektiven Stöhnen der Spielbankbesucher, die sich längst alle um unseren Tisch versammelt haben, an den anderen Tischen wird nicht mehr gespielt, die Menschen stehen um mich herum, verfolgen jede meiner Bewegungen, wittern das Außerordentliche, das Unglaubliche, als ich die Plastikchips zurückschiebe auf das Spielfeld. 30.000 setze ich auf das Drittel Eins bis Zwölf, 30.000 auf Rot, 20.000 auf die ungeraden Zahlen.
Ansonsten liegt nichts auf dem Tisch, so fixiert sind die anderen auf mich, so stark das Verlangen mitzuerleben, wie ich mich ins Unglück stürze, dass sie gar nicht auf die Idee kommen, selbst einen Einsatz zu machen. Es ist also mein Spiel, denke ich, für mich wirft der Croupier die Kugel, der Croupier, der blass geworden ist und in alle Richtungen schaut, wahrscheinlich in der Hoffnung, seinen Vorgesetzten zu entdecken und ihm mit einem sprechenden Blick klarzumachen, dass er unschuldig ist, ganz und gar unschuldig an dem unvorhergesehenen Zwischenfall.
Es ist mein Spiel, auf dem Tisch liegt alles, was ich habe, meine materielle Existenz, begafft vom fetten Gelben, von der jungen Frau mit den großen Augen, von der kreischenden Alten im rosa Kostüm, von denen, die mich verlieren sehen, stürzen sehen wollen, von denen, die mich, gestützt vom treuen Fignon, hinausgehen sehen wollen. Ich muss wieder lachen, dieses Lachen beunruhigt mich selbst, es kommt unvermittelt, wühlt sich nach oben und verlässt als heiseres Quäken meinen Rachen, die Leute starren mich an, als sei ich von allen guten Geistern verlassen, und der Croupier wirft die Kugel, endlich.
Ich horche wieder in mich hinein, spüre wieder kein Verlangen hinzusehen, während die Kugel rollt und ihre Entscheidung fällt über den weiteren Verbleib meiner Plastikchips. Ich lache immer noch, die Leute wissen nicht, sollen sie mich anstarren oder die Kugel, die gerade ausrollt, noch ein paar Bögen schlägt, da und dort aneckt und schließlich liegen bleibt, ich weiß nicht, wo.
Fignon gibt mir diesmal keinen Hinweis, kein Ausruf der Begeisterung, aber auch keiner des Bedauerns, ihm stockt einfach der Atem. Um mich herum wird gemurmelt, erst zaghaft, dann lauter, während ich Richtung Boden schaue, ein Tränennetz bedeckt meine Augen, mir ist schwindlig, und dann höre ich den schrillen Schrei, das ist Fignon, der sich nicht mehr halten kann, der seinen Siegesschrei lang und länger zieht.
Gewonnen, tatsächlich, alle drei Einsätze, es ist nicht zu glauben, aber wahr, die Kugel fiel in die rote Neun, richtige Farbe, richtiges Drittel, ungerade. Für einen Moment schwankt der Boden unter meinen Füßen und ich neige dazu, alles für nicht real zu halten, angefangen bei meiner Abfahrt von Röders Wochenendhaus bis zum schrillen Siegesschrei Fignons, aber es stimmt alles. Der Croupier, Haltung wahrend, schiebt mir meinen Gewinn entgegen, 90.000 Francs für das Drittel, 60.000 Francs für die Farbe, 40.000 Francs für die Ungeraden, 190.000 Francs, schade, dass ich 10.000 Francs an Fignon verschenkt habe, es wäre eine runde Zahl gewesen.
Ich packe Fignon bei der Hand und gehe zielstrebig zum Wechselschalter, die Leute sehen hinterher, ich bin die Sensation des Abends. Der Mann an der Geldausgabe ist perplex und bespricht sich kurz mit einem eleganten Herrn, der schließlich zustimmend nickt.
Fignon, als wir ins kalte dunkelgraue Parkhaus kommen, späht nach rechts und links, mahnt zur Vorsicht, als lauere hinter jeder Ecke ein Raubmörder. Bereits oben im Foyer hat er mir den abwegigen Rat gegeben, mein Geld im Schuh zu verstecken, so wie er es macht mit seinen 10.000 Francs, für die er sich alle zwei Sekunden bedankt.
Es erscheint niemand, wir steigen unbehelligt in den Wagen und fahren durch die menschenleere Stadt Richtung Landstraße. Ich fahre ganz langsam, bin müde, sehr müde, während Fignon wieder ins Reden gerät, auch er muss sich erst sammeln, so etwas, versichert er mir, hat er noch nicht erlebt, so etwas nicht.
Fignon will noch ein Fläschchen aufmachen im Hotel, möchte feiern, beteuert, dass man jetzt unmöglich schlafen könne, er erzählt die ganze verrückte Geschichte der Rezeptionsdame, fischt zum Beweis sogar seine 10.000 Francs aus den Schuhen. Die Rezeptionsdame, die eigentlich schlafen gehen wollte, ist plötzlich hellwach, möchte nicht glauben, dass ich wirklich 190.000 Francs in meiner Jackentasche herumtrage, ich habe den Eindruck, sie möchte mir am liebsten an die Wäsche gehen.
Ich lasse die beiden stehen, gehe die Treppe hinauf, Fignon macht einen letzten Versuch, mich zurückzuhalten, dann lässt er mich ziehen, wirft mir Kusshände hinterher und plaudert schon wieder mit der Hotelangestellten.
Mein Zimmer ist kühl und dunkel, ich schalte nur die Nachttischlampe an, ziehe meine Schuhe aus, dann den Anzug, die Krawatte, das Hemd. Ich wasche meine Hände, bespritze mein Gesicht mit Wasser, nehme das Jackett meines Anzuges, das über dem Stuhl hängt und ziehe das Geld heraus, werfe es auf den Holztisch, einige Scheine sind bereits eingerissen.
Es ist bald halb zwei, ich gehe zum Fenster, öffne es. Hinter der Sanddüne, die im Dunkel liegt, sehe ich den schmalen Streifen des Ozeans, auf den das rote Licht des Leuchtturmes fällt, in regelmäßigen Abständen.
Inhaltsverzeichnis
Zweiter Tag
1
Ich werde geweckt von einer Hotelangestellten, die erst an meine Tür klopft, dann die Klinke herunterdrückt, die Tür aufschließt und das Zimmer betritt, offensichtlich in dem Glauben, es sei leer. Ich muss abgeschlossen haben, bevor ich mich schlafen legte, ich kann mich nicht daran erinnern.
Das Zimmermädchen stößt einen leisen Schrei aus, stammelt, sie habe nicht gewusst, dass ich da sei, sie werde später wiederkommen. Ich rufe ihr nach, sie solle bleiben, das sei kein Problem. Sie kommt zaghaft zurück und beginnt mit ihrer Arbeit, während ich mich im Bett aufrichte, meinen freien Oberkörper präsentiere und auf ihre Reaktion warte. Sie sieht angestrengt an mir vorbei.
Stattdessen fällt ihr Blick auf das Geld, das auf dem Holztisch liegt, sie ist so entsetzt, dass sie doch einen Blick auf mich wagt. Ich lächle und sage leichthin, dass ich gewonnen habe, gestern, im Casino.
Sie ist hübsch, schlank, Anfang zwanzig, mir gefallen ihre schmalen dunklen Augen, deren Wirkung sie mit schwarzem Schminkstift zu steigern hofft, am Morgen, vor dem Spiegel in ihrem Badezimmer, wo immer das ist. Obwohl sie weiß, dass sie nur zur Arbeit geht.
Ich begreife nicht, wie ich darauf komme, aber ich höre mich plötzlich Englisch sprechen und Deutsch, ich möchte sie testen und stelle fest, dass sie kein Wort versteht, sie lächelt nur und macht eine abwehrende Handbewegung.
Mir wird heiß, ich fühle wieder dieses Lachen aufsteigen, Schüttelfrost, dann kommen die Worte aus meinem Mund, einfach so, ohne mein Zutun. »Möchtest du mit mir schlafen?«, und sie lächelt nur, versteht nichts. »Möchtest du? Komm doch her zu mir, komm, I want you, now, come to me!« Ich sage das mit einem netten, liebenswürdigen Lächeln, ganz unverbindlich, vermutlich denkt sie, ich rede vom Wetter und hält mich für einen Trottel, weil ich nicht verstehen will, dass sie kein Englisch spricht und kein Deutsch. Jedenfalls lächelt sie nur und zieht den Staubsauger hinter sich her.
2
Nach dem Frühstück erkundige ich mich bei der Rezeptionsdame nach Fraikin, ob sie ihn kenne, ob sie wisse, wo sich sein Ferienhaus befinde. Natürlich kennt sie ihn, wer kennt den nicht, den deutschen Schauspieler meine ich, nicht wahr, ja, ja, den kennt sie, der verkehrt sogar des Öfteren hier im Hotel und unterhält die Gäste, erzählt Geschichten aus seinem Leben. Sein Wohnhaus ist nur ein paar Schritte entfernt, in der Avenue de l’Atlantique, einmal rechts, einmal links, es ist ein sehr schönes Haus.
Ob sie denn mal einen Film mit ihm gesehen hat, frage ich boshaft, ich schätze sie auf Ende zwanzig, zu jung für Filme mit Carl Fraikin. Sie muss tatsächlich verneinen, es scheint ihr peinlich zu sein, »aber ich weiß, dass er Schauspieler ist«, sagt sie, als wolle sie sich rechtfertigen. Natürlich weißt du das, denke ich, wer weiß das nicht, Fraikin wird nicht versäumen, es jedem zu erzählen, der ihm über den Weg läuft.
»Er spricht immer von seinen Filmen«, fügt sie hinzu, er könne sehr spannend erzählen, alle seien immer ganz hingerissen von seinen Geschichten.
Sie fragt, woher ich ihn denn kenne, ob ich ein Bekannter von ihm sei. Ich könnte sagen, ich sei ebenfalls Schauspieler, sie würde sicherlich ein Autogramm verlangen, aber ich bleibe bei der Wahrheit und sage, dass ich sein Biograf bin, ich werde ein Buch über ihn schreiben. Auch das beeindruckt sie, sie fragt, welcher seiner Filme mir denn am besten gefalle und ich antworte wahrheitsgemäß, dass ich seine Filme nicht kenne. Die junge Frau ist ganz erschüttert, einer, der ein Buch über Fraikin schreibt, sollte doch wohl seine Filme kennen. Ich zucke mit den Achseln, lächle freundlich und um Nachsicht bittend und verabschiede mich.
Sie sieht mir irritiert hinterher, vermute ich.
Es dauert eine ganze Weile, bis ich das Haus des Schauspielers finde, so einfach, wie die Rezeptionsdame gemeint hat, ist es nicht, eine Straße gleicht der anderen, überall die weißen Bungalows mit den sonnigen Namen, Haus Sonnenschein,Haus Meerblick. Überall das Rauschen der Wellen im Hintergrund, überall Hitze.
Ich finde das Haus schließlich, mithilfe eines Einheimischen, der sein Fahrrad repariert. Er hat einen beängstigenden Sonnenbrand, die Haut vom Nacken bis zur Badehose ist dunkelrot, sein faltiges Gesicht ebenso. Er scheint das gar nicht zu registrieren. Natürlich weiß er, wo Fraikin wohnt, die nächste rechts, dann links und wieder links, dann stünde ich direkt davor.
Ich danke und folge seinen Anweisungen, dieses Mal mit Erfolg, am Briefkasten steht unübersehbar, in großen weißen Buchstaben: Carl Fraikin. Und seinem Haus hat er einen ganz sinnigen Namen gegeben: Zur hohen Kunst,das steht in blumigen grünen und blauen Buchstaben über dem Eingangstor, das nicht verschlossen ist. Im Haus zur hohen Kunst sind alle willkommen.
Fraikin hat allerdings auch alle Zeit der Welt, sich zu entscheiden, ob ein Besucher gelegen oder ungelegen kommt, denn wer nach oben gelangen möchte, zur Eingangstür des kleinen Ferienschlösschens, muss Treppenstufen steigen, ich zähle sie, während ich bergauf gehe. Ich habe das Gefühl, dass ich dabei beobachtet werde, und Fraikin, wenn er wollte, könnte mich beizeiten hinabstoßen, aber ich bin gekommen, um seine Biografie zu schreiben, ein sehr gerne gesehener Gast also.
Während ich nach oben wandere, betrachte ich das beeindruckende Anwesen. Hinter den hohen Glastüren, die zur Terrasse hinausführen, mag sich das Wohnzimmer befinden, ich kann nicht hineinschauen, bin noch zu weit weg, außerdem scheint die Sonne darauf. Überall hängen Pflanzen und Blumen, rot, gelb, violett, ein braungebrannter Gärtner macht sich daran zu schaffen, der muss kürzlich auch den Rasen gemäht haben, der ist saftig grün und kurz geschoren. Links und rechts ragen Türme in die Höhe, die das Haus einem Schloss ähnlich machen.
Am Rand des Gartens liegt ein Schwimmbad, ich höre Schläge im Wasser, jemand schwimmt da. Fraikin ist es nicht, denn Fraikin kommt mir entgegen, noch bevor ich die Haustür erreicht habe, er spricht mich schon an, aber ich höre nicht zu, weil ich mich auf das Zählen der Stufen konzentriere, dreiundsechzig, vierundsechzig, fünfundsechzig, das wäre geklärt. Ich hebe den Kopf, sehe in das faltige, dunkelbraune Gesicht eines 70-Jährigen und sage: »Herr Fraikin, nehme ich an.«
»Ganz recht«, sagt Fraikin. »Und der Teufel soll mich holen, wenn Sie nicht Mark Cramer sind, ich freue mich.«
Er schüttelt mir die Hand, während ich mich frage, warum ihn der Teufel holen sollte, wenn ich nicht Cramer wäre. Ich muss seine rhetorische Frage im Übrigen gar nicht beantworten, es ist entschieden, dass ich Cramer bin, leugnen ist zwecklos, selbst wenn ich es nicht wäre.
Fraikin geht voran, wir betreten das Haus über die Terrasse, dahinter befindet sich tatsächlich das Wohnzimmer, ein riesiger Raum, zwei braune Sessel, ein braunes Sofa, ein silberner Kronleuchter an der Decke, das ist ein Stilbruch, was macht das schon.
Es ist angenehm kühl im Innern des Hauses, ich bemerke erst jetzt, wie stark ich geschwitzt habe. Fraikin bittet mich, Platz zu nehmen, ich lasse mich fallen, klebe sofort fest an dem glatten, bereits angeschwitzten Bezug des Sessels.
»Schatz, unser Gast ist angekommen«, ruft Fraikin plötzlich und mir ist, als glänzten seine Augen, es muss mit seiner Gattin zusammenhängen.
Während wir auf die Ankunft seiner Frau warten und er ohne echtes Interesse nach dem Verlauf meiner Reise fragt, betrachte ich ihn näher, er ist klein, das habe ich gesehen, als ich ihm gefolgt bin Richtung Terrasse, er hat graue Haare, die ihm allmählich abhandenkommen, aber sie sind geschickt nach vorne gekämmt. Seine Augen sind blau, davon hatte ich schon gehört, damit konnte er beeindrucken, damals. Auf mich wirken sie nicht, es ist ein trübes, leeres Blau. Sie glänzten nur ganz kurz, als er nach seiner Frau rief. In seinen Mundwinkeln hängt ein Lächeln, das abrufbar ist und nie ganz verschwindet.
Er hat die notwendigen Fragen mit seiner sonoren Stimme abgespult, ich habe die gewünschten einsilbigen Antworten gegeben. Seine Stimme ist beeindruckend, das muss ich zugeben, sie ist warm, tief, der ganze Raum scheint mitzuklingen, wenn er spricht. Die Stimme passt nicht zu den Falten im Gesicht.
Er bietet mir ein Getränk an, besser, er drängt es mir auf, eine Kreation seiner Frau, sagt er, Orange, Birne, Pfirsich und irgendein Schnaps. Er schüttet das Ganze aus einer Karaffe in ein kunstvoll geschwungenes Glas mit goldenem Rand. Ich nippe daran und sage »nicht übel, ja«, obwohl es nicht schmeckt.
»Ja, das ist ein Getränk für die ganz heißen Abende, wenn die Sinne sich selbstständig machen, wir lieben es, meine Frau und ich«, sagt er und lacht, ein lüsternes, gewolltes Lachen, das nicht zu der sonoren Stimme passt. Ich schaue auf mein Glas, etwas irritiert von der erotischen Anspielung des 70-Jährigen und frage mich allmählich, was er die ganze Zeit mit seiner Frau hat, da erscheint sie im Türrahmen. Ich muss gestehen, mir bleibt der Atem stehen für einen Moment, und mit Mühe gelingt es mir, mich nicht zu verschlucken.
Ich hätte es mir denken können, natürlich.
»Darf ich vorstellen, meine Frau Sarah«, sagt Fraikin, der sofort aufgesprungen ist und schon neben ihr steht. Er streckt den Arm nach ihr aus, sieht dabei mich an, ja, er präsentiert sie mir wie ein Moderator, der einen Interpreten ansagt, er präsentiert mir sein Eigentum, auf das er stolz ist, zu Recht.
Sarah Fraikin trägt einen schwarzen Badeanzug, der nass ist und an ihrer sonnengebräunten Haut klebt. Sie hat rote, lockige Haare, die ihr auf den Rücken fallen. Sie ist schlank, einen Kopf größer als ihr Mann und mit Sicherheit noch keine dreißig. Sie ist zu jung, um seine Tochter zu sein, denke ich und grinse, ein der Situation ganz unangemessenes Grinsen, diesen Eindruck zumindest hat Sarah. »Sie lächeln?«, sagt sie, ironisch, aber verunsichert.
Ich richte mich abrupt auf und gehe auf sie zu. »Ich lächle«, sage ich, »weil ich mich freue, Sie kennenzulernen.« Das ist keine originelle Erwiderung, aber sie gefällt ihr, sie gibt mir die Hand und ich werfe einen Seitenblick auf Fraikin, dessen Augen glänzen, leer sind sie trotzdem.
Wir setzen uns wieder, Fraikin und Gattin auf das Sofa, sie legt den Kopf an seinen Nacken. Ich sitze wieder im selben Sessel, klebe wieder fest, und während Fraikin mir lang und breit erklärt, wieso er sich entschlossen hat, seine Biografie zu schreiben (schreiben zu lassen, müsste er sagen, aber das tut er nicht), während Fraikin also eine erste Kostprobe seiner sonoren Geschwätzigkeit abliefert, fresse ich seine Gattin mit gierigen Blicken. Fraikin muss blind sein, dass er es nicht bemerkt, fast ärgert mich das.
Sarah bemerkt es natürlich und ihre Verunsicherung wächst, nach einer Weile verschwindet sie unter dem Vorwand, sich anziehen zu müssen (warum eigentlich?). »Geh nur, Schatz, geh nur«, sagt Fraikin, er hat sie mir ja jetzt präsentiert, ich weiß jetzt ja, was ihm da ins Netz gegangen ist, ich glaube, Fraikin ist dumm genug, sich für einen attraktiven Mann zu halten, er scheint einen gesichtsglättenden Zerrspiegel zu haben in seinem Badezimmer.
Irgendwann kommt Fraikin auf Röder zu sprechen, er verlasse sich ganz auf seinen alten Freund Jakob Röder, der mich empfohlen hat, und er ist sicher, dass ich ihn nicht enttäuschen werde. »Wenn ich mich recht erinnere«, sagt er und legt das Gesicht in Falten, »wenn ich mich recht erinnere, betonte Jakob, dass er Ihnen keineswegs aufgrund Ihrer Verwandtschaft einen Bonus einräume. Er bezeichnete Sie als sehr talentiert, eine Aussage, die dem guten Jakob nicht leicht über die Lippen kommt, glauben Sie mir.«
»Ich weiß«, sage ich.
»Wenn ich mich recht entsinne«, fährt er fort, legt wieder die faltige Stirn in Falten, »haben Sie bereits eine Kurzgeschichtensammlung veröffentlicht und vor allem die Biografie von Strassner, zu der ich Ihnen nur gratulieren kann. Ich habe sie gelesen, wollte ja wissen, mit wem ich es zu tun habe, Jakobs hohe Meinung in allen Ehren, Sie verstehen, diese Biografie ist hervorragend.«
»Danke«, sage ich.
Die Biografie des Skirennfahrers Bernd Strassner schrieb ich vor drei Jahren. Mein Name taucht nur einmal auf in dem Buch, ganz klein, Bernd Strassner lautet der Autorenname auf dem Einband, obwohl Bernd Strassner kein Wort selbst geschrieben hat und dazu auch nicht in der Lage gewesen wäre. Das Buch ist natürlich nicht hervorragend, wie Fraikin glaubt, es ist miserabel, die Lebensgeschichte eines unerheblichen Menschen, der sich für wichtig hält, weil er auf Brettern einen Schneeberg hinunterfahren kann.
»Im Moment, wie ich hörte, arbeiten Sie an einem großen Projekt«, sagt er.
Ich nicke.
»Ein Roman, wie Jakob mir sagte?«
»Ja«, sage ich.
»Sie arbeiten daran bereits seit einigen Jahren?«
»Seit zwei Jahren«, bestätige ich.
»Und, wenn ich Jakob recht verstanden habe, steht die Fertigstellung kurz bevor.«
»Der Roman ist abgeschlossen.«