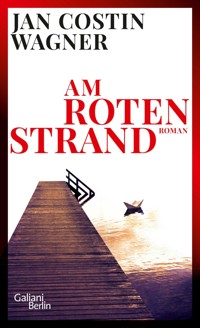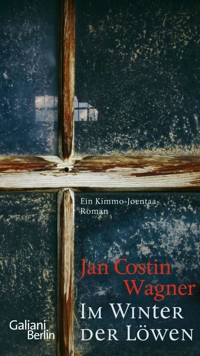9,99 €
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Kimmo-Joentaa-Roman
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Die Macht des Todes – die Kraft des Lebens. Auf dem Marktplatz der finnischen Stadt Turku steigt ein junger Mann in einen Brunnen. Er ist nackt und offenbar verwirrt. Und er hat ein Messer bei sich.Im Nachhinein kann sich niemand so recht erklären, warum einer der herbeigeeilten Polizisten ihn erschossen hat – vor allem nicht der Schütze selbst. Er versucht, mehr über den jungen Menschen zu erfahren, dem er das Leben genommen hat, und wendet sich hilfesuchend an seinen Kollegen Kimmo Joentaa. Kimmo, inzwischen selbst alleinerziehender Vater einer Tochter, sucht die Eltern des Toten auf – und stößt auf Spuren einer Katastrophe, die nicht nur das Leben des Jungen aus dem Brunnen, sondern das zweier Familien tragisch und tiefgreifend verändert hat. Kimmo Joentaa beginnt, die losen Fäden zu verknüpfen. Und er begreift, dass diese Ermittlung ihn vor allem mit der Frage konfrontiert, woran Menschen sich in unserer Welt festhalten können, wenn schlimmste Befürchtungen wahr werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 237
Ähnliche
Jan Costin Wagner
Sakari lernt, durch Wände zu gehen
Ein Kimmo-Joentaa-Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Inhaltsverzeichnis
Über Jan Costin Wagner
Über dieses Buch
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Die Fee des frühen Morgens
Sakari
Petri
Sakari
Petri
Sakari
Petri
Sakari
Petri
Sakari
Zwei Zentimeter Mond
Kimmo
Petri
Kimmo
Petri
Kimmo
David
Petri
Kimmo
Petri
David
Leena
Kimmo
Petri
Sanna
Kimmo
David
Stefan
David
Kimmo
Das ganze Leben
Sanna
David
Petri
Leena
Kimmo
Petri
Kimmo
Leena
Petri
Kimmo
Leena
Alles, was anders ist als erwartet
Kimmo
David
Kimmo
Sakari
Stefan
Kimmo
Sanna
Kimmo
Stefan
Kimmo
Stefan
Sakari
Petri
Stefan
Leena
Kimmo
Stefan
Emma
Der Moment, in dem sie wieder auftaucht
Aune
Kimmo
Petri
Kimmo
Magnus
Kimmo
Feuer und Wasser
Stefan
David
Petri
Kimmo
Leena
Stefan
Kimmo
Stefan
Kimmo
Valtteri
David
Nichts und alles
Magnus
Kimmo
Stefan
David
Kimmo
Stefan
David
Leena
Kimmo
Petri
Kimmo
Stefan
Kimmo
David
Kimmo
Sonne, Schatten. Tanzen.
Kimmo
Leena
Emma
Kimmo
Petri
Stefan
Kimmo
Dank
Inhaltsverzeichnis
Für Niina und Venla
Inhaltsverzeichnis
Die Fee des frühen Morgens
In dem Sommer, in dem Marisa den Mond vermessen möchte, betritt Kimmo Joentaa den Raum, in dem das Meer zu Hause ist. Sanna schwimmt im Sonnensee. Petri läuft zwischen Bäumen, auf der Flucht vor sich selbst. David löscht die Sonne aus. Magnus und Stefan spielen Leben, Aune und Valtteri stehen Hand in Hand, Leena tanzt mit dem Tod. Sakari lernt, durch Wände zu gehen.
Sakari
Es ist ganz einfach. Sakari muss nur die Türen öffnen, die immer schon da gewesen sind. Nicht die Türen sind das Problem gewesen, sondern er selbst, er hat endlich den Blick gefunden, die richtige Perspektive, es sind Türen, die Kontur gewinnen, die sich aus dem Mauerwerk herauskristallisieren, im Licht, das die Sonne sendet.
Der Morgen ist kühl, frisch und klar, ein Morgen, der wispernd vom beginnenden Tag erzählt, und während Sakari von Tür zu Tür geht, von Welt zu Welt, im Dialog mit der Fee des frühen Morgens, beginnt die Nacht zu verblassen, und mit ihr das Dunkle, das ihn umschlossen hat. Die Angst ist Erinnerung, die Erinnerung Fantasie, die Fantasie ein stillstehender Gedanke, über den er lachen kann.
Er lacht, lauthals, über die Angst, die nur noch ein Gedanke ist, darüber, dass sich die Angst nicht mehr bewegen kann, er lacht die Angst aus, und er lacht über die Autos, die aufblenden, weil Fahrer hinter den Lenkrädern, verblendet, das Licht der Sonne noch zu übertrumpfen versuchen. Heller als die Sonne wollen sie sein. Und einer bremst ab und lässt die Scheibe herunter und ruft: »Weg von der Straße, Idiot!«
Darüber lacht Sakari, über Worte, die folgenlos verhallen, ein taubes Gebrüll, das von ihm abprallt, plump zu Boden fällt, liegen bleibt.
»Gute Reise!«, ruft Sakari und winkt dem Fahrer und seinem Wagen nach. Er läuft, auf breiten Straßen, von Zeit zu Zeit biegt er ab, mit den Wänden verschmelzend, und jedes Mal, wenn er zurück auf die Wege tritt, die vor ihm liegen, ist das Licht der Sonne ein wenig heller geworden.
Aber mit dem Licht kommen die Menschen, und mit den Menschen kehrt die Angst zurück, die Enge, er spürt die Präsenz der falschen Soldaten, er spürt die Druckwellen der bevorstehenden Detonationen, und er begreift nicht, warum ihn sein Weg ins Innere der Stadt führt.
Er muss raus, möchte in der freien Fläche stehen und sich um die eigene Achse drehen, aber die Fee des frühen Morgens sagt: »Frag nicht, denk nicht. Lauf!«
Also läuft er den Menschen entgegen und beginnt, das Lächeln auf seinem Gesicht zu spüren, er beginnt zu begreifen und das Wort zu flüstern.
Engel.
Auf dem Marktplatz kauft er ein Eis, ein freundliches Mädchen drückt ihm die Tüte in die Hand, sie trägt die Uniform der Eisverkäuferinnen, die Uniform der guten Soldatinnen, er bedankt sich und nimmt für eine kurze Weile ihre Hand in seine, flüstert ihr zu, was die Fee des frühen Morgens sagt, und das Mädchen sieht ihn an, groß und undurchdringlich sind die Augen. Er lächelt, das Eis kühlt seine Zunge, während es schmilzt.
Über den vielen kleinen Wasserfällen, vor dem Stockmann-Einkaufszentrum, tanzen alle Farben. Er setzt sich an den Rand der Fläche und betrachtet für eine Weile die Vorübereilenden, bevor er beginnt, seine Kleider abzustreifen.
Das Böse wird schweigen, die Welt in Ordnung sein. Er möchte der Fee noch eine Frage stellen, aber sie ist schon gegangen. Sie wird erst zurückkehren, sobald wieder ein Morgen dämmert.
Sakari stapelt die Kleider ordentlich übereinander, stellt die Schuhe ab, die Schuhe im rechten Winkel zu den Kleidern.
Er nimmt das Messer aus seiner Umhängetasche, läuft langsam, mit wachsender Ruhe und Zuversicht, dem Wasser entgegen und steigt über die flache Schwelle in die von Regenbögen umschlossenen Fontänen.
Petri
Petri Grönholm sitzt in seinem Büro im dritten Stock des Polizeigebäudes, als der Anruf kommt. Der Anruf gilt nicht ihm, und er hört nur die eine Hälfte des Dialogs. Die Stimme der jungen Polizistin, die die Notrufzentrale betreut, dringt vom anderen Ende des neu eingerichteten Großraumbüros herüber, leise, aber deutlich.
»Am Marktplatz«, sagt sie. »Ja. Ok. Ja, ich verstehe Sie. Nackt. Mit Messer.«
Petri Grönholm hat sofort ein Bild vor Augen. Ein Bild der kleinen Wasserfälle, die er jeden Morgen sieht, wenn er aus dem Fenster seiner Wohnung nach unten blickt. Auf den Marktplatz von Turku. Auf die Eiskiosks. Mädchen in Uniformen, auf denen die Logos der Eishersteller prangen, befüllen die Tüten, die die Kinder entgegennehmen, um dann zu den Fontänen zu rennen, sie strecken die Arme aus, ihr Eis vergessend, und manchmal fällt eine der Tüten ins Wasser.
Die junge Polizistin sieht ihn fragend an.
»Was ist da am Marktplatz los?«, fragt er.
»Hm? Ach so … ein Mann, nackt, im Wasser.«
Grönholm nickt.
»Er trägt wohl ein Messer bei sich.«
Messer, denkt Grönholm.
»Ich wohne da nämlich«, sagt er.
»Zwei Wagen sind unterwegs, um sich die Sache anzusehen«, sagt sie. »Willst du …«
»Ja, ich fahre hin«, sagt Grönholm.
»Ok, das gebe ich durch.«
Er hebt die Hand zum Abschied und läuft. Als er in die flimmernde Hitze des Sommers hinaustritt, denkt er vage, dass dieser Tag wie geschaffen ist für ein Bad in kühlem Wasser. Er steigt in den schwarzen, brütend heißen Dienstwagen, startet den Motor und fährt die Strecke, die er am Morgen schon einmal gefahren ist, nur die Richtung ist eine andere.
Er fährt zurück, viel früher als sonst. Zum Marktplatz von Turku.
Nach Hause.
Sakari
Sakari sitzt zwischen den Regenbögen. Die Klinge des Messers kühlt seine Haut, die Stimme hinter der Stirn schweigt. Er ist allein, die Menschen sind zurückgewichen. Flimmernde Schatten hinter der Wasserwand, die ihn umgibt.
Die Angst ist ein Gedanke, Zentimeter entfernt, so wie das Wasser, das ihn umschlossen hat, ohne ihn zu berühren. Nur ab und zu die Ahnung eines kühlen Tropfens auf der Haut.
Er streicht mit dem Messer an seinen Armen entlang, an seinem Hals. Über ihm klebt die Sonne auf einem harten Himmel. Hinter der Wand steht ein Junge. Er hält ein Eis in der Hand und sieht ihn an, mit weit geöffneten Augen, als wolle er etwas sagen. Eine Frage stellen.
»Keine Angst«, sagt Sakari.
Obwohl der Junge gar nicht ängstlich aussieht, eher neugierig. Lustig sieht er aus. Der Junge sieht aus wie eine ferne Erinnerung. Er kennt ihn.
»Du hast gar keine Angst«, sagt Sakari. »Gut so.«
In einiger Entfernung kommen Autos zum Stillstand. Das ist ungewöhnlich, der Marktplatz darf von Autos nicht befahren werden. Die Linienbusse dürfen im Quadrat um den Platz herumfahren, blau die Busse, blau der Sommerhimmel, aber Autos sind verboten.
Was wollen die verbotenen Autos?, denkt Sakari.
Die Angst nähert sich, und die Klinge des Messers sticht erste schmale Wunden in die Finger seiner Hände. Beiläufig. Er spürt nichts. Aus den Autos steigen Polizisten. Sie kommen auf die Wasserwand zu, zügig, mit angelegten Armen. Ein Mann und eine Frau. Sakari mag die Uniformen, die sie tragen. Er stellt sich vor, dass sie sich sicher fühlen in diesen Uniformen. Auch er fühlt sich sicher, hinter der Wand, entblößt. Er trägt die Uniform der Engel.
»Hören Sie?«
Das hat einer der Polizisten gesagt. Der Mann.
»Hören Sie mich?«
Sakari betrachtet den Mann, hinter dem Wasser.
»Kommen Sie bitte da raus und ziehen sich an«, sagt der Polizist.
Sakari schweigt. Weil die Stimme hinter seiner Stirn plötzlich so laut geworden ist. Die Stimme hinter seiner Stirn spricht Warnungen aus, so schnell, dass er kaum folgen kann.
»Hören Sie mich? Ich fordere Sie auf, herauszutreten. Legen Sie das Messer ab.«
Im Hintergrund kommen weitere Fahrzeuge zum Stillstand. Die Frau, die Polizistin, hat den Jungen mit dem Eis an die Hand genommen. Die beiden entfernen sich schnell. Sakari spürt einen Stich, im Nacken.
Die Stimme hinter seiner Stirn möchte, dass der Junge bleibt. Ich kenne dich, Junge, denkt er, der Satz beginnt, Kreise zu ziehen, ich kenne dich, du bist gesegnet, musst bleiben, kennst keine Angst.
Petri
Als Petri Grönholm ankommt, sieht er einen Polizisten vor dem Brunnen stehen, eine Polizistin führt einen Jungen an die Seite, und während er aussteigt, fährt ein weiterer Streifenwagen vor, der ruckartig zum Stillstand kommt, drei Uniformierte steigen aus, einer von ihnen ist Markku Persson, den er kennt.
»Hei, Petri«, sagt Persson, schwungvoll auf ihn zukommend. »Wir wurden angefordert. Was ist das hier genau?«
Grönholm zögert, ein Flimmern hat sich vor seine Augen gelegt. Die Uniformierten, Perssons Kollegen, gehen bereits auf die Szene zu, federnd, fast schlendernd, aber wachsam, der Platz ist leer, die Marktbesucher stehen am Rand, ein schweigendes Publikum.
»Ein Nackter am Wasser. Er soll ein Messer bei sich tragen.«
»Ok«, sagt Persson.
Er läuft neben Persson, hinter dem Flimmern, das seine Augen umspielt, sieht er den Jungen, er nippt an seinem Eis. Gedankenverloren. Worüber denkst du nach, Junge?, denkt Grönholm vage.
»Scheiße, was ist das denn für einer?«, sagt Persson, und Grönholm folgt seinem Blick und erahnt den Mann hinter den kleinen funkelnden Wasserfällen, der Mann sitzt, von Regenbögen umschlossen, zwischen den Wasserspielen und fährt, ruhig, geduldig, mit einem Messer an seinen Armen entlang.
Im Hintergrund, hinter dem Wasser, hinter den flackernden Rändern, die sein Sichtfeld einengen, sieht Petri Grönholm das Fenster seiner Wohnung. Darüber ein heller Himmel. Bald zu Hause, denkt er, während er fahrig, mit einer zitternden Hand, nach seiner Dienstwaffe tastet.
Sakari
Hinter der Wand baut sich eine Wand auf. Eine Wand aus Menschen hinter der Wand aus Wasser. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Sechs tragen Uniform. Einer ist in Zivil, in einer schwarzen Jacke, die sich irgendwie nicht in den Tag einfügt. Ein schwarzer, praller Fleck im Sommer, der zu schnell näher kommt.
Weg, denkt er. Weg, weg. Weg von mir.
Der schwarze Fleck steht ihm gegenüber, flankiert von blauen und weißen Uniformen, die sich schleichend bewegen, auf der Hut.
Keine Angst, denkt Sakari. Kein Grund zur Sorge. Ich bin hier, kein Grund zur Sorge.
»Leg das Messer weg«, sagt der schwarze Fleck.
Warum schmilzt du nicht, schwarzer Mann?, denkt Sakari. Warum tropfst du nicht zu Boden, vermengst dich mit Wasser, verrinnst?
Petri
Hinter dem Flimmern, das seine Augen benetzt, sieht er den Balkon seiner Wohnung, das Fenster. Im Fenster spiegelt sich die Sonne. Für einen Moment glaubt er, sich selbst zu sehen, auf dem Balkon stehend, die Szenerie beobachtend, nachdenklich, abwägend, aus sicherer Distanz.
Dann spürt er sich wieder. Noch nie hat er seine Beine so fest auf ebener Erde gespürt. Seine Hand hat sich fest um den Knauf der Waffe gelegt. Seine Augen suchen die Augen des Mannes zwischen den Regenbögen. In seinem Rücken spürt er den Blick des Jungen mit dem Eis. Der Junge will zu den Fontänen rennen und lachend die Hände nach ihnen ausstrecken.
Gleich, denkt Petri Grönholm. Gleich.
Er findet die Augen des nackten Mannes und hat das Gefühl, einen Tunnel zu betreten. Die Augen des Mannes sind schwarz und sehen durch ihn hindurch in eine fremde Ferne.
Gleich, denkt er. Gleich ist alles wieder in Ordnung.
»Messer weg.«
Das Blut, das der nackte Mann, einige Meter entfernt, von seinen Armen abschält, tropft zu Boden, vermengt sich mit Wasser, verrinnt.
Sakari
Sie erkennen ihn nicht, sie wissen nicht, wer er ist, wissen nicht, warum er hier ist, wissen nicht, was sie tun. Wie soll er den Blick dieser Menschen öffnen, wie soll er ihre Schuld in Mut umwandeln, wenn sie blind sind?
Engel, sagt er.
Messer, sagt der andere.
Ich … bin ein Engel.
Das sind Sie nicht. Hören Sie auf, sich Wunden zuzufügen.
Siehst du nicht, dass ich gekommen bin, um deine Schuld von meiner Haut zu waschen?, denkt Sakari.
Messer runter und raus da.
Der schwarze Mann hinter der Wasserwand kommt schnell näher.
Lass mich …
Ein Schritt, dann noch einer, dann übertritt der Mann die Schwelle, steht zwischen den Wänden, mit einem Bein in dem Raum, der nur Sakari gehört.
… lass mich einfach nur …
Der Mann richtet eine Waffe auf ihn, auf die Stelle, an der sein Herz schlägt.
… lass mich einfach nur ein Engel sein.
Petri
Er steht im Zentrum. Im Zentrum seiner Welt, nicht weit von zu Hause. Er steht so, wie er es gelernt hat. Die Waffe in seiner Hand verlängert seinen Arm, der Arm steht waagrecht in der Luft, der Finger am Abzug zittert nicht. Nur seine Hand. Und seine Beine. Die Worte, die er spricht, flirren im Raum, in der Schwebe, lösen sich voneinander, verpuffen als Buchstaben. Das Wasser prasselt leise. Hat der nackte Mann Engel gesagt?
»Messer weg. Jetzt.«
Der nackte Mann erhebt sich, plötzlich, in einer Bewegung, die Petri Grönholm als zugleich ruckartig wie fließend erlebt. Der Mann ist groß und schlank und steht gekrümmt, mit angezogenen Schultern, das Messer mit einer Faust fest umschließend, und er sagt etwas, das Grönholm nicht versteht. Dann ist er nur noch einen Augenblick weit entfernt, und der Augenblick steht still, ist ein Gemälde.
Das Gemälde zeigt ihn selbst. Ihn, Petri, im Zentrum einer Welt, die seine ist, nicht weit von zu Hause. Nur diesen einen Augenblick entfernt. In einer Bewegung erstarrt, die er einstudiert hat.
Dann beginnt die Zeit wieder zu laufen, und die Energie, die Kraft, die Petri Grönholm aufwendet, durchströmt mit ungeheurer Gewalt seinen Körper. Bevor sie endlich seine Fingerspitze erreicht, die den ersten Schuss auslöst.
Sakari
Die Stimme hinter Sakaris Stirn schwillt an, bricht auf, zerplatzt. In tausend Melodien.
Er ignoriert die Schüsse, steht einfach wieder auf, läuft weiter, den Mann mit der Waffe vergessend, die folgenden Schüsse vergessend, den Tag vergessend, einen anderen ansteuernd.
Dann verdichten sich die Melodien. Er kann sie übereinanderlegen. Eine auf die andere, ein Muster kristallisiert sich heraus, ein Gleichklang, während er am Boden liegt, auf kühlen, vom Wasser benetzten glatten Steinen. Ist er ausgerutscht? Der schwarze Mann steht über ihn gebeugt. Die Augen aufgerissen. Beobachtet ihn. Scheint eine Frage stellen zu wollen. Spricht er?
Sakari denkt über eine Antwort nach, obwohl er die Frage nicht hören kann. Die Fee des frühen Morgens kehrt erst zurück, wenn ein Morgen dämmert, und der Mann wendet sich ab und entfernt sich, schwankend laufend, langsam, Kopf und Waffe gesenkt.
Sakari einigt sich mit der vielstimmigen Melodie hinter seiner Stirn auf einen Moment der Stille.
Inhaltsverzeichnis
Zwei Zentimeter Mond
Kimmo
Kimmo Joentaa trägt den dampfenden Kochtopf nach draußen zu dem alten Holztisch, der am Steg unter einer gleißenden Sonne steht, und er sucht die glatte blaue Fläche des Sees ab, die still, unbeweglich unter dem Himmel ruht. Er wartet.
Er hat Nudeln gekocht, Spaghetti, mit einer Tomatensoße, die Sanna ungeheuer gerne mag, sie weigert sich, streng genommen, irgendeine andere Soße auch nur anzurühren und hält ihren Papa für den besten Koch der Welt, obwohl Kimmo Joentaa, als er diese Soße erfunden hat, nur Tomatenmark mit Wasser vermengt und, einem offenbar glücklichen Impuls folgend, eine Prise Gemüsebrühe beigefügt hat.
Der See liegt still unter der Sonne. Dann tauchen die Mädchen auf, erst Marisa, dann, einige Sekunden später, Sanna.
»Ich war länger unten!«, ruft sie.
Marisa lacht.
»Noch mal!«, ruft Sanna, und Kimmo Joentaa sieht den beiden, seiner Tochter Sanna und ihrer Freundin Marisa, dabei zu, wie sie unter der Oberfläche verschwinden. Zuerst Sanna. Dann Marisa.
Dann ist alles still.
Kimmo Joentaa stellt den Topf auf dem Tisch ab, rückt die Teller und Gläser zurecht und geht ein paar Schritte auf das Haus zu. Während er läuft, muss er sich ein wenig dazu überreden, nicht stehen zu bleiben, sich nicht umzudrehen und das stille Wasser nach kaum merklichen Bewegungen abzusuchen. Sekunden zählend.
Er ist schon fast am Ende der Anhöhe angekommen, als in seinem Rücken ein helles Lachen die Stille zerreißt.
Während die Mädchen darüber streiten, wer dieses Mal länger unter Wasser gewesen ist, spürt er ein Lächeln auf seinem Gesicht und betritt beschwingt das Haus, um den Topf mit der Soße zu holen.
Petri
Petri Grönholm sitzt in seinem Wagen, unter dem blauen Himmel und der brennenden Sonne. Sein rechter Arm hängt schlaff auf dem Beifahrersitz. Seine Augen suchen den Raum hinter der Windschutzscheibe ab.
Rechts am Rand steht in einer Traube von Menschen der Junge, der ein Eis gegessen hat, als alles anfing. Als er angekommen ist, nicht wissend, was ihn erwartet. Auch die Arme des Jungen hängen schlaff herunter, wie losgelöst von seinem Körper, sein Mund ist leicht geöffnet. Neben dem Jungen sieht Grönholm zertrampelte Reste seiner Eiswaffel liegen.
Zwei uniformierte Polizistinnen versuchen, den Jungen und die anderen Umstehenden weiter zurückzudrängen. Immer weiter, denkt Grönholm, das ist gut. Weg von dort.
Der leere Raum, der die Wasserfontänen umgibt, wird zusehends größer, und im Zentrum der weiten freien Fläche liegt am Boden der nackte Mann, umgeben von drei Sanitätern, die nichts mehr werden tun können. Das ist das Einzige, was er mit Sicherheit weiß. Persson kommt auf ihn zu, mit zügigen, dennoch kontrollierten Schritten, er klopft gegen die Scheibe der Fahrertür. Grönholm öffnet.
»Deine Waffe«, sagt Persson.
Er sieht ihn fragend an.
»Gib mir deine Waffe«, sagt Persson.
Natürlich, denkt er. Er tastet nach der Waffe, die auf dem Beifahrersitz liegt, hebt sie an, spürt sie bleischwer in seiner Hand und reicht sie an Persson weiter.
»Alles klar, Petri?«, fragt Persson.
»Ja. Sicher«, sagt er.
Persson nickt und entfernt sich, er sieht ihm nach, dann gleitet sein Blick von Persson ab und bleibt auf den Kleidern und den Schuhen haften, die am Rand der Szene liegen. Ordentlich gestapelt die Kleider. Die Schuhe glänzen dunkelblau in der Sonne.
Er betrachtet abwechselnd den am Boden liegenden Mann und die Kleider am Rand und schließt die Augen. Da ist einiges, das er nicht versteht. Eine Frage steht im Raum, er greift nach ihr, bekommt sie nicht zu fassen.
Er stellt sich vor, dass der Mann aufsteht. Geduldig streift er seine Kleider über, zieht die Schuhe an. Er läuft, aufrecht, entspannt.
Nichts ist passiert.
Grönholm wird dem Jungen noch ein Eis kaufen, und der Mann wird laufen, mit glänzenden Schuhen, den leeren Raum verlassen, einem unbekannten Ziel entgegenstreben, ohne sich noch einmal umzudrehen.
Kimmo
Paula aus einem der Nachbarhäuser ist gekommen, um mitzuspielen, sie hat auch eine Spielidee mitgebracht, die die Mädchen sofort zu überzeugen scheint, und während Kimmo Joentaa Apfelsaft und kalte Milch nachschenkt, wirft er Seitenblicke auf die drei. Sanna, Marisa und Paula, die lächelnd auf dem Steg stehen, regungslos, mühsam ihren Bewegungsdrang bändigend, als seien sie, von einem Moment auf den anderen, erstarrt.
Er versucht zu begreifen, aber noch entzieht sich das Spiel, das die Mädchen spielen, seinem Verständnis. Es muss irgendetwas mit Polizisten und Dieben zu tun haben, denn Sanna hat gerufen, dass sie als Erste die Polizistin sein wolle, ihr Papa sei nämlich auch Polizist.
»Sagt mal … wie wäre es mit Eiscreme?«, ruft Kimmo Joentaa, die Mädchen reagieren nicht.
»Nicht jetzt, Papa«, sagt Sanna.
»Oh, entschuldigt …«, sagt Joentaa. Er betrachtet Sanna, die scharf nachzudenken scheint, während sie ihre Freundinnen genauestens beobachtet, Marisa und Paula, die sich eisern darauf konzentrieren, starr auf der Stelle zu stehen, wie Statuen, vor der ruhigen dunkelblauen Fläche des Sees.
»Du!«, ruft Sanna plötzlich, hell lachend. »Du bist der Dieb, Marisa. Du hast dich bewegt!«
Jetzt lachen alle, und sie lösen sich aus der Erstarrung, lockern ihre Beine, ihre Arme. »Mann, Sanna, das hat gedauert«, sagt Paula.
»Gar nicht«, sagt Sanna.
»Eiscreme!«, ruft Marisa.
»Und vorher noch mal schwimmen«, sagt Sanna und rennt schon über den Steg, springt in hohem Bogen ins Wasser, die anderen folgen ihr, Marisa versucht, höher zu springen als Sanna, Paula versucht, höher zu springen als Marisa, und im Wasser entbrennt eine Diskussion darüber, wer am höchsten gesprungen ist.
»Spring du rein, Papa!«, ruft Sanna. »Aber so hoch du kannst.«
»Gleich, erst mal Eis holen«, ruft Joentaa.
»Ok«, ruft Sanna. »Und noch was, wir müssen mein Geodreieck finden.«
»Hm … warum denn?«, fragt Joentaa.
»Marisa hat gesagt, dass sie den Mond messen möchte. Also, später natürlich, in der Nacht.«
Petri
Irgendwann ist er allein.
Einer nach dem anderen ist aus der Szene herausgetreten. Die Sanitäter haben den Toten in den Krankenwagen gehoben und sind, eskortiert von Polizeifahrzeugen, abgefahren, und Grönholm hat sich gefragt, warum ein Toter in einem Krankenwagen liegt.
Die Umstehenden haben ausgeharrt, für eine Weile, dann sind auch sie nach und nach zögerlich zurückgetreten, weitergegangen, ursprüngliche Ziele ansteuernd, Vorhaben fortsetzend, die sie für einen begrenzten Zeitraum unterbrochen haben, und die Polizisten, seine Kollegen, haben den Raum, der den Brunnen umgibt, abgesperrt, haben geduldig das Band um den Brunnen herum gespannt, schweigend, auch mit ihm, der am Rand der Szene im Wagen sitzt, hat niemand mehr gesprochen.
Der Junge, der ein Eis gegessen hat, ist an den Eiskiosken vorbei in Richtung Innenstadt gegangen, Petri Grönholm hat seinen Blick auf ihm ruhen lassen, während der Junge immer kleiner wurde, bis er außer Sichtweite war, auf Höhe des Einkaufszentrums Stockmann. Der Junge ist entspannt gelaufen, aber auch auf eine kaum merkliche Weise zögerlich, fragend, anders als zuvor. Einmal hat er sich umgedreht und ist für einige Sekunden stehen geblieben, den Blick auf den Brunnen gerichtet, auf die Wasserfälle, auf die Leerstelle zwischen den Fontänen.
Dann ist Paavo Sundström gekommen, sein Vorgesetzter, der Leiter der Abteilung für Delikte am Menschen der Polizei in Turku. Sundström hat seinen Wagen direkt neben Grönholms geparkt, zwei identische schwarze Dienstwagen, nebeneinanderstehend, und er hat nach Worten gesucht, während er Grönholm durch das geöffnete Fenster der Beifahrertür gemustert hat.
»Petri. Wie … wie geht es dir?«, hat er schließlich gefragt, und die Worte, die Buchstaben haben wie Marionetten in der flimmernden Sommerhitze gehangen, vor dem geöffneten Beifahrerfenster. Grönholm hat einen brennenden Stich hinter der Stirn gespürt, als Sundström die Beifahrertür geöffnet und sich neben ihn gesetzt hat.
»Petri … was genau ist hier passiert?«
Grönholm hat nichts entgegnet. Sundström hat, nach langem Schweigen, den Fortlauf skizziert, merkwürdig sachlich darauf hinweisend, dass natürlich, in Fällen wie diesem, eine Bürokratie in Gang gesetzt werde, werden müsse, aber das wisse er ja. Grönholm hat genickt und hinter dem Brunnen den Balkon seiner Wohnung gesehen, eingehüllt in Sonnennebel.
Sundström hat ihm angeboten, ihn mitzunehmen, aber Grönholm hat abgelehnt, und Sundström hat gesagt, dass es vielleicht ohnehin besser sei, wenn er erst mal zur Ruhe komme, er müsse sich allerdings zeitnah, im Laufe des Nachmittags, bei Aku Streb einfinden, dem Leiter der Abteilung für innerpolizeiliche Angelegenheiten, dann werde das alles seinen guten Gang nehmen.
»Ich habe Aku zugesichert, dass du am Nachmittag dort sein wirst, er erwartet dich um vier.«
Innerpolizeilich, hat Grönholm gedacht und gespürt, dass Sundström hinter seinen sachlichen Erläuterungen Entsetzen und eine für ihn ganz untypische Verunsicherung verborgen hat. Dann ist auch Sundström gegangen, hat ihm zum Abschied auf die Schulter geklopft, und Grönholm hat gespürt, dass es von Herzen kam.
Sundström ist in seinen Dienstwagen gestiegen und losgefahren, und Petri Grönholm ist endlich allein gewesen, umgeben nur noch von Kriminaltechnikern, die auf ihre Aufgabe konzentriert gewesen sind, behutsam den Brunnen umkreisend. Irgendwann sind auch die Kriminaltechniker gegangen, haben den Arbeitstag beendet, die Hitze ist Wärme gewichen, der Abend ist langsam, aber stetig näher gerückt und irgendwann da gewesen.
Grönholm sitzt in seinem Wagen, vor der abgesperrten Fläche, die den Brunnen umgibt. In einiger Ferne sein Balkon, sein Zuhause. Die Anzahl der Nachrichten auf seinem Diensthandy ist enorm, aber niemand ist gekommen, um ihn abzuholen, weder Aku Streb, der innerpolizeiliche Angelegenheiten regelt, noch sonst irgendjemand.
Petri Grönholm startet den Wagen und fährt für eine Weile geradeaus, die Stadt hinter sich lassend. Am Rand eines Waldes bleibt er stehen, steigt aus. Er steht für eine Weile still, abwartend.
Dann beginnt er zu laufen. Er spürt eine Kraft, die ihn überrascht. Eine unangenehme Energie, er läuft in den Wald, immer schneller ein Bein vor das andere werfend, er rennt und stellt sich vor, sich aus sich selbst herauszulösen, auf der Suche nach einer Dunkelheit, die ihn sicher umschließen wird.
Aber der Abend ist taghell, die Nacht wird einer Morgendämmerung gleichen. Der Mond wird, sobald er aufgegangen ist, der Sonne zum Verwechseln ähnlich sehen.
Kimmo
Am Abend spielen die Mädchen ein Spiel auf dem Tablet-Computer. Die drei sitzen am Steg, lassen die Füße im Wasser baumeln und sind ganz fokussiert auf das kleine flimmernde Rechteck, während über ihnen eine rote Sonne mit dem dunkelblauen Wasser des Sees zu einer Dämmerung verschmilzt, die auch den Morgen ankündigen könnte.
»Was spielt ihr denn?«, ruft Joentaa.
Er sitzt in Badehose und T-Shirt am Tisch und hört nur leise eine wiederkehrende, blecherne, dynamische Melodie, die aus dem Gerät dringt und die immer wieder von vorn beginnt, ein schwungvolles, irgendwie witziges Lied, die Mädchen wiegen sich vage im Rhythmus, während ihre Fingerspitzen routiniert und schnell über das Display streifen.
»Das ist so ein Zombie-Spiel … man muss über die U-Bahnen springen«, sagt Sanna.
»Oha … klingt irgendwie … gruselig«, sagt er.
»Ne, Papa, das sind gute Zombies. Also … liebe Zombies.«
»Ach so«, sagt Joentaa.
Gute Zombies. Gut gelaunte Untote. Die das zweifelhafte Privileg, ewig zu leben, womöglich zu schätzen wissen. In dem Moment, in dem er denkt, dass die Mädchen den Anbruch des Abends verpassen werden, ruft Sanna: »Hey, wie rot die Sonne ist!«
»Ui«, sagt Marisa.
»Oder ist das der Mond?«, fragt Sanna.
»Jetzt hat dich die U-Bahn plattgemacht, du Dödel«, sagt Paula.
»Kimmo?«
Die Stimme ist in Joentaas Rücken. Eine bekannte Stimme, die anders klingt. Er wendet sich um, noch lächelnd über die Mädchen. »Petri«, sagt er.
»Ich … hoffe, ich störe nicht«, sagt Grönholm.
»Natürlich nicht.«
Grönholm steht einige Meter entfernt, unter der Abendsonne und dem rötlich blauen Himmel, er scheint noch abzuwägen, ob er näher kommen oder stehen bleiben möchte. Joentaa folgt seinem Blick, Petri betrachtet den Tisch, auf dem Nudel- und Soßentöpfe und mit Vanilleeisresten gefüllte Schüsseln kreuz und quer stehen.
»Magst du ein Eis?«, fragt Joentaa.
»Kimmo, ich weiß ja, dass du heute noch Urlaub hast, aber … du musst mir … etwas erklären. Dieser Mann … ich glaube, dass er … ein Kind gewesen ist.«
Joentaa sucht Grönholms Blick, der unruhig hin und her wandert.
»Welcher Mann?«, fragt Joentaa.
»Der Mann, den ich erschossen habe … er ist fast noch ein Kind. Ein Junge«, sagt Grönholm.
David
Er läuft, die Stadt hinter sich lassend, mit dem Geschmack von Melone auf seiner Zunge.
Dafür hat er sich entschieden, eine Kugel Meloneneis. Das Mädchen, das ihm die Waffel gereicht hat, hat gelächelt, und als er begonnen hat, das Eis zu essen, als er den Geschmack auf der Zunge gespürt hat, die fremde Süße, hat er sich gefragt, warum. Warum Meloneneis? Er hat noch nie Meloneneis gegessen.