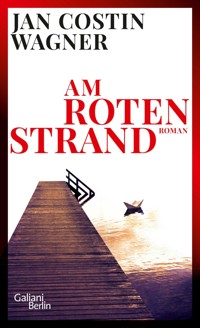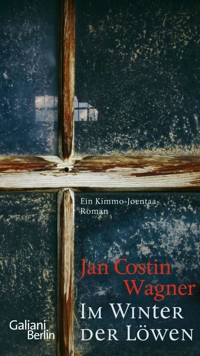9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Kimmo-Joentaa-Roman
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Ein psychologischer Kriminalroman der besonderen Art: über Trauer, Verlust und die Abgründe der menschlichen Psyche. Sanaa ist tot, eingeschlafen und nicht mehr aufgewacht. Ihr Mann, Kommissar Kimmo Joentaa, weiß, dass seine junge Frau gerade an Krebs gestorben ist, aber er kann es nicht begreifen. Wie in Trance versucht er, sein Leben in der finnischen Stadt Turku weiterzuführen, als sei nichts gewesen. Doch dann erreicht ihn die Nachricht, dass eine Frau schlafend in ihrem Bett erstickt wurde. Als Joentaa den Tatort betritt, glaubt er Sanaa vor sich zu sehen – eingeschlafen und nicht mehr aufgewacht. Die Tote wird nicht das einzige Opfer bleiben. Alle werden im Schlaf erstickt, von einem Mörder, der durch Wände zu gehen scheint. Jan Costin Wagners »Eismond« ist ein psychologischer Kriminalroman der besonderen Art: tiefsinnig, von einem geradezu hypnotischen Sog und getragen von einer melancholischen Grundstimmung. Ein fesselnder Auftakt zur Krimireihe um Kommissar Kimmo Joentaa, der den Leser tief in die Abgründe der menschlichen Psyche blicken lässt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 407
Ähnliche
Jan Costin Wagner
Eismond
Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Inhaltsverzeichnis
Über Jan Costin Wagner
Über dieses Buch
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
Inhaltsverzeichnis
Danksagung
Widmung
Erster Teil
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
Zweiter Teil
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
Dritter Teil
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
Inhaltsverzeichnis
Ich danke für wertvolle Hilfe ganz besonders Niina, Georg Simader, Wolfgang Hörner, Esther Kormann, Renate und Dietrich.
Inhaltsverzeichnis
Für Kaisa und Kerttu
»Take my freedom for giving me a sacred love«
(Mark Hollis, Spirit of Eden)
Inhaltsverzeichnis
Erster Teil
1
Kimmo Joentaa war allein mit ihr, als sie einschlief.
Er saß in dem abgedunkelten Raum neben ihrem Bett, hielt ihre Hand und bemühte sich, ihren Puls zu fühlen. Wenn er ihn verlor, wenn er auch ihr leises Ein- und Ausatmen nicht mehr hörte, hielt er die Luft an, beugte sich zu ihr hinab und verharrte still, um den Kontakt zurückzugewinnen. Er entspannte sich, sackte ein wenig in sich zusammen, wenn er die leichten Schläge unter ihrer Haut wieder an seinen Fingern spürte.
Mehrmals sah er auf die Uhr, weil er glaubte, es sei vorbei. Er hatte sich vorgenommen, den Zeitpunkt ihres Todes festzuhalten, ohne darüber nachzudenken, warum. Der Gedanke war ihm schon Tage zuvor gekommen, als er auf der Wartebank vor ihrem Zimmer gesessen und auf die schneeweiße Tür gestarrt hatte, hinter der sie lag. Rintanen, der behandelnde Arzt, hatte ihn auf die Seite gezogen, bevor er mit starken Medikamenten und aufmunterndem Lächeln zu ihr hineingegangen war, hatte ihm gesagt, es könne zu Ende gehen, sehr bald, jederzeit.
Er verließ sie nicht mehr, nahm seine Mahlzeiten an ihrem Bett ein und verbrachte die Nächte in einem unruhigen Halbschlaf, aus dem er minütlich aufschreckte, fürchtend, in den letzten Sekunden ihres Lebens nicht bei ihr zu sein.
Im Schlaf sah er ein Dickicht aus grauen Träumen.
In den Tagen vor ihrem Tod begann sie, Geschichten zu erzählen, die er nicht verstand. Sie erzählte ihm von Bildern, die sie sah, von einem roten Pferd, auf dem sie ritt, und von Reisen in Länder ihrer Fantasie. Sie sprach mehr zu sich selbst als zu ihm und sah durch seine Augen ins Leere. Einmal fragte sie ihn, wer er sei und wie er heiße. Er sagte »Kimmo«, und sie formte den Namen mit ihren Lippen.
Er streichelte ihre Hand, hörte ihr zu, lächelte, wenn sie lächelte, und verbot sich, in ihrem Beisein zu weinen. Einige Male fragte sie ihn, ob er sie auf dem roten Pferd reiten sehen könne, und er nickte.
Rintanen erklärte ihm auf seine Anfrage hin, die Halluzinationen seien Nebenwirkungen der Medikamente.
Sie habe keine Schmerzen.
Ihr Tod trat nachts ein, drei Tage nachdem Rintanen ihn über die Verschlechterung ihres Zustands informiert hatte. Es war dunkel im Zimmer, er spürte ihre Hand und erahnte ihre Augen und Lippen. Er begann, in den Halbschlaf hinabzugleiten, wurde zurückgerissen von der plötzlichen Angst, die Pause zwischen ihren Atemzügen werde nicht enden. Er tat, was er oft getan hatte, hielt die Luft an, beugte sich zu ihr hinab und verharrte still. Er wartete auf ihr leises, flaches Atmen, auf den schwachen Puls an seinen Fingern, aber dieses Mal kam nichts.
Er begann, ihren Arm zu streicheln, und beugte sich tiefer hinab, bis seine Wange ihre Lippen streifte. Er strich langsam über ihr kaltes Gesicht, ließ den Kopf auf ihren Schoß sinken. Dann richtete er sich auf und sah auf die Uhr.
Es war vierzehn Minuten nach drei, und sie war eingeschlafen.
Der Gedanke an den Moment ihres Todes und an die Minuten danach hatte ihn häufig beschäftigt, hatte ihn heimgesucht gegen seinen Willen, er hatte sich bemüht, ihn abzuschütteln. Halb bewusst hatte er geglaubt, gehofft, ihr letzter Atemzug werde auch sein Leben zum Stillstand bringen. Manchmal hatte er sich vorgestellt, dass er weinen würde, wie er nie zuvor geweint hatte. Es war ein tröstlicher Gedanke gewesen, denn in dem Bild, das er sah, hatten die Tränen den Schmerz überdeckt, vielleicht sogar langsam aufgefressen.
Jetzt, als der Moment gekommen war, dachte er nicht an die Vorstellungen, die er sich von ihm gemacht hatte. Er streichelte ihre Hand, ohne sich dessen bewusst zu sein. Sein Leben war nicht zum Stillstand gekommen, und er weinte nicht. Seine Augen, sein Rachen, seine Lippen waren ganz trocken. Später konnte er sich nicht erinnern, etwas gedacht zu haben in den Minuten, die vergingen, bis die Nachtschwester kam und er ihr sagte, sie sei gestorben.
Die Nachtschwester schaltete das Licht an, trat an ihr Bett heran, prüfte ihren Puls und fixierte ihn mit einem routiniert mitfühlenden Blick. Er wich aus und sah Sanna, deren Gesichtszüge er zuvor in der Dunkelheit erahnt hatte, im grellen Licht.
Für einen Moment glaubte er, sie schlafe nur.
Die Nachtschwester ging hinaus, ohne ihn anzusprechen, und kehrte wenige Minuten später mit Rintanen zurück, dessen Mitgefühl ihm echt erschien. Rintanen hatte ihm ermöglicht, gegen die Regeln des Krankenhausbetriebes Tag und Nacht bei ihr zu sein. Er nahm sich vor, ihm dafür irgendwann zu danken.
Auch Rintanen prüfte, was bereits feststand. Er nickte kaum merklich, verharrte kurz, dann strich er mit der Hand ganz leicht an Sannas Schulter entlang, eine Bewegung, die Kimmo Joentaa in Erinnerung blieb.
»Sie ist wirklich eingeschlafen«, sagte er, und Joentaa wusste, was er meinte. Ihr Gesicht verriet keinen Schmerz.
»Möchten Sie eine Weile bei ihr bleiben?«, fragte Rintanen, und Joentaa nickte, obwohl er nicht sicher war, ob er es wollte. Er horchte in sich hinein, während der Arzt mit der Nachtschwester auf den Flur hinaustrat. Er spürte, dass er sich auf einer dünnen Oberfläche bewegte. Rintanen sprach auf dem Flur mit der Nachtschwester. Er verstand die Worte nicht, aber er wusste, dass sie Sanna zum Inhalt hatten und das, was mit ihr, mit ihrem toten Körper, zu geschehen habe.
Er dachte: Sanna gehört mir nicht mehr.
Er sah sie an und hatte den Eindruck, es falle ihm leicht, dem Anblick ihrer geschlossenen Augen standzuhalten. Er versuchte, sich zu vergegenwärtigen, dass sie ihn nie wieder ansehen und dass er sie ganz verlieren würde. Er versuchte, die Züge ihres Gesichtes einzuatmen. Nach einer Weile wandte er sich ab, weil er spürte, dass es nicht gelang.
Die Erleichterung, nichts zu fühlen, schlug um in die Angst, nicht weinen zu können. Eine diffuse Angst, der Schmerz werde ihn von innen aushöhlen, bevor er es bemerkte.
Abrupt, einem Impuls folgend, stand er auf. Er hob ihren Körper, drückte sie an sich, küsste ihren Mund, ihren Nacken, biss leicht in ihren Hals, in ihre Schultern. Dann ließ er sie sinken, deckte sie zu.
Er löschte das Licht und verließ den Raum, ohne zurückzusehen. Er ging schnell den Korridor entlang. Als er im Auto saß, begann er zu denken. Er spürte, dass etwas bevorstand, er wusste, es würde etwas sein, das er nicht kannte. Er hatte Angst davor, aber er wartete darauf, er sehnte es herbei. Er wollte zu Hause sein, wenn es ausbrach.
Er fuhr auf der Landstraße Richtung Angelniemi, parkte den Wagen vor der Einfahrt. Er lief hinunter zum See, der zwischen dunklen Bäumen glitzerte. Der morsche Steg gab unter seinem Gewicht nach, er hatte den Eindruck, ins schwarze Wasser hinabgezogen zu werden.
Er hatte geplant, im Sommer einen neuen Steg anzubringen, aber sie hatte gesagt, sie liebe alles so, wie es sei. Er erinnerte sich an ihre Worte, an den warmen Ton ihrer Stimme. Sie hatte gesessen, wo er jetzt stand, er sah wieder ihr Lächeln, ihr blasses Gesicht und fühlte die Angst, die ihm den Atem geraubt hatte, als er sie ansah.
Er wusste, dass er am Ziel war. Er zog die Schuhe aus und ließ seine Füße ins Wasser sinken. Er atmete den klaren Wind und registrierte erleichtert, dass die Kälte des Wassers von seinen Beinen nach oben wanderte. Er wartete, bis das Gefühl zu erfrieren überall in seinem Körper war. Dann ließ er sich zurücksinken, legte sich flach auf den Rücken und schloss die Augen. Er sah sie auf einem roten Pferd reiten, er sah ihre langen, hellen Haare im Wind. Er wartete, bis das Pferd galoppierte, wartete, bis sie lachte und ihm etwas zurief, wartete, bis sie schnell auf ihn zukam, glücklich, schreiend … dann endlich streckte er die Arme nach ihr aus und empfing den Schmerz, der tief und stechend in ihn eindrang und ihn nie mehr verlassen würde.
2
Der Klavierstimmer wartete, bis er den Eindruck hatte, es sei ganz still, dann schlug er die Taste an und inhalierte den harten, falschen Ton. Er schloss die Augen und sah den Klang hell und gelb vor dem schwarzen Hintergrund seiner Gedanken. Ein gelber Kreis, ein greller Vollmond, der kleiner wurde und verschwand, als der Ton in den Schoß der Stille zurücksank.
Er öffnete die Augen und sah in das Gesicht von Frau Ojaranta, die Kaffee brachte und ihn fragte, ob er zurechtkomme. Er nickte und bemühte sich um ein Lächeln.
In der Tasse, die sie ihm reichte, schwamm ein greller gelber Mond.
Er hoffte, Frau Ojaranta werde ihn allein lassen, aber sie setzte sich und begann zu sprechen. Sie fragte ihn, was er von dem Klavier halte, erzählte, es sei ein Vierteljahrhundert alt, ein Erbstück ihrer Eltern.
Dasselbe hatte sie schon am Tag zuvor erzählt.
Er sah, wie ihre Worte langsam Richtung Boden rieselten.
Es sei ein gutes, ein sehr gutes Klavier, sagte er, und sie nickte, lächelte, zufrieden mit seiner Antwort. Sie erzählte, dass sie selbst nicht musikalisch sei, aber ihre Schwester spiele sehr gut und werde sich freuen, wenn sie demnächst zu Besuch käme.
Er nippte an seinem Kaffee, genoss die Hitze, den Schmerz auf der Zunge. Er nahm einen kräftigen Schluck, hoffte, an der Mondkugel zu ersticken, aber er schluckte sie hinunter.
Durch die Glastüren, die zur Terrasse führten, schien die Sonne, er sah den Staub wirbeln über den Klaviertasten. Er verschwieg Frau Ojaranta, dass dieses Instrument nie mehr zu stimmen war. Sie sagte, es sei ein wunderbarer Sommer, und er glaubte, in ihren Augen die Hoffnung auf ewige Wärme zu sehen.
Draußen war der Himmel hellblau über grünem Rasen.
Frau Ojaranta lächelte, stand auf und wünschte ihm gutes Gelingen. Er sah ihr nach, bis sie aus seinem Blickfeld verschwunden war, dann schlug er wieder die Taste an, leicht, er wartete, bis sich die Schwingung des schiefen Klangs im Nichts verlor.
Er versuchte, sich vorzustellen, wie es sei, hinabzutauchen ins Niemandsland, aber es gelang ihm nicht. Er saß einige Minuten, dann stand er auf und ging ans offene Fenster. Frau Ojaranta goss Blumen im Garten, sie bewegte sich routiniert, flüssig und gleichgültig.
Er war sicher, dass sie nicht dachte.
Sie bückte sich und riss Unkraut aus dem feuchten Boden. Er sah ihr eine Weile bei ihrer Arbeit zu. Sie trug einen weißen Bikini, ihre Haut war blass. Er inhalierte das Bild, schloss die Augen, öffnete sie und sah sie sterben.
Er sah in scharfen Kontrasten und grellen Farben, wie sie in einer schnellen Bilderfolge verbrannte.
Die Sonne war rot und orange und sehr heiß.
Er wandte sich ab und trat zurück in den Schatten des Raumes, den er als angenehm kühl empfand. Er begann zu laufen, ließ sich treiben, langsam, durch den langen Korridor ins helle große Schlafzimmer, in dem ein breites Bett aus Holz stand, weiße Laken, weiße Decken und Kissen, weich und kalt, er befühlte sie vorsichtig mit seinen Händen.
An der Wand im Flur hing ein Gemälde, das ihm gefiel, eine verschwommene Landschaft, alles floss ineinander, ein See in einen Berg und der Himmel in den Mond.
Er sah das Bild lange an.
Dann ging er die Treppe hinunter in den Keller, er fühlte bewusst, dass es kalt und dunkel wurde. In der Waschküche lief die Maschine, auf der Wäscheleine hingen Kleider. Wasser tropfte auf den Boden.
Er atmete die feuchte, schwüle Luft.
In der peinlich sauberen Sauna roch es nach nassem Holz und Duschgel. Es war noch warm, ein rotes Handtuch lag auf der zweiten Stufe der Bank. Er stellte sich Frau Ojaranta vor, die vor wenigen Minuten hier gelegen hatte.
Neben der Sauna fand er einen großen Weinkeller. Er widerstand dem Impuls, eine Flasche zu zerschlagen und alles zu schlucken, den Wein und die Scherben.
Er ging wieder nach oben, sein Schritt wurde schwer und der Mond, der seine Gedanken fraß, größer und plastischer.
Er ging zum Schlüsselbrett im Flur, nahm einige Schlüssel und suchte ohne Eile den für die Eingangstür. Er wurde schnell fündig und steckte den Schlüssel in seine Hosentasche.
Er inhalierte die Macht.
Im elegant eingerichteten Wohnzimmer tastete er die Rücken der Bücher ab, er fand eine fast unberührte, neu glänzende Ausgabe des Kalevala-Epos. Er sah Frau Ojaranta durch die geöffnete Terrassentür, sie stand im Sonnenlicht und drehte ihm den Rücken zu.
Er nahm das Buch aus dem Regal, blätterte zielstrebig in den 49. Gesang und las, wie Ilmarinen in der totalen Dunkelheit einen neuen Mond, eine neue Sonne schmiedete, einen Mond aus Gold, eine Sonne aus Silber …
Er stellte das Buch ins Regal zurück, sah hinaus und traf die Augen von Frau Ojaranta, die ihn anlächelte. »Lesen Sie nur«, rief sie, trat in den Schatten des Raumes und wischte sich den Schweiß von der Stirn.
Er sah die Perlen auf ihren Wangen.
»Ich bin so weit«, sagte er mechanisch, und ihr Gesicht hellte sich weiter auf. Sie trat an das Klavier heran und schlug eine Taste. Es höre sich viel besser an, viel klarer, sagte sie. Er nickte und genoss es zu wissen, dass der Ton so falsch war wie zuvor. Sie sagte, er habe gute Arbeit geleistet, und er bedankte sich.
Er spürte, wie sich der Schatten über ihnen tiefer senkte, er sah nur noch die Umrisse ihres Gesichts.
Draußen brannte die Sonne dunkelrot.
Die Angst war jetzt sehr gegenwärtig.
Frau Ojaranta gab ihm Geld. Er verabschiedete sich und trat zögernd ins Freie. Vor seinen Augen schmolz die Straße, aber neben ihm war sie grau und hart. Er setzte seine Schritte vorsichtig, bis er sicher war, nicht zu versinken. Er ging im lauen, warmen Wind zu seinem Wagen und legte den entwendeten Schlüssel ins Handschuhfach. Der Schlüssel fühlte sich kalt und klein an, er fürchtete, sein Zauber sei schon erloschen. Er nahm sich vor, ihn bis zum Abend zu vergessen, total zu vergessen, als existiere er nicht.
Während er fuhr, wurde es kühl. Die Sonne schien zartrot, weinrot, die Farbe, die er am wenigsten mochte und die ihm signalisierte, dass die Welle der Angst ihren Scheitelpunkt erreichte.
Er hielt auf einem Parkplatz, an einem Holztisch saßen Urlauber, ein junges Paar mit zwei kleinen Kindern. Sie unterhielten sich in einer Sprache, die er nicht verstand. Sie aßen und lachten, und er sah sie sterben. Das weinrote Bild wurde blau und grau und eiskalt. Er konzentrierte sich, obwohl er sich dagegen wehrte, auf den kurzen Todeskampf der beiden Kinder.
Nach einigen Minuten wich das Bild. Die Kinder kickten gegen einen Plastikball, das Ehepaar packte die Reste zusammen.
Er lehnte sich zurück und schloss die Augen. Er wollte lange schlafen und hoffte, der Wunsch würde ihm erfüllt werden.
Er wusste jetzt, dass er nicht er selbst war, und der Gedanke beruhigte ihn. Er begann, die nächsten Stunden klar vor sich zu sehen, und er spürte, wie das Wissen um den Schlüssel im Handschuhfach ihm Kraft gab.
Er war jetzt zuversichtlich und hatte den Eindruck, alles sei normal, alles sei richtig und unumgänglich.
Kurz bevor er einschlief, registrierte er erleichtert die Ankunft der Bewusstlosigkeit, die die Angst betäubte, bevor er sie in der Nacht besiegen würde.
3
Kimmo Joentaa lag auf dem Steg. Er streckte seine Arme und Beine weit aus und versuchte, sich nicht zu bewegen, nichts zu tun und nichts zu sein.
Irgendwann setzte die Dämmerung ein, er beobachtete sie, zum ersten Mal in seinem Leben, das Wechselspiel der Farben. Schwarz wurde Grau und Grau Hellgrau, Dunkelblau, Blassblau. Es wurde schnell heller, nahtlos, er verpasste den Übergang, obwohl er sich zwanghaft auf den Moment konzentrierte, in dem die Schwelle zwischen Hell und Dunkel überschritten würde.
Der Morgen war kalt und klar.
Als das Schauspiel vorüber war, dachte er daran, wie gerne Sanna jetzt neben ihm gelegen hätte. Auf dem Nachbargrundstück rechts von ihm stiegen Kinder in ein rotes Ruderboot und paddelten auf den See hinaus. Er sah ihnen nach. Das Bild verschwamm vor seinen Augen, die begeisterten Rufe entfernten sich.
Er schloss die Augen und sah ein graues Ruderboot auf grauem Wasser, in dem Sanna saß und lachte. Er versuchte, das Boot rot und das Wasser blau zu sehen, aber es ging nicht. Je mehr er sich bemühte, desto blasser wurde das Bild. Nach einer Weile verschwand es ganz, und er schlief ein, gerade als er dachte, dass er nie mehr würde schlafen können.
Er schlief unruhig, immer nah an der Oberfläche, und erwachte von etwas Kaltem auf seinem Gesicht. Er richtete sich ruckartig auf und schrie unkontrolliert. Die drei Jungen im roten Ruderboot saßen neben ihm und sahen ihn mit großen Augen an. Ob alles in Ordnung sei, fragte einer von ihnen. Joentaa nickte und entschuldigte sich.
»Ich war wohl eingeschlafen«, sagte er.
»Wir dachten, dass vielleicht etwas nicht stimmt«, sagte Roope, der Sohn der jungen Frau, die im Nebenhaus wohnte. »Sie lagen … irgendwie komisch.«
»Alles in Ordnung«, sagte Joentaa und stand auf. »Trotzdem danke, dass ihr nach mir gesehen habt.« Er zog seine Jacke aus, die verstaubt und faltig war. »Habt ihr Ferien?«, fragte er, um irgendetwas zu sagen.
»Noch zwei Wochen«, antwortete einer.
Joentaa nickte, wandte sich ab und ging die Anhöhe hinauf zu seinem Wagen. Der Schlüssel steckte in der Zündung. Er zog ihn heraus und stolperte über die drei Stufen zur Haustür. Während er aufschloss, registrierte er, dass es sehr heiß geworden war. Er hatte offensichtlich eine ganze Weile geschlafen. In der Küche sah er auf die Uhr. Es war Viertel nach elf. In der Spüle lagen Teller, auf denen sich Schimmel gebildet hatte, weil er die vergangene Woche fast ausschließlich im Krankenhaus verbracht hatte. Er war nur nach Hause gefahren, um Kleider zu wechseln.
Einmal hatte Sanna ihn gebeten, alte Fotos zu holen. Bilder aus Lahti, wo sie sich vor sechs Jahren kennengelernt hatten, in einem eiskalten Winter, beide Zuschauer eines Langlaufrennens. Er hatte sich kaum wiedererkannt auf den Bildern, und sie hatte gelacht, als er sich über seine Frisur aufgeregt hatte, schulterlange Haare, blaue Zipfelmütze. Er sehe lächerlich aus, hatte er gesagt, und sie hatte erwidert, seine Haare hätten ihr damals besonders gut gefallen: »Wer weiß, ob ich dich ohne diese Haare und vor allem ohne die Mütze genommen hätte.«
Er erinnerte sich an ihr Lächeln und daran, dass sie fest seine Hand gedrückt hatte. Am Tag darauf hatte sie zu fantasieren begonnen und immer häufiger gefragt, wer er sei und wo sie sich befinde.
Er füllte das Spülbecken mit heißem Wasser, ließ die Teller hineinsinken und begann, alle Fenster im Haus zu öffnen. Auf dem Glastisch im Wohnzimmer lag die Modezeitschrift, die Sanna zuletzt gelesen hatte, im Schlafzimmer war das Bett nicht gemacht. Die Decken lagen halb auf dem Boden.
Er erinnerte sich an die Nacht, in der sie ihn geweckt und gesagt hatte, sie müsse jetzt wohl doch ins Krankenhaus, weil sie unerträgliche Schmerzen habe. Er hatte ihr angesehen, dass sie weinen wollte. Sie hatte nicht geweint, sondern mühsam gelächelt, und er hatte plötzlich ganz sicher gewusst, dass sie bald sterben würde, dass die Ärzte recht hatten und dass es keine Hoffnung mehr gab. Auf der Fahrt zum Krankenhaus hatte sie still neben ihm gesessen und die Schmerzen verschluckt.
Er hatte das Gefühl gehabt, in vollkommene Leere hineinzufahren.
Er öffnete im Wohnzimmer die Terrassentüren, setzte sich auf die Lehne des Sofas und dachte, dass diese Leere jetzt wirklich da war, eine umfassende, endgültige Leere. Er blieb eine Weile sitzen, dann ging er in die Küche und füllte ein Glas mit Wasser. Als er es zum Mund führen wollte, bemerkte er, dass seine Hände zitterten. Er stellte das Glas ab, legte seine Hände flach auf die Tischfläche und spannte die Muskeln und Sehnen an, um das Zittern zu kontrollieren.
Durch das Küchenfenster sah er Pasi und Liisa Laaksonen, ein älteres Ehepaar, das im Nachbarhaus wohnte. Die beiden gingen wie jeden Tag um diese Zeit hinunter an den See. Pasi trug seine Angel über der Schulter, Liisa den hellbraunen Korb für die Fische, die ihr Gatte immer verblüffend mühelos aus dem Wasser zog. Die beiden sahen ihn hinter dem Fenster stehen und winkten. Er reagierte nicht.
Er senkte den Blick und beobachtete die explodierenden Perlen im Wasserglas. In seinem Magen breitete sich langsam ein taubes Gefühl aus, das weiterwanderte, bis sein ganzer Körper wie betäubt war.
Nach einer Weile ging er ins Wohnzimmer zum Telefon und wählte die Nummer von Merja und Jussi Sihvonen, Sannas Eltern. Er brach den Wählvorgang bei der letzten Ziffer ab, legte den Hörer auf die Gabel und atmete durch.
Sannas Eltern waren noch am Tag vor ihrem Tod bei ihr gewesen und hatten angekündigt, am kommenden Wochenende wiederzukommen. Er erinnerte sich an den liebevollen, müden Blick, mit dem Merja ihre Tochter betrachtet hatte, und an die hilflosen Aufmunterungsversuche ihres Vaters. Sannas Eltern wohnten in der Nähe von Helsinki, rund zwei Autostunden entfernt von Turku. Kimmo Joentaa hatte anfänglich nicht begriffen, dass sich die beiden in der vergangenen Woche keinen Urlaub genommen hatten, um dauerhaft bei ihrer Tochter sein zu können. Erst allmählich war ihm klar geworden, dass sie entweder nicht verstanden oder nicht verstehen wollten, wie schlimm es um Sanna stand.
Insbesondere Jussi Sihvonen hatte sich von Anfang an dagegen gesperrt, ihre Krankheit als Tatsache anzuerkennen. Er hatte zunächst beharrlich von einer Fehldiagnose gesprochen, erst die Ärzte und dann das ganze Gesundheitswesen kritisiert. Es sei undenkbar, dass Sanna die Hodgkinsche Krankheit habe, es sei eine statistische Unmöglichkeit. Diese Krankheit bekämen nur Männer, er habe sich erkundigt. Später, als sich Sannas Zustand verschlechterte, als die Chemotherapie die Krankheit sichtbar machte, hatte er ständig versucht, gute Laune zu erzwingen, während Merja Sannas Hand gehalten, ihr gut zugeredet und lethargisch gelächelt hatte. Joentaa hatte sich einige Male über Sannas Vater geärgert, aber wenn er jetzt an Merja und Jussi dachte, an ihr Entsetzen und ihre hilflosen Bemühungen, die Katastrophe zu bewältigen, spürte er nur tiefe Traurigkeit.
Er hielt kurz inne, dann wählte er erneut. Sein Magen krampfte sich zusammen, als er Merjas erschöpfte, heisere Stimme am anderen Ende der Leitung hörte.
»Hier spricht Kimmo«, sagte er.
»Kimmo, schön, dass du dich meldest. Wie geht es Sanna?«, sagte sie leise.
»Merja … es ist vorbei … sie ist eingeschlafen, gestern Nacht.« Er wollte den Satz ruhig und deutlich aussprechen, aber auf halbem Weg brach seine Stimme. Einige Sekunden vergingen. Merja entgegnete nichts, und in seinen Gedanken hallten die Worte nach, die er eben gesprochen hatte.
»Sie hat keine Schmerzen gehabt«, sagte er, als sich die Pause in die Länge zog.
»Aber wir wollten doch am Wochenende zu euch kommen, du weißt doch, dass wir das wollten«, rief Merja, und während Kimmo nach beruhigenden, tröstenden Worten suchte, begann sie, zu schreien und zu weinen. Joentaa hörte Jussis Stimme, erst leise, dann direkt in der Leitung.
»Was ist los, Kimmo?«, fragte er hektisch, und Joentaa wiederholte, was er Merja gesagt hatte. Wieder brach seine Stimme, und wieder hallte der unwirklich wirkende Satz wellenartig in seinen Gedanken nach. Jussi schwieg, aber Joentaa hatte den Eindruck, sein Entsetzen über die Distanz hinweg zu spüren.
Im Hintergrund weinte Sannas Mutter in hektischen Stößen. »Du musst dich jetzt um Merja kümmern«, sagte Joentaa, aber Jussi schwieg noch immer.
»Gestern Nacht …«, sagte er nach einer Weile sehr langsam. »Gestern Nacht, hast du gesagt …«
»Gestern Nacht um kurz nach drei«, entgegnete Joentaa.
»Das ist eine schlimme Nachricht …«, sagte Jussi mehr zu sich selbst als zu ihm. »Eine sehr schlimme Nachricht …«
»Du solltest dich jetzt um Merja kümmern«, sagte Joentaa noch einmal. »Ich werde mich am Abend wieder melden.«
»Tu das, Kimmo«, sagte Jussi Sihvonen, aber Joentaa hatte noch immer den Eindruck, dass er gar nicht aufnahm, was er ihm sagte, weil er nicht zu begreifen schien, was passiert war.
»Bis nachher, Jussi«, sagte Joentaa. Als Sannas Vater nicht reagierte, legte er behutsam den Hörer auf die Gabel. Er starrte durch die geöffnete Terrassentür ins Freie und hörte von fern das Lachen und Schreien von Kindern und Schläge im Wasser.
Vielleicht waren es die drei Jungen in ihrem Ruderboot, die die morgendliche Begegnung mit ihm und sein merkwürdiges Verhalten längst vergessen hatten. Er versuchte, sich vorzustellen, wie Merja und Jussi Sihvonen den Schock bewältigen würden, und hoffte, dass Jussi die Geistesgegenwart besaß, für Merja einen Arzt zu holen. Er erwog kurz, noch einmal anzurufen, verwarf den Gedanken jedoch. Er war erleichtert, das Gespräch so schnell hinter sich gebracht zu haben.
Er trat ins Freie und stützte sich gegen den Liegestuhl, auf dem Sanna seit Monaten, eingehüllt in Wolldecken, ihre Nachmittage verbracht hatte. Schon im April hatte sie beharrlich das Recht eingefordert, im Freien zu sitzen. Seinen Hinweis, dass es viel zu kalt sei, hatte sie unwillig beiseitegewischt mit der einfachen Feststellung, es sei jetzt Frühling. Es war kalt geblieben, einer der kältesten Sommer, an die er sich erinnern konnte, und in der Nacht vor dem ersten wirklich heißen Tag war Sanna gestorben.
Er erinnerte sich an den Moment, in dem die Krankenschwester das Licht angeschaltet und er Sannas Gesicht gesehen hatte. Sie hatte so ausgesehen wie in vielen Nächten, in denen er sie betrachtet hatte, während sie schlief.
Er begann, widerwillig den Gedanken zu formen, dass sie wirklich nur geschlafen hatte, längst wieder aufgewacht war und sich fragte, wo er sei. Er wusste, dass der Gedanke falsch war, er ahnte, dass er gefährlich war, und wollte ihn abschütteln, aber es gelang ihm nicht. Der Gedanke quälte ihn und linderte gleichzeitig den tauben Schmerz.
Er stand auf, nahm seine Schlüssel und fuhr zum Krankenhaus.
Während der Fahrt stellte er sich vor, dass Sanna ihn anlächeln würde, wenn er die Tür zu ihrem Zimmer öffnete. Als er am Krankenhaus aus dem Wagen stieg, war das Bild schon fast verschwunden, aber er bemühte sich, es festzuhalten, während er das massige weiße Gebäude betrat und mit dem Aufzug in den zweiten Stock fuhr. Er lief schnell zu dem Zimmer, in dem Sanna gelegen hatte, aber in ihrem Bett lag eine alte Frau, die ihn fragend ansah, als er in den Raum stürzte. Er wandte sich ab, lief den Korridor entlang, fragte einen entgegenkommenden jungen Pfleger nach Rintanen und erhielt die Auskunft, dass der Arzt einen freien Tag habe.
»Ich suche meine Frau«, sagte er. »Sanna Joentaa, sie lag bis gestern in Zimmer 21.«
»Sie ist … meines Wissens … gestern verstorben«, sagte der Pfleger verunsichert.
»Das weiß ich«, entgegnete Joentaa unwillig. »Ich möchte wissen, wo sie ist. Ich möchte zu ihr.«
»Ich weiß nicht … ob das möglich ist«, sagte der Pfleger und sah sich Hilfe suchend um. »Ich werde fragen, Moment.« Er wandte sich ab und lief in Richtung des Schwesternzimmers. Joentaa sah ihm nach. Wenig später kam die stämmige Schwester auf ihn zu, die in der Nacht an Sannas Bett gestanden und keine Regung gezeigt hatte. Sie blieb vor ihm stehen und sah zu ihm hinauf, fixierte seine Augen.
»Ihre Frau befindet sich im Kühlraum«, sagte sie ohne Umschweife. »Es ist nicht üblich, aber wenn sie möchten, können Sie sie sehen.«
»Ich möchte zu ihr«, sagte Joentaa.
Die Schwester sah ihn durchdringend an, dann signalisierte sie ihm mit einem Nicken, ihr zu folgen. Sie fuhren mit dem Aufzug in den Keller. Joentaa starrte an die Wand, während sie nach unten fuhren. Die Schwester ging mit kantigen Schritten voran. Der Raum, in den sie ihn führte, war kleiner, als er erwartet hatte.
Sanna lag auf einer Bahre an einer Seitenwand, ihr Körper war mit einem blassen grünen Tuch abgedeckt worden. Die Schwester trat an die Bahre heran und sah ihn kurz an, bevor sie das Tuch anhob.
Er hielt dem Anblick nur einen Moment stand. Sannas Gesicht erschien ihm verfärbt und geschwollen. Es war nicht ihr Gesicht, aber er erkannte sie.
Er wandte sich instinktiv ab und hörte sich schreien. Er spürte, dass er zu Boden sank, und sah in einem Winkel seines Blickfeldes die Schwester zusammenzucken und auf ihn zustürzen. »Es geht schon«, sagte er, während sie versuchte, ihn aufzurichten. Er riss sich los und ging wankend Richtung Tür. Er schüttelte die Schwester ab und lief schnell durch das Treppenhaus nach oben. Die Schwester rief ihm etwas nach, aber er wollte nichts hören.
Als er im Freien stand, atmete er durch. Er schwitzte. Zwei junge Frauen, die auf einer Bank auf dem großen Vorplatz saßen, sahen ihn verstohlen an und kicherten.
Während er nach Hause fuhr, versuchte er, sich klarzumachen, dass Sanna tot war und dass diese Tatsache von nun an sein Leben bestimmen würde.
Pasi und Liisa Laaksonen winkten ihm von Weitem zu, als er aus dem Wagen stieg. Er tat so, als sehe er sie nicht, und beeilte sich, ins Haus zu kommen. Er lehnte sich gegen die Tür, schloss die Augen und versuchte, nichts zu denken und nichts zu fühlen.
Er zuckte zusammen, als es an der Tür klingelte. Durch das Küchenfenster sah er Pasi und Liisa Laaksonen auf dem Treppenabsatz stehen, Liisa schwenkte erwartungsfroh ihren Holzkorb.
Er ging zur Tür und öffnete. »Überraschung«, rief Liisa und präsentierte den Korb mit den toten Fischen.
»Sie haben sehr gut angebissen heute«, sagte Pasi Laaksonen, und Joentaa sah den Stolz in seinen Augen. »Wir dachten, wir bringen mal wieder was vorbei … Ihre Frau freut sich doch immer …«
»Vielen Dank«, sagte Joentaa. Pasi reichte ihm eine sorgfältig gefaltete Folie, in der zwei Forellen lagen.
»Sanna … ist gestern Nacht gestorben«, sagte Joentaa.
Die beiden starrten ihn an. Er glaubte zu sehen, wie die Nachricht langsam in ihr Bewusstsein eindrang. Sie schwiegen lange.
»Kimmo, das ist … schrecklich«, sagte Liisa Laaksonen schließlich, Pasi nickte mit offenem Mund.
Joentaa hatte das Gefühl, etwas sagen zu müssen, aber er wusste nicht, was. Er wandte sich ab. »Bis bald«, sagte er, bevor er die Tür schloss.
4
Am späten Nachmittag fuhr Joentaa nach Lenganiemi.
Die Schwester aus dem Krankenhaus hatte angerufen und ihn daran erinnert, dass er die Beerdigung in die Wege leiten müsse. Als er ihre tiefe, starre Stimme hörte, sah er unwillkürlich die Bahre, auf der Sanna gelegen hatte, und ihr bläulich gefärbtes Gesicht. »Wenn Sie möchten, können wir ein Bestattungsinstitut beauftragen«, sagte die Schwester.
Joentaa entgegnete hastig, er werde alles selbst regeln. Er bedankte sich für den Anruf und beendete das Gespräch.
Ein Bestattungsinstitut … er hatte nicht daran gedacht, obwohl alles vorbereitet war. Sanna hatte ihre Beerdigung geplant, als er noch nicht fähig gewesen war, an ihren Tod zu denken.
Vor einigen Monaten, an einem kühlen Tag im Frühjahr, hatte sie begonnen, davon zu erzählen. Sie hatte am Steg gesessen, ihre Füße im Wasser baumeln lassen und gesagt, dass sie auf Lenganiemi begraben werden wolle, auf dem kleinen Friedhof am Meer, neben der roten Holzkirche. Sie habe die Stelle genau vor Augen, sie habe sie sich eingeprägt.
Er hatte zunächst nicht begriffen. Sie waren nur einmal gemeinsam auf der Halbinsel am Rand von Turku gewesen, und das war Jahre her. »Ich habe mir die Stelle ausgesucht, als ich noch gesund war«, hatte sie erklärt, als sie sein irritiertes Gesicht gesehen hatte.
Er hatte verwirrt und zunehmend verärgert gefragt, warum sie ihm das damals nicht erzählt habe, warum sie überhaupt über ihren Tod nachdenke, warum sie sich nicht stattdessen darauf konzentriere, die Krankheit zu besiegen.
Er hatte keine Antwort erhalten. Das Funkeln in ihren Augen hatte ihm signalisiert, dass sie mit seiner Reaktion nicht einverstanden war, und er hatte seine Wut sofort bereut. Er war hinter sie getreten und hatte sie an sich gedrückt. Nach kurzem Sträuben hatte sie seine Umarmung erwidert und begonnen, von ihrem Ausflug nach Lenganiemi zu erzählen, den er kaum noch in Erinnerung hatte, von dem er nur wusste, dass er schön gewesen war, zu schön, um Platz zu finden in der Gegenwart, die ihn erdrückte. Er hatte sich innerlich geweigert zuzuhören und war erleichtert gewesen, als Sannas Redefluss allmählich abgeebbt war.
Sie hatte anschließend lange nicht mehr über ihren Tod gesprochen, und er hatte das Thema vermieden, aus Angst und weil er sich bis zum Schluss, auch als er wusste, dass er sich belog, eingeredet hatte, dass Hoffnung bestehe … dass sie den Kampf gewinnen könne, wenn sie nur den Gedanken an das Sterben abschüttelte.
Vor einigen Wochen, kurz bevor sich ihr Zustand so deutlich verschlechterte, dass Joentaa langfristig Urlaub beantragte, hatte sie ihm erzählt, alles sei vorbereitet. Er hatte zunächst nicht verstanden.
Es sei nicht ganz die Stelle, die sie gewollt habe, hatte sie gesagt, aber sie liege zwischen der Kirche und dem Meer.
Er hatte sich langsam von seiner Verblüffung erholt und gefragt, warum sie ihn nicht früher informiert habe. Sie hatte gelächelt, ihn umarmt und die Frage im Raum stehen lassen. Später hatte sie ihm erzählt, dass sie mit dem Gemeindepfarrer gesprochen habe und dass er sich nach ihrem Tod mit ihm in Verbindung setzen solle.
Er hatte etwas sagen wollen, aber sie hatte mit dem Zeigefinger seine Lippen verschlossen.
Nach dem Telefonat mit dem Krankenhaus fuhr er nach Lenganiemi. Als er mit der Fähre übersetzte, kam schemenhaft die Erinnerung an den Tag zurück, den er mit Sanna auf der Insel verbracht hatte. Es war damals viel kälter gewesen, ein Tag im Herbst oder im Winter.
Er fuhr den Feldweg hinauf und stellte überrascht fest, dass er genau wusste, welche Richtung er einschlagen musste. Nach einer Weile sah er die Kirche, deren kräftiges Rot sich scharf vom hellblauen Himmel abhob. Er parkte den Wagen auf dem sandigen Vorplatz und ging langsam auf die Gräberreihen zu, die im Schatten der Bäume lagen.
Zwei Frauen, eine sehr alte und eine mittleren Alters, kamen ihm entgegen. Die ältere Frau stützte sich auf die jüngere und redete wirr auf sie ein. Die Jüngere versuchte, sie zu beruhigen. Er grüßte sie, als sich ihre Wege kreuzten, aber die beiden bemerkten ihn nicht.
Er fragte einen Friedhofsgärtner, der an einem Grab Blumen goss, nach dem Pfarrhaus. »Neben der Kirche«, sagte der Mann und deutete in die Richtung, die er meinte. Joentaa bedankte sich und war schon einige Schritte gegangen, als der Mann ihm etwas zurief. »Falls sie den Pfarrer suchen, der ist in der Kirche, Chorprobe …«
Joentaa bedankte sich noch einmal. Als er die Kirchentür öffnete, hörte er leise den Gesang von Kindern. Er setzte sich in die hinterste Bankreihe und versuchte zuzuhören. Nach einigen Minuten begann er, stark zu frieren. Er stand auf und wollte gerade nach draußen gehen, als der Pfarrer die Probe beendete.
»Vielen Dank, für heute habt ihr’s überstanden«, rief er und sammelte lächelnd die Gesangsbücher ein. Die Kinder rannten an Joentaa vorbei ins Freie. Er ging langsam auf den Pfarrer zu, der sorgfältig die Bücher stapelte und die Kerzen ausblies.
»Entschuldigung«, sagte Joentaa. Der Pfarrer wandte sich um und sah ihm ins Gesicht. Joentaa fielen sofort die schelmisch blitzenden Augen auf, die unruhig hin und her wanderten. »Ja, bitte?«, sagte der Pfarrer.
»Mein Name ist Joentaa. Meine Frau … Sanna Joentaa …«
Der Pfarrer unterbrach ihn. »Natürlich, ich erinnere mich«, sagte er, hielt kurz inne. »Ist sie gestorben?«
Joentaa nickte.
»Das tut mir sehr leid.« Er holte kurz Luft. »Ihre Frau hat zwei Mal mit mir gesprochen. Sie hat mir erzählt, dass ihr Lenganiemi sehr gefällt. Sie fand es schön, dass der Friedhof direkt ans Meer grenzt.« Er machte eine Pause. »Kommen Sie«, sagte er und ging mit schnellen kleinen Trippelschritten voran. »Ihre Frau hat mich beeindruckt«, rief er über die Schulter hinweg, während sie aus dem Schatten in die grelle Sonne traten. »Sie musste einige bürokratische Hürden überspringen, um die beiden Grabstellen zu bekommen. Es ist ein sehr kleiner Friedhof.«
Vor einem quadratischen Rasenstück blieb er stehen.
Zwei Grabstellen … Sanna hatte an alles gedacht, wie immer, wenn sie sich etwas in den Kopf gesetzt hatte. Joentaa starrte auf die Stelle, die sie sich erstritten hatte. Ihm wurde schwindlig. Der Pfarrer sprach ihn an, aber er hörte nur hallende Laute. »Herr Joentaa …«
»Entschuldigung«, sagte Joentaa.
»Wann ist sie gestorben?«, fragte der Pfarrer.
»Gestern Nacht.«
Der Pfarrer nickte. »Ich habe Ihre Frau gemocht. Sie war … sehr stark. Ich glaube, sie hat ihren Tod wirklich akzeptiert. Ich habe viele sterbende Menschen begleitet, aber das habe ich selten erlebt.« Er schien nachzudenken. »Sind Sie gläubig?«, fragte er. Joentaa war von der Frage völlig überrumpelt.
»Ich wollte Sie nicht in Verlegenheit bringen, entschuldigen Sie. Ihre Frau hat mir erzählt, dass sie nicht gläubig sei, zumindest keiner Religion angehöre. Das hat mich überrascht …« Er schwieg eine Weile. Dann straffte er sich und drückte fest Joentaas Hand. »Ich wünsche Ihnen die Stärke, die Ihre Frau gehabt hat«, sagte er. Als Joentaa den Kopf hob, sah er ein Lächeln im Gesicht des Pfarrers, das ihn irritierte.
Der Pfarrer nickte ihm zu und wandte sich ab. Joentaa sah ihm nach, bis er im Innern der Kirche verschwunden war. Er stand eine Weile, dann ging er langsam in Richtung des Abhanges, der ans Wasser führte. Er setzte sich auf eine morsche Holzbank am Rand der Klippen.
Ein Motorboot zerschnitt die ruhige Wasserfläche. Der Lärm ebbte langsam ab. Die Autofähre bewegte sich gemächlich auf das gegenüberliegende Ufer zu.
Er dachte über das Lächeln des Pfarrers nach und deutete es als Ausdruck eines Gottvertrauens, das er nie hatte nachvollziehen können. Ein Gottvertrauen, das die Trauer auffing, weil es das Entsetzliche des Todes nicht anerkannte, weil es seine Endgültigkeit leugnete.
Aber Sannas Tod war endgültig.
Er bemühte sich zu akzeptieren, dass Sanna ihren Tod geplant hatte, ohne ihn zu beteiligen, aber es fiel ihm schwer. Er redete sich gegen seinen Willen ein, hintergangen worden zu sein, und versuchte gleichzeitig zu begreifen, dass Sannas Verhalten Verständnis und Zuneigung verriet. Sie hatte ihn vor vollendete Tatsachen gestellt, weil sie seit ihrem Gespräch im Frühjahr gewusst hatte, wie unerträglich groß seine Angst vor ihrem Tod gewesen war.
Bei dem Gedanken, dass sie, die Schwerkranke, ihn, den Kerngesunden, hatte schonen wollen, löste sich der Schmerz. Er begann zu weinen und laut mit sich selbst zu sprechen. Er warf sich vor, versagt zu haben … sie mit ihrer Todesangst allein gelassen zu haben, weil er sich verzweifelt und hartnäckig an die falsche Hoffnung geklammert hatte, sie könne überleben.
Dann schlug seine Stimmung um, und er bildete sich ein, Sanna habe ihn gezielt in diesen Konflikt mit sich selbst gestürzt, habe ihn über ihren Tod hinaus quälen wollen.
Der Gedanke verschwand so schnell, wie er gekommen war, und er begriff nicht, wie er ihn hatte denken können. Dennoch blieb die Angst, dass er das, was sie getan hatte, nie ganz begreifen würde.
Die Sonne bewegte sich langsam auf die Wasserfläche zu.
Er versuchte, darüber nachzudenken, was morgen sein würde, aber da war nichts.
Als er über den schmalen Kiesweg zu seinem Wagen ging, sah der Friedhofsgärtner auf, streckte seinen Kopf der Sonne entgegen und rief ihm zu, es sei ein herrlicher Tag.
5
Sein Wunsch war erfüllt worden, er hatte lange geschlafen.
Es war noch nicht dunkel, als er erwachte, aber die Sonne stand schon tief. Er startete den Wagen und fuhr hinunter ans Meer, um sie untergehen zu sehen.
Der Strand war noch bevölkert von Menschen. Er setzte sich auf eine abseits stehende Bank und sah den roten Feuerball, der knapp über den Bäumen der gegenüberliegenden Insel stand.
Er versuchte sich vorzustellen, was Frau Ojaranta gerade machte, aber der Rahmen seines Gedankenbildes blieb leer. Die Sonne verschwand langsam hinter den Bäumen. Er senkte den Kopf, schloss die Augen und hörte, wie sie brodelnd und zischend ins Wasser sank. Als er aufsah, stand das Meer schon in Flammen, die Menschen waren verschwunden.
Er ging langsam in Richtung des Wassers. Als er am Ufer stand, legte er seine Kleider ab.
Die kalten roten Funken durchstachen seine Haut.
Am Horizont stand ein riesiger Mond.
Er sprang hoch ab und tauchte ins Feuer, in dem er verbrannte und erfror. Als er auftauchte, wusste er, dass er ewig leben würde.
Er schwamm ans Ufer, das im Dunkel lag, zog seine Kleider an und ging zu seinem Wagen. Hinter ihm und neben ihm taten sich schwarze Abgründe auf, aber er ging wie ein Schlafwandler auf dem schmalen Pfad jenseits der Dunkelheit.
Er stieg in den Wagen und fuhr dem Mond entgegen, der sich über ihn senkte. Er parkte in einer Seitenstraße, nahm den Schlüssel aus dem Handschuhfach und ging langsam auf das Haus zu. Er näherte sich von der Rückseite, stieg über die Mauer in den Garten. Er trat näher heran und sah Frau Ojaranta, die auf dem Sofa im Wohnzimmer saß, der Fernseher flimmerte. Offensichtlich war sie allein.
Er genoss es, unbemerkt zu beobachten, und war erleichtert, keine Ungeduld zu spüren. Das Wohnzimmer lag in warmem Licht. Der Gedanke, dass er schon bald aus der schwarzen Kälte in dieses Licht treten würde, erregte und beruhigte ihn. Er senkte den Kopf und konzentrierte sich auf den Schauer, der langsam über seinen Rücken strich.
Als er aufsah, kam Frau Ojaranta auf ihn zu. Für einen Moment fürchtete er, sie habe ihn gesehen. Er stöhnte vor Schreck und wollte rennen, aber sie ging zum Telefon und nahm den Hörer ab. Er sah, wie ihre Lippen die Buchstaben ihres Namens formten.
Sie stand direkt an der Tür, lehnte sich gegen das Glas, nur einige Meter von ihm entfernt. Er trat einen Schritt zurück. Ihr Gesicht hellte sich auf, sie rief etwas, offensichtlich freute sie sich über den Anruf. Sie hörte eine Weile zu und lachte. Ihr abwesender Blick traf seine Augen, aber sie konnte ihn in der Dunkelheit nicht sehen.
Er trat wieder einen Schritt vor, ärgerte sich über seine Angst und den dummen Impuls wegzurennen.
Er war unsichtbar und unantastbar. Es war wichtig, es war notwendig, das zu begreifen.
Frau Ojaranta schüttelte den Kopf, verdrehte die Augen, kicherte, erzählte. Das Gespräch dauerte lange. Während er sie beobachtete, formte sich sein Gedanke, sein Wunsch zur festen Gewissheit. Als sie lächelnd den Hörer auf die Gabel legte und zum Sofa zurückging, wusste er, dass er dieses Mal die Grenze überschreiten würde. Er war jetzt ganz sicher, dass es einfach war, einfacher als alles, was er je getan hatte.
Frau Ojaranta schaltete den Fernseher aus und löschte das Licht im Wohnzimmer. Die Dunkelheit kam so abrupt, dass er zusammenfuhr. Ohne das goldene Licht wirkte das Gebäude, das er in Besitz nehmen wollte, abweisend und belanglos. Er umschloss fest den Schlüssel in seiner Jackentasche, aber die Zuversicht war schwer zurückzugewinnen.
Er ging von der Terrasse zurück in den Garten, bis er das ganze Haus überblicken konnte. Er fixierte das Fenster, hinter dem das Schlafzimmer liegen musste. Er hatte sich die Anordnung der Räume genau eingeprägt.
Nach einer Weile wurde im Schlafzimmer das Licht eingeschaltet, er trat näher heran und sah Frau Ojarantas Silhouette durch die zugezogenen Vorhänge. Er sah, wie sie ihre Kleider ablegte und ein Nachthemd überzog. Dann wurde es dunkel. Er stöhnte und spürte, wie seine Erregung wuchs, aber auch die Angst kehrte zurück, die Angst, vor der großen Aufgabe zu versagen.
Die Angst, nicht erlöst zu werden.
Er wartete eine Weile, aber es blieb dunkel. Er glaubte zu spüren, dass sie schlief.
Er ging um das Haus herum, vergewisserte sich aus sicherer Entfernung, dass niemand ihn von der Straße oder den angrenzenden Grundstücken aus sehen konnte. Dann ging er langsam und aufrecht auf die Vorderfront des Hauses zu. Während er ging, zog er Handschuhe über. Die Zuversicht kam zurück, er begann zu schweben und fühlte ein Lächeln auf seinem Gesicht. Als er den Schlüssel ins Schloss führte und behutsam zu drehen begann, war er endlich ganz und gar der, der er sein wollte und sein musste, um die Aufgabe zu bewältigen.
Er öffnete leise die Tür und sah die Konturen seines Gesichts im großen Spiegel im Flur. Das Lächeln erschreckte und erleichterte ihn.
Er erkannte sich selbst nicht.
In seinem Rücken spürte er das grelle Licht des Mondes. Er schloss schnell die Tür und stand in der Dunkelheit. Er atmete die Stille und ging langsam durch den Flur ins Wohnzimmer. Er spürte einen starken Impuls, das Zimmer in goldenes Licht zu tauchen, aber er widerstand. Er tastete sich an der Wand entlang zum Klavier, entfernte das rote Tuch und strich vorsichtig über die Tasten. Er hatte den Eindruck, es sei Jahre her, seit er hier gesessen und mit Frau Ojaranta gesprochen hatte.
Seine Augen gewöhnten sich an die Dunkelheit. Er ging langsam durch den Korridor und die Treppe hinunter in den Weinkeller, der abgeschlossen war, der Schlüssel steckte. Er spürte einen wohltuenden Schmerz im Magen bei dem Gedanken, dass Frau Ojaranta sich vor Einbrechern hatte schützen wollen, die versuchten, durch das Fenster des Weinkellers in die Wohnung zu gelangen.
Er nahm eine Flasche aus einem der Fächer und ging wieder nach oben. An der Tür zum Schlafzimmer blieb er kurz stehen. Sie war angelehnt. Er trat dicht heran und glaubte, ganz leise ihren regelmäßigen Atem zu hören.
In der Küche öffnete er die Flasche und nahm ein Glas aus einem der Schränke. Er setzte sich auf das Sofa im Wohnzimmer und konzentrierte sich auf den filzigen, bitteren Geschmack des Weins. Er versuchte, so regelmäßig zu atmen wie Frau Ojaranta.
Es war schön zu wissen, dass alles ihm gehörte, alles, was er wollte.
Es war schön, Teil der Dunkelheit zu sein.
Er wartete, bis er nichts mehr dachte.
Dann stand er auf und ging mit weiten Schritten zum Schlafzimmer. Vor der angelehnten Tür blieb er stehen und atmete durch. Er spürte, dass es schnell gehen musste, so schnell, dass er nicht begriff, was passierte. Wenn es schnell ging, würde es einfach sein.
Er schob behutsam die Tür nach vorn und betrat den Raum. Als er an ihrem Bett stand, sah er auf sie hinab. Sie lag ein wenig verdreht, die Arme um das Kissen geschlungen, und atmete in kurzen Stößen. Er fragte sich, was sie träumte, versuchte, die Macht zu inhalieren, aber es ging nicht, weil die Angst zurückkam und ihn umklammerte.
Er durfte keine Angst haben, alles war sinnlos, wenn er Angst hatte.
Um die Aufgabe zu bewältigen, musste er schnell und sicher sein, so selbstverständlich wie der Windhauch, der eine Kerzenflamme löscht.
Er beugte sich über sie und nahm das Kissen, das neben ihr lag. Er spürte ihren leichten Atem an seinem Hals und krallte seine Finger in das Kissen. Er dachte daran wegzurennen, alles zu vergessen, unerkannt ins Dunkel zu tauchen, aber das war unmöglich.
Er schloss die Augen und presste das Kissen fest auf ihr Gesicht. Er war erleichtert, kaum Widerstand zu spüren, nur eine leichte Straffung ihres Körpers, unterdrückte Schreie, die nichts bedeuteten. Als er sicher war, dass es vorbei war, ließ er los. Er zitterte.
Er vermied es, sie noch einmal anzusehen.
Im Wohnzimmer schaltete er das goldene Licht an. Er zog die Handschuhe aus, setzte sich ans Klavier und spielte die Melodie, die er besonders mochte, eine einfache Melodie, die Klarheit brachte.
Er schwebte auf den weichen Tönen über das Niemandsland.
Nach einer Weile stand er auf. Er verwischte die Abdrücke seiner Finger und löschte das Licht. Im Flur nahm er das Bild mit der verschwommenen Landschaft von der Wand.
Dann trat er ins Freie. Es war sehr kalt. Er stand am Fuß der Anhöhe, die er bergan laufen musste, um nichts mehr und alles zu sein. Er stöhnte leise bei dem Gedanken, dass hinter der Anhöhe der Tod endete und sein Leben begann.
Er lief, erst langsam, dann schneller. Er näherte sich dem Scheitelpunkt und schrie seine Euphorie heraus.
Dann stand er im Nichts.
Als er die Farbe sah, die niemand kannte, begann er zu weinen. Er war für immer in Sicherheit.