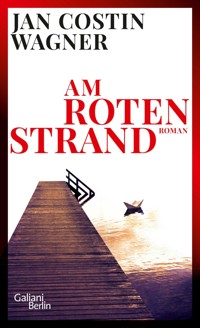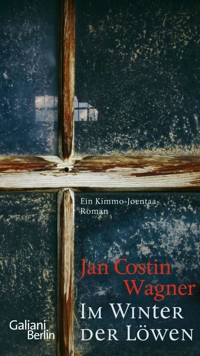9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
"Ein meisterhaftes Lied von Liebe und Tod, so spannend wie wehmütig." Focus Sein Haus, seine Familie, seine Firma - und sein Augenlicht. All das verliert der Protagonist in Jan Costin Wagners Roman buchstäblich über Nacht. Ein Leben endet, eines beginnt. Denn ausgerechnet am Tag der Katastrophe, im Krankenhaus, trifft der plötzlich Erblindete seine Jugendliebe Mara wieder. Gemeinsam mit ihr sucht er auf einer grünen Insel, in einem roten Holzhaus, umgeben nur von Himmel und Wasser, einen neuen Anfang. Doch das scheinbare Glück ist fragil. Die sich in immer kürzeren Abständen in seine Gedanken stehlenden Bilder und Szenen aus der Vergangenheit sind ebenso bedrängend wie die wiederkehrenden Ängste: vor dem Scheitern. Vor Mara, die ihn verlassen könnte. Vor dem seltsamen Kommissar vom Festland, der ihm nicht sagen will, wie sein Kinderbild in die Brieftasche eines Mordopfers kommt. In einer sich beschleunigenden Spiralbewegung mischen sich surreale Wirklichkeit und realistische Fiktion zu einer Tour de Force der Seele - und treiben den Leser auf ein Ende zu, das mit einem Paukenschlag das gesamte Buch in einem völlig anderen Licht erscheinen lässt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 172
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Jan Costin Wagner
Schattentag
Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Jan Costin Wagner
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Jan Costin Wagner
Jan Costin Wagner, Jahrgang 1972, lebt als Schriftsteller und Musiker bei Frankfurt am Main. Seine Romane um den finnischen Ermittler Kimmo Joentaa wurden von der Presse gefeiert, vielfach ausgezeichnet (u. a. Deutscher Krimipreis, Nominierung zum Los Angeles Times Book Prize) und in 14 Sprachen übersetzt. Tage des letzten Schnees und Das Licht in einem dunklen Haus wurden 2019 und 2022 vom ZDF u.a. mit Henry Hübchen und Bjarne Mädel verfilmt. Sommer bei Nacht erhielt den Radio Bremen Krimipreis, Am roten Strand ist nominiert für den Glauser-Preis für den besten deutschsprachigen Krimi.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Sein Haus, seine Familie, seine Firma - und sein Augenlicht. All das verliert der Protagonist in Jan Costin Wagners Roman buchstäblich über Nacht. Ein Leben endet, eines beginnt. Denn ausgerechnet am Tag der Katastrophe, im Krankenhaus, trifft der plötzlich Erblindete seine Jugendliebe Mara wieder.
Gemeinsam mit ihr sucht er auf einer grünen Insel, in einem roten Holzhaus, umgeben nur von Himmel und Wasser, einen neuen Anfang. Doch das scheinbare Glück ist fragil. Die sich in immer kürzeren Abständen in seine Gedanken stehlenden Bilder und Szenen aus der Vergangenheit sind ebenso bedrängend wie die wiederkehrenden Ängste: vor dem Scheitern. Vor Mara, die ihn verlassen könnte. Vor dem seltsamen Kommissar vom Festland, der ihm nicht sagen will, wie sein Kinderbild in die Brieftasche eines Mordopfers kommt.
In einer sich beschleunigenden Spiralbewegung mischen sich surreale Wirklichkeit und realistische Fiktion zu einer Tour de Force der Seele - und treiben den Leser auf ein Ende zu, das mit einem Paukenschlag das gesamte Buch in einem völlig anderen Licht erscheinen lässt.
Inhaltsverzeichnis
Widmung
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
Für Venla
1
Der Himmel blau. Keine Wolke, kein Hauch von Weiß. Die Luft steht, die Sonne scheint. Mara hat ihre Hand unter mein T-Shirt geschoben und krault meinen Rücken, meinen Nacken. Gänsehaut.
Ich wünsche mir, dass sie nie mehr damit aufhört.
Wir reden nicht viel, ab und zu ein paar Worte, die im Wellenrauschen verhallen.
Nichts bewegt sich. Nichts kann passieren. Ein Tag ohne Bedrohung. Katastrophen liegen fern.
Irgendwann sagt Mara mit ihrer hellen, klaren Stimme: »Lass uns gehen.« Sie löst ihre Hand von meiner Haut und strafft mein T-Shirt. »Komm, lass uns gehen, es fängt gleich an.«
»Was fängt an?«, frage ich.
»Der Regen.«
»Der Himmel ist blau und wolkenlos, die Sonne scheint«, sage ich.
Mara lacht. »Du bist nah dran.« Sie lacht und lacht und streichelt meine Wange.
Ich spüre Maras Liebe und die ersten Tropfen.
»Komm jetzt, das geht gleich heftig los«, sagt Mara und zerrt mich mit.
Sie hat recht, da ist der Regen, er prasselt auf uns ein.
»Komm schon«, ruft Mara, und jetzt bin ich es, der lacht.
Hagelkörner aus wolkenlosem Himmel.
Es ist der Tag, an dem Katastrophen fernliegen, es sei denn, sie sind bereits passiert.
Mara stellt mich unter die Dusche, trocknet mich ab, bringt mir einen Bademantel. Dann gießt sie Tee ein und reicht mir die Tasse. Wir schweigen. Ich konzentriere mich auf den Rhythmus des Regens. Ich höre, wie sich das Wasser in Pfützen sammelt, wie es im Rasen versickert. Die Terrassentür ist geöffnet, Wind weht herein. Mara reicht mir einen Teller mit Kuchen, der nach Zitrone schmeckt.
»Mara?«, sage ich.
»Ja?«
»Ich wollte deine Stimme hören.«
»Du hast am Nachmittag einen Termin im Krankenhaus«, sagt Mara.
»Heute nicht«, sage ich.
»Was heißt das, heute nicht?«
»Das heißt, dass ich nicht hingehen werde.«
»Und warum?«
»Einfach so.«
Ich spüre Maras Atem und ihre Hand, die an meinem Hals entlangstreicht. Wieder Gänsehaut.
Sie soll nicht aufhören.
Mara streicht die Tränen aus meinen Augen.
Die Insel ist das Bild, das Mara in meine Gedanken gezeichnet hat. Mara füllt meine Welt mit Bildern.
Das Bild in meinen Gedanken ist wie eine Karte, ein Lageplan. Die Insel ist mit dem Schiff erreichbar und kann mit dem Schiff verlassen werden. Dreimal täglich, morgens, nachmittags und abends, setzt die Fähre über. Mara schildert mir die Fähre als alten Kutter, den ich früher, als ich mit eigenen Augen sehen konnte, sicher nicht betreten hätte. Früher habe ich Angst gehabt, von Flugzeugen, Schiffen, Zügen fortbewegt zu werden. Ich habe mich in Unfällen sterben sehen. Ich habe nie jemandem davon erzählt.
Heute genieße ich, wenn ich auf der Fähre stehe, das Rattern des altersschwachen Motors und das Gefühl, sicher zu sein. Mit mir wird dieser Kahn nicht untergehen.
Auf meinem Lageplan der Insel habe ich das Meer blau ausgemalt, die Fähre pendelt als weißes, umgekehrtes Dreieck zwischen dem Festland und der Insel. Das Festland ist auf dem Lageplan nur angedeutet, ein Rechteck, das aus dem Bild herausführt und keine Bedeutung hat.
Die Insel ist ein grauer gelber roter grüner Kreis.
Grau die Klippen am Rand der Insel.
Gelb die kargen, trockenen Pflanzen.
Rot Maras Holzhaus auf dem Hügel.
Grün der Hügel.
Ich sehe Farben in Gedanken.
Die Stimmen der Menschen passen nicht zu Maras Beschreibungen. Ich sehe sie als Schattenrisse. Grau auf schwarz, fließende Bewegungen. Wenn die Menschen lachen, vibriert das Bild vor meinen Augen.
Ich spüre, wie der Tag abläuft, wie er sich auf Mara und mich herabsenkt. Der Hagelschauer ist in Regen übergegangen und der Regen in Wasser, das durch die Regenrinne abfließt und von Bäumen tropft.
Mara schweigt, aber ich spüre ihre Anwesenheit. Ich kneife die Augen zusammen und sehe sie als Schattenriss. Sie sitzt auf der Sofakante, sie hat etwas Abstand zwischen uns gelegt, vermutlich, um mir zu zeigen, dass sie böse ist. Weil ich angekündigt habe, nicht ins Krankenhaus zu gehen. Von Zeit zu Zeit, in regelmäßigen Abständen, führt Maras Schattenriss die Teetasse zum Mund. Wenn ich noch einen Wunsch frei hätte, wäre es der, Mara zu sehen.
Die Klippen am Rand der Insel:
Mara sagt mir, dass die Klippen steil abfallen. Wer einen Schritt zu viel macht, stürzt tief in flaches Wasser.
Irgendwann steht Mara auf und ruft im Krankenhaus an. Ich höre ihre Stimme, die für mich spricht. »Es geht ihm heute nicht gut«, sagt sie, und nach einer Weile zu mir: »Sie haben morgen einen Termin. Wirst du hingehen?«
»Natürlich«, sage ich.
Ich stelle mir vor, dass es draußen langsam dunkel wird, und Mara setzt sich neben mich, so nah, dass wir uns berühren, sie streichelt meinen Arm.
»Wird es draußen schon dunkel?«, frage ich.
Mara antwortet nicht. Ihre Hand wandert unter meinen Bademantel. Während sie mir zielsicher wohl- und wehtut, presse ich die Augen zusammen und stelle mir Mara vor, so wie ich mich an sie erinnern möchte.
2
Was passiert ist:
Erblindung über Nacht. Nicht zu erklären. Ich sitze an einem Strand und starre ins Leere, ich warte, ohne zu wissen, worauf. Irgendwann gehe ich zurück in mein Hotel und lasse die Jalousien herunter. Das Letzte, was ich sehe, ist eine Nachttischlampe, in dem Moment, in dem ich sie ausschalte.
Der Arzt im Krankenhaus hört sich geduldig an, was ich zu sagen habe. Er kann mir nicht helfen. Er hat mir eine Erklärung gegeben. Eine drastische Entzündung der Netzhaut. Er sagt, es könne sich legen.
Mara treffe ich an dem Tag wieder, an dem ich mein Augenlicht verliere. Sie ist auch im Krankenhaus, sie hat sich eine Schere in die rechte Hand gerammt. Ich erkenne ihre Stimme, obwohl so viele Jahre vergangen sind.
Ich schreie ihren Namen. Sie umarmt mich und sagt: Ich möchte, dass du bei mir bleibst, bis das ausgestanden ist. Dann lässt sie sich ihre Hand verbinden. Ich frage nicht, warum Mara sich die Schere in die Hand gerammt hat, und ich habe keine Angst, als die alte Fähre Mara und mich auf Maras Insel bringt.
Manchmal, wenn Mara zu sprechen beginnt, habe ich den Eindruck, sie werde mir in einem Satz die Welt erklären. Manchmal höre ich ihr stundenlang zu, ohne ein Wort zu verstehen. Wenn Mara mich berührt, spüre ich die Angst vor dem Moment, in dem sie loslässt. Sie lässt los, wann immer sie will. Sie kehrt immer zurück.
Etwas, das lange vergessen war:
Bevor ich Mara wiedertraf und ihr auf die Insel folgte, habe ich sie nur einmal gesehen, vor vielen Jahren, und wir haben wenig gesprochen. Sie legte sich neben mich auf meine Isomatte, unter meine Decke. Der Himmel war schwarz. Sie sagte, ich solle leise sein, um die anderen nicht zu wecken.
Ich fahre mit Mara über das Wasser. Maras Hand an meinem Rücken, auf meiner Haut, sie hat sie unter mein T-Shirt geschoben. Die Hand ist kalt. Ich sehe das Schiff als Schattenriss, grau, ein Geisterschiff, und es fällt mir schwer, Farben in meine Gedanken zu zwingen.
Ein sonniger Tag, ein heller blauer Tag, sagt Mara.
Der Arzt im Krankenhaus tröpfelt etwas in meine Augen, sie brennen. Ich liege auf dem Rücken und soll die Augen geschlossen halten, bis die Tropfen in die Augenhöhlen gesickert sind.
Mara schläft. Ich höre sie atmen wie vor vielen Jahren.
Ich habe damals lange wach gelegen. Ich erinnere mich, dass ich verkrampft lag, weil ich Angst hatte, Mara zu wecken. Mir war kalt, weil sie im Schlaf die Decke zu sich gezogen hatte. Ich habe in den schwarzen Himmel gestarrt und bin erst am Morgen eingeschlafen, es wurde gerade hell. Kurz bevor ich einschlief, dachte ich darüber nach, wie es weitergehen würde mit Mara und mir, und als ich später aufwachte, war Mara verschwunden. Heute, am Morgen auf unserer Insel, frage ich sie, warum sie damals gegangen ist, ohne mich zu wecken, ohne noch etwas zu sagen.
»Ach das«, sagt Mara, schlaftrunken.
Ich bin zu perplex, um etwas zu erwidern.
»Ich musste meinen Zug erwischen«, sagt Mara.
Ich warte. Sie lacht. Dann sagt sie: »Wie wäre es mit: Jedes weitere Wort hätte uns ein wenig von dem genommen, was wir uns gegeben haben.«
Sie lacht wieder, und ich denke, dass sie einen schönen Satz gesagt hat, genau den, nach dem ich lange gesucht habe.
3
Ich, früher:
Wer bin ich gewesen? Eine einfache, nicht zu beantwortende Frage.
Wir knien auf dem Sand. Ich stelle mir vor, dass Mara auf das Meer hinaussieht. Dieses Mal scheint wirklich die Sonne, und der Himmel ist wirklich blau, glaube ich.
Wir sind allein. Ich rede wie im Rausch, ich spüre, wie ich mich hineinsteigere. Während ich spreche, frage ich mich, ob ich es ernst meine, und das treibt mich an, lauter und schneller zu sprechen.
Ich sage Mara, dass ich glücklich bin, nicht mehr sehen zu können. Denn ich hätte Mara nicht wiedergetroffen, wenn ich nicht genau am selben Tag wie sie im Krankenhaus gewesen wäre. Ich sage, dass ich mein Augenlicht gegen Mara getauscht habe, und es sei ein guter Tausch gewesen, und ich lache befreit. Ich sage, dass ich glücklich bin, zum ersten Mal in meinem Leben.
Maras Schattenriss sieht auf das Meer hinaus, und Mara schweigt.
Die Insel:
Nähe und Berührung.
Das Leben ist greifbar.
Nichtgesagtes ist unerheblich.
Gesagtes ist nichts.
Bevor ich Mara wiedertraf, ist sie immer bei mir gewesen in dem zehrenden, wunderbaren Gedanken daran, was wir am nächsten Morgen gesprochen hätten.
Eine Flasche mit Wasser. Eine Tablette. Es sprudelt, während sie sich auflöst.
Draußen, hinter der Glaswand meines Büros, eine Tankstelle und ein Regenbogen. Mein Kompagnon steckt seinen Kopf durch den Türspalt und fragt, wie ich vorankomme.
»Bestens«, sage ich.
»Na dann«, sagt er.
»Du hast schlecht geträumt«, sagt Mara, ihre Hände streichen über meinen Rücken. Ich bleibe liegen und konzentriere mich auf die Nähe, die Mara mir gibt.
»Kannst du dich erinnern, was es war?«, fragt Mara.
»Hm?«
»Dein Traum. Es muss etwas Schlechtes gewesen sein.«
»Ich weiß nicht mehr.«
Irgendwann löst sich Mara. »Ich gehe jetzt«, sagt sie. Sie küsst mich auf den Mund, so fest, dass ich meine Lippen nicht öffnen kann.
»Bis heute Abend«, sagt sie.
Mara arbeitet als Zimmermädchen im Hotel am Strand. Ich setze mich aufrecht und höre, wie sie sich anzieht, wie sie den Fahrradschlüssel sucht, das macht sie jeden Morgen. Ich höre sie fluchen. Ein Klirren, als sie den Schlüssel findet, dann nimmt sie ihren Rucksack, sie sagt, es sei derselbe, den sie schon damals dabeihatte. Ich höre, wie sie den Reißverschluss des Rucksacks öffnet und schließt. Es ist ein rosaroter Rucksack. Ich habe gelacht, als ich ihn vor vielen Jahren zum ersten Mal gesehen habe.
»Bis später«, ruft sie, sie ist schon an der Tür.
»Mara!«
»Ja?«
Ich warte, ich höre ihre Schritte.
»Was ist?«, fragt sie.
Ich sehe ihren Schattenriss im Türrahmen. Ich strecke die Hände nach ihr aus. Sie kommt auf mich zu, sie ist bei mir, ihre Hände in meinen kalt und weich. Ich taste nach der Wunde an ihrer rechten Hand, ich spüre die Kruste.
»Es verheilt gut«, sage ich.
Mara schweigt, wartet.
»Sag noch etwas, Mara«, sage ich.
»Was?«
»Etwas.«
»Am Waldrand liegt ein kleiner Löwe, rekelt sich in der Sonne und fühlt sich wohl.«
Ich lache. Mara lacht. Dann löst sie sich von mir. Ich ahne, wie sich grau auf schwarz ihr Schattenriss entfernt. Ich stelle mir vor, dass Mara auf ihr Fahrrad steigt und losfährt, es ist ein gelbes Fahrrad, sagt sie, wie das Fahrrad des Postboten.
Ich sehe hinter meinen Augen, wie Mara an einem blauen Tag mit ihrem rosaroten Rucksack auf dem gelben Fahrrad den grünen Hügel hinunterradelt. Ich warte, bis sich das Bild auflöst.
Dann stehe ich auf, taste mich ins Freie, setze mich auf den Rasen vor Maras Haus und beginne, auf Maras Rückkehr zu warten.
Was Mara sagte:
Jedes Wort hätte uns ein wenig von dem genommen, was wir uns gegeben haben.
Der Satz gefällt mir, ich glaube, dass er wahr ist, obwohl Mara gelacht hat. Ich muss noch darüber nachdenken, obwohl ich gehofft habe, auf der Insel zu sein bedeute, nicht mehr nachdenken zu müssen.
Es ist schwieriger, als ich angenommen habe.
Etwas, das lange vergessen war:
Ein Mitschüler, der bei einer Bergwanderung in eine Schlucht stürzt. Es müssen die Herbstferien gewesen sein. Ich erinnere mich, wie einer meiner Freunde mir davon erzählt. Wir stehen in einem Garten. Ein großer Garten, der Rasen ist feucht und übersät mit gelben und roten Blättern. Türkisblaue Abenddämmerung.
Mein Freund sagt, der Mitschüler, der in eine Schlucht gestürzt ist, sei jetzt gelähmt und nicht mehr richtig im Kopf.
Wir stehen im Garten, in Trainingshosen, ich versuche, einen Fußball mit dem Finger zu balancieren. Wir sind außer Atem, wir haben eine Weile auf ein Tor aus Baumstämmen geschossen. Mir ist kalt, ich schwitze, und dann erzählt mein Freund das von unserem Mitschüler.
Der Junge, der jetzt angeblich gelähmt ist und nicht mehr richtig im Kopf, ist ein toller Fußballspieler. Wir haben als kleine Kinder schon gemeinsam in einer Mannschaft gespielt, und jetzt spielen wir in den Pausen in der Schule immer mit einem kleinen gelben Softball auf Tore aus Pullovern. Er ist mein Lieblingsmitspieler, er spielt mannschaftsdienlich, klug. Wenn ich ein Tor schieße, ist er immer der Erste, der mich beglückwünscht.
Mein Freund fragt, was ich zu der Sache sage, aber ich bringe kein Wort heraus. Ich lache. Ein Stechen im Magen. Mein Freund reißt mir den Ball aus der Hand und beginnt, um mich herumzudribbeln.
Später fahre ich mit dem Fahrrad nach Hause und denke, dass der Mitschüler, der in eine Schlucht gestürzt ist, eine Weile nicht mehr in der Pause mit uns Fußball spielen wird.
Das Hotel, in dem Mara arbeitet, ist ein senkrecht stehendes Rechteck, dessen Fassade bröckelt. Im höchstgelegenen Stockwerk gibt es einen breiten Balkon, den Mara mag, weil sie von ihm aus alles überblicken kann. Das Hotel steht am Rand der Insel und ist so grau wie die Klippen dort.
Der Junge, der in eine Schlucht gestürzt war, konnte nach seinem Unfall nicht mehr in die Schule gehen. Er war querschnittgelähmt und nicht in der Lage, sich zu artikulieren. Das hörte ich, als in den Pausen über ihn gesprochen wurde. Es wurde in den ersten Wochen nach den Herbstferien viel über ihn gesprochen. Ich hörte jedes Wort, ich sog die Worte in mich auf.
Ich fände es schön, die Insel würde nur aus Maras Holzhaus bestehen, aus dem grünen Hügel, aus unserem Bett und Maras rosarotem Rucksack und dem gelben Fahrrad und dem Rauschen des Meeres, und aus Sonne und Wärme und aus kalten Nächten und ab und zu einem Hagelschauer, der mich zum Lachen bringt.
Am Waldrand liegt ein kleiner Löwe, rekelt sich in der Sonne und fühlt sich wohl:
Mara ist nicht da, aber ihre Stimme ist in meinem Kopf, hell und klar, ich höre, wie sie die Worte in die Länge zieht, wie sie am Ende des Satzes, obwohl sie eine Aussage macht, eine Frage zu stellen scheint.
Auf einer Kostümparty habe ich ihn wiedergesehen. Er saß in einem Rollstuhl und war als Cowboy verkleidet. Ich konnte den Blick nicht von ihm abwenden. Eine Mitschülerin war die ganze Zeit bei ihm, viele haben ihn angesprochen und ihm auf die Schulter geklopft. Ich sah, dass er sich freute. Er verstand das meiste, und er konnte auch schon wieder ein wenig sprechen, langsam und undeutlich. Ich näherte mich, bis ich leise seine Stimme hörte.
Maras Hand, die über meinen Kopf streicht.
»Hast du die ganze Zeit auf mich gewartet?«, fragt sie, und ich nicke.
4
Ein Feuerwerk auf der Insel:
Ein Feuerwerk auf der Insel, über dem Wasser. Mara freut sich darauf und möchte, dass ich mitkomme, obwohl ich lieber in Maras Holzhaus bleiben würde. Wir laufen den Hügel hinunter, den Steg entlang, am Rand der Insel, auf den Lärm, auf die Klippen, auf das Wasser zu, über dem die kleinen Raketen explodieren sollen. Mara hat mich in einen Abendanzug gezwängt, führt mich wie einen Hund und redet auf mich ein. Sie ist aufgedreht, sie ist nicht bei mir, was sie sagt, verhallt, bevor ich die Bedeutung ihrer Worte greifen kann.
Der Gedanke, dass Mara irgendwann nicht zurückkehrt.
Stimmen, Lachen, klingende Gläser. Wir stehen auf weichem, feuchtem Sand. Es ist ein warmer Abend, dunkel, Menschen, fremd, ich kann ihre Schattenrisse nicht sehen, obwohl überall grüne, rote, gelbe, blaue Lichter brennen. Das hat Mara mir gesagt, die mich an der Hand nimmt und anderen vorstellt, die mir von Zeit zu Zeit zuflüstert, ich solle auch mal etwas sagen, die lacht und sich auf das Feuerwerk freut und nicht zu bemerken scheint, wie die anderen sich nähern, wie sie ihre Worte wägen, wie sie in ihr Lachen einstimmen, um Mara zu gefallen. Oder ist es Maras Spiel?
Irgendwann sagt Mara: »Komm!«
Sie zieht mich mit, so plötzlich, dass ich stolpere, ich muss ein lächerliches Bild abgeben, als ich versuche, mich aufzurichten, Mara lacht, andere lachen, vielleicht über mich, ich spüre den nassen Sand an meinen Fingern, und Mara ruft, dass sie mir etwas zeigen möchte. Sie schiebt mich durch eine Tür, eine Drehtür, die geölt werden müsste. Ich bin außer Atem, Mara zerrt mich weiter über eine Treppe, der Geruch von Verfall, mein Bein schlägt gegen die Stufen. Mara reißt mich nach oben, wenn ich strauchele.
»Jetzt komm schon, es fängt gleich an!«, sagt sie. Dann stehen wir wieder im Freien, ich höre in einiger Entfernung das Meer und das nervöse Stimmengewirr der Menschen. Mara lässt mich los, ich taste nach etwas, an dem ich mich festhalten kann. »Da ist ein Geländer«, sagt Mara ungeduldig und führt meine Hand. Ich spüre kaltes Metall.
»Wo sind wir?«
»Im Hotel, auf dem Balkon«, sagt Mara. »Von hier können wir am besten sehen. Das Feuerwerk fängt gleich an.«
Ich taste nach Maras Hand, aber ich kann sie nicht greifen. Weicht sie mir aus? Lächelt sie?
»Schau nur!«, sagt Mara. Ich höre die Explosionen, begleitet von Geschrei, das gedämpft nach oben dringt, und Mara lacht und lacht und ruft: »Schau nur! Die Farben! Alle Farben!«
Ich kneife die Augen zusammen, bis ich mir vorstellen kann, die Feuerwerkskörper als graue Sternschnuppen zu sehen.
Es dauert quälend lange.
Irgendwo tief unter mir höre ich einen Schrei, einen lang gezogenen Schrei des Entsetzens.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: