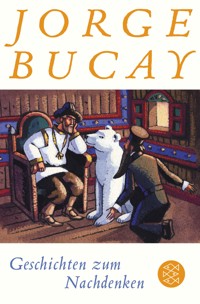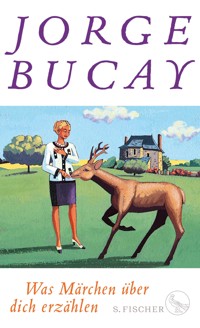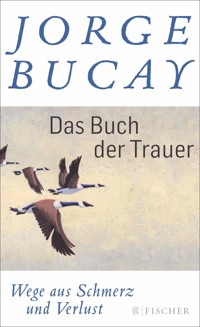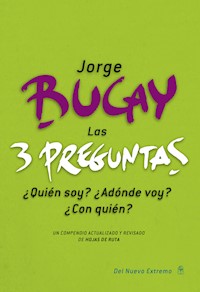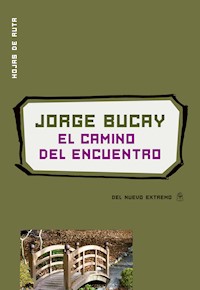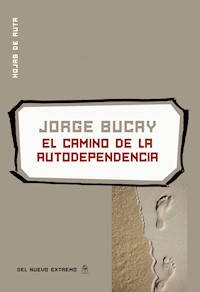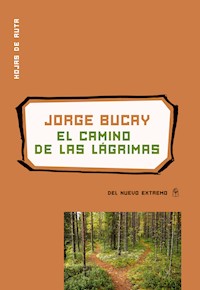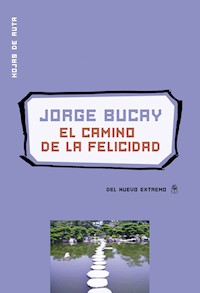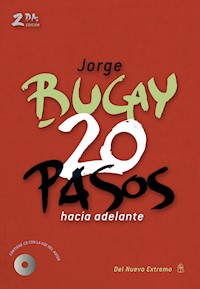9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Jorge Bucay, Autor des Weltbestsellers »Komm, ich erzähl dir eine Geschichte«, und sein Sohn Demián laden uns ein zu einer spannende Reise durch die einzigartige Beziehung zwischen Eltern und ihren Kindern. Kinder bereichern das Leben. Doch in jedem Kapitel der Beziehung zwischen Eltern und Kindern gibt es unterschiedliche Herausforderungen: Wie mit dem träumerischen kleinen Sohn umgehen, wie die große Tochter ins eigene Leben begleiten? Und was bedeutet es, wenn die Eltern älter werden? In ihrem ersten gemeinsamen Buch betrachten Jorge und Demián Bucay diese lebenslange Beziehung von der Geburt des Kindes bis zum Altwerden der Eltern. Und es ist ein Glück, dass beide aus ihrem reichen Erfahrungsschatz als Psychotherapeuten und als Väter schöpfen können. In persönlichen Anekdoten, in Romanen wie Hermann Hesses »Demian« oder in »Der kleine Prinz« und Filmen wie »Herr der Ringe«, »Der Pate« oder »Star Wars« finden sie Antworten – immer verständnisvoll und erhellend.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 299
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Jorge und Demián Bucay
Eltern und Kinder
Vom Gelingen einer lebenslangen Beziehung
Über dieses Buch
Eines Tages lauschte Demián Bucays Frau einer Unterhaltung zwischen ihrem Mann und dessen Vater, Jorge Bucay. Es ging um das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern, den schönen Seiten des Elternseins, den unterschiedlichen Herausforderungen, denen sich Eltern und Kinder in verschiedenen Phasen stellen müssen. »Warum schreibt ihr nicht Buch darüber, mit all eurer Erfahrung als Therapeuten, als Väter und Söhne?« Und so wurde dieses Buch geboren, »mein bislang bestes«, wie Bestsellerautor Jorge Bucay darüber sagt.
»Erziehung ist das, was wir tun können, um unsere Kinder dabei zu unterstützen, glücklich zu werden.« Jorge und Demián Bucay
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Jorge Bucay, 1949 in Buenos Aires geboren, ist einer der einflussreichsten Gestalttherapeuten seines Landes und international erfolgreicher Autor von Büchern wie »Komm, ich erzähl dir eine Geschichte«. Darüber hinaus ist er der Vater von Demián Bucay, der die gleiche Laufbahn eingeschlagen hat: Auch er ist Gestalt- und Psychotherapeut, Psychiater und Autor und Vater. »Eltern und Kinder. Vom Gelingen einer lebenslangen Beziehung« ist ihr erstes gemeinsames Buch, das auch ihnen so manche Einsicht bescherte.
Lisa Grüneisen, 1967 geboren, arbeitet seit ihrem Studium der Romanistik, Germanistik und Geschichte als Übersetzerin. Sie übersetzte unter anderem Bücher von Carlos Ruiz Zafón, Carlos Fuentes, Miguel Delibes, Alberto Manguel und Frida Kahlo.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Danksagung
Vorwort
1 Was heißt das: Eltern sein?
Von Wichtigem und Nebensächlichem
Zu Eltern wird man
Eine Frage der Entscheidung
2 Bedingungslose Liebe
Das Beste und das Schlimmste
Warum Kinder?
Der Instinkt
Gesellschaftliche Erwartungen
Der Wunsch nach etwas Bleibendem
Der wahre Grund
Eine einzigartige Liebe
Asymmetrische Verantwortung
3 Ambivalente Liebe
Idealisierung und Enttäuschung
Spuren, die bleiben
Ungehorsam sein und Wagnisse eingehen
So gut sie konnten
4 Was wir unseren Kindern mitgeben
Der Fokus
Sohn von …
Sohn oder Tochter sein
Die Eltern übertreffen
Die Eltern verleugnen
Das Erbe der Eltern fortführen
Sein oder Nichtsein (so wie die Eltern)
5 Erziehung
Das Ungenügen der Eltern
Der Erziehungsauftrag
Das »Was«: Inhalte versus Werte
Die fünf Kategorien von Eltern
Gleichgültige Eltern
Autoritäre Eltern
Laisser-faire-Eltern
Politisch korrekte Eltern
Gute Eltern
Die beiden Listen
Wie verhalten sich gute Eltern?
Wertschätzung zeigen
Hinweise geben
Hilfe anbieten
Und was ist mit den Jugendlichen?
6 Ein Beispiel sein – Eltern als Vorbild
Die drei Erziehungsmethoden
Vorbild sein
Was unsere Überzeugungen bewirken
Veranlagung oder Erziehung?
Gleiche Eltern – unterschiedliche Erziehung
Mit gutem Beispiel vorangehen
7 Lernen – Eltern als Lehrmeister
Lernen ist ein ständiger Prozess
Von der Möglichkeit, anderer Meinung zu sein
Man kann nichts erzwingen
Belohnen und Strafen
Unmittelbare Folgen
Langfristige Folgen
Die »Verbesserung«: Belohnen und nur belohnen
8 Die Motivationsmethode – Eltern als Wegweiser
Warum hört das Kind nicht?
Echte Motivation
Raum für Argumente
Vom Handeln und seinen Folgen
Von der Schwierigkeit, Fehler zuzulassen
Strategien entwickeln
Über Grenzen
Die Vorteile betonen
Alltagsszenen
Gefahren und Risiken
Schüler des Wahren und Guten
9 Wünsche und Erwartungen
Was die einen wollen und was die anderen
Sich nicht aufopfern
Das Symptom der doppelten Frustration
Trost bieten
Erwartungen und Ideale
10 Das Ende des Erziehungsauftrags
Wenn die Arbeit getan ist
Veränderte Bedingungen
Erwachsene Kinder
Der Heldenweg
Alternde Eltern
Wenn sich die Beziehung verändert
Ungebetene Ratschläge
Die Beziehung klären
Zum Schluss
Wenn die Eltern alt werden
Beglichene Rechnungen
Nachwort
Quellenverzeichnis
Filme
Bücher
Danksagung
Fabiana, erste Leserin, unbestechliche Korrektorin und unschätzbare Stütze.
Den Patienten, die uns die Erlaubnis gaben, ihre Geschichten in diesem Buch zu veröffentlichen.
José Rehin, wie immer.
Hugo Dvoskin, der so großzügig mit seinem Wissen und seiner Anerkennung ist.
Meinen Kindern, Wegweisern für meine Einstellung zum Elternsein und unfreiwilligen Leidtragenden meiner Mängel auf diesem Feld. (D.B.)
Claudia und ihrer wunderbaren Familie. (J.B.)
Vorwort
Ein gemeinsames Buch zu schreiben ist keine einfache Angelegenheit. Es bedeutet, Kompromisse zu finden oder, falls das nicht möglich ist, unterschiedliche Ansichten in gegenseitigem Respekt beizubehalten.
Es bedeutet auch, eine Arbeitsweise zu finden, bei der das, was da entsteht, vom einen zum anderen fließen und sich in diesem Fluss verändern kann.
Während der Arbeit an diesem Buch stellten wir erfreut fest, dass die Aufgabe, die wir uns gestellt hatten, exakt die Richtung nahm, die es brauchte, um eine Beziehung zwischen zwei Menschen zu schaffen.
Man kann nur dann von einer Beziehung sprechen, wenn aus der Begegnung zwischen dir und mir etwas Neues entsteht. Ein Wir, das sich vom Dir und vom Mir unterscheidet.
Als Therapeuten wissen wir, dass der Einzelne in einer gesunden Beziehung niemals vollständig in diesem Wir aufgeht. Ganz im Gegenteil werden das Ich und das Du respektiert und verstärkt.
In jeder gesunden Beziehung gibt es diese drei Instanzen: ich, du, wir. So auch in diesem Buch.
Deshalb findest du hier drei Arten von Texten. Einige stammen aus der Feder von Demián; darin erzählt er von den Erfahrungen mit seiner eigenen Familie und schildert seine Gedanken dazu. Andere sind in Gemeinschaftsarbeit entstanden – vierhändig und zweimündig sozusagen. Sie sind das Ergebnis von manchmal mehr, manchmal weniger kontroversen Gesprächen, die wir über die Inhalte und Zielsetzungen dieses Buches geführt haben. Einige wenige habe ich allein geschrieben. Es sind meine bescheidenen Anmerkungen und Überzeugungen, die vermutlich nicht immer die Zustimmung meines Sohns finden. Sie sind aus der Perspektive von dreißig Jahren mehr Lebenserfahrung geschrieben, einer Lebenserfahrung, die er irgendwann auch haben wird … In dreißig Jahren!
Vielleicht fragst du dich beim Lesen, aus wessen Feder was stammt. Deshalb haben wir unterschiedliche Typographien benutzt, die folgende, wenn ein Text von Demián stammt, und wieder eine andere, wenn ich spreche. Allerdings würden wir uns wünschen, dass beim Lesen irgendwann in den Hintergrund tritt, welcher Autor gerade spricht, und dass du dich auf deine eigene Leseerfahrung konzentrierst, um herauszufinden, was dir weiterhilft und was nicht.
Eines Tages verschwand der große und weise Laotse aus dem Tempel, in dem er täglich zu Tausenden Schülern sprach, die in den Gärten saßen und begierig seinen Worten lauschten. Wochenlang suchten seine treuesten Schüler die Umgebung ab und sandten schließlich Boten aus, die in ganz China nach ihm Ausschau halten sollten. Doch alle Bemühungen blieben vergeblich. Niemand wusste, wohin er gegangen war und warum. Keiner hatte ihn gesehen.
Einige Monate später wartete ein Händler am Ufer des Min-Flusses auf die Fähre, die ihn auf die andere Seite bringen sollte. Es wurde schon dunkel, als der Fährmann mit seinem einfachen Kahn anlegte und ihm die Hand reichte, um ihm an Bord zu helfen. Der Reisende gab ihm eine Münze und machte es sich für die Überfahrt bequem. Der alte Fährmann nahm das Geld entgegen, steckte es in seine Tasche, nickte zum Dank und machte dann die Leinen los.
Der Fluss floss ruhig dahin, und am Himmel prangte ein riesiger, strahlender Mond, der zum Reden einlud. Vielleicht begann der Reisende deshalb, von seinen Sorgen zu erzählen, von seiner Familie, den halbwüchsigen Kindern, seinen Geschäften. Der Fährmann hörte aufmerksam zu und machte so kluge Bemerkungen, dass der Reisende staunte.
Als sie das andere Ufer erreichten, gab der Mann dem Fährmann eine weitere Münze für seine Ratschläge, die dieser demütig annahm. In diesem Moment sah der Reisende zum ersten Mal das Gesicht des Mannes, der ihn über den Fluss gerudert hatte, und erkannte ihn.
»Du!«, rief er. »Du bist Laotse! Was machst du hier? Halb China ist auf der Suche nach dir. Deine Schüler sind verzweifelt und wollen sich nicht damit abfinden, dass sie auf deine täglichen Unterweisungen verzichten müssen.«
»Ohne es zu wollen, war ich auf einmal berühmt geworden«, sagte Laotse. »Die Menschen strömten von weit her herbei, um Rat und Hilfe zu suchen. Dass mir der Ruf eines weisen, erleuchteten Mannes vorauseilte, hatte zur Folge, dass die Wahrheit, die aus meinem Mund kommen mochte, hinter die Tatsache zurücktrat, dass ich es war, der sie aussprach.«
Der Reisende begriff immer noch nicht, warum Laotse weggegangen war, und sagte vorwurfsvoll:
»Aber Meister, wir können nicht auf dich und deine Weisheit verzichten. So viele dürsten nach deinen Worten, deinem Licht, deinen Ratschlägen.«
Laotse lächelte und sagte:
»Ich sage immer noch dieselben Dinge wie früher im Tempel, und auf den, der sie hört, haben sie wohl dieselbe Wirkung. Aber wenn dieser Jemand jetzt nach Hause kommt und erzählt, welche Erkenntnis er getroffen hat, sagt er nicht mehr voller Stolz, dass er das von Laotse gehört hat, sondern er sagt einfach: ›Das hat mir ein Fährmann erzählt.‹« J.B.
1Was heißt das: Eltern sein?
Von Wichtigem und Nebensächlichem
Bevor wir in diesem Buch über die Eltern-Kind-Beziehung sprechen, soll zunächst geklärt werden, was eine solche Beziehung überhaupt ausmacht. Was ist das Wesen des Elternseins? Was macht diese Rolle aus? Wie wird man zur Mutter oder zum Vater?
Um das zu definieren, muss man zunächst das Wesentliche vom Nebensächlichen unterscheiden – also das, was das Elternsein wirklich ausmacht, und das, was dazugehören kann, aber nicht muss.
Zur besseren Veranschaulichung möchte ich folgende Geschichte erzählen, in der es, passend zum Thema, um meinen jüngsten Sohn geht.
Der Kleine, ein niedlicher, blondgelockter Engel (diese Beschreibung ist natürlich absolut objektiv!), konnte noch nicht sprechen, da hatte er schon gelernt, sich das Handy ans Ohr zu halten und so zu tun, als würde er telefonieren: »Aaaa?«
Allerdings machte er anfangs dasselbe auch mit der Fernbedienung. Klare Sache: ein schwarzes, rechteckiges Ding mit vielen Tasten, ungefähr handtellergroß. Natürlich kapierte er bald, dass die Fernbedienung etwas anderes war, und begann damit vor dem Fernseher herumzufuchteln, statt sie sich ans Ohr zu halten. Zu dieser Zeit bekam er ein Spiderman-Spielzeugtelefon geschenkt. Dieses Spielzeugtelefon war rot, kleiner als ein echtes Telefon und ließ sich zuklappen (niemand bei uns zu Hause benutzt noch ein Klapphandy). Trotzdem klappte er es sofort auf und drückte auf den Tasten herum, worauf ein Klingelton und eine Stimme ertönten, hielt es sich ans Ohr und sagte klar und deutlich: »Aaaa?« Woher wusste der Kleine, dass dies ein Telefon war? Offensichtlich begriff er, dass ein Telefon weder schwarz noch handtellergroß noch rechteckig sein musste, noch musste es Tasten haben, aber es musste klingeln und eine Stimme ertönen. Das heißt, er unterschied das Wesentliche vom Nebensächlichen. Und er lag richtig: Ich habe Telefone in Form eines Fußballs gesehen, und Handys mit Touchscreen haben keine Tasten, aber alle klingeln und »sprechen«. Genau darin besteht das »Prinzip Telefon«. Darin liegt das Wesentliche; alles andere, ganz gleich, wie üblich es ist, sind Nebensächlichkeiten. Anders gesagt: Wenn du nicht klingelst und man nicht durch dich sprechen kann, bist du kein Telefon, tut mir leid.
Was also ist das Wesentliche am Elternsein? Was genau macht uns zu Eltern? Um diese Frage zu beantworten, greifen wir in gewisser Weise auf dieselbe Methode des Abgleichens zurück, die der Kleine aus der Geschichte anwendet, um herauszufinden, was ein Telefon ist und was nicht.
Im Jahr 2010 kam der US-amerikanische Film The Kids Are Allright in die Kinos, in dem eine der Figuren zwar der Vater ist, seiner Rolle aber nicht gerecht wird, und eine andere zwar nicht der Vater ist, aber dessen Position einnimmt. In dem Film geht es um die Frauen Nic und Jules, ein lesbisches Paar, und um ihre beiden Kinder, die achtzehnjährige Joni und den fünfzehnjährigen Laser. Gleich am Anfang erfahren wir, dass beide durch künstliche Befruchtung aus dem Samen ein und desselben Spenders entstanden sind (Hollywood eben!).
Laser, der gerade diese Phase des Erwachsenwerdens durchlebt, in der man auf der Suche nach sich selbst ist, möchte Kontakt zum biologischen Vater herstellen und überredet seine Schwester Joni, bei der Samenbank anzurufen und nach den Angaben zu fragen, weil man dafür volljährig sein muss. Joni gibt schließlich nach, nicht ohne zu betonen, dass sie es nur für ihn tut.
Wie sich herausstellt, ist Paul, der Samenspender, ein ziemlicher Kindskopf. Er fährt Motorrad, führt ein improvisiertes Bio-Restaurant und hat häufig wechselnde Beziehungen. Aber Jonis Anruf macht ihn neugierig, und er beschließt, sich mit den beiden zu treffen.
Die Begegnung ist für beide Kinder aufwühlend, auch wenn sie unterschiedlich reagieren. Während Laser, der hohe Erwartungen hatte, keine Gemeinsamkeiten mit seinem biologischen Vater erkennen kann, fühlt sich Joni von Pauls Freigeist angezogen. Als Jules und Nic von dem Treffen ihrer Kinder mit ihrem biologischen Vater erfahren, beschließen sie, Paul ebenfalls kennenzulernen.
Zunächst sind alle durcheinander. Laser hatte gehofft, durch Paul die männliche Seite zu entdecken, die er vermisst, Joni sieht in ihm die Projektion ihres Wunschs, sich von ihren Müttern abzunabeln, Nic fühlt sich in ihrer Autorität bedroht, und Paul selbst glaubt, dies sei die Gelegenheit, endlich Vernunft anzunehmen.
Am Ende enttäuscht Paul alle, inklusive sich selbst. Es wird klar, dass er der Situation nicht gewachsen ist, weil er eben nicht der Vater der Kinder ist, ganz gleich, wie viele Gene sie teilen.
Ein aufschlussreiches Gespräch zwischen ihm und Laser nimmt diesen Schluss bereits vorweg:
»Kann ich dich was fragen?«, sagt Laser.
»Klar.«
»Wieso hast du Samen gespendet?«
Das ist eine ganz entscheidende Frage. Man kann sich vorstellen, wie der Junge sie jahrelang mit sich herumgetragen hat, um sie genau in diesem Moment seinem biologischen Vater zu stellen. Paul versucht sich mit einem Witz herauszureden:
»Na ja, ich dachte, es macht mehr Spaß als Blut spenden.«
Aber Laser lacht nicht. Er will eine richtige Antwort.
»Ich hatte Leuten damit helfen wollen«, sagt Paul schließlich. »Weil sich viele Menschen zwar Kinder wünschen, aber es geht nicht …«
Es ist ein netter Versuch, aber Laser ist nicht überzeugt und hakt nach:
»Wie viel hast du dafür gekriegt?«
»Wieso willst du das wissen?«, fragt Paul zurück.
»Ich bin nur neugierig.«
Aber wir ahnen, dass es nicht nur Neugier ist. Als pubertierender Teenager lautet die Frage für Laser: Was bin ich wert?
»Der Satz war sechzig Dollar pro Becher«, sagt Paul schließlich.
»So wenig?«
»Das war viel Geld für mich«, entschuldigt sich Paul, »und mit der Inflation wären das heute neunzig Dollar …«
Aber natürlich ist Pauls Antwort nicht zufriedenstellend. Laser sucht in der Biologie nach Antworten auf Hunderte von Fragen, die sich nicht durch die Gene beantworten lassen, sondern nur mit dem Herzen. Auch Joni hat Paul zum Abschied etwas mitzugeben. Keine Frage, keinen Vorwurf, sondern einen Satz, der von ganz tief drinnen kommt. Sie sagt:
»Ich hätte mir nur gewünscht, du wärst … besser.«
Besser.
Wie, besser?
Sicherlich ein besserer Vater!
Es ist eine Erwartung, die Paul nicht erfüllen kann. Nicht weil er ein schlechter Mensch wäre. Er wirkt eher wie jemand, der vor einer Herausforderung steht, die er sich nicht ausgesucht hat und auf die er nicht vorbereitet ist. Er wird einfach ins kalte Wasser geworfen und bekommt gesagt: »Los, jetzt sei mal Vater.« Niemand, der bei klarem Verstand ist, würde mit etwas anderem rechnen als mit krachendem Scheitern.
Was folgern wir daraus?
Die Tatsache, dass Kinder die Erbinformationen ihrer Eltern in sich tragen, sie also »vom selben Blut sind«, ist ohne Frage ein wichtiger Aspekt der Elternschaft (nicht umsonst gibt es DNA-Tests, um eine Elternschaft juristisch nachzuweisen). Aber »wichtig« heißt eben nicht zwingend »notwendig«. Biologische Verwandtschaft macht uns nicht automatisch zu Müttern oder Vätern, und umgekehrt hindert uns ihr Fehlen nicht daran, Eltern zu sein.
Wenn es nicht die Chromosomen sind, was ist dann das Wesentliche am Elternsein?
Kommen wir noch einmal auf den Film zurück und zu der Frage, wer denn nun der Vater der Kinder ist.
Die These, dass Paul der Vater ist, weil er die Hälfte seiner Gene beigesteuert hat, haben wir bereits verworfen, weil wir zu dem Schluss gelangt sind, dass dieser Umstand nicht entscheidend ist.
Eine zweite Antwort wäre, dass die Kinder schlichtweg keinen Vater haben. Aber schon der Filmtitel widerspricht dieser Antwort. The Kids Are Allright. Ist es nicht so, dass Kinder für eine gesunde seelische Entwicklung eine Vater- und eine Mutterfigur brauchen? Suggeriert der Film, dass Kinder »okay« sein können, obwohl sie keinen Vater haben? Ich denke nicht. Wer den Film schon gesehen hat oder ihn anschaut, nachdem er das hier gelesen hat, wird sofort erkennen, wer im täglichen Leben die Rolle des Vaters einnimmt: Es ist Nic, eine der beiden Mütter. Sie geht jeden Tag zur Arbeit, sie ist die Ernährerin der Familie, diejenige, die strenger zu den Kindern ist, ihnen Grenzen setzt und moralische Werte vermittelt, diejenige, die am Kopfende des Tisches sitzt … Diejenige also, die nachdrücklich und liebevoll die Rolle des Vaters übernimmt und ausübt (eines ziemlich »klassischen«, archetypischen Vaters, ehrlich gesagt, aber eben die des Vaters). Die Aussage des Films lautet nicht, dass man auch ohne Vater »okay« sein kann; vielmehr stellt er in Frage, dass man dafür unbedingt ein Mann sein muss. Nic nimmt die Vaterfunktion ein, und so könnten wir sagen, dass sie der Vater ist, obwohl sie eine Frau ist. Dasselbe gilt natürlich auch umgekehrt: Frau zu sein ist keine Grundvoraussetzung für Mutterschaft, auch wenn es die Regel ist. Auch ein Mann kann gegebenenfalls sehr gut die Mutterrolle ausfüllen.
Zu Eltern wird man
Die Kunst, ein guter Vater oder eine gute Mutter zu sein, besteht vor allem darin, diese Aufgabe angemessen zu erfüllen. Zu Eltern wird man, indem man als Eltern handelt, denkt und fühlt. Ein Kind geboren zu haben reicht nicht aus, um sich als Eltern zu betrachten, und folglich auch nicht, um von den Kindern als solche anerkannt zu werden.
Ich bin der Ansicht, dass zum Vater- oder Muttersein mindestens drei Dinge gehören, die durch unser Umfeld, unsere Gefühle und unser Verhalten bestimmt werden: der gesellschaftliche Status als Eltern, die elterliche Liebe und die Ausübung der elterlichen Pflichten. Drei Dinge, die nicht von unbegrenzter Dauer sind, wie wir so gerne glauben, und die zudem selten gleichzeitig beginnen oder enden.
Ich muss hier an Edgar Rice Burroughs’ Geschichte von Tarzan denken, an Mogli, den Jungen aus Rudyard Kiplings Dschungelbuch, und an viele ähnliche Figuren, die als Waisenkinder von einem Muttertier oder einer Herde adoptiert werden, die sich um sie kümmert, sie ernährt und beschützt, aber auch erzieht. Sie sind keine »tierischen Babysitter«, sondern richtige Ersatzväter und -mütter für das jeweilige Kind.
Ich persönlich kenne niemanden, der von Affen oder Wölfen aufgezogen wurde, aber es kommt gar nicht so selten vor, dass eine Person von außerhalb der Familie oder gar eine Institution die Vater- oder Mutterrolle einnimmt. Ich lernte einmal einen Mann kennen, dessen leibliche Mutter sich nicht um ihn kümmern konnte und ihn deshalb in die Obhut einer Tante gab, die bereits eine ganze Kinderschar zu versorgen hatte. Dieser Mann erzählte in der Therapie, dass er von klein auf jeden Tag zu einem Fußballplatz ging, der sich ein paar Straßen weiter befand, und den Großteil seiner Zeit dort verbrachte. Irgendwann blieb er auch zum Essen dort und unterhielt sich stundenlang mit den Leuten aus dem Verein. Ich habe keinen Zweifel, dass er diesen Verein als Erwachsener mit einem ähnlichen Gefühl der Verbundenheit und Dankbarkeit betrachtete, wie andere Menschen sie für ihre Eltern empfinden. Ein Gefühl, das nicht schwer zu verstehen ist, wenn man seine Geschichte kennt, und das man als Außenstehender dennoch nicht nachempfinden kann. Tatsächlich kam der Mann unter anderem in meine Praxis, weil er ständig Streit mit seiner Frau hatte, die eifersüchtig darauf war, wie viel Zeit und Aufmerksamkeit er seinem geliebten Verein widmete (und ja, es ist ganz natürlich, dass man früher oder später mit seiner Schwiegermutter hadert!).
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Eltern die Menschen sind, die dich großgezogen haben. Aber das ist nicht die ganze Wahrheit. Was noch hinzukommt, ist die bewusste Entscheidung, die Verantwortung für ein Kind zu übernehmen.
Nach unserem Verständnis sind Vater und Mutter nicht nur die Personen, die dich versorgt, gekleidet, beschützt und erzogen haben. Sie haben vor allem eine bewusste Entscheidung getroffen: »Dies ist mein Sohn, dies ist meine Tochter, und ich werde für sie sorgen mit allem, was dazugehört.« Dabei muss betont werden, dass dieser willentliche Vorgang des Annehmens aus freien Stücken auch und gerade dann notwendig ist, wenn es sich um ein leibliches Kind handelt, denn:
Um wirklich Vater oder Mutter zu sein, muss man seine eigenen Kinder annehmen, sie adoptieren.
Auch wenn wir uns mit dieser Aussage keine Freunde machen, weil sie allem widerspricht, was die meisten Menschen gelernt haben, sind wir der festen Überzeugung, dass jedes Kind in diesem Sinne »adoptiert«, also angenommen wurde. Wir glauben, dass es irgendwann im Leben einen Moment gibt, in dem Vater und Mutter, jeder für sich und vielleicht nicht zum selben Zeitpunkt, beschließen, ihr Kind als zu sich gehörig anzusehen, als Verlängerung und Teil ihrer selbst, als ihr eigen Fleisch und Blut. Entschieden schwerer zu verdauen ist, dass diese Entscheidung für das eigene Kind keine »natürliche« ist; sie geschieht nicht von allein und ergibt sich nicht automatisch aus der Tatsache, dass sie dieses Kind gezeugt, geboren und offiziell anerkannt haben.
Bei den meisten Frauen findet diese »Adoption« im Laufe der Schwangerschaft statt. Wenn die Mutter das Kind nach der Geburt in den Armen hält, hatte sie schon genügend Zeit, das Neugeborene als ihr Kind anzunehmen. Für den Vater (auch das gilt für die Mehrheit, nicht für alle) gestaltet sich der Prozess ein bisschen schwieriger, vielleicht, weil die intensive Bindung zum Kind fehlt, die eine Schwangerschaft für die Mutter mit sich bringt. Solange sich das Kind im Mutterleib befindet, spürt der Mann das Baby nicht, er ist nicht tagtäglich vierundzwanzig Stunden mit ihm in Kontakt, vierzig Schwangerschaftswochen lang. Für den Vater ist das Kind zunächst nur eine Idee, eine Vorstellung, die langsam heranreift. Die Geburt ändert erst einmal nichts an diesem Gefühl. In den ersten Lebensmonaten des Kindes ist der Vater kaum mehr als eine undeutliche Gestalt, die manchmal neben der Mutter steht. Das Neugeborene hat nur Augen, Hände und ein Lächeln für seine Mutter, die es stillt, die mehr Zeit mit ihm verbringt und deren Geruch und Stimme ihm vertraut sind. Der Mann bleibt häufig ein wenig außen vor, was die Beziehung zu seinem Kind angeht, oder er schließt sich selbst aus. Die Ursache dafür liegt sowohl in der Biologie wie auch in gesellschaftlichen Übereinkünften begründet.
Auch wenn Väter heute in der Regel versuchen, sich in dieser Phase aktiv einzubringen, als wollten sie intuitiv den Adoptionsprozess beschleunigen, liegt die Hauptverantwortung dafür, dass dieser Prozess des Annehmens gelingt, vor allem bei der Mutter. Sie ist diejenige, die dem Partner Raum geben muss. Nur wenn sie sich ein wenig zurücknimmt und etwas von ihrer Fürsorge abgibt, kann sich die Bindung zwischen Vater und Kind festigen.
Als mein ältester Sohn zur Welt kam, musste er zunächst auf die Neonatologie, weil er drei Wochen zu früh geboren wurde (meine Frau hatte eine Schwangerschaftsgestose) und seine Lunge noch ein wenig Zeit und Sauerstoff benötigte, um sich vollständig zu entwickeln. Eine Krankenschwester bat mich, mitzukommen, als sie das Kind zur Station brachte, und wies mich an:
»Sie bleiben hier bei dem Kleinen, bis es ihm bessergeht.«
Ich gehorchte, weniger weil ich überzeugt war, dass es das Richtige war, sondern weil ich nicht wusste, was ich sonst tun konnte. Da saß ich nun allein mit diesem Baby, das mit seinem Händchen einen meiner Finger umklammerte, schaute es an und sagte mir: »Das ist also mein Sohn …« Ich sah ihn wieder und wieder an und stellte erstaunt fest, dass ich dieses Wesen überhaupt nicht kannte. Ich empfand nicht diese Welle von Liebe, von der ich dachte, sie würde mich überrollen. Wenn ich ehrlich bin, hätte ich lieber gewusst, wie es meiner Frau ging, die gerade einen Notkaiserschnitt hinter sich hatte. Schließlich wagte ich es, eine der Schwestern zu fragen:
»Kann ich ein paar Minuten zu meiner Frau?«
»Nein. Der geht’s gut«, sagte die Schwester kurz angebunden. »Sie bleiben hier.«
»Aber …«, begann ich, doch der strenge Blick der Krankenschwester genügte, um zu begreifen, dass meine Bitte weder Gehör finden würde noch moralisch vertretbar war.
Eine Stunde, die mir wie eine Ewigkeit vorkam, saß ich dort und hielt die Hand des Kindes, das immer mehr zu meinem Sohn wurde, dann kam der Kinderarzt herein und horchte das Baby ab. Er lächelte und sagte, die Atmung habe sich normalisiert, ich könne nun zu meiner Frau. Als ich das Kind in die Arme der Krankenschwester legte und das Zimmer verließ, spürte ich plötzlich eine tiefe emotionale Verbundenheit und die unumstößliche Gewissheit, dass dieses Kind mein Sohn war, mit allem, was das mit sich brachte.
Nicht wenige Männer plagen in diesen ersten Momenten heftige Schuldgefühle, weil sie für ihr Kind nicht die unbändige Liebe empfinden, die sie doch angeblich empfinden müssten. Diese Liebe, von der alle immer erzählen, auch ihre eigenen Väter, wenn sie vom Tag der Geburt berichten.
Die folgende, angeblich wahre Geschichte hat nichts mit Eltern und Kindern zu tun, aber vielleicht hilft ihr Witz uns trotzdem zu verstehen, wie manche Dinge laufen.
Ein älterer Herr kommt auf seinen Stock gestützt zum Arzt.
»Doktor«, sagt er, als er dem Arzt gegenüber Platz nimmt, »Sie müssen mir helfen. Ich glaube, ich habe ein ernsthaftes Problem …«
»Dann erzählen Sie mal, worum es geht.«
»Sehen Sie, Doktor, ich wohne ein paar Straßen von hier, direkt am Park. Jeden Freitag treffe ich mich mit ein paar Bekannten aus dem Viertel in der Kneipe an der Ecke, und dann prahlen alle mit ihren sexuellen Abenteuern.«
»Und wo ist das Problem?«
»Na ja, Serafín ist fünfundachtzig und hat eine vierzigjährige Freundin, die ihn fast um den Verstand bringt. Sie will die ganze Zeit Sex, und um sie nicht zu verlieren, bleibt ihm nichts anderes übrig, als sie jedes Mal zu befriedigen, wenn sie Lust hat. Er hat jeden Tag Sex, manchmal sogar zweimal täglich … Der alte Berto, der Älteste in der Runde und ein überzeugter Junggeselle, behauptet, dass er sich mit dem Zimmermädchen aus dem Hotel de la Avenida trifft, mit der Tochter des Ladenbesitzers und mit einer früheren Freundin und dass er mit allen Sex hat … Selbst bei meinem alten Schulfreund Juancito, er ist fünfundachtzig wie ich, steht uns jedes Mal der Mund offen, wenn er erzählt, wie oft und wie leidenschaftlich er Sex hat …«
»Und?«, fragt der Arzt, dem immer noch nicht klar ist, worauf der Mann hinauswill.
»Na ja, meine Frau und ich sind seit zweiundfünfzig Jahren verheiratet. Ich liebe sie und finde sie nach wie vor attraktiv. Wir schlafen noch immer miteinander, heute zum Beispiel, und haben beide großen Spaß daran, aber ehrlich gesagt komme ich danach ein, zwei Wochen nicht mal auf die Idee, es wieder zu tun. Und dann höre ich meine Freunde reden und schäme mich beinahe für meine armseligen Bemühungen im Bett. Was soll ich tun, Doktor?«
»Ganz einfach, mein Freund. Lügen Sie auch!«
Aber beim Elternsein geht es nicht darum, sich selbst etwas vorzumachen und an dem alten Mythos festzuhalten, dass Blut dicker ist als Wasser. Wenn wir einsehen würden, dass diese Zeit des Annehmens ein normaler, gesunder Prozess ist, wäre es leichter für uns, eine enge, gute Bindung zu unseren Kindern zu schaffen.
Manchmal, wie in dem Beispiel mit dem zu früh geborenen Baby, bringt ein einziges Ereignis die Wende, andere Male (und das ist weitaus häufiger) dauert es ein bisschen länger, manchmal sogar Monate. Aber wenn wir Geduld haben und keine Gefühle erzwingen wollen, sondern alles auf uns zukommen lassen, wird die Beziehung inniger und stärker werden, je mehr Zeit wir miteinander verbringen, bis schließlich jene einzigartige, unauflösliche Bindung entsteht, die das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern ausmacht.
Erinnern wir uns an die erste Begegnung zwischen Antoine de Saint-Exupérys kleinem Prinzen und dem Fuchs:
Der kleine Prinz möchte mit dem Fuchs spielen, doch der antwortet, dass er nicht mit ihm spielen könne, weil er noch nicht gezähmt sei.
»Was bedeutet ›gezähmt‹?«, fragte der kleine Prinz.
»Das ist eine Sache, die in Vergessenheit geraten ist«, sagte der Fuchs. Es bedeutet: ›eine Bindung eingehen‹. Noch bist du für mich nur ein kleiner Junge wie hunderttausend andere kleine Jungen. Ich brauche dich nicht, und du brauchst mich nicht. Ich bin für dich nur ein Fuchs wie hunderttausend andere. Aber wenn du mich zähmst, werden wir einander brauchen. Dann wirst du für mich einzigartig sein auf der Welt. Und ich werde für dich einzigartig sein … Wenn du einen Freund willst, zähme mich.«
»Wie soll ich das anstellen?«, fragte der kleine Prinz.
»Du musst geduldig sein«, antwortete der Fuchs. »Erst setzt du dich in einiger Entfernung von mir ins Gras. Ich werde dich aus den Augenwinkeln betrachten, und du wirst nichts sagen. Aber jeden Tag kannst du dich ein bisschen näher von mir hinsetzen …«
Darum geht es: eine Bindung mit unseren Kindern eingehen. Ein Band zwischen uns zu knüpfen, das uns die Gewissheit gibt, dass unsere Kinder einzigartig für uns sind und wir für sie. Das ist es, was uns zu Eltern macht, nicht die gemeinsamen Gene.
Eine Frage der Entscheidung
Folgende Situation wird des Öfteren als problematisch heraufbeschworen, obwohl sie es eigentlich gar nicht ist: Nachdem ein Mann viele Jahre zusammen mit seiner Frau das gemeinsame Kind erzogen hat, erfährt er »die Wahrheit«, dass dieses Kind nämlich nicht seines ist. Verständlicherweise kann dieser Mann nun der Mutter des Kindes Vorwürfe machen, weil sie ihn angelogen hat. Aber dem Kind gegenüber ändert sich nichts: Er ist und bleibt der Vater, denn er hat dieses Kind erzogen und die Entscheidung getroffen, die Vaterrolle zu übernehmen. Es wäre keine Option, nun aus verletztem Stolz oder damit die Mutter »nicht damit durchkommt« nicht länger der Vater sein zu wollen. Er kann die Bindung, die entstanden ist, nicht einfach kappen, und falls er aus irgendeinem Grund doch den Kontakt abbricht, wird er furchtbar leiden. Wenn eine Frau oder ein Mann ein Kind verlässt, ohne darunter zu leiden, liegt dem wahrscheinlich eine schwere seelische Störung zugrunde, oder aber die Person war diesem Kind niemals Mutter oder Vater gewesen.
Hier sei auf das berühmte Urteil König Salomos verwiesen, von dem im 1. Buch der Könige im Alten Testament berichtet wird. Salomo war der Sohn König Davids und der Überlieferung nach ein weiser Mann. Wenn es Streit unter seinen Untertanen gab, fragten sie ihn um Rat, weil sie darauf vertrauten, dass durch sein Urteil wieder Ruhe und Frieden einkehrten.
Eines Tages kamen zwei Frauen zu ihm, die beide kürzlich ein Kind zur Welt gebracht hatten; aber während das eine Kind lebte und wohlauf war, war das andere bei der Geburt gestorben. Beide Frauen beteuerten nun, die Mutter des lebenden Kindes zu sein, und wandten sich an König Salomo.
Der weise König hörte sie an, und da jede von ihnen auf ihrer Aussage beharrte, sprach er:
»Schluss mit dem Jammern und Klagen! Man bringe mir ein Schwert; da beide im Recht zu sein scheinen, möge man das Kind in der Mitte teilen und jeder von ihnen eine Hälfte geben.«
»Dann soll es so sein«, sagte die erste Frau. »Die da wird mein Kind jedenfalls nicht bekommen.«
»Nein«, rief darauf die zweite. »Hört auf! Tut ihm nicht weh. Gebt ihr das Kind.«
Da sah Salomo die zweite Frau wohlwollend an, wies mit dem Finger auf sie und befahl:
»Gebt dieser Frau das Kind. Sie ist die Mutter.«
Üblicherweise wird die Geschichte so verstanden, dass Salomo eine Art Trick anwandte, um herauszufinden, wer die wahre Mutter ist und wer eine Lügnerin. Ich denke, dass Salomo nicht von detektivischem Scharfsinn geleitet wird, von tiefer Weisheit (es heißt, dass Salomo weise war, nicht schlau …). Es geht nicht darum, dass die echte Mutter lieber ihr Kind hergeben würde, als ihm Schaden zuzufügen, sondern darum, dass diejenige, die auf das Kind verzichtet (welche von beiden es auch ist), genau aus diesem Grund die wahre Mutter ist. Diese Frau wird zur Mutter, indem sie entscheidet, es lieber wegzugeben, als dem sicheren Tod auszuliefern, und die andere schließt sich selbst als Mutter aus, weil sie das Kind lieber tot sieht als bei der anderen Frau. Dabei könnte die Frau, die einwilligt, das Kind zu teilen, durchaus die biologische Mutter sein. In diesem Sinne enthüllt das Urteil nicht zwingend die »Wahrheit«; aber mit Sicherheit hat Salomo die Frau gefunden, die das Kind mehr liebt, und das macht sie zu seiner wahren Mutter.
In einem kleinen Dorf kamen zwei Frauen zum Bürgermeister, der gleichzeitig auch der Dorfrichter war. Beide behaupteten, die Mutter eines Kindes zu sein, das man unten am Fluss gefunden hatte.
Der Mann war nicht besonders klug, aber er hatte in der Bibel die Geschichte von Salomo gelesen und wollte dem Weisesten aller Weisen nacheifern.
»Hört auf zu streiten!«, befahl er. Da er weder ein Schwert besaß noch Soldaten hatte, ließ er den Metzger holen und befahl ihm: »Hack das Kind in der Mitte entzwei und gib jeder dieser Frauen eine Hälfte.«
Die beiden Frauen sahen sich verdutzt an, und die Dorfbewohner verstummten. Nur der Metzger begehrte auf, als er begriff, was man von ihm verlangte:
»Das ist Wahnsinn … Ich soll ein Kind in der Mitte durchhacken? Bist du verrückt geworden? So was mache ich nicht!«
Der Bürgermeister lächelte zufrieden. Dann erhob er sich und verkündete feierlich:
»Der Fall ist gelöst. Der Metzger ist die Mutter!«
Scherz beiseite: Elternschaft, so lässt sich abschließend festhalten, beruht auf der bewussten Entscheidung, diese Funktion auszuüben. Sie ist kein naturgegebener Rang und kein Orden, den man sich einfach an die Brust heftet.
2Bedingungslose Liebe
Das Beste und das Schlimmste
Erst wenn wir selbst Eltern werden, können wir nachvollziehen, wie treffend die Aussage derer ist, die uns diese Erfahrung voraushaben, nämlich dass Elternsein (das gilt für Mütter wie Väter) etwas ist, das sich nur schwer beschreiben lässt.
Erst jetzt merken wir, wie viel Wahrheit in so manchem dieser Sätze steckt, die sie uns mitgegeben haben. Sätzen wie diesem: »Das erste Kind verändert dein ganzes Leben.«
Jede frischgebackene Mutter, jeder frischgebackene Vater würde das unterschreiben. Noch bevor wir unser Kind »adoptieren«, wie wir es im vorigen Kapitel nannten, spüren, ahnen, erkennen wir, dass unser Leben nie mehr so sein wird wie vorher. Etwas hat sich radikal verändert.
Ein guter Freund, vierfacher Vater, formulierte es etwas anders, sehr treffend und noch viel beunruhigender:
»Vater sein ist das Beste, was dir im Leben passieren kann … Und das Schlimmste.«
Das Beste wegen all dem, was wir schon längst wissen: Da ist das Gefühl der Erfüllung, wenn wir unsere Kinder ansehen oder im Arm halten. Die Freude, sie lachen zu hören. Die tiefe Rührung, wenn wir sie bei ihren Entdeckungen begleiten. Das große Glück, sie zu einzigartigen Persönlichkeiten heranwachsen zu sehen.
Und das Schlimmste, weil all das auch eine Kehrseite hat: den Schmerz, sie leiden zu sehen, die Sorge, nicht zu wissen, wie man ihnen helfen kann, die bodenlose Angst, ihnen könnte etwas zustoßen.
Mein ältester Sohn hatte uns überredet, ihm ein Mofa zu kaufen. Ich war der Überzeugung, dass er ganz gut auf sich aufpassen konnte, und war nicht beunruhigt, wenn er mit seinem klei- nen Flitzer im Viertel herumfuhr. An jenem 14. Dezember war ich allein zu Hause, als das Telefon klingelte.
»Jorge?«, fragte eine Stimme.
»Ja, wer ist da?«