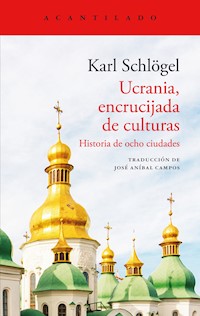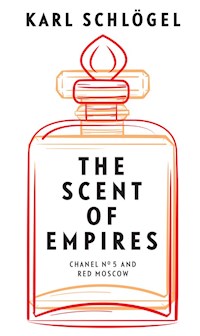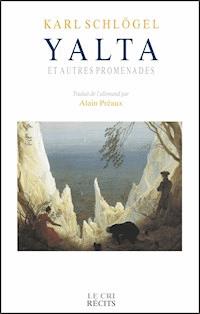Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hanser, Carl
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Was macht die Ukraine aus? Erst mit der russischen Annexion der Krim entwickelte sich ein Bewusstsein für die Eigenständigkeit dieses Landes, das nach dem Willen der Aggressoren nun von der Landkarte verschwinden soll. Seit vielen Jahren ist Karl Schlögel in der Ukraine unterwegs, seine ukrainischen Lektionen von 2015 ergänzt er nun um einen großen Essay über den Krieg, der sich gegen die Idee der Freiheitlichkeit überhaupt richtet. Lemberg, Odessa, Czernowitz, Kiew, Charkiw, Mariupol: All diese Namen, die sich nun mit Schreckensnachrichten verbinden, stehen eigentlich für eine offene, vielfältige Welt, die der Westen viel zu lange ignoriert hat. Wer wirklich wissen will, was in Europa auf dem Spiel steht, muss auf die Ukraine schauen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 549
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Was macht die Ukraine aus? Erst mit der russischen Annexion der Krim entwickelte sich ein Bewusstsein für die Eigenständigkeit dieses Landes, das nach dem Willen der Aggressoren nun von der Landkarte verschwinden soll. Seit vielen Jahren ist Karl Schlögel in der Ukraine unterwegs, seine ukrainischen Lektionen von 2015 ergänzt er nun um einen großen Essay über den Krieg, der sich gegen die Idee der Freiheitlichkeit überhaupt richtet. Lemberg, Odessa, Czernowitz, Kiew, Charkiw, Mariupol: All diese Namen, die sich nun mit Schreckensnachrichten verbinden, stehen eigentlich für eine offene, vielfältige Welt, die der Westen viel zu lange ignoriert hat. Wer wirklich wissen will, was in Europa auf dem Spiel steht, muss auf die Ukraine schauen.
Karl Schlögel
Entscheidung in Kiew
Ukrainische Lektionen
Aktualisierte und erweiterte Neuausgabe 2022
Hanser
»Für Eure und unsere Freiheit« Vorwort zur Neuausgabe
Die Nebel haben sich gelichtet. Nicht in eine lange Friedenszeit sind wir dreißig Jahre nach 1989 eingetreten, sondern in eine neue Vorkriegszeit. Der Krieg, der mit der russischen Besetzung der Krim im Frühjahr 2014 seinen Anfang nahm, ist endgültig und offen in Europa angekommen. Eine Armee von 150.000 Mann überschritt am 24. Februar 2022 aus vier Richtungen kommend die ukrainische Grenze, in der Hoffnung, das Land in einem Blitzkrieg niederzuwerfen und zu besetzen. Aber die Einnahme Kiews misslang, die Regierung hielt stand, das ukrainische Volk leistete heldenhaft Widerstand. Die russischen Angreifer konzentrierten nun ihre ganze Kraft auf die vollständige Eroberung des Donbass, die Herstellung der Landbrücke zur Krim und die Zerstörung der Lebensgrundlagen der noch freien Ukraine. Damit war ein Krieg entfesselt, der erklärtermaßen die Vernichtung des ukrainischen Staates, die Unterjochung der Ukraine und die Vernichtung ihrer Kultur zum Ziel hat. Was niemand sich noch vorzustellen gewagt hatte, war eingetreten. Raketen und Bomben gingen auf Großstädte nieder, Wohnviertel, Infrastrukturen und Versorgungseinrichtungen für Wasser und Elektrizität, Pipelines, Bahnlinien und Verkehrsknotenpunkte wurden gezielt angegriffen und zerstört. Atomkraftwerke gerieten zwischen die Kriegsfronten. Ein ganzes Volk, Millionen Menschen, die sich über die Grenze der Nachbarländer in Sicherheit brachten, Frauen, Kinder und alte Menschen, eine Fluchtbewegung, wie es sie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht gegeben hatte. Millionenstädte von Einschließung und Aushungern bedroht, die Einwohner monatelang in Keller und U-Bahnschächte geflohen, Städte und Dörfer geplündert und von den Spuren entsetzlicher Gräuel gezeichnet. Die Beschuldigungen, mit denen Putins Propaganda arbeitete — in der Ukraine werde ein Genozid an den dort lebenden Russen verübt, die Regierung bestehe aus Nazis und Drogenabhängigen, die Ukraine müsse denazifiziert und demilitarisiert werden —, waren so aberwitzig wie die Zerstörungen, die die russischen Invasoren anrichteten, monströs und auf Jahrzehnte hinaus irreparabel. Putins Russland hatte sich Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschheit schuldig gemacht, und es wird der Tag kommen, an dem es dafür zur Rechenschaft gezogen werden und den Preis dafür zu bezahlen haben wird.
Es bedurfte eines offenen und völkermörderischen Krieges, um ein Land wahrzunehmen, das immer noch — trotz der nicht einmal ein Jahrzehnt zurückliegenden Okkupation der Krim und der seither anhaltenden Kämpfe im Donbass — am Rande der Aufmerksamkeit der Europäer geblieben war. Nun gab und gibt es Bilder vom Schlachtfeld Ukraine in Nahaufnahme: von getöteten Zivilisten, die am Straßenrand liegen geblieben sind, Drohnen- und Satellitenbilder, auf denen man mit bloßem Auge zerstörte Wohngebiete, Fabrikanlagen und Massengräber identifizieren kann. Es ist die Stunde der Korrespondenten vor Ort, die uns Belagerung, Blockade, die Bewegung der Frontlinien im Detail vor Augen führen und die Zahlen der Opfer und Geretteten nennen. Noch nie ist die Welt draußen so unmittelbar mit dem Geschehen vor Ort verbunden gewesen. Ein Land, das man sich in Friedenszeiten nach und nach erschließen konnte, nehmen wir nun in Kriegszeiten im Stakkato der Breaking News wahr. Es ist der Rhythmus, den die Sirenen des Bombenalarms diktieren, es sind die Bilder vom Ausnahmezustand, vom Ende der Normalität in einem normalen europäischen Land. Momentaufnahmen eines zivilisatorischen Bruchs. Die Gesellschaft, die sich einst auf dem Majdan versammelt hat, ist wehrhaft geworden, der Alltag der Zivilisten ist abgelöst vom Alltag des Kriegszustands. Eine revolutionäre Levée en masse, überzeugender als jedes historische Lehrbuch.
Mein im Jahre 2015 erstmals erschienenes Buch »Entscheidung in Kiew« stellte so etwas wie eine Erkundung des Landes dar, das mit dem russischen Angriff auf der Krim und im Donbass schlagartig in den Blick gerückt war und einen Prozess des Neubedenkens ukrainischer und vor allem russischer Geschichte ausgelöst hatte. Meine Erkundung und Aneignung der Ukraine erfolgte nicht in einer nationalgeschichtlichen Erzählung, von der es ausgezeichnete Beispiele gibt, auf die sich auch dieses Buch stützen konnte, sondern in einer Art der Begehung, der landeskundlichen Exploration, des Wanderns von Ort zu Ort. Dieses Vorgehen verdankt sich nicht einem methodischen Vorsatz, dem ich seit Jahren folge — gemäß dem Motto »Im Raume lesen wir die Zeit« die Geschichte entlang und anhand von Orten zu erforschen und zu erzählen —, sondern es scheint mir auch am besten geeignet, die Vielschichtigkeit und Heterogenität der Ukraine als ein »Europa im Kleinen« erfahren und beschreiben zu können. Ukrainische Städtebilder ergeben das Mosaik, aus dem sich die Ukraine zusammensetzt, und worin gerade ihr spezifischer Reichtum liegt — nicht nur die Gespaltenheit und Heterogenität, die oft als Zeichen ihrer Schwäche und Verwundbarkeit interpretiert wird. Die im Buch zusammengefassten Erkundungen spiegeln den Zustand vor dem Krieg wider, zeigen ein Land, das dabei war, sich in all seinen Widersprüchen neu zu entdecken und zu erfinden und dabei trotz des schweren sowjetischen Erbes neue Kräfte freisetzte. Diese Situation des take-off der in die Unabhängigkeit und Freiheit entlassenen Ukraine ist von dem Krieg eingeholt, damit aber nicht entwertet worden. Eher umgekehrt: Es wird jetzt noch deutlicher, was für die Ukraine auf dem Spiel steht, wenn sie mit Gewalt erneut dem Imperium — sei es russisch, sowjetisch oder postsowjetisch — einverleibt würde: ihre Existenz als freie und souveräne Nation. Die vom russischen Krieg ausgelösten Zerstörungen und Verwüstungen führen nur noch drastischer vor Augen, was Europa verlieren würde und was auf Europa zukäme, ginge die Ukraine in die Knie.
Den ukrainischen Lektionen, von denen im Untertitel des Buches aus dem Jahre 2015 die Rede war, sind weitere Lektionen hinzugefügt worden. Lektionen, die kein Lehrbuch, sondern nur eine grausame Wirklichkeit erteilt. Die Raketen, die auf Odessa und Charkiw abgefeuert werden, zielen auf europäische Städte, auf uns. Es liegt an uns, eine Entscheidung zu treffen. Wir werden nicht länger ungestraft der Illusion anhängen können, nichts damit zu tun zu haben. Wir werden uns, je härter und je länger der Kampf gegen die russische Aggression anhält, auf Entbehrungen und Opfer, in welcher Form auch immer, einstellen müssen. Wir kommen um die Entscheidung, die Kiew getroffen hat, nicht herum: Es ist die Entscheidung darüber, ob wir uns unterwerfen oder Widerstand leisten werden.
Der Krieg hat uns längst erreicht — er reicht bereits in unser aller persönlichstes Leben hinein: in die Diskussionen im Familien- oder Freundeskreis, in das Pro und Contra um die Form des Engagements für das bedrohte Land, in die Hilfeleistung für die aus dem Land Geflohenen, in die Überlegungen, was, wenn der Krieg zu Ende gekommen ist, zu tun sein wird: Es könnte sein, dass Europa, das schon den Glauben an sich selbst verloren zu haben schien, in der Rettung der Ukraine und ihrem Wiederaufbau zu neuer Kraft und Einheit findet.
Redaktionelle Nachbemerkung: Die Erstausgabe ist unverändert geblieben, aber im Abschnitt »Nach dem 24. Februar 2022« um Texte erweitert, die nach der russischen Invasion verfasst wurden.
(Juni 2022)
Europas Ukraina — Einleitung
Wir wissen nicht, wie der Kampf um die Ukraine ausgehen wird; ob sie sich gegen die russische Aggression behaupten oder ob sie in die Knie gehen wird, ob die Europäer, der Westen, sie verteidigen oder preisgeben wird; ob die Europäische Union zusammenhalten oder auseinanderfallen wird. Nur so viel ist gewiss: Die Ukraine wird nie mehr von der Landkarte in unseren Köpfen verschwinden. Es ist nicht lange her, da gab es diesen Staat, dieses Volk, diese Nation im allgemeinen Bewusstsein kaum. Besonders in Deutschland war man daran gewöhnt anzunehmen, dass sie irgendwie Teil »Russlands«, des Russischen Reiches oder der Sowjetunion war und dass man dort eine Sprache sprach, die so etwas wie eine Unterart des Russischen sei. Die Ukrainer haben mit ihrer »Revolution der Würde« auf dem Majdan und mit dem Widerstand, den sie der versuchten Destabilisierung ihres Staates durch Russland entgegensetzen, gezeigt, dass diese Ansicht von der Wirklichkeit längst überholt ist. Es ist Zeit, noch einmal einen Blick auf die Landkarte zu werfen und sich neu zu vergewissern.
Jedenfalls gilt dies für mich. Ein Buch zur Ukraine zu schreiben war in meinem Lebensplan nicht vorgesehen. Aber es gibt Situationen, wo man nicht anders kann und wo man gezwungen ist, alle Planungen über den Haufen zu werfen und sich einzumischen. Putins Handstreich gegen die Krim, der seither weitergehende Krieg in der östlichen Ukraine ließen mir keine andere Wahl. Dies nicht deshalb, weil ich mich für besonders kompetent hielte, sondern eher im Gegenteil: Ich musste feststellen, dass man sich ein Leben lang mit dem östlichen Europa, mit Russland und der Sowjetunion beschäftigt haben konnte, ohne eine genauere Kenntnis von der Ukraine besitzen zu müssen — und ich war nicht der einzige im Fach, der zu dieser Einsicht kam. Erst recht gilt dies für das allgemeine Publikum. Im medialen Dauergespräch ging es fast ausschließlich um Putins Russland, das zudem nicht als politisches Subjekt, als Akteur verstanden wurde, sondern als Opfer, das auf Aktionen des Westens reagierte. Man sprach selten mit den Ukrainern, sondern vielmehr über sie und ihr Land. Man hörte leicht heraus, dass viele Diskutanten das Land, über das sie sprachen, nicht kannten, es nicht für nötig ansahen, sich dort umzusehen. Während jedermann etwas zur »russischen Seele« einfiel, kam vielen — ausgerechnet den Deutschen, die zweimal im 20. Jahrhundert die Ukraine besetzt und verwüstet hatten — nicht mehr in den Sinn als das Klischee von den Ukrainern als ewigen Nationalisten und Antisemiten. Fast ohnmächtig stand man dieser kompakten Ignoranz und Anmaßung gegenüber, die sich auf ihre Fortschrittlichkeit auch noch etwas einbildete. Während man jede Woche im Fernsehen wählen kann zwischen Dutzenden von Russland-Filmen — vorzugsweise Flussreisen und historischen Dokumentationen —, hat das (öffentliche) Fernsehen es auch nach einem Jahr, in dem die Ukraine zum Kriegsschauplatz geworden war, nicht zuwege gebracht, diesem Land ein Gesicht zu geben, das über die Bilder vom Majdan hinausginge — keine Dokumentation über Odessa oder den Donbass oder die Geschichte des Kosakentums, keine Tour durch Lemberg oder Czernowitz — Orte, mit denen man in Deutschland — dank der alten wie der jungen Dichter — durchaus etwas anfangen kann. Kurzum: Die Ukraine blieb eine Leerstelle im Horizont, ein weißer Fleck, von dem allenfalls Beunruhigung ausging.
Dieses Buch ist der Versuch, mein Versuch, sich ein Bild von der Ukraine zu machen. Es ist keine Geschichte der Ukraine, wie sie von Historikern in herausragenden Werken bereits erzählt und dargestellt worden ist (die in meinen Augen wichtigsten sind im Anhang aufgeführt). Es ist auch nicht der Versuch, die laufenden Ereignisse darstellen und kommentieren zu wollen — eine Arbeit, die von den Journalisten und Reportern manchmal auf geradezu heroische Weise geleistet wird. Meine Art, mir ein Bild zu machen, ist die Erkundung geschichtlicher Topographien. Meine Weise, mir die Geschichte und Eigenart eines Landes oder einer Kultur vor Augen zu führen, ist die Begehung von Orten und die Erschließung von Räumen. Ich habe diese Methode in meinem Buch »Im Raume lesen wir die Zeit. Über Zivilisationsgeschichte und Geopolitik« (2003) dargestellt. Man kann »Städte lesen«, Städte als Texturen und Palimpseste dechiffrieren, ihre Schichtungen in einer Art urbaner Archäologie freilegen und ihre Vergangenheit so zum Sprechen bringen. Städte sind erstrangige Dokumente, die gelesen und erschlossen werden können. Sie erweisen sich dann — anders als in der makrokosmisch-globalen oder der mikrokosmischen Perspektive — als Punkte maximaler Verdichtung geschichtlicher Ereignis- und Erfahrungsräume.
Im Zentrum des vorliegenden Bandes stehen Porträts ukrainischer Städte. Sie sind das Ergebnis dieser Art von urbaner Archäologie. Der Blick auf diese mittlere Ebene hat unschätzbare Vorteile, gerade im Kontext einer Geschichte der Ukraine als einer nicht ethnisch, sondern politisch definierten Nation, deren Territorium von der Geschichte und Kultur ganz verschiedener Imperien geprägt worden ist. Es ist gerade das Fragmentarische, Partikulare, Regionale, das etwas sehr Spezifisches der ukrainischen Nations- und Staatsbildung zum Ausdruck bringt. Die hier versammelten Städtebilder sind nicht vollständig — wie gern hätte ich Winniza oder Tschernigiw aufgenommen und das vom Holodomor so furchtbar heimgesuchte ukrainische Dorf. Wie wichtig wäre es gewesen, auch Uman oder Drohobytsch aufzusuchen, um die noch sichtbaren Spuren des in der Shoah vernichteten Shtetl, dem einstigen Zentrum des osteuropäischen Judentums, zu lesen. Aber auch der Gang über die Dammkrone von Dneproges, dieser Ikone sowjetischer Modernisierung, hätte dazugehört. Trotz dieser Beschränkungen glaube ich, dass die vorliegenden Studien den Blick für die außerordentliche Komplexität, aber auch den Reichtum der Ukraine schärfen können. Die Erkundung dieses Grenzlands Europas, dieses »Europas im Kleinen« hat eben erst begonnen.
Die Städtebilder zu Lemberg und Czernowitz stammen aus den späten 1980er Jahren, die Porträts von Odessa und Jalta aus dem Jahre 2000. Schon an anderer Stelle veröffentlicht, sind sie von den geschichtlichen Ereignissen überrollt und überholt worden, aber sie halten eine Perspektive und einen Perspektivwandel fest, der selber höchst aufschlussreich ist: Lemberg und Czernowitz waren in unseren Horizont in einer Zeit getreten, als Mitteleuropa, das Europa jenseits von Ost und West, sich zu Wort gemeldet hatte; die Ukraine lag also schon damals im Horizont Europas. »Die Mitte liegt ostwärts«, hatte ich in den 1980ern noch vor dem Fall der Mauer formuliert. Nun stellt sich mit Blick auf Städte wie Charkiw, Dnipropetrowsk, Donezk heraus, dass die Osterweiterung unseres Blicks noch weiter in dieser Richtung fortschreiten muss. Auch an der Beschreibung der Krim und Odessas kann man etwas sehr Wichtiges ablesen: die imperiale Prägung des postsowjetischen, damals aber schon zur Ukraine gehörenden Raumes, die sich nicht von heute auf morgen wegdekretieren lässt, sondern noch lange fortwirkt.
Die Ukraine hat sich entschieden, ihren eigenen Weg zu gehen, und die Lebensform, für die sie sich entschieden hat, zu verteidigen, der russischen Aggression Widerstand zu leisten. Der Majdan war eine Erhebung im Zeichen nicht nur der blau-gelben Flagge der Ukraine, sondern der blauen Europafahne mit den goldenen Sternen.
Eine technisch-redaktionelle Bemerkung: Texte, die von russisch-ukrainischen Problemen handeln, sind nicht nur mit dem üblichen Problem der Übertragung von Personen- und Ortsnamen ins Deutsche konfrontiert — die Entscheidung für die eher leserfreundliche Transkription oder die wissenschaftliche Transliteration —, sondern auch mit dem Problem, welche Sprache in einem zweisprachig geprägten Land zur Bezeichnung verwandt wird — die russische oder die ukrainische. Es war hier ein Mittelweg zu gehen zwischen der eingespielten Lesegewohnheit, in der das Russische dominant war, und der sanften Ukrainisierung, die stattfindet, ohne dass sie als affirmative action forciert werden müsste. Einen mittleren Weg zu finden, ohne dem einen oder dem anderen Gewalt anzutun, ist nicht ganz einfach. Was die Anmerkungen betrifft, wurde in den Essaytexten auf Fußnoten und Literaturverweise verzichtet; doch findet sich die verwendete und zitierte Literatur im Anhang zu den einzelnen Kapiteln.
Karl Schlögel, Wien im Juni 2015
Schreiben im Situation Room. Einsam
In gewöhnlichen Zeiten kann man sich die Bedingungen seines Schreibens aussuchen. Man bestimmt den Arbeitsrhythmus, arbeitet die Literaturliste durch, baut Kapitel nach Kapitel. Alles hat seine Zeit, ist überschaubar, machbar. Aber dann gibt es Augenblicke, Situationen, in denen all das über den Haufen geworfen wird und man sich neu einrichten, sich neu aufstellen muss, will man irgendwie Schritt halten mit der Zeit und sein Gleichgewicht zurückgewinnen. Der Rhythmus, in dem man plant, wird dann von Ereignissen bestimmt, die von außen kommen. Man muss auf sie reagieren, sich irgendwie verhalten, nicht weil man mitspielen, sich vernehmlich machen, »seine Stimme erheben« will, sondern weil es einen getroffen hat, weil es plötzlich um alles geht: um das, woran man ein Leben lang gearbeitet hat, weil man sich gleichsam verwundet fühlt. Es bleibt einem nichts übrig, als sich zu wehren, von zurückschlagen will man gar nicht reden. Diese Situation ist eingetreten mit dem Massaker an den Demonstranten auf dem Kiewer Majdan Nesaleschnosti, dem Unabhängigkeitsplatz, den wir immer nur kurz »Majdan« nennen, also ganz einfach »Platz« — und mit der frechen Lüge Wladimir Putins, es gebe gar keine Annexion der Krim, wo wir sie doch mit eigenen Augen gesehen haben.
Situation Room, das Wort tauchte irgendwann im letzten Jahr gehäuft auf, angeblich ein bekanntes Format, von CNN entwickelt — You’re in the Situation Room — where news and information are arriving all the time. Standing by: CNN reporters across the United States and around the world to bring you the day’s top stories. Happening Now … I’m Wolf Blitzer, and You’re in the Situation Room — die Urform dafür sei der unter Präsident Kennedy eingerichtete Situation Room im Weißen Haus gewesen: ein Zentrum, in dem Echtzeit-Informationen zusammenlaufen und zusammengefasst werden. Ein Bild von der Welt auf einen Blick.
Wenn die Welt einem so naherückt, dass sie einen nicht mehr machen lässt, was man sich vorgenommen hatte, dann wird nicht alles, aber fast alles anders. Man hält sich die Nachrichten nicht mehr vom Leibe, man ist vielmehr dringend auf sie angewiesen. Jemand wie ich, der seinen Widerstand gegen das Internet, die jederzeitige Verfügbarkeit nicht aufgegeben hat, muss sich in kürzester Zeit mit den Techniken des Netzes vertraut machen, will er auf dem Laufenden bleiben. Nicht aus Bildersucht, nicht zum Zeitvertreib, sondern weil von der nächsten Nachricht, vom nächsten Ereignis alles abhängt: dass die Kette der Gewalt abbricht, zum Stillstand kommt, oder dass es weitergeht. Jede Sekunde sind Katastrophen nicht bloß denkbar, sondern Wirklichkeit. Man wird hineingezogen in den Strudel der Informationen, die heute unendlich umfangreich, unendlich zahlreich und unendlich vielfältig, sich widersprechend, sich gegenseitig dementierend sind. Zusammenfassende Analysen, Kommentare, Meinungen folgen in kürzestem Abstand, aber auch sie sind kein Haltepunkt, auf dem man sich ausruhen oder an dem man festhalten könnte, denn sie werden von den laufenden Ereignissen sofort wieder gekippt, überholt. Man ist über Tausende von Kilometern Entfernung dennoch dabei, es sind Tausende von Augen, aufgestellt an Tausenden von Punkten in dem Raum, in dem das Geschehen abläuft: Das ist die Fensterbank des Eckhauses im Leninskij Rajon in Donezk, von der aus die Straßenkreuzung überschaubar ist, wo der Alltag der besetzten Stadt abläuft: Dort fahren Panzerfahrzeuge, aber es werden auch Radwege gebaut — während im Hintergrund die Granateneinschläge zu hören sind —, es gibt die Bilder aus den Kellern, die zu Bombenunterständen geworden sind, und die Pressekonferenzen der Warlords, die sich in den Büros der Oligarchen, niedergelassen haben. Der provisorische Direktor des Opernhauses von Donezk gibt Interviews über das laufende Repertoire und der Soziologe, der seine Universität verlassen muss, einen letzten Bericht zu den sozialen Verwerfungen in der Stadt: soziologische Autopsie aus dem Kriegsgebiet.
All das kommt hier an in meinem Arbeitszimmer, es kommt über die verschiedensten Kanäle, über die Fernsehstationen, die russischen, die ukrainischen und viele andere. Es kommt an über die Zeitungen, die man online lesen kann — Donetsk Times, Kharkiv Times, Kyiv Post, Nowaja Gaseta aus Moskau —, man kann die Reflexion über die Ereignisse in mehreren Talkshows gleichzeitig verfolgen — bei Sawik Sсhuster in Kiew auf Russisch und Ukrainisch, bei Doschd in Moskau, dem Kabelkanal, der erstaunlicherweise immer noch funktioniert, Interviews in Echo Moskwy und das unendliche und fast immer gleiche Talkshow-Ritual der deutschen Sender — in Deutschland, wo irgendwie immer noch nicht angekommen ist, was in der Ukraine passiert. Bilder, Briefe, Kommentare, Dementis — alles läuft in jenem Arbeitszimmer zusammen, in dem sonst an Büchern gearbeitet wird, die von der Geschichte des Raumes handeln, aus dem die Nachrichten kommen. Und man weiß, dass man nie Schritt halten kann, man weiß, dass man der Schwerkraft der Gewohnheit, der Unwissenheit, der sich selbst bestätigenden Vorurteile, die grassieren, unmittelbar und vielleicht sogar für längere Zeit nichts entgegenzusetzen hat. Ein Gefühl grenzenloser Ohnmacht. Im Situation Room, in dem die Nachrichten und Bilder aus der Ukraine, vor allem dem umkämpften Gebiet, zusammenlaufen, ist es schwer, cool zu bleiben und die Nerven zu behalten.
Destabilisierung ist kein abstrakter Begriff, Destabilisierung, wie sie von Russland betrieben wird, richtet sich gegen »die Macht«, gegen »die Souveränität« eines Staates. Aber in Wahrheit zielt Destabilisierung auf die Intaktheit der Gegenseite, die angegriffen wird, auf die Gesellschaft, genauer, auf die Menschen. Destabilisierung eines Staates, einer Gesellschaft heißt in letzter Konsequenz: Man will die Menschen fertig machen. Einen Staat in die Knie zu zwingen heißt, die Menschen in die Knie zu zwingen. Eine Regierung zur Kapitulation zu bringen heißt, jene, die diese Regierung gewählt haben, dazu zu bringen, sich zu unterwerfen, die Unterwerfung hinzunehmen. Eskalationsdominanz ist nicht etwas, was gegen eine abstrakte Größe — einen Staat, eine Armee, eine Regierung — durchgesetzt wird, sondern zielt ad hominem. Jemandem werden die Regeln diktiert, jemandem wird der Wille aufgezwungen, jemandem wird ein Ultimatum gestellt. Und man muss sich dazu verhalten. Aus diesem Kampf, der einem aufgezwungen wird, auszutreten ist natürlich möglich: durch Gleichgültigkeit, Indifferenz, Zynismus, Defaitimus — alles Größen und Haltungen, die in der laufenden Auseinandersetzung um die Ukraine ins Gewicht fallen — in der Vergangenheit waren sie zuweilen entscheidend: kriegsfördernd, kriegsauslösend, jedenfalls nicht kriegsverhindernd.
Im Situation Room ist es niemals ruhig. Breaking news rund um die Uhr. Hier herrscht eine andere Zeit. Das Geschehen verlangt nach Kommentaren oder gar Interventionen, für die man sich jedoch kaum gerüstet fühlt. Man ist als Historiker von Hause aus eher für die longue durée zuständig, für Ereignisfolgen, die abgeschlossen sind. Man ist vergangenheits- und geschichtskompetent, bewegt sich aber nicht auf der Höhe der Zeit. Auf der Höhe der Zeit ist der Tatmensch, der die Panzer kommandiert und rollen lässt und der die nächsten breaking news produziert. Er hält sich nicht auf mit Erläuterungen — die kommen post festum. Ebenbürtig ist dem Menschen der Tat nur der Mensch, der ihm entgegentritt — aber die sind, von den zum Kampf gezwungenen Ukrainern abgesehen, weit und breit nicht in Sicht.
Die neuen Medien bringen es mit sich, dass wir auf dem Laufenden bleiben und mit Bildern in Echtzeit versorgt werden, dass wir fast bruchlos die Verschiebung von Fronten, die Einnahme von Orten, die Sprengung von Brücken und Eisenbahnlinien verfolgen können. Google Maps und satellitengestützte Informationssysteme machen es möglich: Wir erkennen auf den Bildern den Hauptprospekt von Donezk, die Fußball-Arena, den Kulturpark, den Flughafen, der mittlerweile in Schutt und Asche liegt. Wir zoomen uns heran an eine Steppenlandschaft, durch die die Europastraße 40 führt, und an die Felder, auf denen die malaysische Passagiermaschine abgestürzt ist. Auf dem Tisch im Arbeitszimmer, wo sonst die Landkarten liegen, auf denen ich historische Schauplätze lokalisiere, liegen jetzt Karten, auf denen man durch das aktuelle Kriegsgebiet navigieren kann: Horliwka, Jenakijewe, Tores, Debalzewe, Artemiwsk und immer weiter. Wir können den Verlauf der Kriegshandlungen nachverfolgen, die Verschiebung der Fronten einzeichnen. Wir lesen in den Blogs die Botschaften und Briefe, die von dort kommen, über das, was in den Kellern, in den Gefängnissen passiert. So wird man zum bloßen Augen- und Ohrenzeugen, zum Zaungast in einem Kampf, den andere entscheiden und andere mit ihrem Leben bezahlen.
Im Situation Room ist man allein. Aus der Flut der Bilder und Nachrichten muss man sich einen Reim machen: Jeder auf seine Weise. Die Welt der Gewissheiten zerfällt. Die Urteilskraft ist in einer Weise gefordert, von der wir uns gewünscht hätten, dass wir einem solchen Test nie mehr unterzogen werden müssten. In die Beschreibung der Stadtlandschaften fallen die Granaten, die sie zerfetzen. Die Gegenwart lässt es nicht zu, sich der Vergangenheit so zu widmen, wie es sich gehört — aus der Distanz. Wie kann man in Zeiten des Krieges den Blick von der Anhöhe, auf der das Kiewer Höhlenkloster liegt, über den Dnjepr hinweg schweifen lassen, ohne in Kitsch abzurutschen. Stadtbeschreibungen in Zeiten des Bombardements sind obsolet. Jetzt ist der Kriegsreporter am Zug oder noch besser der Kriegsfotograf. Details, die sonst so unerlässlich sind, hören sich jetzt an nach Geschwätz, Überfluss an Zeit, Verlegenheit, Zeitvergessenheit. Wir sind nicht gewohnt, Augenzeuge in ungeschützten Situationen zu sein. Wir haben das Handwerk der Schlachtbeschreibung nie gelernt. Wir, die Beobachter und Beschreiber aus der Ferne, sind überflüssig geworden. Die so lange stabilen Meinungslager mit ihren wechselseitig respektierten common places erodieren, jeder muss sich zu der neu entstandenen Lage verhalten. Sich neu aufstellen heißt ja nichts anderes, als dass jeder sich neu entscheiden muss. Das ist ein individueller, molekularer Vorgang. Nicht »die« Gesellschaft stellt sich neu auf, konfrontiert sich einer neuen Lage, sondern jeder Einzelne hat die Wahl. Dem Aufbau einer Gegenwehr gegen den von außen geschürten Krieg geht eine lange und qualvolle Zeit der Destabilisierung, der Fragmentierung, der Atomisierung voraus. Die Destabilisierung ist die Form des Übergangs in ein anderes Europa. Ob wir sie aushalten, ob wir sie durchstehen? Vielleicht ist alles schon überholt in dem Augenblick, da das Buch erscheint. Aufzeichnungen von gestern.
Abschied vom Imperium, Abschied von Russland? Versuch einer Selbsterklärung
Absage an Putin — Warum überhaupt Russland? — Faszination — Es gab das andere Russland — Aufbruch und Sackgasse — Fassungslosigkeit und Sentimentalität — Demütigung und failing man — Der überforderte Westen: Ukraine — terra incognita — Information war — Wortmeldung des anderen Russland — Die Ukraine auf der mental map der russischen Intelligenz
Die Annexion der Krim war für mich wie der berühmte Blitz aus heiterem Himmel. Hätte man es nicht wissen oder ahnen können? Wie kam es, dass bestimmte eindeutige Hinweise ignoriert, ausgeblendet wurden? Welcher Mechanismus des Selbstschutzes gegen eine als Bedrohung empfundene Realität war da im Spiel? Ich bin über Jahre, Jahrzehnte immer wieder in der Sowjetunion, in Russland gewesen, aber dass die Krim eine »offene blutende Wunde« war, an der die Russen gelitten hätten, das hatte ich kein einziges Mal gehört. War das ein Nichtwahrhabenwollen, ein Augenverschließen vor etwas, was man nicht sehen wollte? Aber man hat doch sonst über all die Jahre hin mit den nächsten Bekannten über alles gesprochen, was einen bewegt hat. Ich kann mich an kein einziges Gespräch in Moskau oder anderswo erinnern, in dem die Krim als Topos des Leidens zur Sprache gebracht worden wäre. Als literarischer Topos wohl: In den Antiquariaten lagen die Baedeker aus vorrevolutionärer Zeit und sowjetische Reiseführer an die »Rote Riviera«, und ich habe eine kleine Sammlung davon zusammengekauft. Aber als Streitpunkt, Kontroverse im Gespräch? Es gab nur einen einzigen Fall, an den ich mich erinnern kann. Ich war, ich muss es gestehen, anfangs ein Bewunderer Jurij Luschkows, des Bürgermeisters von Moskau, dessen Tatkraft mich beeindruckte und in dem ich die Wiederkehr der großen Stadtväter Moskaus vor 1917 wie Pawel Tretjakow sah, des Mäzens und Wohltäters; mich beeindruckte die Verwandlung Moskaus in eine global city des 21. Jahrhunderts. Daher nahm ich Luschkows Besuche in Sewastopol, seine Krimreden, die Sammlung von Spenden zwar wahr, aber nicht wirklich ernst, bis mich mein Freund, der Soziologie Lew Gudkow, auf diesen in seinen Augen gefährlichen russischen Patriotismus des Moskauer Bürgermeisters aufmerksam machte, der die Ukraine provozierte und herausforderte. Das führte mir die Kehrseite von Luschkows Erfolgsgeschichte vor Augen. Aber darüber hinaus nahm ich keine Spur von Beunruhigung oder gar leidenschaftlicher Anteilnahme am Schicksal der Krim wahr. Wer reisen konnte — und es waren viele, wie man auf den Moskauer Flughäfen beobachten konnte —, reiste nicht auf die Krim, sondern nach Paris, Florenz, auf die Kanarischen Inseln, nach Griechenland oder an die türkische Riviera von Antalya, nach Scharm el-Scheich. Bei meinen eigenen Besuchen auf der Krim stach mir etwas anderes ins Auge: die schlechte Infrastruktur, wenn man in Simferopol angekommen war, die Hotelpaläste aus sowjetischer Zeit, die nicht entfernt ausgebucht waren, sondern eher leer standen, der grobe, noch aus der sowjetischen Zeit stammende Ton, mit dem die Gäste an der Rezeption abgefertigt wurden, die billigen Feuerwerke auf der Promenade von Jalta, aber auch die weiße steinerne Stadt Sewastopol, die in dem gleißenden Licht dalag, wie Alexander Dejneka es in seinen Bildern aus den 1930er Jahren so großartig festgehalten hat. Und ich erinnere mich an die an den Berghängen klebenden Hütten — man sagte mir, das seien die Siedlungen der Krimtataren, die in den letzten Jahren in großer Zahl mit ihren Familien aus Zentralasien zurückgekehrt waren, wohin Stalin sie im Mai 1944 hatte deportieren lassen. Die Krim war also eher ein zauberhafter Ort, im Aus, herausgefallen aus der großen Geschichte, kein Brennpunkt interner Zusammenstöße oder internationaler Verwicklungen. Es war Putin, der die Krim auf die Landkarte und in den Horizont, in dem es um Mythen, vor allem aber um Krieg und Frieden ging, katapultiert hatte.
Absage an Putin
Die Annexion, vor allem aber die dreiste Lüge, mit der Putin sie verleugnete, machten es mir unmöglich, die Puschkin-Medaille anzunehmen, die seit Anfang der 1990er Jahre der Präsident der Russischen Föderation für Verdienste um die Vermittlung der russischen Kultur im Ausland verleiht. Ich schrieb dem von mir geschätzten Botschafter der Russländischen Föderation in Berlin, dass ich die Auszeichnung, über die ich bereits im November 2013 informiert worden war und die mich und meine Arbeit ehrte, nach dem, was geschehen war, nicht annehmen konnte. War das ein Rückzieher, um dem Druck der öffentlichen Meinung, die über Putins Handstreich empört war, nachzugeben? War es also Illoyalität, sogar ein »Verrat an Russland«? Wäre es nicht gerade im Augenblick der größten Enttäuschung über die Politik der russischen Führung notwendig gewesen, Russland »die Treue zu halten«? Dies waren keine rhetorischen Fragen, wie sich alsbald herausstellte: In einer nicht abreißenden Serie von Talkshows, in denen die russische Politik diskutiert wurde, kam immer wieder die lange Geschichte der deutsch-russischen Beziehungen zur Sprache, das, was Gerd Koenen den deutschen »Russland-Komplex« genannt hat. Diese Beziehungen sind in zahlreichen glänzenden Studien erforscht und dargestellt worden; man denke nur an die frühe, heute noch immer gültige Darstellung von Walter Laqueur aus den 1960er Jahren oder an die Arbeiten in den »West-östlichen Spiegelungen«, die aus dem »Wuppertaler Projekt« hervorgegangen sind, das Lew Kopelew nach seiner Ausreise in die Bundesrepublik initiiert hatte, und an die zahlreichen Forschungen, die dem deutsch-sowjetischen Krieg und dem nationalsozialistischen Besatzungsregime in der Sowjetunion gewidmet sind; auch ich habe einige Arbeiten beigesteuert, die auch auf Russisch erschienen sind, etwa das Buch über das »Russische Berlin. Ostbahnhof Europas«.
Warum überhaupt Russland?
Doch die russische Politik gegenüber der Ukraine — die Entfesselung eines Krieges gegen das »Brudervolk« par excellence — hat das bisher in den deutsch-russischen Beziehungen Erreichte radikal in Frage gestellt. Da Russland für mich und wohl die allermeisten, die sich mit diesem Land beschäftigt haben, eben nicht nur ein Forschungsgegenstand, sondern aufs Engste mit dem eigenen, persönlichen Leben verbunden war, wurde die sogenannte Ukraine-Krise zu einer Stunde der Wahrheit, zu einer Stunde der Prüfung und Selbstprüfung. Dies geht nicht auf in einer Übersicht über die geleistete Forschung, über die Entwicklung der kulturellen, diplomatischen oder wirtschaftlichen Beziehungen, sondern zielt auf den inneren, den Binnenbereich eines Engagements, in dem mehr als nur eine »Position« auf dem Spiel steht, die man »revidieren« oder »weiterentwickeln« kann. Hier handelt es sich um etwas, worauf man sich »mit ganzer Seele«, »mit Haut und Haar« eingelassen hat, also um ein Sich-Einlassen auf etwas, was nicht ohne Folgen bleiben konnte, fast möchte man es eine Bezauberung, eine Verstrickung nennen. Kurzum, es geht um Russland als Teil der eigenen Lebensgeschichte und um eine Antwort auf die Frage, was geschieht, wenn mit den Ereignissen in der Ukraine auch dieser Teil der Lebensarbeit und Lebensgeschichte in Frage gestellt ist. So wichtig und lohnenswert es auch sein mag, noch einmal die Sequenz der glücklichen deutsch-russischen Begegnungen und der dramatischen Zusammenstöße in den vergangenen Jahrhunderten Revue passieren zu lassen, so haben solche meist chronologisch angeordneten Übersichten in ihrer Objektivierungsabsicht etwas Verschleierndes. Da tauchen die Hauptthemen, die literarischen Leitmotive, die Autoren und ihre Darsteller auf, aber man wird im Dunkeln gelassen über die wirklichen Antriebs- und Bindekräfte, die in solchen Beziehungen zum Tragen gekommen sind und noch immer wirken. Man liefert damit eher Pseudoerklärungen, statt Aufschluss zu geben. Man könnte all dies mit sich privat abmachen, wenn es nicht doch von gesellschaftlicher Bedeutung wäre. Denn es geht um nichts Geringeres, als Klarheit darüber zu gewinnen, wie man sich, wie »die Deutschen« sich verhalten sollen zur russischen Politik gegenüber der Ukraine. Um die Schwerkraft des »Russland-Komplexes« zu ermessen, muss man sich ihm aussetzen; und das geschieht am ehesten nicht mit einer abstrakten Skizze einer abstrakten Ideengeschichte, sondern fängt bei einem selber an. Da geht es mehr um Erfahrungen als um Ideen, mehr um Eindrücke als um Lektüren, in jedem Falle aber immer um beides.
Für jemanden, der in den 1950er Jahren in einem Dorf im Allgäu, dem damals wohl abgelegensten Winkel eines ohnehin aus der Welt herausgefallenen Landes, aufgewachsen ist, war Russland weit weg. Aber nur auf den ersten Blick. Denn auf den Gräbern auf dem Friedhof und auf der Gedenktafel der Kriegergedächtniskapelle fanden sich die Namen der Gefallenen aus den mir bekannten Familien. Dort stand dann, meist vage und ungenau, so als gäbe es dort keine konkreten Orte und konkreten Daten, sondern nur einen weiten Raum: gefallen in Russland, Winter 1942. Russland war der Krieg und die Kriegsgefangenschaft. Sie waren das Thema von Unterhaltungen, die wir Kinder mitbekamen, besonders wenn der Vater einmal im Jahr sich mit Kriegskameraden, die ebenfalls davongekommen waren, traf. Russland, genauer: Stalingrad, Sibirien wurde dann zu dem, was man später buchstäblich als lieu de memoire bezeichnen konnte, ein Vorstellungsraum, gebildet aus dem, was in der nicht sonderlich reichlich ausgestatteten Bibliothek des Internats bei den Benediktinern zu finden war: »So weit die Füße tragen«, verfasst von Josef Martin Bauer, einem Schriftsteller, der selber Schüler an meinem Gymnasium gewesen war, oder »Armee hinter Stacheldraht« von Edwin Erich Dwinger, einem Autor, den ich später als eine Monumentalgestalt des deutschen Trivialromans und als Verfertiger »Sibiriens als deutscher Seelenlandschaft« identifiziert habe. Über Russland haben wir zu Hause kaum gesprochen. Der Vater hatte den Krieg, vom 1. September 1939, vom »Polenfeldzug«, bis zum Ende im Frühjahr 1945 »mitgemacht«, als einfacher Soldat und Chauffeur, wie er sagte, und fast die ganze Zeit an der Ostfront. Von dort stammten die in einer Blechkiste aufbewahrten gezackten Schwarzweißbilder, wie sie zu Hunderttausenden, wohl Millionen von den »Landsern« in die Heimat mitgebracht worden waren: mit gesprengten Brücken, Rauchsäulen über Städten, deren Namen manchmal auf der Rückseite der Fotos verzeichnet waren und die ich später bei meinen Besuchen wiedererkannte, Flusslandschaften — der San, der Dnjepr —, Marktplätze, Szenen vom Schlachten von Schweinen und Gänsen, die Mannschaft beim Bad in einem Fluss, Bilder von der »Rollbahn«, die in einen unendlich weiten Raum hineinführte. Von dort stammten auch die Namen von Städten und Verkehrsknotenpunkten, die man schon als Kind aufgeschnappt hatte, die sich im Kopf festsetzten und eine mental map konfigurierten, die sich bis heute erhalten hat: Lemberg, Lublin, Orscha, Krementschuk, Kramatorsk, Stalino. Später, nach dem Tod des Vaters, konnte ich im Wehrpass die ganze Route, die ihn aus dem Allgäu an die Ostfront und in die Welt hinaus geführt hatte, rekonstruieren. Es stellte sich heraus, dass ich auf denselben Routen gefahren war, ohne dass ich Kenntnis von seinen Wegen gehabt hatte.
Den ersten Sichtkontakt mit »Russen« gab es auf der Interzonen-Autobahn von Bayern nach Westberlin. Keine politische Sozialisierung von Schülern Westdeutschlands in den späten 1950er und 1960er Jahren ohne diese obligatorischen Bildungsfahrten, die vom Bundesministerium des Inneren gefördert wurden. Hier liegt ein großer Unterschied zwischen den in Ost- und Westdeutschland Aufgewachsenen vor. »Im Osten« gab es eine Art Kohabitation mit Kasernen, Sport, Offiziersvillen, Spezialgeschäften und den Zügen mit dem Schild »Wünsdorf-Saratow« in kyrillischen Lettern. Sie gehörten, so abgeschlossen die Welt der »sowjetischen Streitkräfte« auch gewesen sein mochte, zum Interieur der DDR-Lebenswelt, so wie die GIs, die Jeeps, die Malls der US-Army im Westen. Die ersten »Russen« begegneten mir also auf einem Parkplatz einer Raststätte bei Leipzig, aber bald auch in den »Druschba«-Buchhandlungen in Ostberlin, in Prag, Sofia, wohin auch immer die Reisen in den Ostblock mich seit Mitte der 1960er Jahre führten. Das Russische zog an: die Aufführung von Jewgenij Schwarz’ »Der Drache« am Deutschen Theater, eine Aufführung von Benno Besson, die vom Ruch des Nonkonformismus umgeben war. Jewgenij Jewtuschenkos Auftritt in München mit »Babij Jar« und »An Stalins Erben«, die auch in großer Aufmachung in der ZEIT abgedruckt wurden und so etwas wie das sichtbarste und hörbarste Signal der Entstalinisierung werden sollte. In diesem war etwas wie die leibhaftige Verkörperung dessen, was einen das Leben lang fesselte: der Dichter, auf der Bühne deklamierend — ich habe das später noch einmal erlebt mit Joseph Brodsky in Berlin oder einem Physiker, der Jessenin-Gedichte in den Hügeln vortrug, die zum Strand von Sotschi hinunterführten —, die Bedeutung des Wortes, das Aus-dem-Kopf-Rezitieren ganzer Poeme, das in unserer Schulerziehung schon außer Mode gekommen war. Dort lag wohl auch der Beginn der Faszination für das Phänomen mit dem Namen »Intelligenzija«, jener kleinen, marginalen Gruppe, die sich aber moralisch im Recht sah, dafür kämpfte, alle Opfer riskierte und in den Gang der Geschichte eingriff.
Es mussten einige Zufälle zusammenkommen, wie immer im Leben, in dem nichts vorbestimmt ist, um auf die russische Spur zu geraten. Ein bayerisches Gymnasium, an dem sonderbarerweise — noch dazu an einer von Benediktinern geleiteten Schule — Russisch unterrichtet wurde, wo die ersten Lieder auf Russisch eingeübt wurden, angeleitet von einem Lehrer, der eigentlich ein aus Białystok stammender Pole war, der nach dem Krieg als »Displaced Person« in der US-amerikanischen Zone hängen geblieben war. Auch die Lehrer, die Patres, waren aufgeschlossen, man sah ihnen die Kriegsverwundung an — Backendurchschuss, zerschmettertes Bein —, vor allem aber ihre unendliche Dankbarkeit dafür, dass sie davongekommen waren, nicht zuletzt dank einer Barmherzigkeit einfacher Menschen, die sie nach allem, was in »Russland« geschehen war, nicht erwarten konnten. Sie sprachen das ganz eigene Vokabular des Kriegsgefangenen-Russisch. Zu dieser Umgebung gehörte wohl auch die Aufgeschlossenheit der Zeit des 2. Vaticanums, an dessen Vorbereitung der Abt an wichtiger Stelle beteiligt war — er war zuständig für das ökumenische Gespräch, die Beziehungen zu den Patriarchen von Konstantinopel und Moskau —, und die Nähe zu München, das (anders als das eingeschlossene, gefährdete West-Berlin) in meiner Schulzeit Heimstatt einer beachtlichen russischen Diaspora-Gemeinde war. Später hieß es, Fedor Stepun, der Philosoph, Soziologie, Literat, der 1922 aus Sowjetrussland ausgewiesen worden war und vor dem Krieg in Dresden gelehrt hatte, der nach 1945 aber zur lebendigen Verkörperung des »russischen Geistes« an der Münchener Universität geworden war, habe seine Sommerferien an unserer Schule verbracht, jener fremde Mann, den wir immer als den Mann mit dem schlohweißem Haarschopf und der Baskenmütze aus der Ferne in Augenschein nehmen konnten.
In diesem Umfeld war es nicht so abwegig, dass ich einen Brief an Chruschtschow — oder war es nur Radio Moskau? — schrieb, auf den wenige Monate später auch eine Antwort kam: in Gestalt von zwei dicken Bücherpaketen, eingewickelt in jenes feste, grobe Packpapier, das heute zur material culture einer untergegangenen Epoche gehört. In die letzten Gymnasiumsjahre fiel die erste Reise über den Eisernen Vorhang hinweg — nach Prag, das zur porta orientis wurde: die äußerlich unversehrte Metropole Mitteleuropas — für jemanden, der nur vom Bombenkrieg zerstörte Städte kannte, fast unfassbar —, der Ort eines um Kafka sich entwickelnden Mythos und einer politischen Bewegung, die nur wenige Jahre später als »Prager Frühling« auf- und untergehen sollte.
Die ersten leibhaftigen Begegnungen mit »Russland« — in Wahrheit ging es ja immer um die Sowjetunion — fanden im Jahr vor dem Abitur und dann nach der Aufnahme des Studiums an der Freien Universität in Berlin statt. Die Geschichte der Reise vor dem Schulabschluss ist in einem ersten umfangreichen Text aufgeschrieben und veröffentlicht worden — unter dem Pseudonym Paul Tjomny (Pseudonym halb aus Koketterie, halb aus einer immer noch bestehenden Befangenheit in der Welt des Kalten Krieges) und dem Titel »Russisches Tagebuch«. Man sieht dem Text an, dass die Reise gut vorbereitet war — mit Seminaren über »Historischen Materialismus«, inspiriert vom führenden Experten dieser Jahre, dem Jesuitenprofessor Gustav O. Wetter, über Kollektivierung der sowjetischen Landwirtschaft und Planwirtschaft, aber auch russische Literatur und Tauwetter. Die Fahrt selbst, von unserer Klasse organisiert, von Unternehmen in der Nähe wie Hipp-Babynahrung finanziell unterstützt, führte über Wien, Budapest, Uschgorod, Mukatschewo, Lwow, Kiew, Charkow, Kursk bis Moskau und endete — wie es sich für ein katholisches Internat gehörte — mit einem Besuch in Sagorsk, Wallfahrtsort und Zentrum der russisch-orthodoxen Kirche, der heute den Namen des russischen Revolutionärs abgelegt und wieder in Sergiew Posad rückbenannt worden ist. Es folgte zwei Jahre später eine Fahrt, unternommen in einem R4, die von West-Berlin über Stockholm, Helsinki, Wyborg, Leningrad, Moskau, Kursk, Rostow-am-Don über Grosny, Ordschonikidse, Tbilissi, Jerewan bis zur sowjetisch-iranischen Grenze führte und von dort über Sotschi, Kiew, die Slowakei und Prag — ein Jahr nach dem Einmarsch der Warschauer-Pakt-Truppen — wieder nach Berlin führte.
Was von diesen Reisen, die sich später wiederholten und kreuz und quer über die Karte der Sowjetunion führten, blieb, braucht hier nur insoweit angedeutet zu werden, als es um Selbstverständigung über eine Erfahrung geht, die heute, Jahrzehnte danach, gleichsam in Frage gestellt, widerrufen erscheint. Im Rückblick sieht es so aus, als sei ein Wunsch nach deutsch-sowjetischer bzw. deutsch-russischer Versöhnung das treibende Motiv für das Interesse an Russland gewesen. Das ist eine Verengung auf das Politische, das oft auch noch mit dem Anspruch, eine moralische Mission erledigen zu müssen — »die Überwindung der Feindbilder« — einhergeht. Sich in Westdeutschland in den 1950er und 1960er Jahren für das Russische zu entscheiden, war nicht selten Ausdruck dafür, etwas ganz anderes sehen und machen zu wollen. Warum sollte man nicht, wenn alle nach Frankreich oder England wollten, in die andere Richtung, nicht nach Westen, sondern ostwärts, in die Sowjetunion gehen? Es hatte nicht nur etwas mit der »Faszination durch das Fremde« zu tun, sondern auch mit dem Wunsch nach Selbstunterscheidung, etwas Außergewöhliches zu tun oder sein zu wollen. Und je mehr Widerstand — von Seiten des Elternhauses oder der Schule — es dagegen gab, umso besser. Sich auf die Sowjetunion oder Russland einzulassen war wenn nicht schon Kampfansage, so doch vorsichtige Ankündigung einer Differenz, eines Dissenses. Es hatte also, das sollte man nicht übersehen, auch etwas mit der Steigerung des Selbstwertgefühls, etwas Besonderes sein zu wollen, zu tun.
Faszination
Wer sich für diese Himmelsrichtung interessierte, brachte keine Opfer (im Unterschied zu jenen Kommunisten, die — in der Bundesrepublik verfolgt — für ihre Anhänglichkeit an das »Vaterland der Werktätigen« sogar ins Gefängnis gegangen waren), sondern bekam etwas dafür, und zwar überreichlich: die Entdeckung einer Welt, die hinter dem Eisernen Vorhang verschwunden war, die andere Geschichte Europas, die uns nach der Teilung der Welt abhandengekommen war. Reisen in den Ostblock, und speziell: in der Sowjetunion, waren Reisen in einen Erfahrungs- und Geschichtsraum, in dem eine ganze Welt zu entdecken war. Man kann jetzt über die Faszination »des Fremden«, die »Erfindung des Anderen« sprechen, aber es ging vielmehr um die Wahrnehmung und Aneignung einer Geschichte, die uns — ich habe die Westdeutschen im Auge — mehr und mehr fremd geworden war. Ich kann nicht behaupten, dass die Sowjetunion als politisches System auf mich je eine Anziehungskraft ausgeübt hätte. Es war eine ganz andere Dimension, die mich — und wohl nicht nur mich — gefangen nahm. Wie könnte man sie umreißen, wenn man sie an dieser Stelle nicht in einer autobiographischen Erzählung ausbreiten kann?
In die Sowjetunion, nach Russland zu fahren war so viel, wie in einen anderen Zeithorizont einzutreten, sich — für einen Augenblick wenigstens — aus einer Zeit zu verabschieden, die bestimmt war von Tempo und Stress. Dort stand die Zeit still, Zeit hatte keinen Wert, dort konnte man sich erholen, hier galten nicht die Gesetze, die von time is money diktiert waren. Zu dieser ganz anderen Zeiterfahrung gehörten die tagelange Reise mit der Eisenbahn, die nächtlichen Küchengespräche, bei denen Zeit keine Rolle spielte. Eine Reise in eine vergangene, verlorene Zeit, die Zeit der Kindheit? Dass diese stillstehende Zeit auch als bleierne Zeit erfahren und erlitten werden konnte — das Verbringen der Lebenszeit in endlosen Warteschlangen —, steht auf einem ganz anderen Blatt.
Zur Erfahrung des Reisens in der Sowjetunion gehörte die Weite des Raums, in dem es keine Grenzen gab, sobald man die Große Grenze, die das »Sechstel der Erde« umschloss und abriegelte, hinter sich gebracht hatte. Aus den kleinteiligen Verhältnissen West- und vor allem Mitteleuropas herauszukommen war fast so etwas wie die Erfahrung von großer, weiter Welt, fast wie das Amerika-Erlebnis, das für mich — zeitgleich — nicht weniger prägend war als das Russland-Erlebnis. Aus dem »russischen Raum« einen Blick zurückzuwerfen auf Europa, auf seine Enge und Provinzialität, war nicht ohne Reiz. Der Provinzialität des (geteilten) Deutschland zu entfliehen— die einen zogen auf den Strecken Istanbul — Teheran — Kabul nach Goa, andere gingen in die USA und folgten dem Highway 66 und wieder andere, wenn auch nicht ebenso zahlreich, zog es in den russischen Raum, in die Grenzenlosigkeit eines Imperiums, in dem Züge zwischen Moskau und Taschkent, zwischen Leningrad und Odessa verkehrten in einem Raum, in dem man sich verlieren, einfach verschwinden, unerreichbar werden konnte. Das Imperium: das waren die großen Ströme, die man in der Transsibirischen Eisenbahn überquerte, das war die Große Grusinische Heerstraße über den Kaukasus, die Stahlschmelzen, die wie zyklopische Skulpturen in den Steppen abgelegt schienen. Und überall konnte man sich bewegen, wenn man es darauf anlegte und einige Unbequemlichkeiten in Kauf nahm. Man lernte schnell, dass es ein offizielles Leben gab, in dem Stempel, Vorzimmer, Genehmigungen eine Rolle spielten, und ein anderes, in dem all dies ignoriert werden konnte. Ja, es gab so etwas wie den Zauber des Imperiums, produziert durch die Homogenität — man könnte auch sagen: Uniformität — eines Soviet way of life, der in Minsk nicht anders war als in Nowosibirsk oder Wladiwostok und unter dem sich eine noch viel ältere Schicht erstreckte: aus klassizistischen Gebäuden, Gouverneurspalästen, Kaufmannsvillen, Bahnhofsarchitekturen, die aus dem weiten, heterogenen Raum den »einen, unteilbaren« Raum des Imperiums gemacht hatten — allen Revolutionen, Kriegen, Brüchen, Modernisierungsschüben und technogenen Desastern zum Trotz.
Wie sehr die Weite Russlands »die Deutschen« in ihren Bann gezogen hat, lässt sich ziemlich genau ablesen am Genre der nicht abreißenden, informativen, oft aber redundanten Fernsehdokumentationen über Land und Leute, die seit Jahren in den deutschen Fernsehprogrammen laufen, ganz besonders aber zur Weihnachtszeit, wenn die Deutschen entweder nach Mallorca fliegen oder sich nach innen wenden.
Ich weiß nicht, ob es so etwas wie »den« russischen Menschen gibt, sicher weiß ich nur, dass Klaus Mehnerts Buch »Der Sowjetmensch«, erschienen in den späten 1950er Jahren, auf mich einen sehr starken Eindruck gemacht hat. Man sah diesem Buch an, dass sein Verfasser — er war in Moskau aufgewachsen und als jugendlicher Enthusiast Anfang der 1930er in die Sowjetunion gefahren — etwas von »Land und Leuten« verstanden hatte. Sicher ist auch, dass ich bei meinen ersten Reisen auf Menschen traf, die dem positiven Vorurteil vom Russen ganz und gar entsprachen. Noch immer sah man auf den Straßen und in Bahnhöfen die Kriegsversehrten, die bis auf den Rumpf amputiert, auf Holzbrettern sitzend und sich mit in Sackleinen gewickelten Händen am Boden vorwärts stoßend bewegten, und auf den Campingplätzen traf man auf Veteranen in ihren blauweiß gestreiften Matrosenhemden, die einen jungen Deutschen, der noch dazu aus dem westlichen Teil gekommen war, aufnahmen, als sei nichts geschehen: kein Krieg, keine Toten, keine verbrannte Erde. Diese Herzlichkeit und Großzügigkeit, die, wie ich weiß, nicht nur mir zuteilwurde, hatte etwas fast Selbstverständliches und Privates an sich, war keinesfalls eine Zurschaustellung moralischer Überlegenheit, so als wollte man schweigen und vergessen vor den Kindern des Feindes. Es ist so viel von der Herzlichkeit, der Gastfreundschaft »der Russen« gesprochen worden, ich habe sie immer als ein Erbe dörflicher Gemeinschaft empfunden oder als die Verhaltensweise von Menschen in Not, die zusammenhalten müssen, wenn sie durchkommen wollen. Und so kommt es, dass fast alle, die »dort« gewesen sind, sich immer willkommen und gut aufgenommen wussten, dass für viele, denen der Stress, die Indifferenz und »die Kälte« des Westens unbehaglich waren, Russland so eine Art Ersatzheimat geworden ist — eine Ersatzheimat, die sich in der Härte der postsowjetischen Welt aufgelöst zu haben scheint.
Es gab das andere Russland
Wenn man der eigentümlichen Bindung nachspürt, die sich im Laufe vieler Jahre ergeben hat und die es vielen von uns so schwer macht, Putin-Russland so zu sehen, wie es ist, dann kommen noch weitere Momente ins Spiel. Als Student in West-Berlin hatte man die Mauer vor Augen, die freudlos-missgünstigen Gesichter der Grenzbeamten an der Übergangsstelle Friedrichstraße, die Warschauer-Pakt-Panzer in Prag 1968; der sowjetische Kommunismus war für Leute, die von der chinesischen Kulturrevolution schwärmten, ohne von ihr wirklich etwas zu wissen, nicht interessant. Für einen Linksradikalen bot die russische Geschichte des 20. Jahrhunderts allerdings einen unermesslichen Fundus an Identifikationsmöglichkeiten, faszinierenden Gestalten, heroischen Gesten und eine unermesslich große Zahl von Tragödien, von persönlichen und kollektiven Schicksalen, die alle einer »verratenen Revolution« zuzurechnen waren. Aber durch alle oft ans Lächerliche grenzenden Imitationen und Kostümierungen hindurch zog sich eine Faszination oder wenigstens eine Ahnung, dass sich in diesem »russischen Jahrhundert« etwas biblisch Grandioses und Schreckliches ereignet hatte. Es gab so etwas wie einen heißen Kern, der noch immer nicht erloschen und auch den Spätgeborenen als ungelöstes Rätsel hinterlassen war. Wie immer man das nennen mag: Russische Revolution, Silbernes Zeitalter, Budjonnys Reiterarmee, die Intellektuellenphysiognomie Trotzkis, Sergej Djagilews »Ballets russes« in Paris, sowjetische Avantgarde, Konstruktivismus, El Lissitzky, Sergej Eisensteins Kino-Ästhetik — da war etwas, das zu recht unvergessen, unaufgehoben oder — wie in der DDR — nur verstümmelt rezipiert und instrumentalisiert, wieder ans Tageslicht zu befördern war. Und was noch wichtiger war: In der Sowjetunion selbst begann sich nach den Verheerungen des Stalinismus wieder etwas zu regen: Dissidenten, Bürgerrechtler, Untergrundpresse, die Schriftsteller als »Gewissen der Nation«, die Wiedergeburt der Intelligenzija und des Intelligenzija-Mythos. So wenig interessant die Sowjetunion Breschnews und seiner in rascher Folge gestorbenen Nachfolger für die westliche Linke waren, so faszinierend waren die Gestalten, die aus dem Untergrund auftauchten und es mit der Macht aufnahmen. Mit ihnen konnte man sich identifizieren, mit ihnen konnte man sich solidarisieren und neue Hoffnung schöpfen, dass die Geschichte weiterging. Die Begegnung mit den Dissidenten — Mitte der 1970er in den Orten der neuen Diaspora in Paris, London, Kopenhagen, München — und dann mit der Moskauer und Leningrader Szene Anfang der 1980er Jahre war so etwas wie ein Wiederanknüpfen an die heroische und opferreiche Geschichte der russischen radikalen und revolutionären Bewegung. In diesem Kontext sind meine Studien über die Arbeiteropposition in der Sowjetunion, über Petersburg als Laboratorium der Moderne, über die Diskurse der russischen Intelligenzija, das russische Berlin der 1920er Jahre und den Großen Terror im Moskau des Jahres 1937 entstanden.
Es wäre ganz seltsam, diese Arbeit als »Versöhnungs-« oder »Verständigungsarbeit« zu bezeichnen, als Mission oder als Opfer, das zu bringen war. Es war viel weniger und gleichzeitig unendlich viel mehr: Es war die Entdeckung eines Kontinents, den man nach und nach für sich erschloss, mit seinen ungeheuerlichen Menschenschicksalen, von denen wir, die in geordneten Friedens- und Wohlstandsverhältnissen aufgewachsen waren, uns kaum eine Vorstellung machen konnten. Es war diese Entdeckung der anderen Welt, einer anderen Geschichte, die es uns angetan hatte und die wir unseren Landsleuten zu Hause zu übermitteln versuchten. Das ganze heute in Mode gekommene, mitunter so aufdringliche Geschwätz von der »notwendigen Vertiefung« oder »Aufrechterhaltung des Dialogs« kann nur von Leuten kommen, die nie am Abenteuer dieser Begegnungen teilgenommen haben oder die die Organisation des Dialogs zur aparten Sache eines eigenen Berufs gemacht haben. Es gab diesen Dialog über die Mauer hinweg und durch den Eisernen Vorhang hindurch immer, er musste nicht erst von Diplomaten erfunden oder von Politikern, die sich ein Denkmal setzen wollten, inszeniert werden. Die Moskauer Küche der 1970er und 1980er Jahre war die Geburtsstätte eines nie abreißenden Palavers über Gott und die Welt, das in der Zeit der Perestroika dann hinaustrat in den öffentlichen Raum, ins Fernsehen, die Plätze der großen Städte, das Parlament — um später unter dem Regime Putins und der von ihm gleichgeschalteten Medien wieder an den Rand oder ins Ausland verbannt zu werden.
Aufbruch und Sackgasse
Es gab zu dem Zeitpunkt, da die Sowjetunion sich auflöste, viele Gründe für die Befürchtung, dass es zu einer Katastrophe kommen könnte — kaum ein Reich ist je ohne Gewalt von der Bühne abgetreten —, aber es gab ebenso viele Gründe, dass die Staaten, die aus dem zerfallenden Imperium hervorgegangen waren, unter ihnen die Russländische Föderation, es schaffen würden, zu einer neuen Form und zu einer neuen inneren Souveränität zu finden. Im Rückblick der Putin-Jahre, aus der Perspektive der (vorläufigen) Sieger, sind die 1990er Jahre allein die »Zeit der Wirren«, die wilden Jahre von Raub und Mord, totalem Orientierungsverlust, skrupelloser Enteignung des Staats- und Volkseigentums, von Mafia und Oligarchen, Ausplünderung und Kapitalflucht. Im Rückblick der Transitionstheoretiker ist es die Verfehlung eines »an und für sich richtigen Programms«, zu dessen Umsetzung es allein am richtigen Personal gefehlt habe. Zuversichtlich konnte stimmen, dass das Ende des Imperiums auch das Ende der Last des Imperiums mit sich brachte; dass in einem geradezu bestürzend rasanten Aufholvorgang Lernprozesse abliefen, die unter den geordneten Verhältnissen »westlicher Gesellschaften« unmöglich gewesen wären; dass Millionen von Menschen sich ihr Leben unter größtem Risiko und Opfer neu einrichteten — vom »Euroremont« der eigenen Wohnung, also einer Sanierung nach westeuropäischen Standards, bis zur Etablierung gänzlich neuer Berufszweige. Viel sprach dafür, dass das Land, das erschöpft und bis zum Äußersten gefordert war, es schaffe, den Absturz in den Bürgerkrieg zu vermeiden, eine neue Balance finde, Zeit gewinne für die Neueinrichtung des Lebens, die sich nicht im Hauruckverfahren oder durch eine Direktive von oben vollziehen konnte. Die Wildheit jener Jahre — im Straßenbild wie im Denken, in den privaten Verhältnissen wie im Durcheinander der Institutionen — war erschreckend, aber kaum zu verstehen war auch, woher das Land die Kraft für die allenthalben zu beobachtenden gravierenden Veränderungen — auch in der sogenannten Provinz — nahm, ohne auseinanderzufallen. Die Stabilität, die Putin seit seinem Machtantritt dem Land versprochen hat, ist — so stellt es sich wenigstens im Nachhinein heraus — nur eine scheinbare: gestützt auf den durch Öl- und Gasexporte ins Land strömenden Reichtum, dem keine wirkliche Modernisierung des Landes entspricht, und an eine Person gebunden, die in der gefährlichen Illusion lebt, ihr Schicksal sei identisch mit dem Schicksal Russlands.
Die Sackgasse, in die Putin das Land mit seinem gegen die Ukraine vom Zaun gebrochenen Krieg geführt hat, ist für all jene, die an den Geschicken Russlands seit jeher Anteil genommen haben, mehr als nur eine jener Enttäuschungen, mit denen man sich als erwachsener Mensch gewöhnlich abzufinden hat. Wenn man die Kränkung, die in der unerwarteten und unsere eigene Lebenszeit sprengenden Wendung der Geschichte beschlossen liegt, hingenommen hat, kommt die befreiende Seite, die in jedem Akt der Zerstörung liegt, zum Tragen. Wir kommen in die Lage, noch einmal und aufs Neue über Russland nachzudenken.
Fassungslosigkeit und Sentimentalität
Man tut sich schwer mit der neuen Situation, besonders in Deutschland. Putin hat das Undenkbare — Krieg gegen das Brudervolk! — gewagt. Territoriale Integrität gilt nichts mehr, Truppen und Material werden über die Grenze geschafft, Tausende sind inzwischen getötet worden, Hunderttausende auf der Flucht, aus der Millionenstadt Donezk ist eine Geisterstadt geworden, terrorisiert von Freikorpsbanden aus Kriminellen, Ex-Tschetschenien-Kämpfern, russischen Hightech-Experten, Speznas-Agenten und Leuten, die in Public Relation Karriere gemacht haben. Was als Blitzaktion gegen die Krim begann, ist in einen unerklärten Krieg übergegangen, dessen Ende nicht absehbar ist. Putin hat die Ukraine nicht in die Knie zwingen können, bisher jedenfalls nicht, eher umgekehrt: Wider Willen wurde er zum Geburtshelfer einer Nationsbildung, die unter weniger dramatischen Umständen vermutlich Jahrzehnte oder Generationen gedauert hätte. Aber nicht nur ist seine Rechnung nicht aufgegangen, sondern er hat Russland in eine Sackgasse geführt, in die ihn kein Embargo, kein Containment, keine Sanktionen und kein noch so böses Reich des Bösen je hätte führen können — eine Situation, in der niemand sagen kann, was als Nächstes passieren wird.
Von diesem Schock sind besonders jene betroffen, die sich ein Lebtag lang mit Russland und der Verbesserung der Beziehung zwischen Deutschen und Russen befasst haben. Sie alle fragen sich, ob sie nicht etwas überhört oder übersehen, sich selbst und anderen sogar etwas vorgemacht haben und sich jetzt am Ende ihr Scheitern eingestehen müssen. Einige behaupten, sie hätten alles kommen sehen. Ich gehöre nicht dazu. Viele haben noch die Rede Putins im Deutschen Bundestag im September 2001 im Ohr, vielleicht nicht ohne innere Bewegung. 2005 hatte Putin das Ende der Sowjetunion als die »größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts« bezeichnet, was einige bereits stutzig gemacht hatte, und auf der Sicherheitskonferenz in München 2007 hatte er eine Rede gehalten, die von Teilnehmern als schockierend, ja als »Rückkehr in den Kalten Krieg« charakterisiert worden ist. Die Reden sind inzwischen tausendfach analysiert, auf ihre rhetorischen Qualitäten und semantischen Nuancen hin untersucht worden. Zu Recht. Die Rede im Bundestag, gehalten an einem Ort, an dessen Wänden die Inschriften der Rotarmisten vom Endkampf um Berlin sorgfältigst restauriert worden waren, erfasste ein Momentum, in dem vieles zusammenkam: die Tatsache, dass ein russischer Präsident überhaupt im deutschen Parlament sprach, dass er Wert darauf legte, seine Rede in der Sprache Schillers und Goethes zu halten, obwohl er als Knabe in Leningrad aufgewachsen war, der Stadt, die noch gezeichnet war von der Blockade durch die deutsche Wehrmacht und in der er seinen Bruder verloren hatte. Es redete ein russischer Präsident, der mit einem Schlag alle Vorurteile zu widerlegen schien, die wegen seiner Spionagetätigkeit in Dresden in den Köpfen spukten, und der sich schon von seiner physischen Konstitution her von der sprachohnmächtigen Gerontokratie der Sowjetfunktionäre krass unterschied. Von dieser Stelle aus an die deutsch-russischen Tragödien im 20. Jahrhundert zu erinnern, sogar von Lehren aus der Doppelerfahrung des deutschen und sowjetischen Totalitarismus zu sprechen und sodann einen Horizont zu eröffnen, in dem endlich alle Konflikte ausgeräumt und Zukunftsaufgaben angepackt werden könnten — von denen Unternehmer, Ingenieure, Banker, Künstler und Museumsdirektoren schon seit Jahren geträumt hatten —, all das war beeindruckend und hatte viel für sich. Alle Widersprüche und Widerstände schienen sich aufzulösen in einer Sphäre des wechselseitigen Verstehenwollens und Verstehenkönnens.
Es ist auch im Nachhinein nicht schwer zu verstehen, warum die Rede immer wieder von Beifall unterbrochen wurde, der am Ende in standing ovations überging. Ein Gefühl der Dankbarkeit für Russlands Anteil am Gelingen der Wiedervereinigung spielte hierbei eine Rolle, immer grundiert vom Schuldgefühl der Deutschen gegenüber »den Russen«, die mehr als verständliche Sehnsucht nach Frieden nach einem Jahrhundert entsetzlicher Gewalt, die Vorstellung, dass sich alle Probleme, und seien sie noch so groß, im Gespräch würden lösen lassen. Hier ist fast schon das Gesamt von Stimmungen und Erwartungen beschrieben, das bis heute wie ein mentaler Block — nun schon nostalgisch und oft rührselig-kitschig — fortwirkt und bis hin zu der festen Überzeugung reicht, dass die Deutschen und »der Westen« mit der Zurückweisung von Putins »Liebeswerben« die Zukunft verspielt hätten.
Putins Auftritt auf der Münchener Sicherheitskonferenz 2007 wurde als Rückkehr eines selbstbewusst auftrumpfenden Russland empfunden, als er dem Westen, vor allem den USA die Leviten las, indem er den Westen der moralischen Doppelstandards, des Wortbruchs und der Verwilderung des Umgangs mit internationalen Normen beschuldigte und die USA des Strebens nach unipolarer Weltordnung und Weltherrschaft zieh. Eine Weltmacht, die selber Schwierigkeiten hatte, mit der neuen Weltunordnung, mit dem Ende der alten bipolaren Welt klarzukommen, bot dafür genug Angriffsflächen: vor allem den Irak-Krieg der von Georg W. Bush geführten Allianz, der mit einer Täuschung der Weltöffentlichkeit begonnen hatte. Seither ist Putin der Mann, der es »dem Westen zeigt«, vor allem aber »den Amerikanern«, die angeblich hinter allem stehen; er ist der Mann, hinter dem sich alles schart, was gegen die Arroganz der Macht, gegen Amerika und überhaupt gegen die Globalisierung und ihre Folgen ist. Er ist der Rächer für all jene, die sich selber als Opfer sehen — von Konsumterror, Hollywood-Filmen, NSA oder sogar einer missglückten deutschen Wiedervereinigung. Zusammengenommen läuft das auf das »Narrativ« hinaus, dass »der Westen« die Verantwortung für die »Ukraine-Krise« trage und Russland Opfer der aggressiven Politik des Westens, der NATO sei.
Demütigung und failing man
Aber das große Russland ist nicht Opfer, sosehr Putin sich dazu stilisieren möchte. Die Erniedrigung und Demütigung, von der er immer wieder spricht und aus der er demagogisch Kapital schlägt, ist nicht durch Einkreisung und Bedrohung von außen erzeugt, sondern durch die beschämende Situation im größten Land der Welt, das sich unter Putin als unfähig erweist, die notwendigen Schritte ins 21. Jahrhundert zu tun.