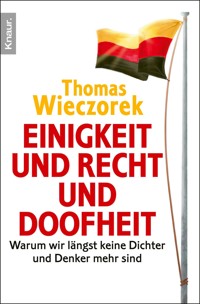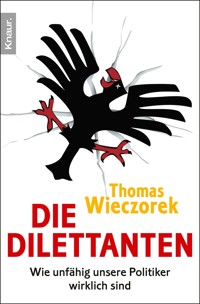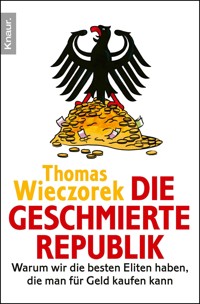4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Euroland in der Krise: Thomas Wieczorek deckt auf, wie dubiose Machenschaften unsere Währungsunion ausplündern! Ist €uroland am Ende? Droht uns die Pleite? In diesem hochaktuellen und brisanten Buch bringt Thomas Wieczorek die ganze Wahrheit über die Eurokrise ans Licht. Er zeigt, wie zwielichtige Ratingagenturen, mächtige Investorenkartelle und neoliberale Politiker die europäische Währungsunion systematisch ausbeuten. Den Profit machen die Reichen und Mächtigen – auf Kosten der Bürger, die am Ende die Zeche zahlen müssen. Wieczorek analysiert die Hintergründe der Wirtschafts- und Finanzkrise und enthüllt die Mechanismen, die zur Destabilisierung des €uro führen. Dieses Buch ist ein Augenöffner für jeden, der verstehen will, was wirklich hinter den Kulissen der internationalen Wirtschaft und Politik vor sich geht. Euroland: Wo unser Geld verbrennt – ein Sachbuch, das in der aktuellen Debatte um die Zukunft unseres Geldes nicht fehlen darf!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 304
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Thomas Wieczorek
E U R O L A N D –Wo unser Geld verbrennt
Wer an dem Schlamassel schuld ist,und warum wir immer zahlen müssen
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Ist €uroland am Ende? Droht uns die Pleite? Thomas Wieczorek deckt die Hintergründe der Wirtschafts- und Finanzkrise auf und zeigt, wie dubiose Ratingagenturen, Investorenkartelle und neoliberale Politiker die europäische Währungsunion systematisch ausplündern. Den Profit machen die Reichen und Mächtigen – zu Lasten der Bürger, die auf jeden Fall die Zeche zahlen werden.
Ein hochaktuelles, brisantes Buch, das endlich die ganze Wahrheit über die €urokrise ans Licht bringt.
Inhaltsübersicht
Vorwort
1 Der Euro,das unheimliche Wesen
Euro – Teuro?
2 Volkes Meinung?In China fällt ein Sack Reis um
EU – Nein danke!
Lissabon: Mitgefangen, mitgehangen
3 Die Geburt des Euro:Theo allein im Währungsdschungel
4 Ohne Euro lebt sich’s besser
5 Der Schmu mit der Stabilitätspolitik
Was ist Geld?
Schreckgespenst Schulden
Die Staatsziele
Inflation – das böse Spiel mit der Angst
Maastricht-Kriterien und Staatsverschuldung
Wem nutzt Stabilität? Die Gläubiger der Problemstaaten
Tarot-Karten, Glaskugeln und Korruption: Die Rating-Scharlatane
6 Das Kaputtsparprogramm
Die Schuldenbremse: ein schwäbisches Hausfrauenmodell
Das Paket: Sparen auf Rezession komm raus
Verrisse von allen Seiten: »Setzen, sechs!«
Die Kreditklemme
Das Elend der Kommunen
Lieber reich und gesund
An wem bleibt wieder alles hängen?
Kinderarmut als Nachhaltigkeit
Ein bisschen Bildung
Der Schlecker-Skandal
7 Befeuert Deutschland die Eurokrise?
Das Dilemma der Marktwirtschaft
Gebrüder Grimm reloaded: Das Märchen vom Staatsbankrott
8 Volksvermögen –Vermögen des Volkes?
Steuerbetrug als »Notwehr«
Ausbürgerung: Warum eigentlich nicht?
Freischampus für Reiche: Darf’s ein bisschen mehr sein?
9 Zahlen wir die Zeche?
Es wächst auseinander, was zusammengehört
Euro am Ende?
»Eurokrise«: Sind die Spekulanten schuld?
10 Die PIIGS-Staaten –Wahrheit und Legende
Pleitepatient Griechenland
Sparen auf Kosten der Kleinen
Der Nächste bitte: Spanien
Abschusskandidat Portugal
Problemfall Irland
Sorgenkind Italien
Staatspleite à la Argentina
Fiskalpolitik: Entweder richtig oder gar nicht
Das politische Kartell
11 Allheilmittel Marktradikalismus
Freie Marktwirtschaft funktioniert, wenn … Der Mensch als Egoist
Das Modell des Adam Smith: Lizenz zur Habsucht?
Wie informiert ist der Käufer?
Die Marke zählt, nicht das Produkt
Die Religion der »unsichtbaren Hand«
Die unverbesserlichen Ignoranten
Wer soll das bezahlen, wer hat so viel Geld?
12 Was tut die Politik,und was könnte sie tun,wenn sie wollte?
Anhang
Die Chronologie des Euro
Die Geschichte der Europäischen Union
Staatsverschuldung in Zahlen
Danksagung
Literatur
Vorwort
Es hatte alles scheinbar so schön begonnen, und alles hatte seinen wahren Ursprung nicht in den EU-Vorläufern, der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) und der Europäischen Gemeinschaft (EG), sondern im Zusammenbruch des staatskapitalistischen Ostblocks und in der deutschen Vereinigung und war eng verbunden mit dem Oggersheimer Bundeskanzler Helmut Kohl. »Wer mir den Quatsch mit den ›blühenden Landschaften‹ in Ostdeutschland abnimmt«, mag er sich damals gedacht haben, »der folgt auch meiner historischen Mission vom vereinten Europa.« Mag auch sein, dass er sich die Sache ganz anders vorgestellt hat, im Sinne des relativ sozialen, von christlichen Ansprüchen geprägten »rheinischen Kapitalismus«, wo der Arbeitgeber fast wie ein Vater für die Angestellten war und wo die Reichen noch – meist ohne zu murren – 53 Prozent Spitzensteuersatz zahlten. Auch die Begründung für den Mehrverdienst des Unternehmers leuchtete vielen Bürgern ein: Er trägt ja schließlich auch das Risiko und steht mit all seinem Hab und Gut für unseren Betrieb ein.
Dann aber wurde Kohl abgewählt und durch Rot-Grün ersetzt. Und wer damals die Illusion hatte, nun würde alles noch sozialer und humaner werden, fühlt sich im Nachhinein wie in einer Folge von Verstehen Sie Spaß? Gerade die »linke« Koalition begünstigte die Reichen durch die Senkung des Spitzensteuersatzes auf 42 Prozent und gesetzliche Freibriefe für jedwede Art von – heute als illegal eingestufter – Spekulation; damit stieß sie die sozial Schwächeren finanziell in den Abgrund. Und folglich betrieb sie das Projekt Europa ausschließlich aus dem Blickwinkel der Großkonzerne, Milliardäre und Spekulanten; der damalige Finanzminister Peer Steinbrück (SPD) pries die Heuschrecken als »geradezu einen Segen für die Volkswirtschaft eines Landes«.1
Nachdem also auch durch unseren Kanzler Gerhard Schröder und den damaligen britischen Ministerpräsidenten Tony Blair mit einem gemeinsamen Pamphlet2 die Weichen für eine menschenverachtende Europapolitik gestellt wurden, war das wirtschaftliche Desaster nur noch eine Frage der Zeit. Und hier erweist sich sogar die Bibel als prophetisch.
Denn sie säen Wind und werden Sturm ernten. Ihre Saat soll nicht aufgehen; was dennoch aufwächst, bringt kein Mehl; und wenn es etwas bringen würde, sollen Fremde es verschlingen.
Altes Testament, Hosea, Kapitel 8, Vers 7
Der Turbokapitalismus (Heiner Geißler) kannte kein Halten mehr, der neoliberale Vordenker Francis Fukuyama sah in ihm das »Ende der Geschichte«3, der homo oeconomicus4 als Menschenbild setzte sich durch, wonach Egoismus und gefühlskalte, hemmungslose Raffgier »rational«, dagegen Rücksichtnahme, Mitfühlen und Solidarität »irrational« sind. Auf Deutsch: Wenn der nette Nachbar uns um eine Flasche O-Saft für seine Gäste bittet, ist es »irrational« und bekloppt, sie ihm einfach zu leihen, »rational« und geschäftstüchtig dagegen, ihm den fünffachen Preis abzuknöpfen.
Dieses Denken und Handeln führte zwangsläufig zum Triumphzug der Lügner und Betrüger. »Der Ehrliche ist der Dumme«, stellte der damalige Tagesthemen-Moderator Ulrich Wickert schon 1996 fest.5
Logische Folge war der steile Aufstieg und der tiefe Fall der New Economy (1999 bis 2000), wo man selbst den Internet-Verkauf von Eiswürfeln nach Grönland als Geschäftsmodell ausgab. Nur mühsam erholte sich die einzigartige Marktwirtschaft; doch kein Jahrzehnt später gab es den nächsten Crash. Die US-Immobilienkrise war lediglich das Tröpfchen, das das Fass zum Überlaufen brachte. Gerade deutsche Banken mischten beim Zocken mit dubiosen Wertpapieren, also beim Spiel mit gezinkten Karten, munter mit. Und wie ein Vater die Spielschulden seines spielsüchtigen Sohnes bezahlt, so kommt der Steuerzahler – und das ist über die Mehrwertsteuer praktisch jeder Bürger, der irgendetwas kauft – für die Verluste der Geldinstitute auf. Und spätestens jetzt gleicht die EU einer ehelichen Schicksalsgemeinschaft: »in guten wie in schlechten Zeiten«, nur dass die Durchschnittsbürger Europas auf die guten Zeiten immer noch warten. Und viele Europäer denken über die EU und den Euro ähnlich wie eine frustrierte Ehefrau über ihren Göttergatten: »Hab ich nicht den Falschen geheiratet?«
Sollten die Skeptiker recht behalten?
Denn dass nun die Eurostaaten – zuvor im internationalen Vergleich überwiegend wohlhabende Länder – als Folge der Finanz- und Wirtschaftskrise fast ausnahmslos in Schwierigkeiten stecken, zeigt schon ein Blick auf die nackten Zahlen: So ermittelte das Europäische Statistikamt Eurostat allein für das Jahr 2009 eine Rezession von 4,1 Prozent (Deutschland 4,9 Prozent); erst ab 2011 wird wieder ein leichtes Wachstum von 1,5 Prozent (Deutschland 1,6 Prozent) erwartet.6
Die Inflationsrate lag bei 0,3 Prozent (Deutschland 0,2 Prozent).7 Dies mögen manche für den Ausdruck »solider Haushaltspolitik« halten. In Wahrheit drückt es nur die Tatsache aus, dass niemand mehr was kauft – die Normalbürger nicht, weil ihnen das Geld fehlt, und die Unternehmen nicht, weil sie für klamme Bürger gar nicht erst produzieren und folglich auch nicht investieren. Insgesamt verzeichnete man für den Euroraum 9,3 Prozent Arbeitslose (Deutschland 7,6 Prozent).8
Vor diesem Hintergrund verwundert es nicht, dass die meisten Euroländer als ziemlich »abgebrannt« erscheinen. Die Frage aber ist, ob zu wenig eingenommen oder zu viel ausgegeben wird – oder beides. Diese Frage spiegelt sich auch in den Lebensgrundsätzen der Normalbürger wider. »Ich brauche nicht viel zum Leben, also auch kein Rieseneinkommen«, sagen die einen. »Je mehr ich verdiene, desto mehr kann ich mir leisten«, meinen die anderen, und wieder andere leben schlicht über ihre Verhältnisse, bis sie dann beim Schuldenberater landen oder Privatinsolvenz anmelden müssen.
Überhaupt Schulden! Nicht wenige Mitbürger haben die Lebensweisheit ihrer Ahnen übernommen, dass Schulden etwas Verwerfliches seien: »Anständige Menschen machen keine Schulden.« Würden sich die meisten Bürger und Unternehmen daran halten, wäre dies das Ende der Finanzbranche.
Zum einen werden hier Schulden mit Überschuldung verwechselt, zum anderen Kredite für Investitionen mit denen für privaten Konsum, von denen aber auch die Wirtschaft profitiert. Ohne Bausparkredite fürs eigene Häuschen oder Ratenzahlung für Autos, Möbel oder Elektronikgeräte müssten viele Menschen auf den Kauf verzichten. Entscheidend ist, ob man seinen finanziellen Verpflichtungen nachkommen kann – wenn man nicht gerade ein angeblich »systemrelevantes« Geldinstitut wie die Hypo Real Estate ist oder als Großkonzern wie Opel »zu groß, um pleitezugehen«.
Ähnliches gilt auch für Staaten. Bloße Zahlen über Staatsverschuldung wie zum Beispiel die Schuldenuhr9 des FDP-nahen Bundes der Steuerzahler sind für sich genommen nichtssagend und irreführend. Viele Staaten haben eine Unmenge an Schulden, Deutschland zum Beispiel im Frühjahr 2010 in Höhe von 1,762 Billionen Euro oder rund 73 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP). Demgegenüber schätzt aber das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) das Gesamtvermögen der Deutschen sogar abzüglich der Verschuldung auf 6,6 Billionen Euro, von dem allerdings ein Prozent der Bevölkerung 25 Prozent besitzt.10 Armer Staat und eine steinreiche Minderheit – man ahnt, wo das Problem liegt und die Möglichkeit seiner Lösung.
Dennoch aber bleibt die Staatsverschuldung für die Mehrheit unserer Mitbürger ein unheimliches, nicht hinterfragtes Schreckgespenst. Laut einer Stern-Umfrage vom Juni 2010 haben 76 Prozent der Deutschen große oder sehr große Angst davor, dass die Staatsschulden nicht mehr zu bewältigen seien. Jeweils 59 Prozent fürchten um die Sicherheit der Renten und meinen, dass die Politiker mit den aktuellen Problemen überfordert seien. 54 Prozent der Bürger sagen, sie hätten Angst vor einer höheren Inflationsrate.11 Allerdings scheint in der aktuellen Krise eher eine Deflation das Problem zu sein.
Merkwürdigerweise sehen aber einige – nicht gerade übermäßig Informierte – das Problem als Krise des Euro. Gerade diese simpel gestrickte Spezies Mensch, deren Eltern und Großeltern in der von Zeitzeugen des Kaiserreichs noch durchsetzten jungen Bundesrepublik grölten: »Wir wollen unseren alten Kaiser Wilhelm wiederhaben«, schreit heute: »Wir wollen unsere gute alte D-Mark wiederhaben.« Ihnen schloss sich sogar Hans Olaf Henkel an: »Ex-BDI-Chef Henkel für D-Mark«, lautete ein Bild-Aufmacher am 7. Juni 2010.12
Tatsächlich trauen viele Deutsche dem Euro noch immer nicht über den Weg. Er ist ihnen unheimlich wie manchen Fortschritts- und Technikmuffeln das Handy oder der PC. Dabei hat der Wechsel des Zahlungsmittels in Deutschland eine lange Tradition. So lag im späten Mittelalter (1250 bis etwa 1520) die Münzhoheit bei Fürsten und Städten, und folglich gab es unzählige Münzen wie Heller, Scherf, Pfennig, Schwaren, Dreiling, Sechsling, Kreuzer, Groat, Stüber, Deut, Schilling, Groschen, Batzen, Taler, Mark, Dukaten oder Gulden.13 Aber auch nach der Reichsgründung 1871 ging der Wechsel der Währungen munter weiter. Der Euro ist seitdem bereits die fünfte. Zuvor kamen:
Die Goldmark – offiziell Mark – war die Währung des Deutschen Kaiserreiches von 1871 bis 1918. Der Name leitet sich von der ursprünglichen germanischen Gewichtseinheit Mark ab und wurde zunächst im Bereich der norddeutschen Hansestädte verwendet. Während der Inflation von 1914 bis 1923 meinte man mit »Goldmark« nur die Goldmünzen als Gegensatz zum entwerteten Papiergeld.
Die Rentenmark war die Antwort der Politik auf die Angst der Deutschen wegen der Inflation von 1914 bis 1923, wo es sogar Briefmarken mit dem Aufdruck 20 Milliarden Reichsmark gab.14 Im Sommer 1923 wurde mit sogenanntem wertstabilem Papiernotgeld – auch Schatzanweisung genannt – mit aufgedrucktem Goldmark- und Golddollar-Bezug versucht, die Inflation einzudämmen, was jedoch gründlich misslang. Auf der Grundlage der gesetzlichen Verordnung über die Errichtung der Deutschen Rentenbank vom 15. Oktober 192315 wurde die Deutsche Rentenbank gegründet. Sie gab Zahlungsmittel mit Datum 15. November 1923 in Banknoten und Münzen an die Bevölkerung parallel zu den umlaufenden hohen Milliarden- und Billionen-Papiermark sowie den in geringerer Anzahl kursierenden wertbeständigen Notgeldbanknoten aus.
Die Reichsmark wurde 1924 eingeführt, als die Goldreserven wieder auszureichen schienen, um damit eine Währung im internationalen Zahlungsverkehr zu decken. Sie sollte eigentlich die Rentenmark ablösen, was aber praktisch nicht geschah. Die ersten Reichsmark-Banknoten und Reichspfennig-Münzen wurden ab dem 30. August 1924 ausgegeben. Das Kursverhältnis betrug 1:1 zur umlaufenden Rentenmark. Die frühen Rentenmark-Banknoten von 1923 wurden zwar eingezogen, spätere Rentenmark-Banknoten kleiner Wertstufen und die Rentenpfennig-Münzen blieben jedoch parallel zur Reichsmark bis 1948 gültig. Die Reichsmark war bis zur Weltwirtschaftskrise 1929 recht stabil. Während der Nazi-Zeit wurde aber viel ungedecktes Geld ausgegeben, um die Kosten für die Aufrüstung und später den Krieg sowie andere Nazi-Projekte zu finanzieren.
Die Deutsche Mark, also die gute alte D-Mark, bei uns meist Mark und im englischsprachigen Raum Deutschmark genannt, wurde durch die Währungsreform vom 21. Juni 1948 in den drei westlichen Besatzungszonen Deutschlands (Trizone) und drei Tage später auch in den drei Westsektoren Berlins durch die Alliierten eingeführt und löste somit die Reichsmark als gesetzliches Zahlungsmittel ab.
Die kurz darauf am 24. Juli in der Sowjetischen Besatzungszone und im Ostsektor Berlins eingeführte neue Währung hieß ebenfalls Deutsche Mark und hatte auch die Abkürzung DM; sie blieb bis zum 31. Juli 1964 die Währung der DDR. Danach hieß sie »Mark der DDR«.
Mit Inkrafttreten der Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion am 1. Juli 1990 löste die Deutsche Mark die Mark der DDR ab und blieb auch im vereinigten Deutschland das gesetzliche Zahlungsmittel.
Der Euro schließlich ersetzte die D-Mark: seit dem 1. Januar 1999 als Buchgeld und seit dem 1. Januar 2002 als Bargeld. Ende des Jahres 2009 war nach Angaben der Bundesbank immer noch Bargeld im Nennwert von etwa 13,6 Milliarden DM im Umlauf; also etwa 5,4 Prozent der Umlaufmenge vom Jahr 2000.16
Vor diesem Hintergrund ist der Euro also nichts Schlimmes oder gar Furchteinflößendes, eher im Gegenteil. Gerade Touristen wissen es zu schätzen, dass sich daheim nicht mehr wie früher Berge unterschiedlichster Währungen stapeln und sie auf Kreta oder Madeira, an der Algarve oder der Côte d’Azur oft nicht ausrechnen konnten, ob die Klamotten, Getränke oder Souvenirs Schnäppchen oder überteuert waren. Dennoch hielt sich die Begeisterung für die neue Währung von Anfang an in Grenzen.
1Der Euro,das unheimliche Wesen
Im Jahre 2002 waren die Eurobefürworter mit 39 Prozent noch in der Minderheit gegenüber den 52 Prozent Skeptikern.17 Nur zwei Jahre später allerdings präsentierte ein Forschungsteam der Fachhochschule Ingolstadt eine Studie, wonach fast 60 Prozent der Deutschen den Euro begrüßten. Viele der Befragten trauerten jedoch der DM nach. Auch rechneten viele der Befragten automatisch die Preise von Euro in DM um, bei höheren Beträgen häufiger als bei niedrigen. Bei allen Preisen taten dies lediglich 48 Prozent der Befragten, bei Preisen über 100 Euro jedoch noch 74 Prozent. Der Grund hierfür ist der einfache Umrechnungsfaktor (recht genau 1:2, exakt 1:1,95583).18
Wozu aber die Aufregung? Ob nun die Menschen in Gedanken den Euro in D-Mark umrechnen oder in Lire, sollte doch eigentlich ganz egal sein. Nicht egal ist es allerdings jenen, die ihre Preise 1:1 umgerechnet hatten, wie wir gleich sehen werden.
Im Jahre 2006 meinten laut Eurobarometer 46 Prozent der Deutschen: »Der Euro ist gut für uns, er stärkt uns für die Zukunft«, während 44 Prozent überzeugt waren, der Euro »schwächt das Land eher«.19 Ende 2007 sank jedoch laut einer Studie der Dresdner Bank im Auftrag der Forschungsgruppe Wahlen die Euroakzeptanz der Deutschen auf 36 Prozent.20
Euro – Teuro?
Einer der Gründe für das zunehmende Misstrauen gegenüber dem Euro ist das Gefühl vieler Menschen, dass mit und seit Einführung der neuen Währung zumindest Teile des Einzelhandels »Preistreiberei« praktizierten.21 So wurde das vom Satiremagazin Titanic erfundene Wort Teuro schnell von den Medien übernommen, zum Bestandteil der Umgangssprache und 2002 sogar zum »Wort des Jahres« gekürt.
Während in einigen EU-Staaten wie Frankreich und den Niederlanden Preiserhöhungen im Zeitraum der Euro-Einführung verboten waren, vertraute man in Deutschland auf eine »Selbstverpflichtung des Handels«22, also eine dieser inzwischen sattsam bekannten Heucheleien, mit denen man auch Verbrecher mit einer »Selbstverpflichtung zur Legalität« auf freien Fuß setzen könnte.
Im Verbraucherpreisindex (VPI) wurden die Preiserhöhungen durch das Warenkorbsystem – die Berechnung nach anteiligen Ausgaben der privaten Haushalte in den verschiedenen Güterkategorien – verschleiert, da die Preiserhöhung nicht alle Produkte betraf.23 Nun gibt es die gestreute Demagogie, dass die Menschen sich den Teuro nur einbilden (»Gefühlte Inflation«), weil die Bürger in Umfragen einen stärken Preisanstieg vermuteten als von den statistischen Ämtern, zum Beispiel vom Statistischen Bundesamt, ermittelt. Richtig ist, dass die Preise für höherwertige Güter weniger stiegen als die der Produkte für den Alltagsgebrauch, also für Lebensmittel, Verkehr oder Strom und Gas. Wenn Fernreisen, Luxusautos oder Computer billiger werden, was macht es da schon, wenn Milch, Butter, Joghurt, Eier, Brot, Brötchen, Obst, Gemüse oder Waschpulver sich im Preis nahezu verdoppeln? Der »Warenkorb« – mit dem anhand ausgewählter Produkte die Inflationsrate ermittelt wird – ist ein Täuschungsinstrument. Motto: »Kaufen Sie sich nichts zu essen, sondern lieber drei Plasma-Fernseher.«24
Nun konnte und kann jeder halbwegs klar denkende Normalbürger nach jedem Supermarkteinkauf feststellen, dass es für immer mehr Geld immer weniger gibt. Bei ihm machen die Kosten für die Dinge des täglichen Lebens einen Großteil seiner Ausgaben aus, während sie von den Besserverdienern aus der Portokasse bezahlt werden. Dem Normalbürger nutzt es nichts, wenn eine Diamantenkette für die oberen Zehntausend nur noch 220 000 statt bisher 250 000 Euro kostet. Daneben haben viele Normalverdiener in den vergangenen Jahren mit geringeren Lohn- und Gehaltszuwächsen leben müssen, was den Teuerungseindruck für die Betroffenen potenziert.
2Volkes Meinung?In China fällt ein Sack Reis um
Der Euro ist offizielle Währung in zweiundzwanzig europäischen Staaten, von denen sechzehn der EU angehören. Andorra, Belgien, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kosovo, Luxemburg, Malta, Monaco, Montenegro, Niederlande, Österreich, Portugal, San Marino, Slowakei, Slowenien, Spanien, Vatikanstadt und Zypern.
Die Münzen werden von jedem der sechzehn EU-Staaten sowie von drei weiteren Staaten mit landesspezifischer Rückseite geprägt. Die Banknoten unterscheiden sich nur durch verschiedene Buchstaben der Seriennummer.
Ein weiterer Grund für das Unbehagen vieler Europäer ist der Umstand, dass sowohl die EU als auch der Euro in den meisten Staaten über ihren Kopf hinweg eingeführt wurden. In Deutschland sind bundesweite Volksabstimmungen zu Einzelfragen laut Grundgesetz, Artikel 29, erst gar nicht zulässig. Es reicht, wenn der Bürger alle vier Jahre seine Volksvertreter wählt – von denen die Hälfte ja ohnehin nur über die Parteienlisten in den Bundestag rutschen –, die dann in seinem Namen so wichtige Entscheidungen wie die Vereinigung mit der DDR oder eben die Einführung des Euro treffen.
Nur in Frankreich, Irland und Dänemark gab es Volksabstimmungen zum Vertrag von Maastricht, wobei das dänische Volk erst im zweiten Anlauf zustimmte, nachdem man unseren nördlichen Nachbarn in einem Zusatzprotokoll die freie Wahl des Ob und Wann der Euro-Einführung garantiert hatte.25
»Du hast wohl geglaubt, du gehörst zu denen, denen Dänen alles durchgehen lassen. Nein, nein, mein Freund.«
Otto Waalkes, Dänen lügen nie
EU – Nein danke!
Als logische Folge der Missachtung des Volkswillens ist die EU den meisten Europäern bis heute fremd geblieben. An der Europawahl 2009 beteiligten sich nur 43,1 Prozent der 376 Millionen Wahlberechtigten, davon in Deutschland auch nur 43,3 Prozent von rund 62 Millionen.26 Manch europakritische Zunge meint, dass ja auch ein Europa der Millionäre und kein Europa der Millionen errichtet worden sei.
Dieses demonstrative Desinteresse spiegelt jedenfalls auch die allgemeine Politikverdrossenheit in Staaten wie Deutschland wider. Dabei ist das Europaparlament neben dem Ministerrat der zweite Teil der EU-Legislative, und die 736 Abgeordneten haben einen nicht geringen Einfluss auf wichtige Entscheidungen, auch in der Wirtschaftspolitik. So brachten sie beispielsweise die Vorschrift zu Fall, nach der in Deutschland nur Bier verkauft werden darf, das nach dem deutschen Reinheitsgebot gebraut ist. Da dieses eherne Verdikt sowohl für deutsche wie für ausländische Hersteller galt, war es zwar nicht direkt benachteiligend, kam aber für die außerhalb Deutschlands hergestellten Biere praktisch einem Einfuhrverbot nach Deutschland gleich. Ebenso bestimmten sie mit über die EU-Wettbewerbspolitik und sorgten mit dafür, dass viele monopolartige Unternehmen, zum Beispiel im Telekommunikationsbereich, bei der Gas-, Wasser- und Stromversorgung und im Eisenbahnverkehr, ihre Sonderstellung aufgeben und sich der Konkur- renz anderer Anbieter auf dem Markt stellen mussten. Der Druck des Wettbewerbs führte teilweise zu mehr Innovation und sinkenden Verbraucherpreisen, aber auch zu schlechteren Lohn- und Arbeitsbedingungen und vielfach zu einem Abbau von Arbeitsplätzen bei den betroffenen Unternehmen.27 Doch obwohl das Parlament recht rigoros den eigentlichen Sinn der EU, die Durchsetzung der neoliberalen freien Marktwirtschaft, betreibt, was keineswegs dem Interesse der Normalbürger entspricht und deshalb von ihnen abgelehnt wird, nimmt man es nicht für voll. Wieso auch? Die meisten Abgeordneten sind den Deutschen entweder völlig unbekannt, oder es sind »Volksvertreter«, deren Europa-Präsenz Folge eigenen Versagens in der nationalen Politik ist und die deshalb – wie im US-Krimi – »aus dem Verkehr gezogen« wurden, bis Gras über die Sache gewachsen ist. Cem Özdemir verzog sich 2004 ins EU-Parlament, nachdem sein zinsgünstiger Kredit beim Unternehmensberater Moritz Hunzinger für Ärger gesorgt hatte.28
Angelika Beer, Ex-Chefin der Grünen, wurde nach einem trunkenen TV-Auftritt292003 ebenfalls im Jahre 2004 ins Europaparlament abgeschoben, 2009 nicht einmal dafür nominiert, woraufhin sie die Grünen verließ und mittlerweise bei der Piratenpartei gelandet ist.30
Ähnliches gilt für die 2003 als PDS-Chefin gescheiterte Gabi Zimmer, die schon seit 2004 im EU-Parlament hockt31, und ihren Parteifreund André Brie, der wegen seiner früheren Stasi-IM-Tätigkeit für eine nationale Führungsposition nicht in Frage kam und daher von 1999 bis 2009 Europa-Abgeordneter war.32
Aber auch die Vertreter anderer Parteien in Europa, etwa die EU-Kommissare Günter Verheugen (SPD), Silvana Koch-Mehrin (FDP) oder Günther Oettinger (CDU), wird wohl niemand ernsthaft zur ersten Garde deutscher Politik zählen.
Lissabon: Mitgefangen, mitgehangen
Nachdem der Plan einer EU-Verfassung am Nein der Franzosen und Niederländer in Volksabstimmungen gescheitert war, nannte man das Ganze Vertrag von Lissabon. Er ist völkerrechtlich bindend und wurde bereits am 13. Dezember 2007 von den 27EU-Mitgliedern unterzeichnet, trat aber nach einigen Querelen – so stimmten die Iren erst in der Wiederholung einer Volksabstimmung zu – erst am 1. Dezember 2009 in Kraft. Das Abkommen reformiert den EU-Vertrag und den EG-Vertrag. Albernes Blabla bietet der Artikel 2EUV über die »Werte« – unter anderem Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte, Toleranz, Gerechtigkeit, Solidarität. Er erinnert an Sandra Bullocks Filmsatire Miss Undercover, wo die Misswahl-Bewerberinnen ihre dümmlichen Statements mit dem Satz beenden: »Außerdem bin ich für den Weltfrieden.«
Die wahren Ziele der neuen EU – neben Angriffskriegen zwecks Sicherung der »ökonomischen Überlebensfähigkeit« durch »Stabilitätsexport zum Schutz der Handelsrouten und dem Fluss von Rohstoffen«33 – nennt Artikel 3: vor allem einen Binnenmarkt mit freiem und unverfälschtem Wettbewerb, Wirtschaftswachstum, Preisstabilität und soziale Marktwirtschaft.34 Letzteres kann man durchaus so verstehen wie die Arbeitgeber-Drückerkolonne Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM). Der Rest ist freie Marktwirtschaft pur: kein Wort zum Beispiel über Arbeitnehmerrechte oder Arbeitslosigkeit.
Aber hat nicht gerade diese Wirtschaftsform die Finanz- und Wirtschaftskrise als Ursache der Verschuldung fast aller EU-Staaten produziert – oder war es am Ende die stalinistische Planwirtschaft oder die Invasion der kleinen grünen Männchen? Dass Euroland fast »abgebrannt« wirkt, während sich in fast jedem EU-Land eine Handvoll von wahren Schmarotzern mit leistungslosem Einkommen eine goldene Nase verdient, ist nicht zufällig das erklärte Ziel der neoliberal-sozialdarwinistischen Nobelpreisträger Milton Friedman (1976) und Friedrich August von Hayek (1974).
Friedman geht davon aus, dass das Reich-Arm-Gefälle zu »sozialen Unruhen« führen würde, und fordert daher als Ergänzung zur freien Marktwirtschaft den starken Staat: »Seine vorrangige Aufgabe muss sein, unsere Freiheit zu schützen sowohl gegen den äußeren Feind als auch gegen unsere Mitbürger, um mit ›Law and Order‹ private Geschäftsbedingungen zu garantieren und konkurrierende Märkte zu schützen.«35
Hayek meint im Februar 1979 in seinem legendären Vortrag an der Uni Freiburg, »dass eine soziale Marktwirtschaft keine Marktwirtschaft, ein sozialer Rechtsstaat kein Rechtsstaat, ein soziales Gewissen kein Gewissen, soziale Gerechtigkeit keine Gerechtigkeit – und ich fürchte auch, dass soziale Demokratie keine Demokratie ist«. Darüber hinaus betont Hayek, er könne nicht sozial denken, denn er wisse gar nicht, was das sei.36
1981 setzt er noch einen drauf: »Soziale Gerechtigkeit ist einfach ein quasireligiöser Aberglaube, den wir bekämpfen müssen, sobald er zum Vorwand wird, gegen andere Menschen Zwang anzuwenden. Der vorherrschende Glaube an ›soziale Gerechtigkeit‹ ist gegenwärtig wahrscheinlich die schwerste Bedrohung der meisten anderen Werte einer freien Zivilisation.«37 Kein Wunder eigentlich, dass die beiden ihren Traum von »Freiheit« ausgerechnet im Chile des verbrecherischen Diktators General Augusto Pinochet verwirklicht sahen.38
Das alles könnte man als asoziales und psychopathisches Geschwätz verhaltensgestörter Sonderlinge abtun, hätten ihre Ideen nicht einen weltweiten Siegeszug angetreten und auch den Geist des Vertrages von Lissabon bestimmt – und hätte sich nicht Angela Merkel als glühende Verehrerin Hayeks geoutet. So lobte sie ihn in einem Aufsatz für die Financial Times Deutschland: »Hayek macht auch deutlich, dass es auf individuelle Freiheit als umfassendes, in der Gesellschaft als Ganzes zu verwirklichendes Prinzip ankommt.«39 Hätte nur noch gefehlt, dass unsere Kanzlerin den Mann ohne soziales Gespür und Gewissen auf eine Stufe mit Graf von Stauffenberg oder den Geschwistern Scholl stellt.
Dabei ist neoliberales Denken und Handeln keineswegs ein Privileg von Schwarz-Gelb, wie wir ja seit der Regierung Schröder/Fischer wissen. »Die Variationsmöglichkeit politischer Anwendung lässt eine respektable Gläubigenschar unter dem Dach des Neoliberalismus zusammenkommen«, schreibt die Wiener Politikprofessorin Eva Kreisky, »vom Konservatismus über Rechtspopulismus bis hin zur Sozialdemokratie und selbst zu den Grünen, fast immer und überall sind es marktliberale Phrasen, die politische Programmatiken nunmehr unterfüttern … Entgegen sonstiger Interessendifferenzen scheint man vor allem in einem Punkt einig, dass nämlich der ›standortbedrohende‹ Sozialstaat auf dem Altar der Unternehmerprofite zu opfern sei, soll globale ›Standortkonkurrenz‹, das Rennen ›um die asozialsten Lebens- und Arbeitsbedingungen‹ (Gerlach 2000, 1055), durchgestanden werden. ›There is no alternative‹ (Thatcher), heißt es im Blätterwald und schallt es aus den TV-Geräten.«40
Vor diesem Hintergrund ist nur allzu verständlich, dass Europas Völker nichts vom Vertrag von Lissabon halten – und fast alle Regierungen wohlweislich ihre Bürger erst gar nicht befragten. Dabei stellte sich der Turbokapitalismus in seinen Anfängen zumindest innerhalb der EU – keine Grenzkontrollen mehr, für die Euroländer eine gemeinsame Währung, freier Warenverkehr und für den Bürger das Recht auf Jobmöglichkeiten innerhalb der Union – noch als relativ harmlos dar. Allerdings äußerte auch das Bundesverfassungsgericht in der Verhandlung von Klagen mehrerer Vertragsgegner Bedenken gegen den Vertrag von Lissabon, Deutschland könne grundgesetzwidrig zu viele Kompetenzen an Brüssel abgeben, fällte aber am 30. Juni 2009 »wohl das grundsätzlichste Grundsatzurteil, das Karlsruhe je gefällt hat« (Heribert Prantl), und stimmte dem Paragraphenwerk grundsätzlich – allerdings mit Einschränkungen – zu. »Nicht jeder, der jetzt in Brüssel jubelt, weil ja der Vertrag von Lissabon grundsätzlich genehmigt worden sei, wird auch noch in einem Jahr jubilieren – weil nämlich dieses Urteil Brüsseler Selbstherrlichkeiten beendet.« So werde der Bundestag die EU-Gesetze nicht mehr einfach durchwinken können. »Es reicht nicht mehr, wie bisher, eine pauschale Sammelzustimmung zu einem EU-Vertrag. Der Bundestag wird sich in jedem Einzelfall mit jeder weiteren Kompetenz für Brüssel befassen müssen, die der EU-Vertrag ermöglicht. Ein eigenmächtiges Zugreifen der EU auf deutsche Zuständigkeiten wird es nicht mehr geben können. Die Ausrede ›Das haben die in Brüssel gemacht‹ funktioniert nicht mehr.«
Der Journalist und Jurist Heribert Prantl sieht voraus: »Infolge des Urteils wird es krachen, etwa im Verhältnis zwischen Karlsruhe und dem EU-Gerichtshof in Luxemburg. Solange das Grundgesetz Gültigkeit hat (abgelöst werden kann es nur durch eine Volksabstimmung), beansprucht Karlsruhe ein Letztentscheidungsrecht in Kompetenz- und Verfassungsfragen … Das kann zu spannenden Konflikten führen. Aber die sind besser als lähmende Müdigkeit.«41
Die Warnungen der Richter kommen nicht von ungefähr, man denke nur an den unsäglichen, de facto polizeistaatlichen Pfusch namens Europäischer Haftbefehl vom 13. Juni 2002, den das höchste deutsche Gericht am 18. Juni 2005 als verfassungswidrig kassierte. So sei das Verbot der Auslieferung deutscher Staatsangehöriger ausgehöhlt und der Rechtsweg zudem ausgeschlossen.
Insgesamt ergibt sich das Bild einer Operettendemokratie: die weiterhin nur indirekte, mittelbare demokratische Legitimation der EU-Kommission. So darf das EU-Parlament den Kommissionspräsidenten zwar »wählen«, aber keine eigenen Vorschläge machen, sondern lediglich den Kandidaten des Europäischen Rates ablehnen oder abnicken. Aus welchem deutschen Staat der jüngeren Geschichte kommt uns das bekannt vor?
Gleiches gilt für den erfahrungsgemäß meist neoliberalen Quark: Die EU-Kommission hat das alleinige Recht, Gesetze und Verordnungen zu formulieren. Sie ist außerdem das ausführende Organ (»Regierung«) und die erste Instanz in wichtigen Bereichen der Rechtsprechung, womit die Gewaltenteilung zwischen Exekutive, Legislative und Judikative komplett aufgehoben ist.
Die Kommission selbst wird natürlich auch nicht gewählt, sondern zwischen den Regierungen und den Wirtschaftsverbänden ausgehandelt. Anschließend muss sie vom EU-Parlament bestätigt werden, das aber keine eignen Vorschläge machen darf. So etwas nennt man Scheindemokratie. Hinzu kommen die weiterhin fehlenden Zuständigkeiten des Parlaments in der Außen- und Sicherheitspolitik und die (trotz des neu eingeführten Kompetenzkatalogs) unklare Kompetenzverteilung zwischen nationalen und europäischen Institutionen.42
Trotz der Mini-Notbremse der Karlsruher Richter bleibt der Vertrag von Lissabon ein Freibrief für militärische Überfälle in der ganzen Welt, für Anleihen beim Polizeistaat, für ein in keiner Weise demokratisch legitimiertes Handeln der EU-Führung – die ihrerseits nur Werkzeug der Regierungen und Mächtigen ist – sowie für einen völlig ungehemmten Marktradikalismus. Wirtschaftsliberalismus und gewaltsames Niederhalten der Bevölkerung – war das nicht die Vision eines Milton Friedman? Der Vertrag von Lissabon war jedenfalls ein Meilenstein auf dem Weg in jene sozialen und ökonomischen Zustände, von der kein EU-Staat und erst recht kein Euroland verschont bleibt.
3Die Geburt des Euro:Theo allein im Währungsdschungel
Die wirkliche Ursache der aktuellen Eurokrise liegt, wie wir noch sehen werden, natürlich nicht in Spekulation und Staatsverschuldung. Vielmehr entladen sich jetzt jene Widersprüche, die schon vor Gründung der Währungsunion bestanden haben. »Der Euro war von Anfang an ein politisches Projekt, kein ökonomisches. So lassen sich die Stabilitätskriterien erklären, deren Einhaltung heute für viele Mitgliedsländer zum Problem wird.«43
Erst mit der deutschen Vereinigung wurde die vage Idee einer Währungsunion zum konkreten Projekt. Besonders Frankreich sah im Euro eine Chance, »dem gnadenlosen Diktat der deutschen Mark zu entkommen«.44 Dies betraf vor allem die Geldpolitik der Deutschen Bundesbank, nach der sich fast alle Staaten Europas unabhängig von ihrer eigenen Konjunkturlage richten mussten, was natürlich ständige Währungskrisen und große wirtschaftliche und politische Spannungen heraufbeschwor. Zunächst sträubten sich die Deutschen gegen den Euro, aber ohne sie wäre wiederum eine Währungsunion undenkbar gewesen. Um sie dennoch zum Mitmachen zu bewegen, schuf man Kriterien, die Länder mit einer »lockeren« Geld- und Haushaltspolitik von vornherein ausschließen. »Doch Italien konnte man dann doch nicht abweisen. Das Land gehörte zu den Gründungsstaaten der EU. Man baute auf die Hoffnung, dass die Italiener, wie alle anderen Mitgliedsstaaten auch, alles tun würden, um die Kriterien wenigstens in der nächsten Zukunft zu erfüllen.«45
Ein zentrales Ziel der Stabilitätskriterien war es, die Politiker möglichst aller konjunkturpolitischen Möglichkeiten zu berauben. Dies entsprach dem damaligen Siegeszug des inzwischen gründlich und auf Kosten der Menschen in aller Welt gescheiterten Marktradikalismus: Finger weg von der Wirtschaft. Der Markt mit seiner freien, durch rein gar nichts beschränkten, skrupellosen Konkurrenz und seinen eigennützigen Raffkes wird’s schon richten. Diesen ökonomischen und moralischen Rohrkrepierer wollte die Europäische Zentralbank (EZB) als Azubi der neoliberalen Bundesbank mit einer zentralen und »von demokratischen Prozessen abgeschotteten Geldpolitik« durchsetzen. Außerdem legte man das Verbot fest, einem überschuldeten Land finanziell unter die Arme zu greifen.46 Übrigens würdigte noch im Mai 2010EZB-Präsident Jean-Claude Trichet die Deutschen als Platzhirsche und Leithammel. Deutschland solle mit seiner »Vorbildrolle« Europa aus der Krise führen. Die Bundesregierung stehe als »eine Art Europolizei in der Pflicht« und müsse »anderen Mitgliedsstaaten der Eurozone auf die Finger schauen«.47
Die erste Stufe der Währungsunion begann am 1. Juli 1990 mit der Herstellung des freien Kapitalverkehrs zwischen den EU-Staaten. Am 1. Januar 1994 folgte die zweite Stufe: Man rief das Europäische Währungsinstitut (EWI) als Vorläufer der EZB ins Leben und prüfte die Haushaltslage der Mitgliedsstaaten. Der Name Euro soll übrigens vom damaligen Finanzminister Theo Waigel erdacht worden sein.
Im Vertrag von Maastricht von 1992 hatten die EU-Mitglieder Kriterien festgelegt, die Staaten erfüllen müssen, die der dritten Stufe der Europäischen Währungsunion beitreten und den Euro einführen wollen.
Auf Theo Waigels Initiative hin wurden zwei Kriterien auf dem EG-Gipfel 1996 in Dublin auch über den Euroeintritt hinaus festge- schrieben. Dieser Stabilitäts- und Wachstumsspakt fordert von den Euroländern in wirtschaftlich normalen Zeiten einen annähernd ausgeglichenen Staatshaushalt, damit in wirtschaftlich ungünstigen Zeiten Spielraum besteht, durch eine Erhöhung der Staatsausgaben die Wirtschaft zu stabilisieren, sowie eine Obergrenze für die Neuverschuldung von drei Prozent und für die Gesamtverschuldung von 60 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Auffällig ist, dass dieses Konzept einen Mischmasch aus einander widersprechenden Theorien darstellt: Der erste Teil (Erhöhung der Staatsausgaben zur Ankurbelung der Konjunktur) entstammt der bei manchen so verhassten Theorie von John Maynard Keynes48, der zweite dem wirtschaftsliberalen Credo vom ausgeglichenen Staatshaushalt um jeden Preis.49 Nur durch den Verkauf von Aktien der Telekom und der Deutschen Post an die staatseigene Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) konnte Deutschland das Schuldenkriterium erreichen. Faktisch hat die KfW die Aktien nur gehalten, das Risiko fallender Kurse blieb beim Bund ebenso wie die Dividendeneinnahmen. Es handelte sich um eine reine Umbuchung, die rechnerisch zu hohen Zahlungen an den Staatshaushalt führte.50
Ein Bericht von Eurostat vom November 2004 über die von der griechischen Regierung geänderte Berechnung des Haushaltsdefizits und der staatlichen Verschuldung zeigt auf, dass die vor 2004 von den Griechen der Kommission mitgeteilten Defizitzahlen nicht nach den europäischen Regeln berechnet waren. Die Falschmeldungen betrafen nicht weniger als elf verschiedene Punkte. Nach der Neuberechnung lagen die griechischen Defizitangaben für die Jahre 1997 bis 2000 über dem Maastrichter Kriterium von 3 Prozent des BIP. Im Klartext: Griechenland hätte der Währungsunion auf Grundlage korrekter Daten niemals beitreten dürfen.51
Auch »seriöse« Staaten wie Deutschland und Frankreich verletzten mehrfach die Stabilitätskriterien; aber dessen ungeachtet konzentrierte man den Blick auf bestimmte Länder und ließ dabei eine diskriminierende Grundeinstellung erkennen. Anfang 2010 entstand der Begriff der PIIGS-Staaten – man beachte die gewollte Ähnlichkeit mit dem englischen pigs (Schweine) –, mit dem Portugal, Italien, Irland, Griechenland und Spanien gemeint sind. Diesen Staaten wird eine so hohe Verschuldung unterstellt, dass ihr Staatsbankrott drohe52, was wiederum die Stabilität des Euro gefährden könne. Worauf diese »Einschätzungen« beruhen, werden wir später noch bestaunen können.
4Ohne Euro lebt sich’s besser
Abgesehen von Großbritannien haben Nicht-Euroländer wie Dänemark und Schweden, aber erst recht Nicht-EU-Mitglieder wie Norwegen oder die Schweiz einen teilweise extrem höheren Lebensstandard als wir. In der UNO-Weltrangliste zum Lebensstandard belegt Norwegen Platz 1, Schweden ist Platz 7, die Schweiz Platz 9 und Dänemark Platz 16, während Deutschland nur auf Platz 22 landet.53 Das führt geradewegs zur Frage: Wenn der Euro also nicht der Bevölkerung nutzt – wem dann?
Dass Norwegen Spitze ist, liegt nicht nur daran, dass das Land so klein und dank seiner Bodenschätze fünftgrößter Gas- und elftgrößter Öllieferant der Welt ist. »Norwegen schwimmt in Öl und Gas und damit im Geld«, stellt der Focus fest. So spülte im Jahre 2008 allein die Petro-Steuer der Ölkonzerne 38 Milliarden Euro in den Staatssäckel. Norwegen ist vielmehr auch Spitze, weil die Regierung die Petro-Steuer sinnvoll einsetzt und damit die Altersversorgung der Bürger finanziert, also einen Pensionsfonds, aus dessen Gewinnen höchstens vier Prozent pro Jahr in die Staatskasse wandern dürfen.54 Norwegen hat also jene »sichere Rente«, die der damalige Arbeitsminister Norbert Blüm (CDU) den Deutschen versprochen hatte. Zu Unrecht, weil die Rentenkasse jahrzehntelang zweckentfremdet wurde, die staatliche Rentenversicherung jetzt fast pleite ist und der Bürger für das Altersgeld auf windige Privatversicherungen angewiesen ist, wie die Riester-Rente, die ehrlicherweise Allianz-Rente heißen müsste: Der Steuervorteil für Arbeitnehmer ist in Wahrheit ein Geschenk an die Versicherungskonzerne. Wenn der Staat – ob durch Abwrackprämie oder Kombilohn – den Bürger scheinbar unterstützt, sichert er in Wahrheit die niedrigen Warenpreise, also den Umsatz und damit den Gewinn der Unternehmen.
Aber auch die hemmungslose Ausplünderung der Staatskasse durch die Konzerne macht nicht den Hauptunterschied zu den Norwegern aus. »Der Mythos von der Gleichheit aller Norweger ist wesentlicher Bestandteil der Gesellschaft«, schreibt der Focus. »Schüler duzen ihre Lehrer, Rekruten in der Armee ihre Vorgesetzten. Der Umgangston ist auffallend freundlich und von Wohlwollen und Respekt geprägt.« Der Osloer Wirtschaftsprofessor Karl Ove Moene sieht in der Gleichheit jedoch mehr als einen Mythos, nämlich »das wahre Erfolgsgeheimnis des norwegischen Wohlstands … Wir haben sehr geringe Einkommensunterschiede, da alle Gewerkschaften die Gehälter zentral untereinander aushandeln.« Zudem hat Norwegen weniger als drei Prozent Arbeitslose55, Besserverdiener zahlen 48 Prozent Einkommensteuer und reiche Norweger 1,2 Prozent Vermögensteuer.56