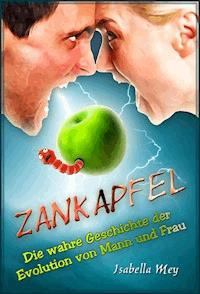0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Fabolon ist anders
Wie anders, das müssen Lisa, Felix, Maja und ihr Rektor schmerzlich feststellen, als sie völlig unvorbereitet aus ihrer Schule in eine fremde Welt katapultiert werden. Und Lisa muss erkennen, dass es alles andere als harmlos ist, von einem Stich in den Finger zu träumen …
Nachdem die beiden Lehrer das Geschenk auf dem Boden abgestellt hatten, befreite es der Rektor vom Papier und musterte mit gerunzelter Stirn den Inhalt: Das Gemälde im dicken Holzrahmen zeigte einen in helles Blau getauchten Brunnen, umgeben von Tropfsteinen. Leuchtende Wellen und Malereien von fantastisch anmutenden Wesen zierten die Szene.
»Äußerst absonderlich«, bemerkte Herr Mayer.
»Ich hoffe, wir haben ihren Geschmack getroffen.« Frau Kassandra streifte eine Haarsträhne hinters Ohr und lächelte unsicher ...
Doktor Mayer rückte seine Brille zurecht und betrachtete das Bild eingehender. »Nun, sehr absonderlich«, wiederholte er stirnrunzelnd.
Im selben Atemzug zeigte sich das Gemälde von seiner absonderlichsten Seite: Plötzlich begannen sich die Wesen darin zu bewegen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 522
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
FABOLON
FarbelFarben
Isabella Mey
Band I
Das Buch Fabolon widme ich meiner Tochter Lara, die die Geschichte durch ihre unzähligen fantastischen Ideen bereichert hat.
Vorwort
Liebe Leser,
bevor ihr loslegt, um direkt ins Abenteuer von Fabolon einzutauchen, habt ihr die Möglichkeit, die Protagonisten in einem Interview kennenzulernen(siehe Anhang), das ich als Autorin mit ihnen führe. Natürlich könnt ihr aber auch direkt in die Geschichte eintauchen.
Wenn ihr etwas nicht ganz versteht oder euch mehr Informationen über Fabolon wünscht, blättert einfach hinten im Lexikon nach. Hier findet ihr auch eine Erklärung der Farbmagie sowie die Entstehungsgeschichte des Planeten.
Viel Freude beim Lesen wünscht euch
Isabella Mey
Kleine Anmerkung: Genau wie das Wort Kinder umfasste das Wort Leser schon immer beide Geschlechter, deshalb verzichte ich generell auf überflüssige Anhängsel. Wer sich eine Gleichberechtigung zur eher männlich klingenden Endung -er wünscht, kann sich ja am weiblichen Artikel des Plurals erfreuen.
Sehnsucht
Frankfurt, Sonntag, 25. November
Der Schmerz verflog genauso schnell, wie er gekommen war. Lisa hob ihre Fingerkuppe vor die Augen, wo ein einzelner Blutstropfen hervorquoll und in dieser Position verharrte. Vorsichtig verrieb sie ihn zwischen den Fingerspitzen. Es kam kein Blut mehr nach, doch ein winziger roter Punkt zeichnete sich auf ihrem linken Daumen ab, sah aus wie ein Insektenstich.
Verwirrt schaute sich Lisa um, doch weder kleine Tiere noch stachelige Büsche waren zu sehen. Der Wind hatte aufgefrischt und zerrte an ihrem grünen Kleid, wirbelte ihr das lange Haar ins Gesicht. Mit gespreizten Fingern kämmte sie es zurück, um einen Blick über die Düne hinweg zum Meer zu werfen. Unwillkürlich vollführte ihr Herz einen Hüpfer, als sie den hübschen jungen Mann zwischen den Felsen erspähte. In Shorts gekleidet hockte er auf einem schroffen Stein, die Gischt umspülte die nackten Füße. Mit einem Stock stocherte er im losen Untergrund herum, der in den auslaufenden Wellen hin und her wiegte, als spielte das Wasser mit den Kieseln.
Doch Lisas freudige Erregung erlosch ebenso schnell, wie sie entflammt war, denn sie spürte sofort, dass mit ihm etwas nicht stimmte. In Gedanken versunken, hatte er Lisa nicht bemerkt, aber selbst auf die Distanz konnte sie die tiefe Trauer spüren, die er ausstrahlte – eine Schwermut, die auch sie mitzureißen drohte.
Was ist passiert?
Lisa rührte sich nicht. Weder konnte sie sich von seinem Anblick lösen noch wollte sie ihn stören. Eine Weile verharrte sie reglos, bis sie plötzlich eine Veränderung im Wasser erfasste: Ein graues Etwas trieb unaufhaltsam auf den jungen Mann zu. Es breitete sich aus und umzingelte ihn in einem weiten Bogen, als wollte es ihn verschlingen. Lisa wusste nicht, was es war, doch mit jeder Pore ihres Seins spürte sie die große Gefahr, die davon ausging. Sie wollte schreien, ihn warnen, doch der Schock schnürte ihre Kehle zu. Immerhin setzten sich ihre Beine wie von selbst in Bewegung und ein Keuchen entwich ihrer Kehle, welches jedoch vom Wind fortgetragen wurde, während sie durchs Dünengras preschte. Noch bevor die Düne in felsigen Untergrund überging, versanken ihre Füße so tief im Sand, dass sie stolperte und stürzte. Der Schwung ließ sie vorne überkippen. Noch im Fallen sah sie, wie das graue Verderben unaufhaltsam auf den jungen Mann zurollte.
Nein! Nein!
»Nein!«, schrie Lisa und richtete sich ruckartig in ihrem Bett auf.
Die Erkenntnis, dass alles nur ein böser Traum gewesen war, tröpfelte erst allmählich in ihr Bewusstsein. Noch immer donnerte ihr Herz wie wild, kalter Schweiß stand auf ihrer Stirn. Erschöpft ließ sie sich zurück ins Kissen sinken. Die Sonne war noch nicht aufgegangen, dafür sandten die Scheinwerfer eines vorbeifahrenden Autos helle Streifen durch die Ritzen des Rollos.
Warum immer wieder dieser Traum?
Schon zum dritten Mal hatte sie immer dasselbe geträumt und alles hatte so echt gewirkt, der Wind, das Rauschen des Meeres, der Sand in ihren Schuhen … Das musste etwas zu bedeuten haben, doch Lisa hatte nicht die blasseste Ahnung, was es sein könnte. Weder kannte sie den jungen Mann noch war ihr diese Umgebung am Meer vertraut und für einen symbolhaften Traum hatte wiederum alles viel zu real gewirkt.
Das Verrückte jedoch war, dass Lisa dieser junge Mann nicht mehr aus dem Kopf ging, seit sie das erste Mal von ihm geträumt hatte. Gesichtsform und Haarschnitt erinnerten sie an den Prinzen aus »Drei Haselnüsse für Aschenbrödel«, allerdings hatte Lisas Prinz dunkelblondes, statt schwarzes Haar und eine blaue Iris. Das wusste sie ganz genau, obwohl sie seine Augen im Traum von der Düne aus gar nicht hatte erkennen können.
Wer ist das nur? Existiert er überhaupt in der Wirklichkeit
Unruhig wälzte sie sich von einer auf die andere Seite, doch der Schlaf wollte einfach nicht mehr kommen. Schließlich schob Lisa ihre Füße aus dem Bett und tapste ins Bad. Nach dem Toilettengang streckte sie ihre Hände in den kalten Wasserstrahl überm Waschbecken. Plötzlich blieb ihr Blick auf dem linken Daumen hängen.
Ist das da tatsächlich ein Stich?
Lisa trocknete ihre Hände ab und betrachtete den roten Punkt auf der Fingerkuppe von allen Seiten.
Das kann doch nicht wahr sein? Ich träume von einem Stich in den Daumen und habe danach tatsächlich einen? Oder träume ich etwa noch immer?
Sie kniff die Lider zusammen und atmete tief durch.
Nein, ich bin wach, aber wahrscheinlich ist es so abgelaufen, dass ich mich irgendwo im Bett gepiekt habe und das in meinen Traum eingeflossen ist.
Lisa suchte gründlich ihr Bett ab, schüttelte Decke, Laken und Kissen aus, doch wenn dort etwas Spitzes gewesen sein sollte, so lag es jetzt mit Sicherheit irgendwo auf dem Teppich.
Da ihr das alles viel zu verrückt vorkam, um sich weiter darüber den Kopf zu zerbrechen, schob sie die Angelegenheit in die Schublade der unerklärlichen, aber unbedeutenden Zufälle. Es dauerte dennoch noch eine ganze Weile, bis sie sich wieder entspannte und schließlich eindöste.
An diesem Sonntag hätte Lisa ausschlafen können, dennoch wollte sie rechtzeitig wach sein, bevor ihr Vater eintraf. Schließlich kam es nicht allzu oft vor, dass er Zeit fand, den Tag mit seiner Tochter zu verbringen. Das lag vor allem an seinem Beruf aber auch daran, dass er nach der Scheidung mit seiner neuen Partnerin nicht mehr in Frankfurt, sondern in Mainz lebte.
Auch früher hatte Lisa ihren Vater manchmal vermisst, doch seit der Trennung der Eltern bekam sie ihn kaum noch zu Gesicht. Aber um ehrlich zu sein, hatten sich Tatjana und Benjamin auch schon vor seiner neuen Liebe voneinander entfernt. Für dieses Argument war ihre Mutter jedoch kaum zugänglich, denn in ihren Augen trug einzig und allein Cecilie Schuld daran, diese glückliche Familie zerstört zu haben.
Benjamin Fischer war ein gefragter Pianist und Dirigent und deshalb beruflich häufig unterwegs. Tatjana Fischer dagegen spielte die zweite Geige in der Frankfurter Oper – in Festanstellung, sodass sie auch damals oft alleine mit ihrer Tochter zu Hause zurückgeblieben war.
Naturgemäß sprang das Talent der Eltern und die Leidenschaft für die Musik auch auf Lisa über. Klavier, Geige und vor allem die Querflöte gehörten zu ihren Favoriten.
In ihrem Zimmer über der Haustür hielt Lisa bereits Ausschau nach ihrem Vater. Nachdem die letzten Zusammentreffen ihrer Eltern alles andere als angenehm verlaufen waren, wollte Lisa unbedingt einen erneuten Streit vermeiden.
Kaum erspähte sie Benjamins Auto, rannte sie auch schon ins Erdgeschoss und mit einem »Tschüss Mama!« stürmte sie nur wenige Augenblicke später aus dem Haus. Ihr Vater hatte gerade eingeparkt, als seine Tochter die Wagentür aufriss und einstieg.
»Na, hoppla! Das ging aber schnell, heute«, staunte Benjamin. »Schön, dich zu sehen.«
»Hallo«, keuchte Lisa und schenkte ihrem Vater ein freudiges Lächeln. Das zurückgekämmte dunkelblonde Haar gab einen guten Blick auf die graublauen Augen des Vaters frei, die sein sanftes Gemüt verrieten.
Benjamin nahm die Hand vom Lenkrad und streichelte Lisa mit seinen feingliedrigen Fingern übers Haar. »Was möchtest du heute unternehmen?«
»Egal, Hauptsache, du fährst jetzt los.« Lisas sorgenvoller Blick glitt zur Haustür, die sich in diesem Moment öffnete.
Der Vater-Tochter-Ausflug führte die beiden in den Frankfurter Palmengarten. Nachdem sie einige Tropenhäuser besucht hatten, fuhren sie schließlich mit einem Tretboot über den kleinen See. Eine ungewöhnlich warme Novembersonne brachte die beiden ins Schwitzen, sodass sie ihre Mäntel auszogen und hinten im Boot verstauten. Im See gab es einen Geysir, der seinen kräftigen Wasserstrahl in den Himmel schickte. In den feinen Nebeltröpfchen schillerte ein Regenbogen.
»Fahr nicht zu nah ran, sonst werden wir noch pitschnass!«, mahnte Benjamin seine Tochter, die das Steuer übernommen hatte.
»Keine Sorge, ich will nur um die kleine Insel herumfahren«, erwiderte Lisa und steuerte in den Kanal zwischen Ufer und Insel auf ein Entenpärchen zu.
Ihr stockte der Atem, als sie plötzlich auf dem Pfad, der das Ufer säumte, jemanden entdeckte, den sie nur allzu gut kannte: Felix. Noch hatte er Lisa nicht bemerkt, doch gemeinsam mit zwei Erwachsenen und einem jüngeren Mädchen kam er geradewegs auf sie zu. Unwillkürlich rutschte Lisa tiefer in ihren Sitz, während sie kräftig in die Pedale trat. Dabei beobachtete sie, wie Felix mit säuerlicher Miene vorneweg marschierte. Sein Blick streifte das vorbeifahrende Tretboot, kehrte abrupt zu Lisa zurück und stoppte in ihrem Gesicht, wobei sich seine Miene merklich erhellte. Hitze schoss in Lisas Wangen, denn sie schwärmte heimlich für ihren Mitschüler Felix. Er dagegen übersah das zurückhaltende Mädchen meistens.
»Hi Lisa! Auch auf Familienausflug?«, erkundigte er sich.
Jetzt, wo sie nicht nur in seinen, sondern auch in den Fokus seiner Familie geraten war, spürte sie, wie sich die Farbe ihres Gesichts merklich intensivierte. Aber es half ja nichts, deshalb antwortete sie zaghaft: »Nur mit meinem Vater.« Benjamin nickte dem jungen Mann und seiner Familie am Ufer lächelnd zu. Felix' Eltern grüßten freundlich zurück, nur das Mädchen (seine Schwester?) spitzte die Lippen. Unterdessen hatte Lisas Vater geistesgegenwärtig rückwärts getreten, um zu verhindern, dass das Boot während der Begrüßung weitertrieb.
»Felix, aus meiner Klasse«, raunte Lisa ihrem Vater zu und rief dann verlegen zu ihrem Klassenkameraden: »Äh, wir müssen dann weiter.«
»Ja klar. Ich hab hier auch noch viele wichtige Dinge zu erledigen.« Felix winkte lachend, doch Lisa schien es, als machte er sich über sie lustig. Sie kam sich maximal dämlich vor, trat kräftig in die Pedale, wollte nur noch weg.
In diesem Augenblick sprang das blond gelockte Mädchen plötzlich von hinten vor ihren Bruder und rief »Buh!« Dabei wedelte sie mit den Händen vor seinem Gesicht herum. »Felix ist verliebt!« Lisa sah gerade noch, wie er entnervt ihre Hände wegschlug.
»Aua!«, jaulte sie.
»Red’ doch nicht so einen Schwachsinn! Du weißt ganz genau, dass ich das nicht leiden kann, Lilli!«, schimpfte er.
»War doch nur Spaß!«
»Warum streitet ihr schon wieder? Kann man nicht einmal einen Familienausflug in den Palmengarten machen, ohne dass ihr euch in die Haare kriegt?«, beschwerte sich die ältere Version von Felix.
Während sich das Tretboot zunehmend entfernte, warf Lisa noch einmal verstohlen einen Blick zurück: Die Geschwister standen sich grimmig gegenüber, während die Eltern vor allem Felix ins Visier nahmen.
»Du bist doch der Ältere, man sollte meinen, dass du inzwischen vernünftig genug wärst, um mit deiner Schwester nicht in Streit zu geraten«, schallt die Mutter.
»Was kann ich denn dafür, dass sie mich immer wieder ärgert? Und warum haltet ihr jedes Mal zu Lilli?«
Die Antwort konnte Lisa jetzt nicht mehr verstehen, weil sich das Boot schon zu weit entfernt hatte.
»Netter junger Mann, dieser Felix«, bemerkte Papa schelmisch grinsend. »Und du magst ihn, stimmts?«
»Hm, ja, er ist ganz nett«, gab Lisa schulterzuckend zu und schon wieder kämpfte sie gegens Rotwerden.
»Naja, du bist ja jetzt schon in einem Alter, wo man sich fürs andere Geschlecht interessiert …«, begann Benjamin zaghaft. »Spricht deine Mutter denn mit dir über diese Dinge, wie … Verhütung?« Er schenkte ihr ein unsicheres Lächeln.
Offenbar sah es Benjamin als seine Pflicht an, Lisa darauf hinzuweisen, obwohl ihm das Thema sichtlich unangenehm war.
Sie verdrehte die Augen. »Papa! Mit sechzehn weiß man darüber Bescheid, wie Kinder entstehen und wie man es verhindert. Wir lernen das auch in der Schule.«
»Ach so. Dann ist ja gut.«
Sie fuhren eine Weile schweigend weiter, umrundeten die zweite größere Insel, bis Benjamin das Thema erneut aufgriff.
»Und gibt es denn da schon jemanden?«, erkundigte er sich neugierig. »Felix vielleicht?«
Lisa schüttelte wild den Kopf. Sie wollte einfach nicht, dass irgendjemand von ihrem Schwarm wusste – auch nicht ihr Vater. Und von dem Jungen aus ihren Träumen konnte sie ihm erst recht nichts erzählen, sonst würde er noch glauben, dass sie sich in Fantasiewelten flüchtete.
»Was treibst du denn so in deiner Freizeit?«
»Das weißt du doch, Papa. Vor allem spiele ich Querflöte.«
»Ich sorge mich ein bisschen, dass du vereinsamen könntest, vor allem seit du nicht mehr fechtest. Unternimmst du denn auch etwas mit Freunden?«
»Ja, manchmal …«, wich Lisa aus. In Wahrheit war sie als empfindsamer Mensch generell eher introvertiert, doch seit der Trennung ihrer Eltern hatte sie sich tatsächlich noch mehr zurückgezogen. Selbst das Fechttraining, bei dem sie in ihrer Freizeit etwas Gesellschaft gehabt hatte, hatte sie aufgegeben. »Wie geht’s Cecilie mit dem Baby? Wisst ihr schon, was es wird?«, lenkte Lisa ihren Vater auf ein anderes Thema.
»Nein, wir wollen uns überraschen lassen.«
»Ach so, verstehe …«
Die Tatsache, dass Papas Partnerin schwanger war, erfüllte Lisa mit Wehmut. Einerseits war es zwar aufregend, dass sie ein kleines Halbgeschwisterchen bekommen würde, doch da sie kein Teil dieser Familie war, fürchtete sie, durch das neue Kind noch mehr ausgeschlossen zu werden. Dieses Gefühl wollte sie sich jedoch nicht zugestehen, denn mit sechzehn war sie kein Kind mehr und könnte theoretisch auch schon ganz alleine leben.
Noch ein paar Minuten schipperten Vater und Tochter auf dem See herum, dann brachten sie das Tretboot wieder zur Anlegestelle. Benjamin wollte den Park mit der Minieisenbahn durchqueren, in Erinnerung an alte Zeiten, in denen Lisa deutlich mehr Enthusiasmus für solche Fahrten gezeigt hatte. Sie besuchten das Wüstenhaus und wanderten schließlich zum Ausgang. Den Abschluss bildete ein Besuch im Café am Palmengarten.
Traurig sah Lisa dem Ende der gemeinsamen Zeit entgegen, ohne zu ahnen, welches Drama sie zu Hause erwartete.
Benjamin hatte sich gerade im Vorraum des Reihenhauses von seiner Tochter verabschiedet und winkte Lisa noch einmal zu, als Tatjana eilig hinzutrat und nach seiner Hand schnappte.
»Bleib doch noch, Benni«, flehte sie inständig.
Lisa stand erschüttert im Wohnzimmer und hielt es für einen ziemlich schlechten Film, was sich da direkt vor ihren Augen abspielte. Bekleidet mit seinem langen, beigen Mantel gab Benjamin ein entnervtes Keuchen von sich, während er sich mit gesenktem Blick die Stirn rieb.
»Bitte, Tatjana! Nicht vor unserer Tochter …«
Doch die Furcht der Mutter vor Verlust war zu groß. Statt loszulassen, schlang sie haltsuchend beide Arme um ihn.
»Bitte bleib …«, keuchte sie.
Da es dem sanften Gemüt des Musikers nicht entsprach, Gewalt anzuwenden, versuchte Benjamin zu halbherzig, sich aus ihrer Umklammerung zu befreien. Auf diese Weise konnte er ihrer Umarmung zwar nicht entgehen, dafür wandte er mit gesenkten Mundwinkeln resigniert den Kopf zur Seite.
Wie versteinert verharrte Lisa im Wohnzimmer und starrte durch die offene Tür zum Vorraum hinüber. Sie wollte das nicht mitansehen und doch brachte sie es nicht fertig, sich von diesem leidvollen Szenario zu lösen. Ihr blasser Leib fror fest, während sie das Gefühl überkam, irgendwie neben sich zu stehen.
»Du willst uns doch nicht wirklich verlassen …«, schluchzte Tatjana, wobei sich nun Tränen aus ihren Augen lösten.
»Das bringt doch alles nichts«, keuchte Benjamin. »Lass mich los!« Allmählich mischte sich Wut in seine Stimme. Er packte ihre Finger, um sie von seinem Rücken zu lösen, während er sich aus ihrer Umarmung herauswand. Sie wollte erneut nachfassen, doch Lisas Vater packte ihre Handgelenke und hielt sie auf Abstand.
Da verlor Tatjana nun völlig die Fassung. In die Tränen des Schmerzes mischten sich nun auch Tränen der Wut hinein. »Was findest du nur an dieser Cecilie?«, rief sie heulend. »Ist sie besser als ich, ja?«
»Jetzt hör doch auf mit dem Unsinn«, schnaubte Benjamin entnervt. »Du hast doch selbst gemerkt, dass es einfach nicht mehr passt zwischen uns.«
»Gar nichts merke ich davon. Und hast du eigentlich auch mal an unsere Tochter gedacht? Ist sie dir völlig egal geworden?«
In diesem Moment hätte Lisa ihre Mutter am liebsten auf den Messeturm geschossen. Sie hasste es, wenn Tatjana sie dafür benutzte, ihrem Vater ein schlechtes Gewissen einzureden.
»Nein, natürlich nicht«, schnaubte Benjamin. Sein unglücklicher Blick wanderte an Tatjana vorbei zu Lisa. Mit zusammengepressten Lippen sah er sie traurig an, dann ließ er die Handgelenke seiner Exfrau los, wandte sich abrupt um, öffnete die Tür und flüchtete aus dem Haus.
Tatjanas verletzter Zorn brach jetzt mit voller Wucht hervor.
»Dann hau doch ab!«, schrie sie ihm hinterher. »Geh doch zu deinem Flittchen! Und lass dich nie wieder blicken!«
Sie knallte die Tür ins Schloss, dann krümmte sie sich, brach erneut in Tränen aus. Im nächsten Augenblick erinnerte sie sich jedoch wieder an ihre Tochter, schaute schluchzend zu ihr auf, als würde sie in dieser leidvollen Lage von ihr Unterstützung erhoffen. Aber Lisa ertrug den Anblick ihrer Mutter nicht länger. Sie wandte sich ab, rannte die Wendeltreppe hinauf und in ihr Zimmer hinein. Sie schloss die Tür und drehte den Schlüssel herum. Was sie jetzt am allerwenigsten gebrauchen konnte, war eine Mutter, die bei ihr Trost suchen wollte. Lisa lief zum Fenster, um vielleicht einen letzten Blick auf ihren Vater zu erhaschen, aber alles, was sie sah, war sein Wagen, wie er gerade aus der Parkbucht scherte und davonbrauste.
Niedergeschlagen warf sie sich auf ihr Bett, blieb dort liegen und starrte zur weißen Decke hinauf, doch es wollten keine Tränen kommen. Sie fühlte sich wie betäubt, dachte betrübt an längst vergangene schöne Zeiten: Da hatte Papa am Flügel gespielt, Tatjana hatte ihn auf der Violine und Lisa auf der Querflöte begleitet. Und manchmal hatten sie alle zusammen gesungen.
Lisa hatte den Sonntag gemeinsam mit ihrem Vater sehr genossen, doch dummerweise hatte er den Fehler begangen, sie ins Haus zu begleiten, sodass es zu diesem Drama zwischen ihren Eltern gekommen war.
Warum können sich Eltern nicht einfach vertragen?
Allmählich lösten sich doch ein paar Tränen aus Lisas Augen und verschafften ihrem Schmerz Erleichterung. Sie wusste, dass es kein Zurück gab und doch sehnte sie sich nach der Unbeschwertheit ihrer jungen Jahre. Wie sie so dalag, schweiften ihre Gedanken unwillkürlich zu ihrem nicht existenten Traumprinzen ab. Er war wie eine fantastische Insel, auf die sie sich flüchten konnte, wenn ihr das Meer der Realität zu stürmisch wogte. Und wie jedes Mal, wenn sie an ihn dachte, spürte sie ein sehnsuchtsvolles Ziehen in ihrer Brust.
Kann man sich in jemanden verlieben, der nur in der eigenen Fantasie existiert?
Die Frage rotierte in ihrem Geist, bis sie in einen dämmrigen Zustand abtauchte.
Schutzgeld
Frankfurt, Mittwoch, 28. November
»Her mit dem Geld, oder es setzt Prügel!«, drohte Rick dem Fünftklässler, dessen Namen er vergessen hatte.
»Ich hab doch gesagt, ich habe keines«, jammerte der Junge und versuchte wegzulaufen, doch Rick war schneller. Er packte ihn am Kragen und schleuderte ihn ins Gebüsch.
»Dann besorg nächstes Mal welches!« Rick riss dem Jungen den Ranzen vom Rücken und wühlte darin herum.
»Hör auf, oder ich sag’s meiner Mama!«, wimmerte der Fünftklässler.
»Ich sag’s meiner Mama«, äffte Rick den Jungen nach. »Wie jämmerlich ist das denn?« Er holte das Mäppchen aus dem Ranzen und hielt es dem Fünftklässler vor die Nase. »Das behalte ich als Pfand, bis wieder ordentlich Kohle fließt.«
Die ängstlichen Augen des Jungen wanderten zwischen der Trophäe und seinem Peiniger hin und her, fixierten dann etwas hinter Ricks Rücken. Noch bevor dieser den Grund dafür begriff, schoss plötzlich eine Hand von hinten an ihm vorbei, entriss ihm das Mäppchen und stieß ihn seitwärts, sodass er neben dem Fünftklässler im Gebüsch landete. Wütend rappelte sich Rick auf und fuhr herum. Maja?! Es war kein muskulöser Halbstarker gewesen, der ihn angegriffen hatte, sondern ein Mädchen aus der Parallelklasse. Zudem kannte er Maja noch aus dem Kindergarten, auch wenn er sich damals nie mit ihr abgegeben hatte. Aber jetzt war sie definitiv zu weit gegangen. Das konnte er unmöglich auf sich sitzenlassen. Er rappelte sich auf und trat auf sie zu.
»Blöde Zicke!«, schimpfte er und holte aus, um ihr einen Kinnhaken zu verpassen.
Doch Maja wich geschickt zur Seite, packte seinen Arm und zog ihn in Schlagrichtung. Rick stolperte vorwärts, da ihm diese blöde Kuh jedoch ein Bein stellte, schlug er hart auf dem Asphalt auf. Kinn, Hände und Knie schmerzten höllisch, er verkniff sich jedoch den Aufschrei. Der Fünftklässler kicherte, was Ricks Wut schier überkochen ließ. Er rollte zur Seite und zwang sich trotz schmerzender Glieder wieder auf die Beine. Zu seinem Ärger trabte eine weitere Zeugin direkt auf ihn zu – er kannte Lisa ebenfalls aus der Parallelklasse, aber von diesem schüchternen Hühnchen hatte Rick nichts zu befürchten. Maja half dem Baby-Fünftklässler gerade, seinen Schulranzen aufzusetzen und drehte ihm dabei den Rücken zu. Wahrscheinlich hatte sie nicht erwartet, dass er so schnell wieder auf die Füße kommen würde. Er zog sein Messer aus der Tasche und ließ es aufschnappen, während er auf Maja zusteuerte und die freie Hand ausstreckte, um sie an den Haaren zu packen. Eine dicke Strähne davon wäre eine angemessene Trophäe für die erlittene Demütigung. Doch in diesem Moment schrie Lisa laut auf – Rick hatte nicht geglaubt, dass sie tatsächlich Töne hervorbringen konnte. Doch nicht nur das, das Mädchen stürzte todesmutig auf ihn zu. Er fuhr herum und streckte seine Klinge nun in ihre Richtung. Im selben Moment trat ihm jemand so kräftig in die Kniekehle, dass er zusammensackte. Maja packte seinen Arm und ein Schlag auf sein Handgelenk brachte das Messer zu Fall.
»Du greifst uns mit einem Messer an! Sag mal, bist du total bescheuert?«, schrie sie.
Dabei zog sie den Messerarm auf seinen Rücken und hielt ihn im Polizeigriff gefangen. Rick hätte sie umbringen können, so sehr kochte er vor Wut. Auf dem Boden kniend versuchte er, sich aus dem Griff zu winden. Und diese dumme Pute Lisa stand zitternd neben ihm und sah auf ihn herab.
»Was gibt’s da zu glotzen?«, schnauzte Rick sie an.
»Lisa, heb das Messer auf und steck es ein!«, wies Maja sie an.
Trotz seiner misslichen Lage bereitete es Rick eine gewisse Genugtuung zu sehen, wie sich Lisa zierte, ihn ängstlich beäugte, als sei er ein wilder Löwe kurz vor dem Sprung. Das Messer zitterte in ihrer Hand, als sie es an sich nahm und in ihre Schultasche stopfte. Daran würde sie keine Freude haben, denn er würde es sich auf jeden Fall zurückholen, und wenn er sie dafür zu Tode erschrecken musste.
Das Übel hatte jedoch noch immer nicht seinen Zenit erreicht, denn in diesem Moment schlenderten Ricks Kumpel, Florian und Diego, die Straße entlang.
Was für ein bescheuerter Tag! Können sich die heute nicht verspäten, wie sonst auch?
Obendrein stierten seine Freunde ihn an, als sei er ein Alien.
»Glotzt nicht so blöd! Haut die Zicken lieber zu Brei!«, schnauzte er seine Freunde an.
Doch den Jungen war es unheimlich, ihren Anführer überwältigt zu sehen, obendrein von zwei Mädchen und einem Fünftklässler. Sie wandten die Blicke ab und setzten ihren Weg fort, als hätten sie Rick weder gehört noch gesehen.
»Du schwörst hier vor allen Zeugen, dass du niemanden mehr bedrohst, ansonsten werde ich den Vorfall dem Schulrektor melden. Das gleiche gilt, wenn du noch einmal jemanden angreifen solltest«, betonte Maja streng, während sie Ricks Arm schmerzhaft Richtung Kopf drückte.
»Du kannst mich mal!«, keuchte dieser wütend.
»Schwöre es!«, beharrte sie.
Immer mehr Schüler sammelten sich und beobachteten die seltsame Szene.
Verdammt! Geht’s noch peinlicher?
Rick tobte vor Wut, aber es half nichts, Maja ließ nicht locker und egal wie sehr er sich wand, er kam nicht frei. Seine Schürfwunden brannten höllisch und die Schmerzen im Arm waren kaum auszuhalten.
»Ja gut!«, stöhnte er schließlich entnervt. »Ich schwöre es.«
Ob er sich daran halten würde, war ohnehin eine andere Sache.
»Wenn ich noch einmal höre, dass du wieder jemanden angegriffen oder bedroht hast, weiß der Rektor über alles Bescheid und erhält das Messer, das wir natürlich an einem sicheren Ort verwahren werden. Nicht, dass du auf dumme Gedanken kommen solltest …« Mit diesen Worten ließ Maja ihn los und sprang zurück.
Rick stemmte sich auf die Füße, was mehr jämmerlich als elegant wirkte und sich wie eine weitere Demütigung anfühlte. Dann packte er seinen Rucksack, der ihm bei der Aktion von der Schulter gerutscht war, und stapfte so dicht an Lisa vorbei, dass diese erschrocken zur Seite wich. Nicht einmal seine Freunde, die etwas abseits stehengeblieben waren, würdigte er eines Blickes. Gut ein Dutzend Schüler beobachteten Ricks Abgang, dann war er um die nächste Hausecke verschwunden.
»Alles klar?«, fragte Maja den Fünftklässler.
»Ja, danke. Hoffentlich lässt er mich jetzt in Ruhe …«
»Dem hast du’s aber gegeben«, bemerkte ein anderer Junge, der hinzugekommen war. »Von mir wollte er auch schon oft Geld haben.«
Lisa stand noch immer unbeholfen herum, wusste nicht, was sie sagen oder tun sollte. Maja trat auf ihre Klassenkameradin zu und legte ihr anerkennend die Hand auf den Arm.
»Danke, das war echt mutig von dir. Ich hätte gar nicht gedacht, dass du so laut schreien kannst.«
»Ich auch nicht«, antwortete Lisa leise und lächelte.
»Komm, gehen wir zusammen in die Klasse«, schlug Maja vor.
Lisa nickte. Aufgrund ihrer Schüchternheit war sie es gewohnt, von allen übersehen zu werden. Doch die Einsamkeit war durch die Angst begründet, nicht, weil sie es sich so wünschte. Daher freute sie sich über Majas Gesellschaft.
»Es steckt ja wesentlich mehr in dir, als man denkt«, sagte Maja anerkennend.
Lisa nickte verlegen. Bisher hatte Maja die schüchterne Klassenkameradin mehr oder weniger übersehen, doch nun betrachtete sie sie mit ganz neuen Augen. Das kastanienbraune Haar wogte in sanften Wellen bis zur Hüfte. Stupsnase und Mäuschengesicht täuschten darüber hinweg, dass sich hinter der Fassade eine kleine Raubkatze verbarg.
Maja steckte meistens mit ihrer besten Freundin Phoebe zusammen. Gemeinsam besuchten sie zwei Mal die Woche das Hapkido-Training, den Rettungsschwimmkurs und das Klettern. Ansonsten ging sie zusammen mit Sina und Helen Rollerbladen oder Mountainbike fahren. Dagegen passte die zart besaitete Lisa so gar nicht in Majas Freundinnenschema hinein. Auch äußerlich unterschieden sich die beiden deutlich. Während Maja hellblondes, glattes Haar bis zum Kinn trug, und ihre Iris silbrig blau leuchtete, verloren sich Lisas Pupillen inmitten der dunkelbraunen Iris in unergründlicher Tiefe.
»Komm, gib mir das Messer, ich weiß ein gutes Versteck«, sagte Maja.
Dieser Bitte kam Lisa gerne nach. Sie packte das Messer wieder aus und reichte es ihrer Schulkameradin. Die öffnete ihre Jacke und stopfte es in die gut getarnte Innentasche.
»Sammelst du zufällig Briefmarken?«, fragte Maja. Bisher hatte sie niemanden gefunden, mit dem sie dieses mehr oder weniger geheime Hobby teilen konnte, wenn man von den Internetbekanntschaften im Briefmarkentauschforum absah, und dort tummelten sich kaum Jugendliche und noch seltener welche mit weiblichem Geschlecht. Bei Maja hatte die Begeisterung mit einer Erbschaft begonnen. Großonkel Hendrik hatte sein antikes Briefmarkenalbum ausgerechnet an seine Großnichte vermacht, als ob er geahnt hätte, dass sie an den kleinen Papierchen Freude finden würde. Vor allem auf seltene Marken aus fremden Ländern hatte es Maja abgesehen. Da gab es so einen Sonderdruck mit dem Motiv eines chilenischen Malers. Die Marke trug den melodischen Titel: Die Königin der Fabelländer. Danach durchkämmte Maja regelmäßig das Internet, aber die wunderschöne Marke war einfach nirgends zu bekommen.
Auch bei Lisa hatte sie kein Glück, denn sie schüttelte den Kopf.
»Nein, sammelst du etwa?«, fragte sie verwundert.
»Ja, ein bisschen«, antwortete Maja schulterzuckend, was natürlich eine Untertreibung war.
Sie erreichten das Schulgebäude und betraten zusammen das Klassenzimmer, wo Phoebe sogleich auf ihre Freundin zustürmte und Maja über die neuesten Sportergebnisse informierte.
»Hast du schon gehört, die erste Liga der Schwimmer hat Gold geholt …«
Lisa wollte nicht weiter hinhören. Kaum waren Maja und Phoebe zusammen, ging es nur noch um Sport und sie fühlte sich plötzlich wie vom anderen Stern, denn Lisa konnte sich dafür nicht begeistern. Ihre Leidenschaft galt der Musik und damit wanderten ihre Gedanken wieder zu ihrem Vater und dem tragischen Ende des vergangenen Wochenendes.
Die Lehrerin betrat das Zimmer und die Schüler kehrten mehr oder weniger geordnet zu ihren Plätzen zurück. Lisa hörte noch, wie Maja ihrer Freundin von der Begegnung mit Rick erzählte, dann mahnte die Klassenlehrerin Frau Kassandra zur Ruhe.
»… vor allem die freche kleine Biene Maja sollte jetzt aufpassen«, wie sie zu scherzen pflegte.
»Ja, Fräulein Kassandra«, antwortete Maja. Anfänglich hatte sie noch gekichert bei diesen Kabbeleien mit der Lehrerin, doch mittlerweile hatte sich der Scherz mit der Kinderserie so abgenutzt, dass in ihrer Antwort jetzt eher Langeweile mitschwang.
Statt auf die Tafel, die die Lehrerin nun mit Formeln vollkritzelte, schielte Maja zu Felix, der schräg vor ihr saß. Der Junge mit den dunkelblonden Wuschelhaaren hatte es ihr angetan. Daran waren nicht so sehr seine schönen graublauen Augen oder die verschmitzten Lachfältchen schuld, sondern vor allem sein fröhlicher Humor. Sie verstanden sich gut, aber zu Majas Leidwesen hatte er bisher keinerlei Flirt begonnen und sie war zu stolz, um den ersten Schritt zu wagen. Felix streifte versehentlich mit dem Ellenbogen das Lineal und beförderte es dabei zu Boden. Als er sich bückte, um es aufzuheben, schweifte sein Blick dabei unwillkürlich zu Maja. Er zwinkerte ihr zu und wandte sich wieder um.
War das ein kleiner Flirt? Ob das ein Zeichen ist, das mehr als Freundschaft bedeutet?, fragte sie sich und ihr Herz hüpfte dabei.
Unterdessen versuchte Lisa krampfhaft, ihre Aufmerksamkeit auf die Tafel zu richten. Viel zu oft geschah es, dass sie sich in ihre Traumwelt flüchtete, außerdem hatte sie der Vorfall heute dermaßen aufgewühlt, dass sich die Szenen in Endlosschleife in ihrem Geist abspulten. Zu sehen, wie dieser Rick mit dem Messer auf Maja losgehen wollte, das war einfach zu viel für sie gewesen, sodass der Schrei unwillkürlich aus ihr herausgebrochen war. Noch immer bebte sie innerlich allein bei der Erinnerung an das Erlebnis. Die Angst um ihre Mitschülerin war in dem Moment größer gewesen als ihre Schüchternheit. Doch dieser ungewohnte und irgendwie peinliche Vorstoß hatte zur Folge, dass sie jetzt umso mehr das Bedürfnis verspürte, sich zurückzuziehen. Gedanken wirbelten wie Strudel durch ihren Kopf: die Szenen von heute Morgen, die Sehnsucht nach einer heilen Familie, die Angst davor, sich zu zeigen, der Junge aus ihren Träumen, die Musik und hin und wieder auch die Matheaufgaben, die sie eigentlich lösen sollte.
In der Klasse hatte sich ein Pärchen gebildet, was auch bei Lisa den Wunsch nach einem Freund weckte und es gab da zwei Jungen, für die sie heimlich schwärmte: Tim und Felix. Aber da sie sich nicht traute, einen von ihnen anzusprechen, würde wohl auch dieser Wunsch unerfüllt bleiben. Selbst wenn der Junge aus ihren Träumen existierte, hätte sie mit ihm sicher dasselbe Problem. Das wäre weitaus schlimmer, denn beim Gedanken an ihn fühlte sie diese Sehnsucht nach seiner Liebe um ein Vielfaches intensiver. So entschwand sie mal wieder in ihren Tagträumen, der einzige Ort, an dem alles möglich war. Hier stand sie eng umschlungen mit ihm auf einer Düne, während der Sonnenuntergang den Himmel in tiefes Rot tauchte …
Nach zwei Stunden Mathe entließ Frau Kassandra die Schüler in die große Pause. Maja und Phoebe steckten wie immer die Köpfe zusammen und Lisa schien mal wieder nicht existent für die anderen zu sein. Sie trat aus dem Klassenzimmer und folgte der Schülerkolonne den Flur entlang. Tim und sein Freund Felix unterhielten sich angeregt und Lisa beobachtete, wie Maja Felix verstohlen nachschaute.
Gegen Maja habe ich ohnehin keine Chance und bei Tim müsste ich mich erst einmal trauen zu reden, dachte Lisa wehmütig.
»Bei deiner Freundin bist du abgeschrieben, was?« Lisa schrak zusammen, denn es war Rick, der plötzlich hinter ihr aufgetaucht war und ihr diese Worte zugeflüstert hatte. Sie beschleunigte ihre Schritte, um ihn abzuschütteln. Zum Glück verfolgte er sie nicht weiter, dennoch donnerte ihr Herz noch immer bis zum Hals. Diesem Rick war nicht zu trauen. Lisa suchte zunächst die Toiletten auf und wanderte dann ziellos über den Pausenhof, damit nicht auffiel, wie einsam sie war. Hin und wieder schlenderte sie an Felix und Tim vorbei, die sich über exotische Tiere unterhielten.
»In das neue Terrarium kommt eine Vogelspinne. Am Wochenende ist ein Tiermarkt in Darmstadt. Ich muss nur meinen Vater bequatschen, dass er mich hinbringt. Vielleicht ist ein leistbares Exemplar für mich dabei.«
»Also, ich find deine Tiere klasse, aber mit solchen Viechern in einem Zimmer schlafen, könnte ich nicht. Hast du da keine Angst, dass eines ausbüxt und dir übers Gesicht läuft, wenn du pennst?«
»Ist schon passiert«, grinste Felix. »Ich hab den Deckel nicht richtig zugemacht und da ist Aphrodite rausgekrochen und hat es sich unter meiner Decke gemütlich gemacht. Sie verkriecht sich nämlich gerne in warmen Löchern.«
»Was war noch mal Aphrodite?«, fragte Tim und verzog das Gesicht zu einer Grimasse.
»Meine Boa natürlich. Du hast sie doch schon gestreichelt.«
Lisa hatte genug gehört und entfernte sich wieder. Dieses Gespräch hatte ihre Sympathien deutlich in Richtung Tim verschoben. Wenn es überhaupt jemals so weit kommen würde, dass sie bei einem Jungen übernachtete, hätte sie wenig Lust, diese Nacht im gleichen Zimmer wie Aphrodite zu verbringen.
Nach Ende der Pause wartete eine Überraschung auf Maja: Ihre Schultasche duftete penetrant nach Parfüm und eine rote Rose lag oben drauf. Der Stängel war ausgefranst, was darauf hindeutete, dass sie einem Vorgartenbeet entwendet worden war.
Was soll das und vor allem, von wem stammt die Rose? Ein heimlicher Verehrer?
Ein roter Briefumschlag steckte zwischen ihren Schulsachen, der dieses intensive Parfüm verströmte.
»Ihhh, was stinkt denn hier so?«, zischte Phoebe. »Sag jetzt nicht, dass das dein neues Parfüm ist.«
»Bist du irre? Ich benutz doch kein Moschus«, brummte Maja und zog einen Brief aus dem Umschlag.
»Ein Liebesbrief?« Phoebe quetschte neugierig ihren Kopf an den ihrer Freundin, um mitlesen zu können.
Maja war nicht wohl dabei, doch sie wollte Phoebe auch nicht zurückweisen, schließlich teilten sie sonst auch alle Geheimnisse miteinander. Sie entfaltete den Brief und las:
Hab mich total in dich verknallt.
Wenn du Interesse hast und wissen willst,
wer auf dich steht, komm in der Mittagspause zum runden Denkmal.
Anonymus
»Oh, ist das spannend! Ein anonymer Verehrer«, jubelte Phoebe. »Du bist echt zu beneiden. Ich hätte auch gerne mal so einen Brief.«
»Ach, wer weiß, ob das nicht nur ein blöder Gag ist …«, entgegnete Maja, faltete den Brief wieder zusammen und steckte ihn in den Umschlag zurück, um ihn dann im Papierkorb neben dem Pult zu entsorgen. Da noch kein Lehrer im Raum war, und sich einige Schüler einen Spaß daraus machten, sich mit Papierkugeln zu beschießen, fiel ihre Aktion nicht weiter auf.
»Bist du verrückt, den Brief einfach wegzuwerfen? Vielleicht ist es ein super genialer Typ, der auf dich steht«, protestierte Phoebe.
»Ein super genialer Typ würde nicht so ein Parfüm verwenden. Widerlich, wie meine ganze Tasche jetzt stinkt. Hoffentlich bekomme ich diesen Geruch da jemals wieder raus.« Maja kräuselte die Nase und hustete, als müsste sie sich übergeben.
»So schlimm finde ich es gar nicht«, erwiderte Phoebe.
»Doch! Mir ist schon ganz schlecht davon. Ich geh besser noch mal auf die Toilette.« Maja stapfte eilig davon, während das Chaos in der Klasse weiter eskalierte.
Es hatten sich vier Parteien gebildet, die sich mit Kugeln beschossen, über Tische und Stühle rannten, um dann wieder Deckung zu suchen. Nur Lisa beteiligte sich nicht, sondern schaute lediglich zu, was die anderen so trieben. In Phoebe keimte unterdessen eine Idee und es juckte ihr in den Fingern, diese in die Tat umzusetzen. So eine günstige Gelegenheit würde nie wiederkehren. Sie eilte zum Papierkorb, fischte den Brief heraus und stopfte ihn im Vorbeigehen flink in die Tasche der Jacke, die Felix über seinen Stuhl gehängt hatte. Auch wenn das ein Thema war, das Maja generell mied, war es ihrer besten Freundin natürlich aufgefallen, dass sich die beiden mochten und es konnte ja nicht schaden, da ein wenig nachzuhelfen.
Unschuldig saß sie auf ihrem Platz, als Maja gemeinsam mit Rektor Mayer das Klassenzimmer betrat.
»Was ist denn hier los?«, donnerte er.
Wie vom Blitz getroffen hielten die Schüler inne und rannten zu ihren Plätzen, wo sie sich brav hinsetzten.
»Bedauerlicherweise ist Herr Schreiner erkrankt, deshalb übernehme ich heute die Vertretung«, kündigte er an. »Es melde sich, wer mir sagen kann, was ihr in der letzten Stunde durchgenommen habt.«
»Der redet noch wie im letzten Jahrhundert«, flüsterte Phoebe Maja zu.
»Kein Wunder, er sieht immerhin schon aus wie fünfundfünfzig.«
»Ich bin sicher, selbst vor siebzig Jahren hat man nicht so dermaßen altbacken geredet. Nicht mal meine Großeltern tun das.«
»Ja, schon, aber …«
»Miriam, hätten Sie bitte die Güte, dem Unterricht Ihre volle Aufmerksamkeit zu widmen?!« Entgegen seiner höflichen Worte richtete Herr Mayer seinen strengen Blick auf Maja.
»Sehr wohl, Herr Mayer«, erwiderte sie und nickte ergeben. »Aber hätten Sie wohl die Güte, mich beim richtigen Namen zu nennen? Ich heiße Maja.«
Die Klasse lachte – zum letzten Mal, bevor sich der Unterricht quälend in die Länge zog. Dabei beobachtete Maja immer wieder besorgt, wie Felix irritiert in der Luft herumschnüffelte.
Bestimmt riecht er das schreckliche Parfüm von dem Brief!
Auch Majas Tasche müffelte fürchterlich danach. Nach der Stunde sollte sie ihn aufklären, woher der Gestank stammte, nicht dass er falsche Schlüsse zog. Doch dazu kam es nicht, denn Phoebe hatte sich zur Aufgabe gemacht, Maja um jeden Preis zum runden Denkmal zu lotsen. Kaum läutete die Pausenglocke, zog sie ihre Freundin förmlich mit sich fort.
»Schau doch wenigstens mal, wer dort auftaucht. Vielleicht ist es ja tatsächlich dein Traummann. Diese Chance würde ich mir an deiner Stelle nicht entgehen lassen«, redete sie auf Maja ein.
»Mann, das muss dir ja furchtbar wichtig sein«, maulte sie. »Na, gut, damit ich meine Ruhe habe, schaue ich kurz mal nach.«
Während die anderen zum Mittagessen in die Mensa strömten, trat Maja in den Schulhof, auf dem sich um diese Zeit nur wenige Schüler tummelten. Es waren diejenigen, die ihre Brotzeit in Tupperware mitgebracht oder Süßigkeiten für das Mittagessen besorgt hatten, statt in der Mensa zu essen.
Auf der anderen Seite des Schulhofes lag die Sporthalle und neben dieser gab es ein rundes Denkmal. So wies es zumindest das Schild aus, doch eigentlich handelte es sich nur einen riesigen runden Stein – das Werk eines modernen Künstlers. Im Zenit sprudelte Wasser hervor und ergoss sich in den darunterliegenden Brunnen. Eine hohe Buxbaumhecke fasste das Denkmal ein, sodass man dort vor neugierigen Blicken geschützt war und auf den im Kreis aufgestellten Bänken schmusten regelmäßig Pärchen. Eigentlich passte dieser Bereich nicht so ganz zu einer Schule, aber nach dem Bau des Gebäudes hatte man einen öffentlichen Park kurzerhand zum Schulhof umfunktioniert.
Schlammbriefe zum Jubiläum
Gesamtschule in Frankfurt, Mittwoch, 28. November
Die abgerupfte Rose des heimlichen Verehrers sah diesen hier verdächtig ähnlich, die am Torbogen emporrankten. Als Maja hindurchtrat, staunte sie nicht schlecht, als sie hier auf Lisa stieß. Ihre Klassenkameradin zog gerade irgendwelche Papiere aus einer schlammigen Pfütze.
»Was machst du denn hier?«, stieß Maja verwundert hervor.
»Äh, ich habe so einen Brief bekommen …«, sie zog ein Papier aus der Tasche, das verdächtig nach dem Brief aussah, den auch Maja erhalten hatte.
»Von wem?«, stieß Maja hervor und näherte sich. Der penetrante Geruch des Parfüms ließ keinen Zweifel daran aufkommen, dass es sich um denselben Brief oder zumindest denselben Absender handelte.
Lisa zuckte mit den Schultern.
»Darf ich mal?«, fragte Maja und streckte die Hand nach dem Blatt aus.
Lisa wollte ihn ihr geben, ließ jedoch zu früh los, sodass der Brief zu Boden segelte, um bei den anderen Papieren in der Pfütze zu landen.
»O nein!«, rief Lisa und bückte sich, um ihn wieder herauszufischen.
»Was treibt ihr denn hier?«
Die Mädchen fuhren herum. Da stand Felix und musterte die beiden verwundert.
»Sag mal, hast du etwa diese roten Briefe geschrieben?« Maja kniff misstrauisch die Augen zusammen.
»Nein, das nicht, aber ich hab auch so einen bekommen«, lachte Felix und wedelte mit dem berüchtigten roten Umschlag. Beide Mädchen atmeten auf, da er es mit Humor nahm. »Da hat uns jemand schön reingelegt. Wer das wohl war?«
»Blöder Scherz«, murmelte Maja.
»Und was sind das für Papiere in der Pfütze?« Felix deutete auf die verschlammten Blätter, die Lisa aus dem Wasser gezogen hatte.
»Auf frischer Tat ertappt!«
Die Schüler zuckten erschrocken zusammen, denn im Torbogen stand Schulrektor Mayer, die Fäuste in die Hüften gestemmt. »Man reiche mir das Corpus Delicti!« Er deutete auf die tropfenden Blätter.
Der Rektor schritt auf Lisa zu, die am ganzen Körper bebte, was besonders an den zitternden Papieren zu sehen war. Herr Mayer entriss sie ihr und studierte das, was Schlamm und Wasser an Buchstaben übriggelassen hatten.
»Das sind eindeutig die Unterlagen, welche aus meinem Büro entwendet wurden. Und …« Er schnüffelte in der Luft. »Der Dieb hat ein Parfüm verwendet, welches …« Er schnüffelte abermals in Richtung von Felix und dann auch Maja. »… jenes welches auch an Ihnen haftet. Womit ich Sie drei hiermit des Diebstahls überführt habe.«
»Aber …«, protestierte Maja, wurde jedoch von Frau Kassandra unterbrochen, die ebenfalls in die Laube stürzte.
»Herr Direktor Mayer! Da sind sie ja! Wir haben etwas vorbereitet und das gesamte Kollegium wartet auf Sie.«
»Nun, Helen, … oh, Frau Kassandra, ich habe hier einen dringlichen Fall aufzuklären«, erklärte der Schulrektor. Seine Wangen glühten verdächtig.
»Das hat doch sicher Zeit bis nach unserer Überraschung. Nun kommen Sie schon!«
Die spritzige Lehrerin hakte sich bei dem alten Mann unter. Da gab er endlich seinen Widerstand auf und ließ sich fortführen – die tropfenden Unterlagen in der freien Hand. Im Fortgehen wendete er noch einmal den Kopf und sagte: »Ich sehe Sie in einer halben Stunde in meinem Büro! Und seien Sie pünktlich.«
Maja pustete durch die Backen und schüttelte den Kopf.
»Habt ihr verstanden, was da gerade abging?« Sie schaute fragend zwischen Felix und Lisa hin und her.
»Ist doch klar«, antwortete Felix. »Der- oder diejenige, die uns hierhergelockt hat, hat irgendwelche Unterlagen geklaut und dieses komische Parfüm am Tatort verteilt, mit dem er auch die Briefe besprüht hat. Damit der Verdacht auf uns fällt. Aber wer wollte uns da eins auswischen? Soviel ich weiß, habe ich keine Feinde. Ihr?«
»Ähm, ich hätte da schon einen Verdacht.« Maja tauschte mit Lisa Blicke aus, die noch immer ziemlich verdattert dreinschaute. »Lisa und ich haben heute Morgen Rick davon abgehalten, einen Fünftklässler auszurauben.«
»Was echt? Wie habt ihr das denn geschafft?«
»Ich bin im Hapkido.« Maja strahlte. Es gefiel ihr, Felix zu verblüffen. »Lisa hat mir geholfen«, fügte sie hinzu. Er sollte sie ja nicht für eine eingebildete Angeberin halten.
»Okay, ich könnte mir schon vorstellen, dass er sich dafür an euch rächen wollte. Aber warum hab ich auch einen Brief bekommen?«
»Hattest du mal Streit mit ihm?«
»Wir können uns nicht besonders gut leiden, aber das träfe wahrscheinlich auf die Hälfte der Jungen in unserer Stufe zu. Keine Ahnung, warum es gerade mich erwischt hat. Vielleicht steckt ja auch was anderes dahinter oder ich bin nur ein Zufallsopfer, damit es nicht ganz so auffällig ist, dass es sich um eine Racheaktion von Rick handelt.«
»Ja, das könnte sein«, überlegte Maja.
Lisa stand noch immer kreidebleich daneben und brachte keinen Ton heraus. Sie fühlte sich doppelt elend und dumm, denn sie war tatsächlich auf den anonymen Verehrer hereingefallen, hatte mit klopfendem Herzen gewartet, in der naiven Hoffnung, aus diesem geheimen Treffen könnte eine wundervolle Romanze entstehen. Jetzt schämte sie sich in Grund und Boden, Rick auf den Leim gegangen zu sein und fürchtete sich vor der Standpauke des Rektors, denn schließlich war sie es, die die Dokumente aus der Pfütze gefischt hatte.
»Komm, wir gehen was essen, bevor wir uns dem Alten stellen. Ich bin am Verhungern«, sagte Felix.
Maja nickte und die beiden wandten sich zum Gehen. Als Lisa noch immer wie versteinert dastand, drehten sie sich nach ihr um.
»Willst du nicht mitkommen?«, fragte Maja.
Ein dünnes Lächeln zauberte sich auf Lisas Lippen. Sie nickte und folgte den beiden in die Mensa. Inzwischen waren die meisten Schüler fertig mit dem Essen und verließen den Saal bereits wieder. So gab es keine Warteschlange und die Drei wurden sofort mit einem Klecks Kartoffelbrei und Gemüse bedient. Sie setzten sich zusammen an einen Tisch. Phoebe stand soeben von einem anderen auf und zwinkerte Maja triumphierend zu, als sie an ihr vorbeiging.
Was sollte das denn?, wunderte sich Maja, dachte aber nicht weiter darüber nach. Wenn sie schon mal die Gelegenheit hatte, gemeinsam mit Felix zu Mittag zu essen, dann wollte sie das auch auskosten. Die beiden lachten und scherzten und vergaßen dabei vollkommen die Zeit.
»Wir müssen zum Rektor«, erinnerte Lisa schließlich mit so dünner Stimme, dass die beiden sie völlig überhörten.
Doch wenn Lisa etwas hasste, dann war es, zu spät zu einem Termin zu erscheinen, der ohnehin schon Ärger versprach.
Mit dem Tablett in der Hand erhob sie sich. »Wir müssen los!«, sagte sie nun für ihre Verhältnisse ungewöhnlich forsch.
Maja und Felix blickten erstaunt zu ihr auf. Dieser Ausbruch war Lisa extrem unangenehm, daher wandte sie sich nun rasch um, um das Tablett im Geschirrwagen zu verstauen. Felix und Maja folgten ihrem Beispiel und wenig später standen sie gemeinsam vor dem Zimmer des Schulrektors, oder genauer: vor dem der Sekretärin, an der man zuerst vorbei musste.
Felix öffnete mutig die Tür und lugte hinein, doch der Platz von Frau Tanne war leer. Die drei traten ein und Felix klopfte an die Tür des Rektors. Von innen war jedoch kein »Herein« zu hören, stattdessen kam Herr Mayer vom Flur her ins Sekretariat. Auf seinem Kopf thronte ein bunter Papierhut. Dort wirkte er so völlig fehl am Platz, bei dem strengen Herrn mit Anzug und Brille, dass Maja spontan losprustete vor Lachen.
»Mäßigen Sie sich!«, wies Herr Mayer sie zurecht.
Maja schluckte ihr Lachen mühsam runter. Da die drei Schüler aber noch immer das Papierhütchen auf seinem Haar fixierten, erkannte der Rektor die Ursache der Erheiterung. Er griff danach und zog sich das Hütchen mit einem beschämten Räuspern vom Kopf.
»Nun ja, das Kollegium hatte diesen absonderlichen Einfall, einer Geburtstagsfeier zu meinem fünfzigjährigen Jubiläum …«
Herr Mayer öffnete die Tür zu seinem Büro und ließ die drei eintreten.
»Setzt euch!«
Lisa, Felix und Maja nahmen auf drei der fünf Stühle am runden Konferenztisch Platz. Herr Mayer thronte auf seinem Chefsessel etwas entfernt vom Tisch.
»Wir sind unschuldig!«, platzte Maja hervor. »Man hat uns mit Briefen zum runden Denkmal gelockt, die alle mit diesem Parfüm besprüht waren.«
Zum Beweis zog Felix seinen Brief hervor und präsentierte ihn dem Rektor.
»Nun, es war ein Fehler, euch nicht sofort in die Mangel zu nehmen, denn nun hattet ihr natürlich genug Zeit, euch eine kleine Lügengeschichte auszudenken, die eure Unschuld beweisen soll«, antwortete der Rektor grimmig. Er rückte seine Brille zurecht und erhob sich.
»Ist euch eigentlich bewusst, welche wichtigen Dokumente ihr mit unverfrorener Respektlosigkeit in den Dreck gezogen habt? Man verzeihe mir diese Wortwahl, doch solche Taten können nicht mehr als Jugendstreich gewertet werden, vielmehr handelt es sich um ein strafbares Delikt.«
Mit jedem Wort, das der Rektor sprach, zitterte Lisa mehr, auch wenn er sie dabei gar nicht ansah, sondern seinen Blick zwischen Maja und Felix hin- und her schweifen ließ. So gesehen hatte das Nicht-wahrgenommen-werden mal einen Vorteil, und doch nahm es sich Lisa zu Herzen, als würde Herr Mayer sie persönlich anklagen.
»Was waren es denn für Papiere?«, wollte Maja wissen.
»Eine geschickte Frage, junge Dame. Doch mein Intellekt verbietet mir, dieser Taktik auf den Leim zu gehen. Es handelt sich um Auszüge einer Doktorarbeit, inklusive historischer Artikel, die ich im Original erworben und eingefügt habe – es handelte sich um die einzigen Originale!« Seine Stimme war bedrohlich angeschwollen. »Und das an meinem Geburtstag! Die Rechnung für den entstandenen Schaden können Sie an Ihre werten Eltern weiterreichen.«
Die Tür platzte auf, doch statt eines Menschen, füllte ein riesenhaftes Paket, eingewickelt in blumiges Geschenkpapier, den Rahmen aus. Alle beobachteten, wie Fräulein Kassandra unter Ächzen und Stöhnen das Paket durch die Tür zu schieben versuchte.
»Oh, entschuldigen Sie! Ich-ich hatte geglaubt, der Raum sei leer …«, stotterte die Lehrerin und ihre Wangen glühten. Das Geschenk stand quer auf einer Ecke halb drin, halb draußen, und Fräulein Kassandra lugte über die obere Schräge in den Raum, wobei sie es rechts und links festhielt und ein nacktes Knie unter eine Seite stemmte, um es zu stabilisieren. »Es-es sollte eine Überraschung sein. Hm, die ist jetzt leider misslungen, … soll ich … ich wollte nicht stören … dann bringe ich es später …«
Herr Mayer räusperte sich. Maja konnte es kaum glauben, aber auch seine Wangen glühten.
»Nun, da ich es schon gesehen habe, können Sie es auch gerne hereinbringen, Fräulein, pardon, Frau Kassandra.«
Der Patzer brachte Maja und Felix erneut dazu, laut loszuprusten. Die ganze Szene war ohnehin schon so skurril, dass sie sich sehr zwingen mussten, nicht zu kichern, aber beim Versprecher des Rektors konnten sie sich einfach nicht mehr zurückhalten.
Herr Mayer versah die Schüler mit strafenden Blicken, ging dann aber der Lehrerin zur Hand, um mit ihr gemeinsam das Paket ins Zimmer zu bringen. Allerdings streiften sie dabei die Ecke des Bücherregals. Diese riss ein Loch ins Geschenkpapier und ratschte im Vorübergehen die halbe Seite auf.
»Oh, Verzeihung. Das ist mir jetzt aber peinlich … Das schöne Geschenkpapier …«, seufzte Frau Kassandra unglücklich.
»Nun ja, eine Sache des Geschmacks …«, brummte der Rektor. »In diesem Fall bietet es sich wohl an, das Paket auch vollständig auszupacken.«
Nachdem die beiden Lehrer das Geschenk auf dem Boden abgestellt hatten, befreite es der Rektor vom Papier und musterte mit gerunzelter Stirn den Inhalt: Das Gemälde im dicken Holzrahmen zeigte einen in helles Blau getauchten Brunnen, umgeben von Tropfsteinen. Leuchtende Wellen und Malereien von fantastisch anmutenden Wesen zierten die Szene.
»Äußerst absonderlich«, bemerkte Herr Mayer.
»Ich hoffe, wir haben ihren Geschmack getroffen.« Frau Kassandra streifte eine Haarsträhne hinters Ohr und lächelte unsicher. »Die Kollegen wissen ja von ihrer Begeisterung für historische Gemälde und dieses hier konnte ich zufällig auf dem Flohmarkt erstehen. Das Motiv hat mich sofort gefangengenommen. Darin lebt so etwas absolut Besonderes, Magisches, nicht wahr?«
Doktor Mayer rückte seine Brille zurecht und betrachtete das Bild eingehender.
»Nun, sehr absonderlich«, wiederholte er stirnrunzelnd.
»Sieht aus wie ein Fantasy-Cover«, bemerkte Felix, wofür er einen vernichtenden Blick des Rektors erntete.
»Fantasy«, grunzte er abfällig. »Derartiger Schund wird an unserer Schule nicht gelesen. Als Mann des Realismus erachte ich nur das als existent, was sich empirisch beweisen lässt. Das solltest du dir merken, junger Mann!«
»Ähm, ich störe dann mal nicht weiter …« Frau Kassandra hob entschuldigend die Schultern. Sie blinzelte gekränkt. Offenbar hatte sie mit ihrem Geschenk danebengelegen, daher verließ sie eilig den Raum, bevor der Rektor weitere Kritik äußern konnte.
Herr Mayer wandte sich erneut seinen Schülern zu: »Nun, wo waren wir stehengeblieben? Ach ja, …«
Im selben Atemzug zeigte sich das Gemälde von seiner absonderlichsten Seite: Plötzlich begannen sich die Wesen darin zu bewegen. Die Wellen wogten lebendig und vier echsenartige Tiere mit Schwimmhäuten zwischen den Zehen krabbelten heraus, um als geisterhafte Lichterscheinungen durch den Raum zu schweben.
Herr Mayer wischte sich über die Stirn, dann nahm er seine Brille ab, um sie zu putzen. Er blinzelte und riss die Augen weit auf, denn das, was da passierte, konnte unmöglich wahr sein.
Aber auch die drei Schüler hockten staunend auf ihren Stühlen und konnten nicht glauben, was sie sahen. Plötzlich sausten die Lichtgestalten, wie angezogen durch Magnete, zu den vier Menschen im Raum und hefteten sich jedem auf den Handrücken. Lisa hielt geschockt die Luft an, Maja japste, Felix rief »Voll krass!« und Rektor Mayer schüttelte die Finger, rieb sich die Augen und zwickte sich in den Arm, um endlich aufzuwachen, denn schließlich konnte dies nichts anderes sein als ein verrückter Traum.
Als nächstes geschah etwas, das Herrn Mayer in seiner Annahme bestätigte: Seine Schüler nahmen kontinuierlich an Transparenz zu, als seien sie Gespenster. Und auch seine eigenen Gliedmaßen verließen den festen Aggregatzustand und transformierten sich zu einer Art Gas. Geräusche gab keiner von ihnen mehr von sich, denn Gas war in dieser Eigenschaft etwas eingeschränkt, wie das Hirn des Doktors noch kombinierte, bevor die Welt um ihn herum in stockdunkler Finsternis versank.