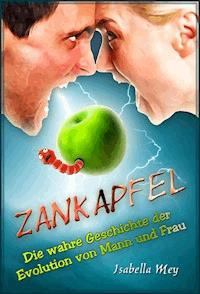5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Meiner Kehle entgleitet ein gequältes Stöhnen, als ich die Lider öffne und zu einer düsteren Zimmerdecke emporblicke, die nicht meine ist. Und ganz sicher verfügt mein Bett auch über kein Gestell samt Handbügel, genauso wenig wie wir zu Hause diese eintönige Bettwäsche verwenden, die im Schein des hereinfallenden Mondes und den Notlichtern an den Wänden in mattem Grau schimmert. In meinem linken Handrücken steckt eine Infusionsnadel, die über einen Schlauch mit einem Beutel transparenter Flüssigkeit verbunden ist.
Ich bin im Krankenhaus?
Unwillkürlich hebe ich die rechte Hand, um mein Gesicht zu befühlen. Als meine Finger über eine raue Naht gleiten, die entlang der brennenden Linie herabführt, nimmt mein Pulsschlag deutlich Fahrt auf.
Eine Naht?! Bin ich schwer verletzt? Wovon? Was ist passiert und weshalb liege ich hier?
Ich stemme mich auf die Ellenbogen, um das Zimmer genauer zu betrachten. Noch ein zweites Bett steht im Raum, ein paar Meter rechts neben meinem, doch die glattgestrichene Bettdecke ist unberührt.
Plötzlich nehme ich eine Gestalt wahr, die aus den Schatten auf mich zutritt ...
Milchglassplitter
Ein Autounfall wirft die selbstbewusste Vertriebsmanagerin Saskia völlig aus der Bahn. Schockiert muss sie feststellen, dass nicht nur ihr Vater ums Leben kam und eine lange Narbe ihr Gesicht entstellt, obendrein wird sie von vermeintlichen Halluzinationen geplagt. Während Saskias Verlobter Daniel wenig Verständnis für sie aufbringt, stößt sie auf immer mehr Ungereimtheiten.
Verbirgt er etwas vor ihr und was stimmt hier nicht?
Einen Wendepunkt bringt die Begegnung mit Leonardo. Der faszinierende Kunstmaler fertigt seine Portraits mit verbundenen Augen an und Saskia fühlt sich auf magische Weise mit ihm verbunden, und doch umwölkt ein dunkles Geheimnis seine Vergangenheit.
Ein übersinnlicher Liebesroman voller Abenteuer, empfohlen ab 14 Jahren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Schmiedehammer
Barfuß
Die fehlende Seite
Fliegende Blätter
Blätterherz
Schlaflos
Farbnebel
Forellen
Daniel
Einbruch
Unerwarteter Besuch
Der Schlüsselplan
Puppenspiel
Besenschlag
Palast
Obstbaumwiese
Aus und vorbei
Ein vager Plan
Pistolenschuss
Peperoni
Nachwort
Ode an meine Testleser
Impressum
MilchGlasSplitter
Isabella Mey
Prolog
Ein Wanderer traf auf eine von einer schwarzen Kutte verhüllte Gestalt. Selbst das Gesicht verschwand im Schatten der Kapuze.
Der Wanderer wunderte sich über den seltsamen Aufzug und sprach den Fremden mutig an: »Sag, weshalb läufst du in derart düsterer Aufmachung umher?«
Da er für gewöhnlich nicht angesprochen wurde, hielt der Fremde verwundert inne, wandte sich zum Wanderer um und antwortete mit tiefer Stimme: »Es ist die Angst der Menschen, die mir dieses Aussehen gab. Du aber scheinst ein mutiger Geselle zu sein, daher beantworte ich dir gerne deine Fragen.«
»Die Menschen fürchten dich? Weshalb?«
»Nun, nicht immer. Zuweilen ersehnen sie durch mich die Erlösung nach Siechtum und Leid. Nicht selten aber stehle ich mich hinterrücks heran wie ein Dieb oder krache in ihr Leben gleich eines Kometen. Eben noch flatterte es seicht über dem Untergrund dahin, bis ich die trübe Scheibe zum Bersten bringe, in Tausende von Milchglassplittern.«
»Welche trübe Scheibe?«, hakte der Wanderer stirnrunzelnd nach.
»Der Schleier, welcher die Zukunft vor den Menschen verborgen hielt«, antwortete der Mann in der schwarzen Kutte.
»Wenn du tatsächlich solch Niederträchtiges vollbringst, wundert es mich nicht, dass dich die Menschen fürchten. So etwas ist hinterlistig und gemein«, urteilte der Wanderer und wollte sich bereits abwenden.
Doch sein Begleiter fuhr unbeirrt fort: »Mag sein, doch die scharfen Splitter reißen längst vergessene Wunden auf, sodass sie endlich heilen können. Ich bringe ihren festgefahrenen Karren dazu, aus seinen schlammverkrusteten Spurrillen herauszuspringen, welche die Gewohnheit niemals verlassen hätte. Mit mir gerät der Schein der Illusion ins Wanken, spült mit den Tränen alle Maskerade fort, bis Grenzen unserer Wirklichkeit in goldenem Licht zerfließen.«
»Nun, so willst du mir also sagen, dass durch das Leid, welches du bringst, Gewohnheiten aufgebrochen werden und daraus auch Gutes erwachsen kann? Wenn Wunden geheilt werden und sich Masken auflösen, verliert sich aller Schein in unserem wahren Sein? Ist es das, was du mir sagen willst?«
Der finstere Geselle nickte stumm.
»So habe ich den Tod bisher noch gar nicht betrachtet«, murmelte der Wanderer nachdenklich.
»Nur der Mut wagt es, mir ins Gesicht zu sehen, wodurch er mein wahres Sein erkennen kann«, antwortete der Tod lächelnd und klappte seine Kapuze herunter. Aus den Schatten trat die freundlich lächelnde Miene eines älteren Mannes hervor. Das weiße Haar umspielte ein faltiges Gesicht, in seinen Augen jedoch glänzte jugendliche Leichtigkeit.
Der Mut erwiderte das Lächeln des Todes, woraufhin die beiden ihren Weg nun gemeinsam fortsetzten.
Schmiedehammer
Saskia, Krankenhaus, Sonntag, 16. August
Ein sanftes Flattern verwischt meine Sinne. Eben noch schwebte ich irgendwo zwischen den Welten, erfüllt von friedlicher Ruhe, beim Hinüberdriften dimmt sich das helle Licht nun herunter und die Erinnerung an etwas, das ich unbedingt behalten wollte, entgleitet mir unweigerlich, schmilzt fort wie Schnee an einem heißen Sommertag.
Mit dem Erwachen tritt der Schmerz in mein Bewusstsein: Rhythmisch schlägt metallisch nachhallend ein Schmiedehammer in meinem Schädel. Verschiedene Stellen meines Leibes drücken und ziepen unangenehm. Am schlimmsten peinigt mich jedoch das Brennen im Gesicht. Eine langgezogene, feurige Linie zieht sich von der Stirn zwischen linker Wange und Ohr hinab bis zum Hals.
Was ist passiert?
Meiner Kehle entgleitet ein gequältes Stöhnen, als ich die Lider öffne und zu einer düsteren Zimmerdecke emporblicke, die nicht meine ist. Und ganz sicher verfügt mein Bett auch über kein Gestell samt Handbügel, genauso wenig wie wir zu Hause diese eintönige Bettwäsche verwenden, die im Schein des hereinfallenden Mondes und den Notlichtern an den Wänden in mattem Grau schimmert. In meinem linken Handrücken steckt eine Infusionsnadel, die über einen Schlauch mit einem Beutel transparenter Flüssigkeit verbunden ist.
Ich bin im Krankenhaus?
Unwillkürlich hebe ich die rechte Hand, um mein Gesicht zu befühlen. Als meine Finger über eine raue Naht gleiten, die entlang der brennenden Linie herabführt, nimmt mein Pulsschlag deutlich Fahrt auf.
Eine Naht?! Bin ich schwer verletzt? Wovon? Was ist passiert und weshalb liege ich hier?
Ich stemme mich auf die Ellenbogen, um das Zimmer genauer zu betrachten. Noch ein zweites Bett steht im Raum, ein paar Meter rechts neben meinem, doch die glattgestrichene Bettdecke ist unberührt.
Plötzlich nehme ich eine Gestalt wahr, die aus den Schatten auf mich zutritt. Ich erkenne sie sofort: Trotz des leicht ergrauten Haares wirkt mein Vater jünger als sonst. Ungewohnt sind außerdem die Bartstoppeln, da er in seiner Position normalerweise auf gepflegtes Aussehen achtet.
»Papa«, hauche ich aus rauer Kehle.
»Du bist wach, mein Engel«, stellt er fest und schenkt mir ein liebevolles Lächeln. In Anbetracht der Lage hätte ich eigentlich jede Menge Sorgenfalten auf seiner Stirn erwartet, doch die großen nussbraunen Augen blicken mich nur gütig an, während er sich auf dem Stuhl neben meinem Bett niederlässt.
»Was ist passiert?«
»Wir hatten einen Unfall.«
»Wir? Du auch? Bist du verletzt?«
»Mir geht’s gut, mein Engel. Sorge dich nicht. Und auch deine Wunden werden wieder verheilen.«
»Meine Wunden …«, hauche ich erschüttert und befühle abermals die Naht auf meiner Haut.
Als Vertriebsmanagerin muss ich ein perfektes Bild abgeben, da passt mir eine hässliche Narbe im Gesicht absolut nicht ins Konzept. Bei den Geschäftspartnern würde sie alle Aufmerksamkeit auf sich ziehen und wer schließt schon gerne Verträge mit einer entstellten Verkäuferin ab?
Das fehlte noch …
Stöhnend lasse ich mich ins Kissen sinken und schließe die Lider. Ich versuche, zu erfassen, was mir zugestoßen sein könnte, doch die dichten Nebel in meinem Kopf weigern sich hartnäckig, die Erinnerungen freizugeben.
»Mach dir nicht so viele Sorgen, Saskia, mein Engel. Du trägst keine schweren Verletzungen davon und alles wird wieder gut«, spricht mir mein Vater Mut zu.
»Wie kannst du so was sagen?«, jammere ich, ohne ihn anzusehen. »Solche Nähte hinterlassen doch immer hässliche Narben.«
Vor allem das tiefe Gefühl, dass sich hinter den weißen Wolken in meinem Hirn noch mehr Katastrophen verborgen halten, beschwört weiteres Elend in mir zutage. Feuchtigkeit sammelt sich in meinen Augen, die ich jedoch mit aller Macht zurückzudrängen versuche – ein Reflex, denn in meinem Job bedeuten Tränen verwischte Schminke und diese muss umständlich wieder ausgebessert werden. Ganz zu schweigen von verweinten Augen geht so etwas gar nicht. Perfektion ist nun mal wichtig, damit ich mein Pensum erfüllen kann. Als Tochter des Miteigentümers der De Winter AG ist es mir besonders wichtig, aus dem Schatten meines Vaters herauszutreten und durch eigene Leistung zu glänzen.
»War Daniel auch schon hier?«, bringe ich nun tonlos hervor.
»Ja, aber da hast du noch geschlafen. Dein Verlobter kommt sicher morgen noch einmal wieder. Du weißt ja, sein Job fordert ihm Einiges ab. Er hat dir Blumen mitgebracht.« Mein Vater nickt zur Vase auf dem Nachttisch, in der ein überdimensionierter Strauß steckt.
Typisch! Daniel muss immer in allem übertreiben.
Wäre mir jetzt nicht so elend zumute, würde ich über diese Tatsache sicher schmunzeln.
Daniel und ich arbeiten gemeinsam im Vertrieb unserer Firma. Seit einem halben Jahr sind wir nun verlobt, konnten bei all dem Stress jedoch noch keinen Termin für die Hochzeit finden.
»Papa …« Gerade will ich die Hand nach meinem Vater ausstrecken, als sich bei der Bewegung ein Pflaster von meinem Finger löst. Ein leiser Summton deutet daraufhin, dass irgendetwas aktiviert wurde. »Was ist das?«
»Du hattest eine Gehirnerschütterung, die musst du noch auskurieren, aber das ist halb so wild. Zur Sicherheit hat man dich an einen Oszillographen angeschlossen, um deine Herztöne zu überprüfen. Gleich wird ein Arzt hereinkommen.«
Kaum hat mein Vater den Satz beendet, fliegt die Tür auf, ein Mann in weißem Kittel stürmt in den Saal und knipst noch im Lauf das Licht an. Als er meine blinzelnden Augen erblickt, verlangsamt er seinen Schritt. »Ah, Sie sind wach«, bemerkt er erleichtert. »Bitte geben Sie in Zukunft darauf acht, dass sich das Pflaster nicht löst.«
Mein Blick gleitet zum Namensschild über seiner Brust: Dr. Adalbert Wackerstorf.
»Natürlich. Es tut mir leid, ich wollte Ihnen keine Umstände bereiten, Dr. Wackerstorf.« Mit dem Auftauchen des Arztes ist augenblicklich alle Schwäche hinter der perfekten Saskia verschwunden, die stets überaus höflich und professionell agiert. Dabei überspiele ich sogar meine Irritation wegen der bunten Farben, die um die Gestalt des Arztes herum wabern.
Bestimmt ist das nur eine Nachwirkung der Gehirnerschütterung. Oder habe ich irgendwelche Medikamente erhalten?
Während sich mein Vater erhebt, um vom Fuße des Bettes aus zuzusehen, greift der Doktor nach meiner Hand und beginnt, das Kabel wieder an meinem Finger zu befestigen.
»Sie hatten großes Glück, dass Sie keine inneren Verletzungen davongetragen haben. Nachdem Sie die Gehirnerschütterung auskuriert haben, können Sie entlassen werden.«
Das Pflaster sitzt nun wieder und die Leitung zum Oszillographen bringt auf dem grünen Bildschirm im Takt meines Herzschlages einen Elektronenstrahl zum Hüpfen.
»Ja, das hat mein Vater schon erzählt«, erkläre ich beiläufig, wobei sich der Arzt jedoch merklich versteift. Er sieht mich komisch an, als wäre ich ein Gespenst.
»Was ist?« Ich ziehe die Stirn in Falten.
Dr. Wackerstorf räuspert sich, wobei er unbehaglich das Standbein wechselt. Durch die Gehirnerschütterung muss etwas in meinem Sehzentrum ordentlich durcheinandergeraten sein, denn diese bunten Farbflecke um ihn herum wollen einfach nicht verschwinden. Besonders beängstigend empfinde ich dabei das schwarze Etwas, welches sich um seine Schultern windet. Blinzelnd versuche ich, die Illusionen zu verscheuchen, während sich der Arzt nun endlich zu einer Antwort durchringt: »Es tut mir leid, Ihnen das mitteilen zu müssen, aber für Ihren Vater kam jede Hilfe zu spät. Er ist noch am Unfallort verstorben.«
Seine Worte bringen den Schmiedehammer dazu, in erhöhter Frequenz schmerzhaft gegen mein Schädeldach zu donnern. Dem heftigen emotionalen Aufruhr, welcher sich dabei in mir zusammenbraut, kann mein professionelles Außenbild nun nicht länger standhalten. »Nein! Das kann nicht sein!«, krächze ich aufgewühlt, wobei ich mich aufrichte. »Er ist doch hier!« Ich deute zum Fußende des Bettes, wo mein Vater unverändert ausharrt und mich mitfühlend ansieht. »Papa! Sag doch etwas!«
»Es tut mir leid, ich habe bereits versucht, mit den Ärzten zu sprechen, doch sie können mich weder hören noch sehen, mein Engel«, antwortet mein Vater gleichzeitig mit Dr. Wackerstorf, der sagt: »Sie halluzinieren. Da ist niemand. Der Schock war wohl zu groß. Ich werde Ihnen ein Beruhigungsmittel verabreichen, das sollte Ihnen helfen, sich erst einmal richtig auszukurieren.«
»Aber …« Der Satz erstirbt in meiner Kehle.
Mein Vater soll tot sein? Der Arzt kann ihn nicht sehen!? Er ist nur eine Halluzination?!
Geschockt und erschöpft sinke ich zurück ins Kissen.
Es gibt keine Geister!
»Ich muss verrückt geworden sein …«, hauche ich voller Entsetzen, wobei ich meine Lider zukneife, um all das nicht mehr sehen zu müssen, was gar nicht existiert.
Aber Papa kann nicht tot sein! Das geht nicht, das darf nicht sein …
Gerade ist mir alles zu viel. Jeder Gedanke und jedes Gefühl scheint dermaßen mit Schmerz erfüllt zu sein, dass ich einfach nur noch wegdösen und mich von dieser viel zu verwirrenden und komplizierten Welt verabschieden will. Ich werfe einen flüchtigen Blick zum Arzt, der gerade irgendeine transparente Flüssigkeit in eine Spritze hineinzieht.
»Bitte, Dr. Wackerstorf. Ich will schlafen … Sehr lange …« Damit strecke ich ihm kraftlos den Arm hin, damit er mir möglichst schnell das Beruhigungsmittel verabreichen kann.
* * *
Glücklicherweise hat der Schmiedehammer zwischenzeitlich seinen Dienst eingestellt, wie ich beim Erwachen bemerke. Stattdessen wird mein Leib von einer bleiernen Schwere gefangen gehalten. Träge hebe ich die Lider, die kaum einen Spalt freigeben wollen, und quäle meinen Oberkörper in die Senkrechte. Aber es hilft nichts, meine Blase drückt so unangenehm, dass ich dringend die Toilette aufsuchen muss.
Natürlich bin ich noch immer im Krankenhaus, wie ich feststelle, als ich die Augen nun gewaltsam aufreiße.
Wäre ja zu schön, wenn alles nur ein Traum gewesen wäre.
Wenigstens hat man mir die Infusionsnadel entfernt, sodass ich das komische Gestänge nicht ins Bad mitnehmen muss. Da eine dicke graue Wolkendecke die Sonnenstrahlen vor der Erde abschirmt, strömt nur mäßig helles Tageslicht zum Fenster herein. Daniels Blumen lassen bereits die Köpfe hängen. So gerädert, wie ich mich fühle, muss ich recht lange geschlafen haben. Immerhin hat das Brennen im Gesicht nachgelassen, doch ich verzichte darauf, die Naht erneut zu befühlen.
Während ich mich schwankend aus dem Bett quäle, drängen sich unweigerlich die Erinnerungen an mein letztes Erwachen auf. Lauernd sehe ich mich im Saal um, kann jedoch nichts Ungewöhnliches entdecken.
Kein Geist hier. Wahrscheinlich hatte ich tatsächlich einen Unfall, aber der Rest war nur ein verrückter Alptraum.
Dass mein Vater gestorben sein soll, kommt mir dermaßen unwirklich vor, dass ich keinerlei Traurigkeit darüber verspüren kann. Vielmehr scheint mir, als würde er jeden Augenblick durch die Tür hereinkommen, um mich in die Arme zu schließen, womit jeder Zweifel ausgeräumt sein dürfte, dass es sich um einen Geist handelt. Das gesamte Thema ist mir dermaßen zuwider, dass ich es vehement beiseitedränge und mich stattdessen darauf konzentriere, den Schwindel in meinem Kopf unter Kontrolle zu bringen. Vor dem Bett stehen zwei schwarze Stöckelschuhe und ich erinnere mich immerhin noch daran, meine Füße vor dem Unfall dort hineingezwängt zu haben, um beim bevorstehenden Geschäftstermin mit Eleganz zu punkten. Hier im Krankenhaus kommen sie mir jedoch so fehl am Platz vor wie Perlenschmuck beim Wertstoffhof.
Ich lasse die Schuhe links liegen und stemme mich auf die nackten Füße. Ausgelaugt und leer steuere ich die Tür zum anliegenden Bad an und trete ein. Dabei schaltet sich das Deckenlicht in dem fensterlosen Raum vollautomatisch an. Magnetisch haftet mein Blick auf dem Spiegel. Von hier aus kann ich mich noch nicht darin erkennen, aber die Neugier vor den unausweichlichen Tatsachen überwiegt der Furcht vor dem Anblick in mein Antlitz.
Wie ich wohl aussehe?
Ängstlich donnert mein Herz gegen die Brust. Die Sorge, gleich in ein völlig verunstaltetes Gesicht zu starren, lässt mich zitternd einen Schritt vortreten, um mich schließlich meinem Anblick zu stellen.
Ich hatte wirklich nichts Schönes erwartet, aber dieses aufgedunsene Gesicht kann doch nicht meines sein – ganz unabhängig von der geröteten Naht, die sich von der Stirn, meine Wange entlang, bis zum Hals zieht. Darum herum gruppieren sich dunkelrote Verkrustungen kleinerer Schnittwunden. Um vor lauter Schreck nicht in die Knie zu sinken, klammere ich mich haltsuchend an den Rand des Waschbeckens.
»Nein, nein, nein«, hauche ich heftig kopfschüttelnd.
Da mir die drückende Blase jedoch keinen weiteren Aufschub gönnt, steuere ich mit zittrigen Knien die Toilette an. Nachdem ich mich erleichtert habe, bleibe ich schwer atmend einfach hocken. Vor allem die emotionale Erschöpfung lässt mich hier verharren. Das Bild meines entstellten Gesichts im Kopf starre ich auf die gegenüberliegende Duschwand aus milchigem Glas. Dieser Anblick macht etwas mit mir, saugt mich förmlich in sich hinein.
Milchglas …
Unvermittelt taucht ein Erinnerungsfetzen aus dem Nebel: Während sich das Auto mit uns durch die Luft schraubt, dem Schaufenster eines Ladens entgegen, verhallt mein Entsetzensschrei in weiter Ferne. Beim Aufprall zerfetzt die milchig weiße Scheibe, während der Wagen auf seine Räder kracht und dabei in die Wäscheständer hineindonnert. Eine lange Eisenstange bohrt sich durch die Windschutzscheibe …
Wir sind mit dem Auto in die Wäscherei gekracht, erkenne ich schockgefroren, während die Emotionen des Unfalls noch in mir nachhallen.
Bebend hocke ich auf der Toilettenschüssel und versuche, mit meiner Situation klarzukommen, wobei ich jeglichen Gedanken an meinen Vater vehement beiseitedränge. Nicht im Ansatz bin ich dazu bereit, mich mit seinem möglichen Tod auseinanderzusetzen und erst recht nicht mit diesem irren Geisterthema. Stattdessen wiederholen sich die Szenen des Unfalls in Dauerschleife in meinem Hirn, wobei der Anblick meines geschundenen Gesichts jedes Mal den krönenden Abschluss bildet.
Eine gefühlte Ewigkeit sitze ich wie paralysiert einfach nur so da, bis ich mich dann irgendwann doch wieder hochstemme. Als ich schwankend die Spülung drücke, geschieht jedoch etwas Unfassbares: Eine alte Frau tritt durch die geschlossene Tür ins Bad herein. Entsetzt aufschreiend weiche ich zurück, presse mich gegen die geflieste Wand in meinem Rücken.
»Da-das kann nicht sein …«, hauche ich heftig blinzelnd. Haltsuchend stütze ich mich gegen die Duschkabine. »Das ist nicht echt!« Doch egal, wie heftig ich den Kopf schüttele, noch immer sehe ich die Alte deutlich vor mir, wie sie gestützt auf ihren Gehstock im Raum steht, genauso real wie alles andere hier drin.
»Verzeihung. Ich wollte nicht stören«, entschuldigt sie sich und wendet sich wieder zum Gehen, sodass ich nun auf ihren grauen Dutt blicke, während die Dame abermals durch die geschlossene Tür verschwindet.
Keuchend schlage ich mir die Hände vors Gesicht.
Ich muss komplett verrückt geworden sein …
Am ganzen Leib schlotternd trete ich ans Waschbecken heran und drehe das kalte Wasser auf, lasse es erst über die Hände fließen, um dann vorsichtig die heilen Gesichtspartien zu benetzen. Auf einen weiteren Blick in den Spiegel verzichte ich.
Hoffentlich bringt mich das kalte Wasser wieder zur Besinnung.
Immerhin erfrischt es mich so weit, dass mit dem nächsten tiefen Atemzug das Zittern etwas nachlässt. Ich tupfe die feuchten Stellen mit dem weißen Handtuch ab, welches hier auf einer Ablage bereit liegt.
»Okay. Ich halluziniere«, hauche ich.
Wahrscheinlich ist das nach so einem Unfall nicht allzu ungewöhnlich. Das vergeht wieder und wenn nicht, gibt es bestimmt Medikamente, um es in den Griff zu bekommen.
Derartige Gedanken beruhigen mich etwas, doch es braucht ein paar weitere tiefe Atemzüge, bis ich mich einigermaßen gefangen habe. Dann steuere ich gefasst die Tür an und kehre zurück ins Krankenzimmer, welches ich zu meiner Erleichterung leer vorfinde.
Vielleicht bin ich auch noch gar nicht richtig wach und mein Unterbewusstsein hat mir im Halbschlaf einen Streich gespielt.
Ich flüchte mich ins weiße Metallbett und schlinge meine Decke schützend um den Leib, als könnte sie mich vor all den unheimlichen Illusionen bewahren. Tief durchatmend liege ich nun da. Gerade, als einigermaßen wieder Ruhe einkehrt, höre ich plötzlich die sanfte Stimme meines Vaters: »Saskia, mein Engel …«, wodurch mein Puls augenblicklich wieder Fahrt aufnimmt.
Ein Geist, eine Illusion oder die Wirklichkeit?
Zaghaft öffne ich die Lider. Mein Vater sitzt auf dem Stuhl neben meinem Bett und beugt sich zu mir vor. Sein sonst von Sorge gezeichnetes Gesicht blickt ungewohnt friedlich drein.
»Papa?« Meine Stimme klingt jämmerlich wie die eines kleinen verwaisten Kindes. »Bist du’s wirklich?«
Bevor er antworten kann, strecke ich die Hand nach seinem Arm aus, welche jedoch einfach durch ihn hindurchgleitet. Das sprengt meine emotionale Schmerzgrenze nun komplett.
»Geh weg!«, kreische ich vollkommen außer mir. Dabei wälze ich mich auf die andere Seite, um nicht sehen zu müssen, was sowieso nicht echt ist. Mit schlotterndem Leib liege ich im Bett, wobei ich schutzsuchend die Decke fest um mich schlinge und die Lider zusammenkneife.
Ich bin völlig verrückt geworden. Ein absoluter Albtraum! Könnte ich doch endlich wieder daraus aufwachen.
Nichts weiter passiert, sodass unweigerlich allmählich etwas von der Anspannung aus meinem Körper weicht. Da ich weder über den Unfall, meinen Vater noch irgendwelche Geisterscheinungen nachdenken will, lenke ich meine Konzentration auf die Geräusche in meiner Umgebung. Immerhin bleibt es jetzt still um mich herum. Lediglich auf den Fluren draußen geht hin und wieder eine Tür auf und zu und ich nehme gedämpfte Laute menschlicher Gespräche wahr. Durch das gekippte Fenster dringt das entfernte Rauschen des Verkehrs und das Gezwitscher der Vögel aus dem anliegenden Parkgelände zu mir herüber. Meine Bettwäsche verbreitet einen künstlichen Waschmittelduft, gepaart mit Desinfektionsgeruch.
Plötzlich höre ich, wie die Tür auffliegt und etwas unter metallischem Rattern ins Zimmer geschoben wird. Da das nach realem Krankenhausalltag klingt, wage ich nun doch einen flüchtigen Blick.
»Ach, Sie sind wach! Es gibt Erbsensuppe mit Würstchen«, verkündet eine dickliche Frau in weißem Kittel. Sie nimmt ein Tablett von ihrem Wagen, um es auf meinem Beistelltisch abzulegen. Ein rot-oranger Schein umwölkt ihren Körper, wobei sich um die Hüfte herum graue Flecken zeigen.
Meine Augen spielen mir mal wieder dumme Streiche, tue ich das Phänomen ab und versuche, die Farbirritationen zu ignorieren.
»Danke.« Ich nicke der Frau zu. Zwar verspüre ich keinerlei Appetit, doch wirkt diese Normalität des Krankenhausalltags wohltuend auf mein von geisterhaften Erscheinungen gebeuteltes Gemüt. Nun richte ich mich auf und betätige die Knöpfe der Steuerung, bis ich das Bett in Sitzposition gebracht habe. Die dickliche Frau zieht bereits wieder weiter. Am liebsten hätte ich sie gebeten, hierzubleiben oder wenigstens die Tür offenzulassen, denn durch ihre Präsenz fühle ich mich meinen Illusionen nicht gar so hilflos ausgeliefert. Das käme mir allerdings doch zu albern vor.
So ähnlich müssen sich kleine Kinder fühlen, wenn sie nachts alleine im Bett liegen.
Ein kurzer Blick unter die Warmhaltehaube genügt, um zu besiegeln, dass ich die gräulich braune Suppe nicht anrühren werde.
»Von solchem Essen kann man doch nicht gesund werden«, schnaube ich kopfschüttelnd. Nicht, dass mich das Thema Mahlzeit im Augenblick besonders interessieren würde, doch mein Unmut hilft mir, mich in diesem Stückchen Normalität zu verankern. Ich knabbere lediglich an den Butterkeksen, die zum Nachtisch gereicht wurden und spüle die Krümel mit einem Schluck aus dem Wasserglas hinunter.
Ich muss schleunigst diese schrecklichen Illusionen loswerden …
Beherzt drücke ich den roten Notknopf. Wenig später betritt Dr. Wackerstorf das Krankenzimmer.
»Nun, Sie sehen schon viel ausgeruhter aus, Frau De Winter. Wie geht es Ihnen?« Sein forschender Blick wandert von mir zum Klemmbrett in seiner Hand. Er überfliegt dort ein paar Zeilen, um mich wieder über die Gläser seiner filigranen Brille hinweg zu fixieren.
»Schrecklich. Ich werde noch verrückt«, keuche ich. »Zunächst muss ich Sie jedoch bitten, die Sache absolut vertraulich zu behandeln, Dr. Wackerstorf«, gebe ich so gefasst von mir, wie es mir in meinem desolaten Zustand möglich ist.
»Selbstverständlich werde ich mich an das Gebot der ärztlichen Schweigepflicht halten«, bestätigt er nickend.
»Seit dem Unfall sehe ich Dinge, die nicht da sind. Die Menschen sind von Farbflecken umgeben und vorhin im Bad schwebte eine ältere Dame durch die geschlossene Tür herein.« Mit meinem angeblich verstorbenen Vater will ich mich gerade nicht beschäftigen, außerdem habe ich dem Arzt von seiner Erscheinung ja bereits berichtet.
»Hm, verstehe. Es sieht mir ganz danach aus, als habe der Unfall ein Trauma verursacht, welches diese Halluzinationen hervorruft. In jedem Fall sollten Sie dringend entsprechende therapeutische Hilfe in Anspruch nehmen.«
»Ja, aber ich kann doch so nicht leben«, bricht es wenig professionell aus mir hervor. »Gibt es denn keine Medikamente, die diese Halluzinationen ausschalten können?«
»Doch, natürlich. Von einem hochpotenten Neuroleptikum habe ich noch eine Probepackung auf Vorrat. Einen Moment bitte.«
Erleichtert darüber, dass meinen Halluzinationen mit einem Medikament beizukommen ist, lasse ich mich zurück ins Kissen sinken, während Dr. Wackerstorf den Saal verlässt. Kurz darauf kehrt er mit einer weißen Schachtel in der Hand zurück. »Nehmen Sie davon drei Mal täglich eine Tablette. Das ist jedoch nur für die akuten Symptome. Suchen Sie in jedem Fall zeitnah einen Psychiater auf, der Sie auf das optimale Präparat einstellen kann.«
Er reicht mir eine weiße Schachtel, die ich hin- und herwende, als könnte sie mir mehr über die Wirkungsweise ihres Inhalts verraten.
»Herzlichen Dank. Sie sind meine Rettung!«
»Gerne. Ein solcher Unfall, gepaart mit dem Verlust eines nahen Angehörigen ist nicht leicht zu verkraften und Sie wären nicht die Erste, die auf diesen Schock mit Halluzinationen reagiert. Daher halte ich es für unabdingbar, sich zeitnah einen geeigneten Therapeuten zu suchen.«, wiederholt er nachdrücklich.
»Jaja, natürlich …«, erwidere ich geistesabwesend, während ich bereits eine weiße Tablette aus der Silberfolie schäle, um sie mit einem Schluck aus dem Wasserglas herunterzuspülen.
Von allem anderen will ich erst einmal nichts wissen, denn noch immer weigere ich mich, den Wahrheitsgehalt des Gesagten anzuerkennen.
»Die Narbe ist bisher gut verheilt und außer ein paar Prellungen konnten keine schwerwiegenden Verletzungen festgestellt werden, daher stehen Sie hier nicht länger unter Beobachtung. Ihr Verlobter hat bereits angekündigt, Sie noch heute abzuholen. Im Sekretariat werden gerade die Entlassungspapiere vorbereitet.«
»Aha. Gut.« Obwohl es tatsächlich eine gute Nachricht ist, erregt sie keine Freude bei mir.
Ein Klopfen an der Tür lässt mich erschrocken zusammenzucken. Offenbar liegen meine Nerven noch immer ziemlich blank, was vor allem daran liegt, dass sich die Farbflecke um Dr. Wackerstorf hartnäckig halten. Solange sie nicht weg sind, wage ich mich nicht aus diesem Bett heraus.
»Wie lange dauert es, bis die Tablette wirkt?«, erkundige ich mich, während sich die Tür gemächlich öffnet und Daniel hereinlugt. Mit der Krawatte im gleichen Blauton wie der Blazer seines Anzugs und den kurzen, leicht nach hinten gekämmten Haaren ist er wie immer perfekt gestylt. Lediglich die gräulich rote Wolke, welche seinen Körper umgibt, passt nicht zu seinem Äußeren. Außerdem gefällt mir sein verunsicherter Ausdruck nicht besonders. Glücklicherweise wandelt sich dieser zu einem Lächeln, als Daniel nun auf mich zusteuert.
»Schwer zu sagen«, antwortet Dr. Wackerstorf auf meine Frage nach der Wirkungsdauer der Tablette. »Also, damit verabschiede ich mich, Frau De Winter. Man wird Ihnen dann die Entlassungspapiere vorbeibringen.«
»Danke für alles«, antworte ich, während ich die Tablettenpackung so unauffällig wie möglich unter meiner Bettdecke verschwinden lasse.
»Tut mir leid, dass ich dich nicht früher besucht habe, du kannst dir ja denken, was in der Firma zurzeit los ist …«, entschuldigt sich Daniel und drückt mir einen flüchtigen Kuss auf die Stirn. »Und beim letzten Mal hast du sowieso nur geschlafen. Die Blumen sind übrigens von mir, nicht dass du noch glaubst, du hättest einen weiteren Verehrer«, versucht er sich an einem Scherz. Daniel nickt den hängenden Blütenköpfen zu und lässt sich dann auf dem Stuhl neben meinem Bett nieder. Allmählich scheinen die Tabletten tatsächlich Wirkung zu zeigen, denn der grau-rote Schleier um meinen Verlobten nimmt nun deutlich an Transparenz zu.
Eigentlich ist es mir ganz recht, dass er bisher nichts von meinen Halluzinationen mitbekommen hat und dennoch erzeugen seine Rechtfertigungen ein flaues Gefühl in mir.
»Aha?! Seit wann ist die Arbeit denn wichtiger als ich?«, brumme ich.
»Aber so darfst du das nicht sehen, Saskia. Nach dem Tod deines Vaters ist es schließlich auch deine Firma, um die ich mich gekümmert habe …«
»Wie bitte?«, entweicht es schrill meiner Kehle, wobei ich mich kerzengerade im Bett aufrichte. »Was redet ihr denn da alle? Mein Vater ist nicht tot!«
»Hey, beruhige dich, … Du leidest wohl noch immer unter dem Schock …« Daniel steht auf und legt mir seine Hand auf die Schulter. »Tut mir leid, dass ich damit so herausgeplatzt bin, aber ich dachte, du hattest schon ein paar Tage Zeit, die Nachricht zu verarbeiten.«
Ich schüttele wild den Kopf, während sich gegen meinen Willen erste Tränen in meinen Augen sammeln.
»Das kann nicht sein … Papa lebt!« Dieses Mal bricht mein Widerstand nur noch erstickt aus mir hervor, weil meinem verstockten Bewusstsein nun doch allmählich klar wird, dass sich weder Dr. Wackerstorf noch Daniel so etwas Schreckliches ausdenken würden.
Schluchzend vergrabe ich mein Gesicht in den Händen, aber ich bin noch nicht bereit, den gesamten Schmerz zuzulassen, sodass ich die aufkommende Traurigkeit vehement wieder beiseitedränge.
Vielleicht ist doch alles nur ein Irrtum – eine Verwechslung.
Meine Mutter ist kurz nach meiner Geburt verstorben, daher war Papa für mich als Kind immer die wichtigste Bezugsperson – der Fels in meiner Brandung. Doch auch später stellte er einen wichtigen Fixpunkt meines Lebens dar. Schon der Gedanke, dass dieser Leuchtturm nun im Meer versunken sein könnte, droht ein Gefühl uferloser Verlorenheit in mir auszulösen.
»Saskia, zieh dich an. Du wirst gleich entlassen«, drängt Daniel, wobei er eine Tüte auf meiner Bettdecke ablegt. Er fischt einen Stapel neu gekaufter Kleidung heraus, während sein Blick einen Atemzug lang seine Armbanduhr streift, bevor er sich mir zuwendet. Dabei entgeht mir jedoch nicht, dass er leicht an mir vorbeischaut, sodass meine verletzte linke Gesichtshälfte aus seinem Fokus gerät.
»Du findest mich hässlich«, stelle ich bitter fest.
»Nein, natürlich nicht, mein Schatz! Es ist doch nur eine Naht, das verheilt wieder. Aber jetzt zieh dich bitte an.«
Schnaubend begutachte ich den Kleiderstapel: eine lange Jeans, eine grüne Bluse und schwarze Spitzenunterwäsche, an der noch das Preisschild hängt. »Da ich heute Morgen einen Termin in München hatte, blieb mir keine Zeit, noch mal zu Hause vorbeizufahren, dafür war unsere Sekretärin so freundlich, dir ein paar neue Sachen zu besorgen. Ich hoffe, sie hat deinen Geschmack einigermaßen getroffen. Auf jeden Fall sieht es bequem aus. Arbeiten kannst du ja im Moment sowieso nicht …«
»Weil mich die Narbe entstellt?!«, schnaube ich.
»Saskia, jetzt reg dich bitte ab. Das wird schon wieder.« Daniel wirft abermals einen nervösen Blick auf seine Armbanduhr.
»Sei so lieb und zieh dich an. Es tut mir leid, dass ich so dränge, aber ich habe noch einen wichtigen Kundentermin. Die Rosenwasser-Gruppe droht abzuspringen, wenn ich die Damen und Herren nicht schleunigst davon überzeugen kann, dass die De Winter AG auch ohne den Senior hervorragende Qualität liefert.«
Noch vor dem Unfall hätte ich ebenfalls alle Hebel in Bewegung gesetzt, um den Absprung der Rosenwasser-Gruppe zu verhindern, doch jetzt klingen die Worte meines Verlobten hohl und leer in meinen Ohren. Noch nie hat mich diese Firmenangelegenheit so wenig interessiert wie in diesem Augenblick. All die naturkosmetischen Cremes, die wir herstellen und weltweit vertreiben, können weder die oberflächlichen noch die tiefen Wunden heilen, die der Unfall gerissen hat.
Was gäbe ich darum, diesen Tag rückgängig machen zu können, um in mein altes Leben zurückzukehren …
Mittlerweile haben sich die bunten Farbflecke um Daniel vollständig verflüchtigt, was mich erleichtert aufatmen lässt. So schiebe ich nun träge meine Beine unter der Decke hervor, um mich anzukleiden.
»Während du hier lagst, musste ich mich alleine um alles kümmern. Die Geschäfte, die Beerdigung – ich hätte gar nicht gedacht, was für ein enormer Aufwand das alles ist. Die ganze Firma wird übermorgen einen Trauertag einlegen, um den Feierlichkeiten der Beerdigung beizuwohnen …«
»Hör auf!« Zornig blitze ich Daniel an und lasse die Jeans los, welche ich gerade zuknöpfen wollte, um die Fäuste zu ballen. »Wie kannst du nur so abgebrüht über solche Dinge reden?«
Barfuß
Saskia, Krankenhaus, Montag, 17. August
»Aber man muss die Dinge doch beim Namen nennen …«, verteidigt sich Daniel. »Am Anfang war mir auch ganz anders zumute, vor allem, als ich den Leichnam identifizieren sollte. Das war schon ein echter Schock, Hannes De Winter so bleich daliegen zu sehen. Für mich waren die drei vergangenen Tage auch nicht leicht, mit dir hier im Krankenhaus. Alles blieb an mir hängen und ich hatte so viel zu organisieren, dass ich kaum Zeit zum Trauern hatte.«
»Na, mein herzliches Beileid«, brumme ich bitter. »Es handelt sich schließlich nicht um deinen Vater, um den es hier geht …« Gereizt greife ich nach der Bluse, um in die Ärmel zu schlüpfen.
»Ich verstehe schon, dass du eine schwere Zeit durchmachst, da ist es verständlich, dass deine Nerven blankliegen. Und nach dem Tod deiner Mutter hattest du ein sehr enges Verhältnis zu Hannes, deshalb trifft dich sein Tod nun natürlich besonders hart.«
»Hör endlich auf! Was soll das denn jetzt?« Die zornigen Blitze aus meinen Augen treffen auf sein verstocktes Gesicht. »Du hast nicht den Schimmer einer Ahnung, wie es mir mit allem geht, also verschone mich mit deiner Hobbypsychologie.«
Mit zusammengepressten Lippen erhebt sich Daniel vom Stuhl. »Lass uns nicht streiten, Saskia. Ist ja klar, dass du diesen Unfall erst noch verarbeiten musst. Bist du dann so weit?«
Schnaubend schließe ich die Lider und nehme einen tiefen Atemzug Krankenhausluft, um wieder runterzukommen.
»Ja …« Dann fallen mir jedoch die Tabletten ein. So unauffällig wie möglich stopfe ich die Schachtel in die hintere Hosentasche der Jeans und hoffe, dass Daniel der Geste nicht allzu viel Bedeutung beimisst. »Dann gehen wir …« Zu meinem Entsetzen fällt mein Blick nun jedoch zum Klinikboden aus grau meliertem Kunststoff, wo mich meine schwarzen Stöckelschuhe voller Schadenfreude anzulachen scheinen.
»Aber nicht in diesen Dingern …«, murmele ich frustriert.
Noch immer fühle ich mich schwächlich und blutleer und ein Versuch, auf dünnen Stelzen bis zu Daniels Auto zu balancieren, würde unweigerlich im Krankenhaus enden, also könnte ich genauso gut im Bett liegenbleiben.
»Oh, an bequemere Schuhe habe ich leider nicht gedacht. Aber ich kann dich stützen«, bietet Daniel an, während ich noch mit mir ringe, ob ich mich in die Dinger nun tatsächlich hineinzwängen soll oder lieber nicht. Seine Ungeduld schwappt so unangenehm zu mir über, dass erneut Aggression in mir aufsteigt.
Im Normalfall hätte ich mich wahrscheinlich letztendlich dazu überwunden, die Stöckelschuhe anzuziehen, aber da die hässliche Naht mein Gesicht ja bereits derart verunstaltet, können die nackten Füße meiner bröckeligen Fassade auch nichts mehr anhaben.
Im August sind die Temperaturen noch einigermaßen moderat, sodass der kurze Weg auf nackten Sohlen bis zum Auto eigentlich kein Problem darstellen dürfte, denke ich, während ich die Schuhe nun vom Boden aufpicke und mich aufrecht hinstelle.
»Was tust du denn da? Du willst doch nicht etwa barfuß …«, stößt Daniel entsetzt hervor.
»Doch!«
»Aber das geht nicht … Was ist mit den vielen Krankenhauskeimen …« Mein Verlobter rümpft die Nase.
Ungeachtet seiner Reaktion tapse ich an ihm vorüber, als mir jedoch noch etwas einfällt: »Wo ist eigentlich meine Handtasche?«
»Ach, die habe ich an mich genommen. Sie liegt im Auto. Hier hätte ja wer weiß wer reinkommen und deine Sachen stehlen können, als du schliefst.«
»Na gut, gehen wir.«
»Hier sind Ihre Entlassungspapiere!« Eine Schwester stürmt mit einem Stapel an Blättern herein. »Sie müssen nur noch unterschreiben.«
Nachdem die Formalitäten erledigt sind, verlasse ich mit den Schuhen in der Hand an Daniels Seite den Raum. Die meisten Leute, denen ich auf den Gängen begegne, wenden peinlich berührt den Blick von meinem Gesicht, dafür mustern sie umso ungenierter meine nackten Füße, wo ein halbtransparenter, schon leicht abgeblätterter Nagellack in sanftem Rosé die Zehen ziert.
Ich fühle mich entblößt vor den Leuten, die nicht hinschauen, genau wie vor denen, die verstohlen ihren Blick abwenden. Auch an Daniels Seite ist mir unwohl. Ich spüre seine Scham über die entstellte Partnerin, die sich erdreistet, barfuß herumzulaufen. Vor dem Unfall war es umgekehrt, da glühte er vor Stolz, wenn er die hübsche Tochter des Chefs an seiner Seite herumzeigen durfte.
Wir haben gerade die sich unter einem Summen automatisch öffnenden Glastüren zum Ausgang erreicht, als die bitteren Worte aus mir herausbrechen: »Du schämst dich für mich.«
»Aber das ist doch Unsinn. Du kannst nichts für die Wunde … Ich wünschte nur, du würdest deine Schuhe …«
»Was ist am Barfußgehen denn so schlimm?«
»Es ist einfach unnormal und es passt nicht zu dir …«, druckst er herum, während wir nun den Parkplatz ansteuern.
Der raue Teer prickelt unter meinen Füßen – kühl, aber aushaltbar. Angenehmer fühlt es sich an, über das Gras am Wegesrand zu gehen – die zarten Halme streicheln sanft über meine Haut, wodurch ich plötzlich eine tiefe Verbindung zu dieser Erde spüre, mit allem, was darauf wächst. Das nimmt mir etwas von der Schwere, die die ganze Zeit auf meinem Herz lastete.
Ich sollte öfters mal barfuß gehen …
»Es passt nicht zu mir?«, wiederhole ich kopfschüttelnd. »Vielleicht kennst du mich einfach nicht richtig …«
In diesem Moment blinzelt ein einzelner Sonnenstrahl durch die dicke Wolkendecke, wirft einen hellen Lichtfleck genau um uns herum und es kommt mir so vor, als wäre dieses Zeichen für mich bestimmt – das Zeichen eines lieben Menschen, der nun nicht mehr auf der Erde weilt. Obwohl sich mein Verstand noch immer weigert anzuerkennen, dass mein Vater verstorben sein könnte, hat mein Gefühl längst erkannt, wer mir diesen Lichtblick sendet. Ergriffen halte ich inne, um den Sonnenstrahl zu bestaunen und schon wieder sammelt sich Feuchtigkeit in meinen Augen, die mir bereits die Wangen hinunterrinnt.
»Saskia?! Was ist denn los? Komm schon, die Zeit rennt uns davon«, drängelt Daniel, während er nun die zwei vorausgegangenen Schritte zu mir zurückkehrt, um mir seine Hand anzubieten. Aber ich fühle mich viel zu unverstanden, um mich von ihm anfassen zu lassen und weiche zurück, sodass er ins Leere greift.
»Weißt du was? Lass mich doch einfach in Ruhe!«, pflaume ich ihn an, weil mir seine nervöse Eile tierisch auf die Nerven geht. »Ich komme schon alleine klar.«
Tief durchatmend schüttelt mein Verlobter den Kopf. »Ach, Quatsch. Natürlich nehme ich dich mit nach Hause. Dann komme ich halt ein bisschen zu spät zum Termin. Wird schon kein Problem sein …« Resigniert lässt Daniel die Schultern hängen, reicht mir dann jedoch versöhnlich die Hand.
Mein Nervenkostüm ist so dünn, dass er es gerade nicht besonders leicht mit mir hat.
Noch immer widerstrebt es mir, sie zu nehmen, stattdessen nicke ich ihm ebenfalls versöhnlich zu und beeile mich nun immerhin, ihm zu seinem Firmenwagen zu folgen.
Wie sah sein Auto nochmal aus?
Erschrocken muss ich feststellen, dass ich mich an dieses Detail kaum mehr erinnern kann.
Habe ich etwa noch mehr vergessen?
Erst als die Rücklichter eines silbern glitzernden Wagens aufleuchten, flackert die Erinnerung wieder auf.
Da die De Winter AG darauf verzichtet, den Fuhrpark mit einem Logo auszustatten, das aus dem weiß-grünen Firmennamen besteht, erregt Daniels Auto lediglich durch die zwei dicken Auspuffe Aufmerksamkeit. Die noble Innenausstattung kann man durch die getönten Scheiben nur erahnen. Der Wagen ist sein ganzer Stolz, wobei ich in dieser Beziehung bisher an erster Stelle gestanden hatte – vor dem Unfall wohl gemerkt – jetzt bleiben nur noch Auto und Job übrig.
In dem Moment, als Daniel die Beifahrertür öffnet, taucht die Sonne gerade wieder hinter den Wolken ab. Ich lasse mich auf dem cremefarbenen Ledersitz nieder und verstaue die Stöckelschuhe im Fußraum. In mir ist plötzlich alles wie betäubt. Es muss ein völlig anderes Leben gewesen sein, als ich akkurat geschminkt in Businessklamotten auf den nächsten Geschäftstermin hin fieberte, noch einmal alle Verkaufsargumente im Kopf durchging und mir Lösungen für mögliche Stolperfallen überlegte. Ich wünschte, es könnte wieder so sein, doch gerade hat all das jegliche Relevanz verloren. Nichts ist mehr, wie es einmal war und eine trübe Schlacke in meinem Inneren überschattet jede Leichtigkeit, die einst mein Leben begleitete.
Werde ich diese Narben je wieder loswerden und meine Arbeit normal erledigen können? Und Papa …
Nein, an meinen Vater will ich jetzt nicht denken.
Mein Fokus wandert in die Ferne, sodass ich nur unscharf Büsche und andere Autos erkenne, als sich das Fahrzeug in Bewegung setzt.
Plötzlich beginnen meine Zähne zu klappern und ich kralle mich an den Handgriff der Beifahrertür. Mein Herz rast, als sich in meinem Geist die Szenen abspulen, wie das Auto über den Fahrbahnrand hinausschießt, einen Erdhügel hinauf – es schraubt sich durch die Luft …
»Saskia!« Statt weiter auszuparken, packt Daniel meinen Oberarm. »Hey, alles in Ordnung?« Die Szenen zerplatzen wie Seifenblasen, wobei die Gefühle jedoch einen angstvollen Nachhall in mir erzeugen.
Blinzelnd atme ich tief durch und schaue ihn an. »Ja, ich … Der Unfall …« Abermals schließe ich keuchend die Augen.
»Kannst du dich denn erinnern, was passiert ist?«, will Daniel wissen.
»Nicht genau. Es sind nur Fetzen. Ich sehe, wie sich der Wagen durch die Luft schraubt und in die Fensterscheibe der Wäscherei kracht.«
»Also kehrt die Erinnerung zurück …«, stellt Daniel fest, doch aus irgendeinem Grund scheint ihm das nicht besonders zu behagen.
»Ja, wieso? Habe ich denn noch mehr vergessen?«
»Der Polizist sagte, die Amnesie wäre vor allem auf den Tag des Unfalls begrenzt.«
»Wieso Polizist? Woher will die Polizei das wissen?«
»Kannst du dich denn noch nicht mal an die Vernehmung erinnern?«
»Nein … Doch, warte mal …« Hinter dichten Schleiern in meinem Hirn taucht plötzlich das Gesicht eines Mannes in dunkelblauer Uniform auf. Er sitzt neben meinem Bett und stellt mir alle möglichen Fragen, die ich mechanisch beantworte:
»Wieso hat Ihr Vater die Kontrolle über das Fahrzeug verloren?«
»Ich weiß es nicht. Ich kann mich nicht erinnern …«
»Ja, da war ein Polizist, aber ich konnte mich an nichts erinnern. Sehr frustrierend …«
»Geht’s dir jetzt besser? Können wir weiterfahren?«, erkundigt sich Daniel besorgt, wobei er seine Ungeduld jedoch nicht vollständig aus seiner Stimme zu verbergen vermag.
»Ja, geht schon.«
Kaum haben wir den Parkplatz verlassen, schaltet Daniel das Radio ein. Aus den Lautsprechern singt eine Frau von Tausend Wundern, die in Erfüllung gehen, doch das Lied passt so gar nicht zu meiner Stimmung.
Auf der weiteren Fahrt herrscht Funkstille zwischen uns, was die Musik aus dem Radio einerseits erträglicher macht, andererseits verfestigt sich unser Schweigen durch die äußere Beschallung.
Was ist nur mit uns passiert? Weshalb fühle ich plötzlich eine solche Distanz zu Daniel?
Ich muss an die Szenen unseres Kennenlernens denken, als noch alles so anders, so leicht zwischen uns war: Allerdings verlief unser erstes Zusammentreffen recht schmerzhaft, denn ich hatte die Tür meines Sportwagens zu hastig aufgestoßen, ohne mich vorher umzusehen. Daniel war ebenfalls in Eile, daher rammte er die eben geöffnete Tür und stolperte über meinen Fuß, den ich bereits herausgestreckt hatte. Ich schrie entsetzt auf, als der fremde Mann im Anzug über mein Bein stolperte und gegen die offene Wagentür knallte, die ihn immerhin vor einer näheren Bekanntschaft mit dem geteerten Untergrund bewahrte. Der Fremde im graublauen Anzug richtete sich ächzend auf, wobei er sich die schmerzende Stirn rieb. Darauf zeichnete sich ein roter Streifen ab, den dort offenbar der obere Rand meiner Tür hinterlassen hatte.
»Können Sie nicht aufpassen?«, schnaubte er. »Normalerweise schaut man sich um, statt Autotüren als Waffe gegen ahnungslose Fußgänger einzusetzen. Mist, wie soll ich so zum Vorstellungsgespräch …?« Er setzte gerade an, sein Gesicht in meinem Rückspiegel zu begutachten, als ich, die glattrasierten Beine voraus, vollständig aus dem Wagen stieg.
»Es tut mir wirklich leid. Ich hätte natürlich besser aufpassen müssen«, entschuldigte ich mich. »Sie sind hier wegen der Stelle als Vertriebsmanager bei De Winter?«
Mit geweiteten braungrünen Augen in einem glattrasierten Gesicht stierte er mich fassungslos an.
»J-ja. S-sie etwa auch?!«, stammelte er, doch dann schien er sich wieder zu fangen, wobei er mir anerkennend zunickte. »Ich hätte nicht gedacht, dass ich heute mit derart knallharter Konkurrenz zu rechnen habe – im wahrsten Sinne des Wortes.«
»Manchmal kommt es eben völlig anders, als man denkt …« Mein verschmitztes Lächeln fand einen Widerhall in seinem Grinsen.
»Na, selbst wenn das Vorstellungsgespräch heute unter keinem guten Stern zu stehen scheint, habe ich wenigstens einen besonders hellstrahlenden kennengelernt. Mein Name ist Daniel Herzog und mit wem habe ich die Ehre?«
»Nennen Sie mich einfach Saskia«, gab ich grinsend zurück. »Und jetzt beeilen Sie sich besser, sonst kommen Sie noch zu spät zu ihrem Termin.«
»Saskia, sehr erfreut. Wenn das eben eine kleine Abfuhr war, kann ich wohl nur noch darauf hoffen, noch öfter Zielobjekt Ihrer Türattacken zu werden«, erklärte er charmant lächelnd, doch in seinen Augen blitzte eine klitzekleine Enttäuschung auf.
»Wir werden sehen«, erwiderte ich unbestimmt, wobei ich krampfhaft das Lachen zu unterdrücken versuchte. Schließlich hielt mich Daniel fälschlicherweise für eine Konkurrentin um die Stelle, er ahnte ja nicht, dass ich das Bewerbungsgespräch gemeinsam mit meinem Vater führte.
Dementsprechend groß war natürlich Daniels Überraschung gewesen, als er wenig später zur Tür hereintrat und mich dort an Papas Seite sitzen sah. Er konnte kaum verhindern, dass Schamesröte in seine Wangen stieg, als Hannes De Winter mich als seine Tochter vorstellte.
»Äh, ja, wir hatten bereits das Vergnügen«, stammelte er, woraufhin er jedoch lachend hinzufügte: »Wie es aussieht, wird mir die Schramme an meiner Stirn in vielerlei Hinsicht noch lange im Gedächtnis bleiben.«
Nachdem wir meinen Vater über unser unglückliches Zusammentreffen aufgeklärt hatten, meisterte Daniel das darauffolgende Gespräch so souverän, dass wir uns einig darüber waren, dass er sich perfekt für die Stelle eignete.
»Ich hoffe, Sie verstehen den Arbeitsvertrag nicht als Wiedergutmachung für die Türattacke, sondern ausschließlich als Anerkennung Ihrer Qualifikation«, erklärte ich, als ich ihm später die unterzeichneten Papiere überreichte.
»Danke für die Blumen. Als Wiedergutmachung wünsche ich mir von Ihnen auch keinen Arbeitsvertrag, vielmehr … Wie wäre es, wenn Sie sich stattdessen von mir zu einem Essen einladen lassen?«
»Das Schmerzensgeld besteht darin, dass Sie mich einladen?« Verwundert hob ich die Brauen und strich eine Strähne des blonden Haares aus meinem Gesicht. »Ich denke, in diesem Fall sollte das eigentlich eher umgekehrt laufen.«
»Auf keinen Fall. Halten Sie mich für einen altmodischen Macho, aber das käme meinem männlichen Ego zu sehr in die Quere. Wie wäre es heute Abend um 19 Uhr mit einem Dinner zu zweit im Del Tufo?«
»Gerne.«
So nahmen die Dinge schließlich ihren Lauf. Durch die gemeinsame Arbeit verbrachten wir zwangsläufig viel Zeit miteinander und kamen uns allmählich näher.
Als der Wagen vor unserer Doppelgarage zum Stehen kommt, erwache ich aus meinen Tagträumen. Das metallene Garagentor rollt sich automatisch auf und gibt meinen roten Sportwagen frei. Völlig unversehrt steht er da, wogegen das Auto meines Vaters nach diesem Unfall wohl in der Schrottpresse gelandet sein dürfte. Sicher hatte Daniel die Fernbedienung für das Rolltor aus lauter Gewohnheit betätigt, denn statt in die Garage einzufahren, fischt er nun meine Handtasche vom Rücksitz und bettet sie in meinen Schoß.
»Du kommst doch alleine zurecht, oder? Wenn ich mich beeile, schaffe ich es vielleicht noch rechtzeitig zum Termin mit der Rosenwasser-Gruppe.«
»Ich komme schon klar«, brumme ich. Tatsächlich bin ich froh, wenn ich jetzt etwas alleine sein kann.
»Prima.« Daniel schenkt mir ein dankbares Lächeln und beugt sich herüber, um mir einen vorsichtigen Kuss auf die heile Seite meines Gesichts zu hauchen.
In dem Moment, wo ich aussteige, erinnere ich mich an meine Stöckelschuhe, doch die Lust, sie mitzunehmen, hält sich in Grenzen, daher schlage ich kurzentschlossen die Beifahrertür zu. Die Räder des Wagens knacken auf dem Kies, während Daniel rückwärts rollt, durch die Einfahrt zur Straße hinaus, woraufhin das Tor aus schwarz gestrichenem Stahl in seine ursprüngliche Position gleitet. Ich schaue dem davonfahrenden Auto hinterher, dann schweift mein Blick über die Gärten und Hausdächer hinweg. Wir wohnen in einer modernen terrassenförmig angelegten Villa am Berghang mit Blick ins Donautal. In der Ebene ragt der höchste Kirchturm Deutschlands aus dem Häusermeer, welcher zum Ulmer Münster gehört.
Ein Gefühl verlorener Einsamkeit überkommt mich, je weiter sich mein Verlobter entfernt. Um mich herum scheint alles so alltäglich normal, als hätte es diesen Unfall nie gegeben, und doch erinnern mich nicht nur meine äußerlichen Narben daran, dass sich etwas grundlegend verändert hat.
Der raue Kies drückt unangenehm auf meine nackten Sohlen, daher wende ich mich nun dem Haus zu: ein kalkweißer Neubau mit kleinem Swimmingpool auf der Dachterrasse. Die Handtasche um die Schulter geschlungen tapse ich auf Zehenspitzen über die Kiesel, bis ich endlich den gepflasterten Weg erreiche, welcher an gestutzten Buxbaum-Kugeln vorbei zum Eingang führt. Gleich einem Tier auf Nahrungssuche fährt der Mähroboter am Wegrand entlang, um den Rasen dauerhaft kurz zu halten. Während ich die Haustürschlüssel aus meiner Handtasche krame, flackern die Szenen unseres Einzugs in mir auf:
Daniel hatte Champagner besorgt und wollte die Flasche zur Einweihung an der Tür zerschellen.
»Was für eine Verschwendung!«, protestierte ich gut gelaunt lachend. Mit unseren satten Vertriebsprovisionen hatten wir uns gemeinsam dieses luxuriöse Wohnobjekt finanziert und es war der Tag des Einzugs gekommen.
»Na gut, eigentlich hast du ja recht.« Daniel hauchte mir einen zärtlichen Kuss auf die Lippen. »Dann erlaubt mir, meine Königin, für uns zwei Gläser zu besorgen. Nachdem wir uns mit der Hälfte des edlen Tropfens verköstigt haben, soll der Rest jedoch der Einweihung unserer zukünftigen Residenz dienen. Um eine standesgemäße Einweihung kommen wir schließlich nicht herum. Was haltet Ihr davon, holde durchlauchtigste Maid De Winter?«
»Einverstanden«, lachte ich.
Mein Verlobter musste schon besonders guter Laune sein, oder zu viel getrunken haben, um sich zu derartigen Blödeleien hinreißen zu lassen – an diesem Tag traf gleich beides zu.
Nach der Einweihung trug mich Daniel dann über die Schwelle hinein, als handelte es sich bereits um unsere Hochzeit.
Als ich jetzt die Vorhalle betrete, die ganze zwei Stockwerke überspannt, wirkt hier alles fremd wie vertraut gleichermaßen. Eine stählerne Treppe führt an der Wand entlang zum Portal auf der oberen Ebene, von wo aus man zu den drei Schlafzimmern, einem gigantischen Bad und der ausladenden Dachterrasse samt Pool gelangt. Für uns beide ist das Haus eigentlich viel zu groß, doch in irgendeiner fernen Zukunft haben wir ja mal Kinder eingeplant, außerdem schmückt sich Daniel gerne mit Gästen aus höheren Gesellschaftsschichten.
Mich zieht es zunächst in unser gemeinsames Schlafzimmer im ersten Stock. Da es heute nichts zu repräsentieren gibt, bevorzuge ich bequeme Kleidung. Ich wähle einen blauen Jogginganzug und weiche Kuschelsocken, um meine geschundenen Sohlen zu verwöhnen.
Erinnerungen an die Farbflecke und Geistererscheinungen drängen sich mir auf. Heftig den Kopf schüttelnd versuche ich, sie loszuwerden.
Gut, dass es Medikamente gibt, die diese Halluzinationen unterbinden, sodass ich wenigstens ein einigermaßen normales Leben führen kann.
Reflexartig greife ich nach meiner brandneuen Jeans, die ich auf dem Bett abgelegt habe, um die Pillenpackung aus der Hosentasche zu ziehen.
Ob ich sicherheitshalber noch eine Tablette nehmen soll?
Da ich auf keinen Fall nochmal von derart unheimlichen Erscheinungen überfallen werden will, stopfe ich mir eine weitere Tablette in den Mund. Die Packung verstaue ich in meiner Handtasche, die ich auf dem Bett ablege.
Nur gut, dass Daniel nichts von meinen Halluzinationen bemerkt hat. Fehlte noch, dass er mich für verrückt hält.
Mit der Tablette im Mund eile ich in die Küche hinab, um das Medikament mit einem Glas Wasser herunterzuspülen. Durch den Anblick des Obsttellers wird mir das Loch in meinem Magen bewusst, welches die fehlende Mahlzeit hinterlassen hat.
Habe ich in den letzten drei Tagen außer dieser Infusion überhaupt Nahrung zu mir genommen?
Entweder der Schock, die Kopfverletzung oder etwaige Medikamente haben einen dichten Dunst in meinem Hirn zurückgelassen, sodass ich mich nur schwer an diese Zeit erinnern kann. Auch der Tag des Unfalls verbirgt sich verschwommen wie hinter milchigem Glas.
Gedankenverloren nehme ich die Obstschale mit in den Wintergarten, wo ich es mir auf einer Liege gemütlich mache. Eine verschiebbare Glastür trennt diesen Bereich vom Wohn-Esszimmer samt Bar im Erdgeschoss. Verschiedene exotische Pflanzen und ein venezianischer Springbrunnen sorgen für eine entspannte Atmosphäre. Eine Erdbeere nach der anderen stopfe ich mir in den Mund, doch echte Entspannung will nicht aufkommen.
Papa?! Bist du wirklich tot? Nein, das darf nicht sein …
Ich spüre, dass da ein gigantischer See schmerzvoller Gefühle darauf wartet, über mich hinwegzubrechen, doch noch immer bin ich nicht bereit, mich der damit verbundenen Trauer zu stellen, stattdessen mauere ich noch eine weitere Betonschicht um den Damm, der diese Emotionen in Schach hält.
Wahrscheinlich produziert das unverarbeitete Trauma derartige Illusionen, dass ich glaube, meinen Vater zu sehen, versuche ich, mir meine Hirngespinste logisch zu erklären.
Da wird die Stille plötzlich von einem sanften Geräusch an der Haustür durchbrochen.
Wer ist denn das? Daniel kann doch unmöglich schon zurück von seinem Termin sein. Aber wer sonst könnte sich an der Haustür zu schaffen machen?
Stocksteif liege ich da und lausche den Schritten auf dem steinernen Boden.
Doch nicht etwa ein Einbrecher?
Bebend richte ich mich auf und schnappe mir die gläserne Obstschale, deren Inhalt ich auf der Liege entleere, da ich sonst keine geeignete Waffe in greifbarer Nähe entdecken kann.
Die fehlende Seite
Saskia, Villa, Montag, 17. August
Bewaffnet mit erhobener Obstschale schleiche ich aus dem Wintergarten und ducke mich unter den Tresen, während ich mich zwischen Bar und Ledercouch Richtung Eingangshalle bewege. Keuchend zucke ich zusammen, als dort etwas Hölzernes laut klappernd zu Boden kracht. Mein Herzschlag gerät fast völlig aus dem Takt. Mit geöffnetem Mund hechele ich nach Atemluft.
Wenn das ein Einbrecher sein sollte, dann stellt er sich aber ziemlich dämlich an. Der verursacht ja einen Höllenkrach.
Mit donnerndem Herzen drücke ich mich gegen den Rahmen, um durch den Spalt in die Vorhalle hineinzuspähen, als die Tür plötzlich aufgleitet und eine junge Frau, bewaffnet mit Wedel und dem Rohr eines Staubsaugers direkt vor mir auftaucht. Vor lauter Schreck über die unerwartete Begegnung gleitet mir die Obstschale aus den Händen. Beim nächsten Atemzug zerschellt sie auf dem Parkett. Gleichzeitig springt die Frau unter Kreischen rückwärts, wobei sie reflexartig mit dem Staubwedel nach mir schlägt wie mit einer Fliegenklatsche. Die feinen Fasern peitschen unter unangenehmem Piksen über mein Gesicht, was vor allem auf den Wunden ein fieses Brennen verursacht, sodass ich abermals geschockt tief die Luft einsauge und zurückweiche. Dabei trete ich auf die umherliegenden Scherben, welche sich stechend in meine Kuschelsocken bohren.
Keuchend atme ich tief ein und aus, bis ich endlich realisiert habe, dass es sich um keinen Einbrecher, sondern um eine Putzfrau handelt, die ich hier allerdings noch nie gesehen habe.
»Oh, sorry, tut mir leid. Wir haben uns wohl beide ziemlich erschreckt«, stammelt sie. »Besser, Sie bewegen sich nicht, bis ich die Scherben alle weggesaugt habe.«
»Ähm, ja …« Wie paralysiert stehe ich da, als sie sich nun zum Staubsauger umdreht, den sie bereits im Schlepptau hatte, um ihn einzuschalten. Während sie die groben Glasteile übereinanderstapelt, saugt sie gründlich das Parkett ab, bis sicher keine Splitter mehr übrig sind.
Nach dem Schock muss ich mich erst mal setzen, daher lasse ich mich auf der Ledercouch nieder. Nun wage ich es endlich, die Socken auszuziehen. Lediglich eine kleine rote Ritze an meiner linken Sohle zeugt von der Verletzung durch einen Glassplitter.
»Immer wieder diese Splitter!«, murmele ich frustriert.
»Ach, man sieht kaum was«, meint die Putzfrau. »Das in Ihrem Gesicht sieht viel krasser aus.«
Überrascht schaue ich zu ihr auf, um sie intensiv zu mustern, denn so offen und direkt hat bisher noch niemand darüber gesprochen. Ihr kurzes, abstehendes Haar schillert in einem sanften Violettton, welchen sie auch für die Lippen und den Rock verwendet. Der Oberkörper steckt in einer schwarzen Bluse. Aus ihren Augen funkelt mir ein äußerst lebendiges Wesen entgegen.
»Wer sind Sie eigentlich? Ich wusste gar nichts davon, dass Daniel Sie eingestellt hat, hier zu putzen.«
»Philippa Cunning. Eigentlich könnten Sie mich kennen, denn normalerweise arbeite ich in Ihrer Firma. Nachdem sich Ihre Zu-Hause-Putzfrau in Mutterschaftsurlaub verabschiedet hat, hat mich Ihr Mann beauftragt, bei ihm daheim sauberzumachen, zumindest so lange, bis Ersatz gefunden wurde.«
»Wir sind noch nicht verheiratet«, rufe ich Philippa nach, die gerade wieder in die Vorhalle verschwindet.
»Besser für Sie«, entgegnet sie geradeheraus, wobei sie mit einem Mülleimer beladen zurückkehrt.
»Wie bitte? Wieso denn das?«, platze ich empört hervor, was von dem Krachen der in den Eimer geworfenen Scherben übertönt wird. Ich knote die splitterverseuchten Socken zusammen und werfe sie ebenfalls mit in den Eimer.
»Na ja, das müssen Sie natürlich selbst wissen, aber mir wäre dieser Typ zu oberflächlich«, antwortet Philippa.
»Daniel ist doch nicht oberflächlich!«, verteidige ich ihn prompt, wobei ich mein Hirn intensiv nach Begebenheiten durchstöbere, die meine Behauptung untermauern.
»Mein Verlobter hat einmal eine Spur aus Rosenblättern von der Eingangstür bis in unser Schlafzimmer für mich gelegt, um mich dort mit einer Torte zu überraschen, in der der Verlobungsring versteckt war.«
Die Putzfrau zuckt jedoch nur gleichgültig mit den Schultern, als wäre das nichts Besonderes, daher beschließe ich, das Thema auf sich beruhen zu lassen.
»Sie arbeiten sonst bei De Winter? Sie sind mir bisher gar nicht aufgefallen«, wundere ich mich.
»Vermutlich, weil ich Ihnen als Putzfrau keine Hautcremes abkaufen kann.«
»Ganz schön frech! Wollen Sie damit etwa andeuten, ich wäre nur an Menschen interessiert, die mir finanziellen Nutzen bringen?«
»Keine Ahnung, ich kenne Sie ja kaum.«
Schnaubend atme ich tief durch. Es passt mir nicht, dass diese Person Daniel und mich offenbar für arrogant und oberflächlich hält.
»Warum arbeiten Sie überhaupt für uns, wenn Sie uns für so überheblich halten?«
»Ob Sie’s glauben oder nicht, es macht mir einfach Spaß, mit dem Staubwedel herumzuwirbeln und den Sauger durch fremde Zimmer zu ziehen.«
»Tatsächlich?«, brumme ich kopfschüttelnd. »Und was machen Sie, wenn Sie gerade mal nicht putzen?«
»Ich studiere Philosophie«, erklärt Philippa, während sie die Vase auf dem Regal anhebt, um den Staubwedel über die Oberfläche gleiten zu lassen.
»Ach wirklich?« Interessiert hebe ich die Brauen. »Was fängt man später damit an?«
»Ich studiere Philosophie, weil es mich interessiert, nicht weil ich irgendwann etwas damit anfangen möchte.«
»Ja schon, aber haben Sie denn nicht irgendwelche Pläne für die Zukunft?«
»Nö, ich mache einfach das, worauf ich gerade Lust habe. Um die Welt reisen steht dabei ganz oben auf der Liste.« Staubwedelnd arbeitet sich Philippa zur Bar hinüber.
»Hm, zugegeben, so in den Tag hineinzuleben hat schon was. Bei mir war von Anfang an irgendwie alles durchgeplant. Von außen betrachtet sieht mein Leben zwar perfekt aus, aber ich hatte es nie leicht, mich unter den Mitarbeitern zu behaupten, weil mir hintenherum oft unterstellt wurde, dass ich als Tochter des Chefs automatisch bevorzugt werde«, rechtfertige ich mich für eine Kritik, die gar nicht stattgefunden hat. Im nächsten Moment ist es mir schon wieder peinlich, dass ich vor dieser fremden Person so viel Privates preisgebe. »Aber was erzähle ich Ihnen das überhaupt?«
»Keine Ahnung. Ich bin ja schließlich nur die Putzfrau.« Verschmitzt lächelnd schüttelt Philippa den Kopf. »Aber machen Sie sich nichts draus, bei der Arbeit ignoriert zu werden, kommt mir meistens ganz gelegen. Ich hatte schon mal in einer Villa geputzt, wo mir der Hausherr hinterhergelaufen ist, um auf jedes Stäubchen hinzuweisen, das entfernt werden muss. Da war ich schneller wieder draußen, als er Staub sagen konnte. Bei Ihnen habe ich normalerweise meine Ruhe – wenn Sie nicht gerade nach einem Unfall zu Hause herumhängen.«
»Also, es tut mir wirklich leid, dass ich mich nicht mehr an Sie erinnert habe. Wir beschäftigen eben recht viele Mitarbeiter und vor allem diejenigen im Reinigungsteam wechseln häufig. Sind Sie eigentlich immer so gnadenlos ehrlich?«
»Ich kann auch schweigen«, versichert Philippa. »Ansonsten kriegen sie von mir nur ehrliche Antworten.«
»Hm, das ist ja auch was wert«, muss ich zugeben und irgendwie fasziniert mich die junge Frau mit den violetten Haaren. Sie ist so erfrischend anders und es fühlt sich an, als ob durch sie etwas Festgefahrenes in mir in Bewegung käme. Dennoch strengt mich das Gespräch allmählich an, denn mal wieder versuchen sich mir so einige belastende Erinnerungen aufzudrängen.
»Nun, dann will ich Sie mal nicht länger vom Wedel-Vergnügen abhalten.« Ohne die Kuschelsocken tapse ich barfuß bis ins Schlafzimmer hinauf, um wieder in Jeans samt Bluse zu schlüpfen. Danach untersuche ich den Inhalt meiner Handtasche und ziehe Handy und Timer hervor. Das Mobiltelefon lässt sich nicht mehr einschalten, deshalb hänge ich es erst einmal an ein Ladekabel. Schließlich blättere ich im Herzstück meines Lebens: In meinem Timer halte ich für jeden Tag akribisch alle relevanten Vertriebsdaten und Termine fest.
Vor dem Unfall wäre es undenkbar gewesen, ohne dieses Buch auszukommen, ein Zeugnis aller Ereignisse, die keinesfalls vergessen werden dürfen. Natürlich hatte ich in den letzten drei Tagen nichts hineingeschrieben. Lediglich die geplanten Geschäftstermine hatte ich dort vermerkt, welche nun wegen des Unfalls entweder gar nicht oder ohne mich stattgefunden haben.
Als ich mir die Einträge vom 14. August, ansehen will, halte ich verdutzt inne, denn diese Seite ist komplett leer. Eigentlich müsste es hier zumindest einen Vermerk des Termins geben, den ich mit meinem Vater zusammen wahrnehmen wollte.
Seltsam …
Auch beim 15. August auf der Rückseite des Blattes herrscht blanke Leere. Selbst die kleinen, mit einem Minenbleistift geschriebenen Zahlen, welche den weiblichen Zyklus markieren, sind bei diesen beiden Tagen nirgends zu finden. Irritiert blättere ich vor und wieder zurück. Die Seite kann ich bei der Nummerierung wohl kaum versehentlich übersprungen haben, denn auf die Zahl sieben folgt die Zehn. Zwar erinnere ich mich nicht mehr genau daran, die Bleistiftziffern hineingeschrieben zu haben, aber es sieht mir absolut nicht ähnlich, bei einer fortlaufenden Zahlenfolge genau zwei davon einfach auszulassen.
Irgendetwas stimmt hier nicht …
Zudem kommt mir dieses eine Blatt bei genauerer Betrachtung seltsam vor, weil es beim Zuklappen des Buches circa einen Millimeter weiter als die anderen heraussteht.
Jemand muss das ursprüngliche Blatt entfernt und durch ein Neues ersetzt haben! Aber warum? Was habe ich hier vermerkt, an das ich mich nicht erinnern soll? Und weshalb ist meine Erinnerung rund um den Unfall überhaupt so getrübt?
Hitze wallt abwechselnd mit Kälteschauern durch meinen Leib.
Wirkte Daniel im Krankenhaus nicht ziemlich nervös, als ich von meiner wiederkehrenden Erinnerung erzählte? Hat er etwas damit zu tun?
Das läge zumindest nahe, da er meinen Timer ja bei sich führte, andererseits kann ich mir das nicht vorstellen.
Weshalb sollte mein Verlobter so etwas tun? Was hätte er zu verbergen?
Wie immer steckte der Timer auch während des Unfalls in meiner Handtasche. Theoretisch hätten nach der Bergung auch andere Personen Zugriff darauf gehabt.
Wenn Daniel zurückkehrt, muss ich ihn unbedingt fragen, was genau am 14. August passiert ist.
So lange möchte ich nun aber nicht zu Hause ausharren und es wird allmählich Zeit, mich der Welt da draußen zu stellen.