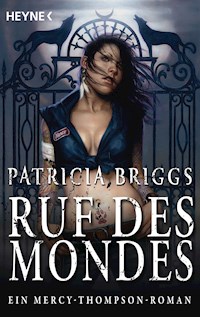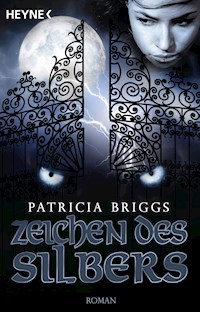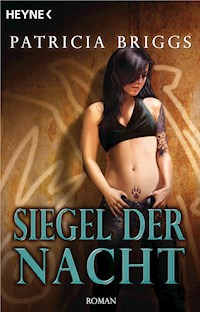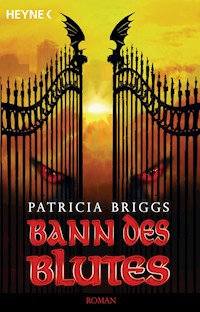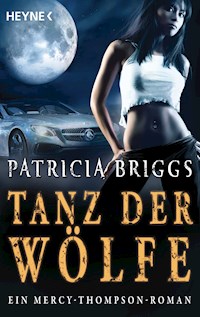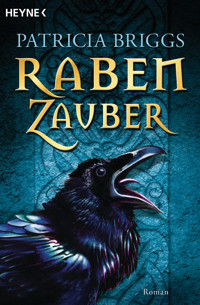9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Mercy-Thompson-Reihe
- Sprache: Deutsch
Jahrhundertelang lebten die Fae in Annwnn, doch dann verschloss die Anderwelt ihre Pforten, und die Fae mussten fliehen. Ihre prächtigen Schlösser ließen sie zurück. Ebenso wie ihre magischen Artefakte. Und ihre Gefangenen, finstere Kreaturen, die seither eine Spur der Verwüstung in Annwnn hinterlassen. Nun ist das tückischste dieser Geschöpfe aus der Anderwelt entkommen und streift ungehindert durch die Tri-Cities. Es kann jede nur erdenkliche Gestalt annehmen und die Gedanken seiner Opfer kontrollieren. Für Mercy Thompson ist klar, dass sie dieses Monster aufhalten muss – um jeden Preis ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 521
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Das Buch
Jahrhundertelang lebten die Fae in Annwnn, doch dann verschloss die Anderwelt ihre Pforten, und die Fae mussten fliehen. Ihre prächtigen Schlösser ließen sie zurück. Ebenso ihre magischen Artefakte. Und ihre Gefangenen, finstere Kreaturen, die seither eine Spur der Verwüstung in Annwnn hinterlassen. Nun ist das Tückischste dieser Geschöpfe aus der Anderwelt entkommen und streift ungehindert durch die Tri-Cities. Es kann jede nur erdenkliche Gestalt annehmen und die Gedanken seiner Opfer kontrollieren. Für Mercy Thompson ist klar, dass sie dieses Monster aufhalten muss – um jeden Preis …
Die MERCY THOMPSON-Serie
Erster Roman: Ruf des Mondes
Zweiter Roman: Bann des Blutes
Dritter Roman: Spur der Nacht
Vierter Roman: Zeit der Jäger
Fünfter Roman: Zeichen des Silbers
Sechster Roman: Siegel der Nacht
Siebter Roman: Tanz der Wölfe
Achter Roman: Gefährtin der Dunkelheit
Neunter Roman: Spur des Feuers
Zehnter Roman: Stille der Nacht
Elfter Roman: Ruf des Sturms
Storyband: Jäger im Schatten
Zwölfter Roman: Feuerkuss
Die ALPHA & OMEGA-Serie
Erster Roman: Schatten des Wolfes
Zweiter Roman: Spiel der Wölfe
Dritter Roman: Fluch des Wolfes
Vierter Roman: Im Bann der Wölfe
Die Autorin
Patricia Briggs, Jahrgang 1965, wuchs in Montana auf und interessiert sich seit ihrer Kindheit für Phantastisches. So studierte sie neben Geschichte auch Deutsch, denn ihre große Liebe gilt Burgen und Märchen. Neben erfolgreichen und preisgekrönten Fantasy-Romanen wie Drachenzauber und Rabenzauber widmet sie sich ihrer Mystery-Saga um Mercy Thompson. Nach mehreren Umzügen lebt die Bestsellerautorin mit ihrer Familie in Washington State.
PATRICIA BRIGGS
Ein Mercy-Thompson-Roman
Deutsche Erstausgabe
WILHELM HEYNE VERLAGMÜNCHEN
Titel der amerikanischen Originalausgabe: SMOKE BITTENDeutsche Übersetzung von Antonia Zauner
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Redaktion: Anita Hirtreiter
Copyright © 2020 by Hurog, Inc.
Copyright © 2021 der deutschsprachigen Ausgabe und der Übersetzungby Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: Animagic, Bielefeld
Karte: Michael Enzweiler
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-26542-7V003
www.heyne.de
Für Clyde, der leidenschaftlich Spiele spielte, sie aber nie zu ernst nahm.
Für Jean, der eine Seele von Mensch ist und ein weiches Herz hat – und Sinn für Humor.
Für Ginny, die Katzen wie Schafe hüten und sie dazu bringen kann, es zu mögen.
Für meine wunderbaren Geschwister, die mich gelehrt haben, Geschichten zu lieben. Ich danke euch.
1
Alles in Ordnung, Mercy?«, fragte Tad, während er den Scheinwerfer des 2000er-VW-Jetta, an dem wir arbeiteten, vom Kabelbaum trennte.
Wir tauschten gerade einen Kühler aus. Dafür mussten wir die ganze Front abmontieren. Die Sache eilte in mehr als einer Beziehung. Die Besitzerin des Wagens war auf dem Weg von Portland nach Missoula, Montana, gewesen, als ihr der Kühler geplatzt war. Wir mussten dafür sorgen, dass sie so bald wie möglich wieder loskonnte, damit sie es pünktlich zu ihrem Vorstellungsgespräch morgen um acht schaffte.
Die Tatsache, dass ihre drei kleinen Kinder sich aktuell in unserem Büro aufhielten, machte das Ganze nur noch dringlicher. Die Kundin hatte mir erzählt, dass sie die Kinder mitgenommen hatte, weil Verwandte von ihr in Missoula wohnten und auf sie aufpassen konnten, während es in Portland bloß ihren alkoholsüchtigen Ex gab. Ich wünschte mir, sie hätte Angehörige hier vor Ort, die babysitten könnten. Ich mochte Kinder, aber wenn sie übermüdet und eingepfercht um meinen Schreibtisch herum waren, begeisterte mich das nicht unbedingt.
Um schneller voranzukommen, arbeitete Tad an der linken und ich an der rechten Seite.
Wie ich trug er einen ölverschmierten Blaumann. Der Sommer wollte sich noch nicht ganz verabschieden, deshalb waren die Overalls zusätzlich schweißgetränkt. Selbst seinem Haar sah man an, dass er in der Hitze schuftete. Es stand in seltsamen Winkeln ab, und hier und da zierte es das gleiche Öl, das auch auf unseren Overalls verschmiert war. Eine schwarze Schliere zog sich über seinen rechten Wangenknochen bis zu seinem Ohr wie eine schlecht aufgetragene Kriegsbemalung. Ich war mir ziemlich sicher, dass ich noch schlimmer aussah als er.
Seit mehr als zehn Jahren reparierte ich nun bereits Autos mit Tad, fast sein halbes Leben lang. Zwischendurch war er einmal weg gewesen, um an einer Eliteuni zu studieren, war jedoch ohne Abschluss und ohne den fröhlichen Optimismus zurückgekehrt, der ihn früher ausgezeichnet hatte. Geblieben war allerdings sein beinahe unheimliches Geschick, das er schon hatte, als ich das erste Mal die Werkstatt seines Vaters auf der Suche nach einem Ersatzteil für meinen VW Golf betreten und Tad, der damals noch zur Schule ging, dort vorgefunden hatte, wie er den Laden schmiss.
Es gab nur wenige Menschen auf dieser Welt, denen ich so vertraute wie Tad. Und trotzdem log ich.
»Alles gut«, sagte ich.
»Lügnerin«, knurrte Zee unter einem 68er-Käfer hervor.
Der kleine Wagen hüpfte ein wenig wie ein Hund, der auf sein Herrchen reagierte. Autos tun so was manchmal, wenn sich ein eisengeküsster Fae in der Nähe befindet. Zee murmelte ein paar beruhigende Worte auf Deutsch, die ich nicht richtig verstehen konnte.
Dann wandte er sich wieder an mich: »Du solltest niemals einen Fae anlügen, Mercy. Sag lieber: ›Ihr seid nicht meine Freunde. Aus diesem Grund will ich euch meine Geheimnisse nicht anvertrauen und verrate euch auch nicht, was mich bedrückt.‹«
Das Gegrummel seines Vaters brachte Tad zum Grinsen.
»Ihr seid nicht meine Freunde. Aus diesem Grund will ich euch meine Geheimnisse nicht anvertrauen und verrate euch auch nicht, was mich bedrückt«, wiederholte ich ungerührt.
»Und das, mein lieber Vater«, sagte Tad und legte mit übertriebener Geste den Scheinwerfer zur Seite und widmete sich einer der Schrauben, die die Front hielten, »ist eine weitere Lüge.«
»Ich liebe euch beide«, versicherte ich ihnen.
»Aber mich magst du lieber«, warf Tad ein.
»Meistens mag ich euch beide«, sagte ich zu ihm, bevor ich wieder ernst wurde. »Es gibt da etwas, aber es geht um das Privatleben einer anderen Person. Sobald sich daran etwas ändert, seid ihr die Ersten, mit denen ich darüber rede. Versprochen«
Ich würde niemals mit irgendjemandem über Probleme zwischen mir und meinem Gefährten sprechen – das wäre schlicht Verrat.
Tad beugte sich herüber, legte mir einen Arm um die Schulter und küsste mich auf den Scheitel, was eine rührende Geste gewesen wäre, hätte es draußen nicht über vierzig Grad gehabt. Obwohl es in der neuen Werkstatt kühler war als in der alten, waren wir alle in Schweiß und den diversen Flüssigkeiten gebadet, die Teil des Alltags eines Automechanikers waren.
»Igitt«, quiekte ich und stieß ihn von mir. »Du bist nass, und du stinkst. Keine Küsse. Keine Berührungen. Bäh.«
Er lachte und machte sich wieder an die Arbeit, und ich folgte seinem Beispiel. Es fühlte sich gut an zu lachen. In letzter Zeit hatte ich nicht viel Grund zum Lachen gehabt.
»Und da ist er wieder«, sagte Tad und zeigte mit seiner Ratsche auf mich, »dieser traurige Gesichtsausdruck. Wenn du deine Meinung ändern solltest und doch mit jemandem reden willst, bin ich für dich da. Und falls nötig, kann ich jemanden um die Ecke bringen und die Leiche irgendwo verstecken, wo sie niemals jemand finden wird.«
»Dass ihr Kinder gleich immer aus allem ein Drama machen müsst«, murmelte der alte Fae unter dem Käfer.
»Hey«, sagte ich, »mach nur weiter so, dann sage ich dir nicht Bescheid, wenn das nächste Mal eine Horde Zombies vernichtet werden muss.«
Er gab ein dumpfes Knurren von sich, das entweder mir oder dem Käfer galt. Bei Zee wusste man nie.
»Niemand sonst wäre zu dem in der Lage gewesen, was ich getan habe«, sagte er schließlich. Es klang arrogant, aber Fae konnten nicht lügen, also war Zee überzeugt, dass es die Wahrheit war. Ich war es auch. »Du solltest froh sein, dass du mich als Freund hast, den du um Hilfe bitten kannst, wenn das Drama in deinem Leben dir mal wieder über den Kopf wächst, Liebling. Und wenn es eine Leiche gibt, dann kann ich sie so verschwinden lassen, dass nichts mehr übrig ist, was jemand finden könnte.«
Zee war ein sehr guter Freund und nicht nur hilfreich, wenn man eine Leiche verschwinden lassen musste – was er bereits getan hatte. Anders als Tad war Zee kein offizieller Mitarbeiter in der Werkstatt, die er mir verkauft hatte, nachdem er mir beigebracht hatte, wie man Autos reparierte und ein Geschäft führte. Das hieß nicht, dass er nicht bezahlt wurde, sondern lediglich, dass er kam und ging, wie es ihm passte. Oder einsprang, wenn ich ihn brauchte. Auf Zee war stets Verlass.
»Hey«, sagte Tad, »hör auf zu quatschen, und mach dich an die Arbeit, Mercy! Ich bin dir zwei Bolzen voraus – und eins der Kinder hat gerade den Mülleimer im Büro umgeworfen.«
Ich hatte es auch gehört, obwohl zwischen uns und dem Büro noch eine Tür war. Zuvor hatte ich auch schon registriert, wie die offensichtlich müde und überarbeitete Mutter versuchte, ihren Ältesten davon abzuhalten, das Lager umzusortieren. Tad mochte halb Fae sein, doch meine andere Gestalt war eine Kojotin – mein Gehör war besser als seines.
Womöglich versank mein Büro gerade im Chaos, aber es fühlte sich trotzdem gut an, den alten Wagen wieder in Ordnung zu bringen. Ich hatte allerdings keine Ahnung, wie ich meine Ehe wieder in Ordnung bringen sollte. Ich wusste nicht einmal, was genau schiefgegangen war.
»Fertig?«, fragte Tad.
Ich fing den Querträger auf, als er den letzten Bolzen herauszog. Wenigstens wusste ich, wie man einen undichten Kühler wieder in Ordnung brachte.
Nach der Arbeit hatte ich gleich noch vor Ort geduscht und frische Kleidung und saubere Schuhe angezogen. Dennoch betrat ich das Haus über die hintere Veranda durch die Küchentür, weil ich nicht riskieren wollte, dass der neue Teppich etwas von dem Dreck aus der Werkstatt abbekam.
Auf dem alten weißen Teppich hatte ich einen Zombiewerwolf ausgeweidet und im Zuge dessen endlich etwas gefunden, das Adams Reinigungsexperten nicht herausbekamen. Wir hatten den Teppich entsorgt und durch einen neuen ersetzt.
Adam hatte ihn ausgesucht. Mir war alles recht, Hauptsache nicht weiß. Er hatte sich für einen warmen Sandton entschieden, der freundlich wirkte und praktisch war. Der Teppich gefiel mir.
Einige Monate zuvor hatten wir die Fliesen in der Küche austauschen müssen. Langsam, aber sicher verwandelte sich das Haus, das ursprünglich seine Ex-Frau Christy eingerichtet hatte, in Adams und mein Zuhause. Wenn ich gewusst hätte, wie gut sich der neue Teppich anfühlen würde, dann hätte ich schon viel früher einen Zombiewerwolf zum Ausweiden aufgestöbert.
An der Tür schob ich mir die Schuhe von den Füßen, warf einen Blick in die Küche und erstarrte. Es war, als würde ich in die letzte Szene eines Theaterstücks platzen. Ich hatte keine Ahnung, was der Grund für die Spannungen im Raum war, aber ich wusste sofort, dass ich etwas Großes unterbrochen hatte.
Darryl zog meine Aufmerksamkeit als Erster auf sich, was bei dominanteren Wölfen häufiger der Fall war. Er hatte die Augen auf den Boden gerichtet, den Mund zu einem schmalen Strich zusammengepresst. In der Rangordnung unseres Rudels stand er an zweiter Stelle, und in ihm floss das Blut von Kriegern zweier Kontinente. Er musste sich anstrengen, um sympathischer auszusehen, gab sich allerdings gerade keine besondere Mühe damit. Obwohl er wusste, dass ich das Haus betreten hatte, sah er mich nicht an. Seine angespannte Körperhaltung sagte mir, dass er bereit für den Kampf war.
Auriele, seine Gefährtin, strahlte grimmigen Triumph aus – obwohl sie am Tisch auf der anderen Seite des Raums saß. Aber nicht, weil sie Angst vor ihm hatte. Darryl mochte von chinesischen und afrikanischen Kriegsfürsten abstammen (seine Schwester hatte die Geschichte ihrer Familie nachrecherchiert, hatte er mir einmal erzählt), doch Auriele sah aus wie eine Kriegsgöttin der Maya. Ich hatte die beiden einmal als unschlagbares Team gegen einen Vulkangott kämpfen sehen, und es war ein atemberaubender Anblick gewesen. Ich mochte und respektierte Auriele.
Der Grund dafür, dass Auriele sich einen Platz gesucht hatte, der so weit wie nur möglich von Darryl entfernt, aber noch immer in der Küche war, lag vermutlich darin, dass sie eine Meinungsverschiedenheit hatten. Interessanterweise würdigte auch sie mich, genau wie Darryl, keines Blickes. Dennoch konnte ich ihre Aufmerksamkeit auf mir spüren.
Die letzte Person in der Küche war Joel, das einzige Rudelmitglied außer mir, das kein Werwolf war. Er hatte sich in seiner Presa-Canario-Gestalt auf dem Boden ausgestreckt und nahm, wie er es meistens tat, den größten Teil der begehbaren Fläche ein. Das strahlende Sonnenlicht, das durch das Fenster hereinfiel, brachte das streifige Muster zum Vorschein, das sonst in seinem dunklen Fell kaum zu sehen war. Seine große Schnauze ruhte auf seinen ausgestreckten Pfoten. Er schaute mich an und dann wieder weg, ohne sich anderweitig zu bewegen.
Nein, nicht weg. Ich folgte seinem Blick und sah, dass die Tür zu Adams (selbst für Werwolfohren) schalldichtem Büro geschlossen war. Als ich die Aufmerksamkeit wieder auf die Personen im Raum richtete, fiel mein Blick auf die Tasche meiner Stieftochter, die verlassen auf der Küchenzeile lag.
»Was ist los?«, fragte ich an Auriele gerichtet.
Möglicherweise klang ich etwas schroff, aber der Anblick von Jesses Tasche, die geschlossene Tür zu Adams Büro, Darryls düstere Stimmung und Aurieles Gesichtsausdruck – all das sagte mir, dass etwas geschehen war. Die Beteiligten und mein Wissen über das, was gerade in Jesses Leben passierte, ließen mich vermuten, dass es etwas mit meiner Erzfeindin, Adams Ex-Frau und Jesses Mutter Christy, zu tun hatte.
Mein ganz persönlicher Albtraum war endlich nach Eugene, Oregon, zurückgekehrt, und mein Optimismus hatte mich dazu verleitet zu glauben, dass sie von dort aus weniger Ärger machen konnte. Aber Christy hatte einen Anspruch auf den Schutz meines Ehemannes und einen noch viel größeren Anspruch auf die Zuneigung ihrer Tochter. Solange die beiden in meinem Leben waren, würde auch sie Teil meines Lebens sein.
Wenn Christy zu einem Schlag gegen mich ausholte, dann ging das selten über ein Ärgernis hinaus. Sie war gut darin, subtile Hiebe auszuteilen, doch ich war mit Leah, der Gefährtin des Marrok, aufgewachsen, die vielleicht weniger intelligent, aber dafür gefährlicher war.
Für Adam und Jesse würde ich einen weit höheren Preis als die Differenzen mit Christy zahlen. Was allerdings nicht bedeutete, dass ich ihre Gegenwart sonderlich schätzte. Ich wurde vielleicht mit ihr fertig, doch sie verletzte Adam und Jesse immer wieder.
Auriele hob das Kinn, aber Darryl war es, der das Wort ergriff. »Meine Frau hat einen Brief geöffnet, der an jemand anderen gerichtet war«, sagte er düster.
»Das ist deine Schuld«, fauchte sie – und zwar nicht an Darryl gerichtet. »Deine Schuld. Du hast Adam, ihre Position im Rudel, das Zuhause, das sie eingerichtet hat, und trotzdem gönnst du Christy nichts.«
Ich mochte Auriele, aber umgekehrt war das nicht der Fall, denn Christy hatte eine Art an sich, die in jedem um sie herum den übermächtigen Wunsch weckte, sie zu beschützen. Christy brachte schlicht Aurieles Instinkte zum Durchdrehen.
Dennoch verstand ich nicht, was die Tatsache, dass ich und nicht Christy Adams Frau war, damit zu tun hatte, dass sie anderer Leute Post öffnete. Ich entschied, nicht genug Informationen zu haben, um irgendetwas aus ihren Anschuldigungen zu ziehen.
Also hakte ich nach: »Hast du einen Brief von Christy oder an Christy geöffnet?«
»Weder noch«, sagte Darryl und starrte seine Gefährtin an. »Sie hat einen Brief an Jesse geöffnet.«
Auriele hatte den Blick auf den Tisch gerichtet, und jetzt fiel mir der Stapel Post vor ihr auf. Obenauf lag ein weißer Umschlag, auf dem das unverkennbare Logo der Washington State University, ein Puma, zu sehen war, und plötzlich ergab alles Sinn.
Ich kniff mich in den Nasenrücken. Es war eine Geste, die Bran, der Marrok, der über alle Werwolfrudel mit Ausnahme des unseren in Nordamerika herrschte, so oft wiederholte, dass jeder, der länger Zeit mit ihm verbrachte, sie irgendwann übernahm. Da ich in seinem Rudel aufgewachsen war, hatte ich sie mir zwangsläufig angewöhnt. Sie half nicht gegen den Frust, aber ich hatte das Gefühl, dass ich mich dann besser konzentrieren konnte. Vielleicht tat Bran das deshalb so oft.
»Oh verdammt«, sagte ich. »Jesse hat mir letzte Woche gesagt, dass sie ihre Mutter anrufen will. Lasst mich raten, sie hat sich bis gestern oder heute Morgen davor gedrückt. Und Christy hat sich bei euch gemeldet. Ihr seid hergekommen, habt den Brief der WSU auf dem Tisch gefunden und …«
»Im Briefkasten«, sagte Darryl.
Ich hob die Augenbrauen, woraufhin Aurieles Kinn noch ein Stück weiter nach oben ging und ihre Schultern sich verspannten. Wenigstens schämte sie sich in ihrem Wahn, in den Christy sie getrieben hatte, für diese Aktion doch ein wenig.
»Als wir hier ankamen, war der Briefträger gerade am Gehen«, sagte sie steif. »Ich dachte, wir nehmen die Post gleich mit rein.«
»Du hast also das Schreiben im Briefkasten gefunden«, berichtigte ich mich selbst. »Und weil Christy nach den Planänderungen ihrer Tochter so ein Drama gemacht hat, musstest du ihn natürlich öffnen, um dich zu überzeugen, dass hier üble Machenschaften am Werk sind.«
Jesse war an der University of Oregon in Eugene angenommen worden, wo ihre Mom wohnte. Sie war aber auch an der University of Washington in Seattle angenommen worden, wo Gabriel, ihr fester Freund, studierte.
Beides waren gute Hochschulen, und sie hatte ihre Mutter glauben lassen, dass sie sich noch nicht entschieden hatte, wohin sie gehen wollte. Adam und ich waren uns beide sicher gewesen, dass sie Gabriel folgen würde – in diesem Alter war der feste Freund wichtiger als die Eltern. Ich verstand, warum Jesse es ihrer Mutter nicht hatte sagen wollen – dafür musste man sich nur die aktuelle Situation mit Auriele vor Augen führen. Es vor sich herzuschieben hatte jedoch lediglich zur Folge gehabt, dass der große Knall eben etwas später gekommen war.
Die jüngsten Ereignisse wirkten sich allerdings auch auf Jesses Collegepläne aus. Unser Rudel hatte sich einige neue und sehr gefährliche Feinde gemacht.
Vor einer Woche hatte Jesse mir gesagt, dass sie hierbleiben und auf die Washington State University gehen würde. Ich konnte ihre Gründe nachvollziehen. Jesse war ein praktisch denkender Mensch, und in der Regel – wenn ihre Mutter nicht im Spiel war – traf sie gute Entscheidungen. Ich hatte Jesse bloß einen einzigen Rat gegeben: dass sie es Adam und Christy so bald wie nur möglich erzählten sollte.
»Ha!«, sagte Auriele mit bitterem Triumph in der Stimme und zeigte auf mich. »Hab ich dir doch gesagt, dass es ihre Idee war.«
Ich öffnete den Mund, um etwas zu erwidern, aber in diesem Moment wurde die Tür zu Adams Büro aufgerissen, und Jesse marschierte mit geballten Fäusten und geröteten Wangen heraus. Sie blickte an mir vorbei zu Auriele, und das Gefühl des Verrats war deutlich in ihren Augen zu lesen, ehe sie um die Ecke bog und in einem Tempo die Treppen hinauflief, das man fast schon als Rennen bezeichnen konnte.
Ich wollte hinter ihr her und war gerade am Fuß der Treppe angekommen, als Adam aus seinem Büro gestürmt kam. Der zeitliche Abstand zwischen Jesses Flucht und Adams Auftauchen sagte mir, dass er versucht hatte, sie gehen zu lassen, der Wolf in ihm ihn jedoch dazu getrieben hatte, die Verfolgung aufzunehmen.
Ich drehte mich um, sodass ich zwischen ihm und der Treppe stand.
»Geh zur Seite«, sagte Adam, und seine Augen leuchteten gelb. »Mit dir werde ich später über die Sache reden.«
Ich spürte die Macht seiner Dominanz, ließ zu, dass sie wirkungslos über mich hinwegspülte. Ich bin eine Gestaltwandlerin, kein Werwolf. Adams Alphadominanz weckte in mir nicht den Wunsch, mich gehorsam mit dem Bauch auf den Boden zu kauern – sie brachte mich dazu, dass ich ihm die Zunge rausstrecken und ihm einen Klaps auf die Nase verpassen wollte. Noch vor einem Monat hätte ich das vielleicht getan.
Heute hielt ich mich zurück und beließ es bei einem simplen »Nein«.
Adam atmete tief durch und bemühte sich, seinen Wolf unter Kontrolle zu halten, und die daraus resultierende Anspannung schien ihn noch einmal gute drei Zentimeter breiter und höher werden zu lassen. Unter anderen Umständen hätte ich ein kleines Kräftemessen mit meinem Ehemann vielleicht genossen. Ich scheue einen Kampf nicht, solange niemand zu Schaden kommt.
Aber Jesse war bereits unnötig verletzt worden. Das machte mich wütend, deshalb traute ich mir selbst nicht und verzichtete lieber darauf, ihn zu provozieren. Und der Grund dafür war nicht, dass ich Adam nicht vertraute. Zumindest sagte ich mir das.
»Was willst du?«, fragte ich ihn ruhig. »Du kannst sie vielleicht so unter Druck setzen, dass sie macht, was du willst – was auch immer das ist. Möchtest du wirklich so eine Beziehung zu deiner mittlerweile erwachsenen Tochter?«
»Du solltest in Betracht ziehen, dass ich wütender auf dich bin als auf Jesse«, sagte er mit schneidender Stimme.
Das überraschte mich für einen Augenblick – und dann wurde mir klar, dass er Aurieles Theorie glaubte, ich hätte Jesses Entscheidung beeinflusst, ohne vorher mit ihm darüber geredet zu haben. Das tat weh – er sollte mich besser kennen. Aber ich unterdrückte den Schmerz, um mich später mit ihm auseinanderzusetzen. Im Moment war nur Jesse wichtig.
»Zuerst beruhigst du dich so weit, dass deine Augen nicht mehr golden sind, dann gehe ich aus dem Weg«, sagte ich zu ihm.
»Verdammte Scheiße«, knurrte er, drehte sich um und stampfte zurück in sein Büro. Er schloss die Tür so betont leise, dass er damit niemandem etwas vormachen konnte.
Adam fluchte niemals in meiner Gegenwart. Nicht, wenn er nicht dabei war, die Kontrolle zu verlieren. Ich blickte zu der Tür – nachdenklich, wie ich mir sagte. Ich war nicht wütend, es gab ohnehin schon zu viele wütende Leute im Haus. Ich war nicht verletzt, denn so etwas machte ich mit mir selbst aus und nicht vor meinen Feinden. Und Auriele sah offenbar den Feind in mir – auch das verletzte mich nicht, nicht im Geringsten. Zumindest nicht hier, wo sie mich sehen konnte.
»Vielleicht solltest du dir in Erinnerung rufen«, sagte Darryl leise zu seiner Frau, »dass Adam uns alle gewarnt hat, er würde jeden töten, der etwas gegen seine Frau, seine Gefährtin, sagt.«
Mir fuhr der Schreck in die Glieder – all der Schmerz, den ich vorgab, nicht zu fühlen, war plötzlich zweitrangig. Ja, das hatte er gesagt. Es war eine Aussage, mit der ich mich nicht ganz wohlfühlte, deshalb hatte ich sie seltsamerweise nicht mit der aktuellen Situation in Verbindung gebracht. Und er würde sein Wort nicht brechen, bloß weil er wütend auf mich war.
Auriele zu töten wäre nicht nur dumm, es würde ihn auch kaputtmachen. Und deshalb, meine lieben Kinder, ist ein Ultimatum immer eine schlechte Idee, hörte ich die Stimme des Marrok in meinem Kopf. Ich glaube, er hatte das zu einem seiner Söhne gesagt, aber es war mir immer im Gedächtnis geblieben.
Drängend fragte ich Auriele: »Hast du etwas gegen mich gesagt? Oder einfach nur wiederholt, was Christy gesagt hat?«
Sie gab keine Antwort, doch Darryl tat es für sie. »Ich glaube«, meinte er, »dass er uns eher gehen lassen würde, als einen Kampf mit mir zu riskieren. Und ich werde ihn nicht kampflos meine Gefährtin töten lassen.«
Auriele runzelte die Stirn. »Was? Warum? Jemand musste ihm sagen, was unter seinem eigenen Dach vor sich geht.« Ihrem Tonfall entnahm ich, dass sie anscheinend nicht auf den Gedanken gekommen war, das könnte eventuell ein Problem sein.
Darryl sah mich an und wandte dann den Blick ab. Er war besorgt.
»Jesse«, begann ich, unterbrach mich allerdings, weil meine Stimme etwas bebte. Kontrolle gehörte zu den Dingen, die Werwölfe respektierten. Als ich weitersprach, war meine Stimme leiser. Das war ein Trick, den ich von Adam gelernt hatte. Die Leute hörten dann aufmerksamer zu. »Jesse hat mir erzählt, dass sie sich entschieden hat, sich an der Washington State University hier in den Tri-Cities zu bewerben. Die Ereignisse der letzten Monate haben ihr klargemacht, dass sie, sollte sie woanders hingehen, eine Schwäche wäre, die die Feinde ihres Vaters gegen ihn verwenden würden.«
Ich ließ das für einen Moment in der Luft hängen. Sah zu, wie sie es sich durch den Kopf gehen ließ.
»Es gibt in Eugene kein Werwolfrudel«, sagte ich und erzählte ihnen damit etwas, das sie bereits wussten. »Jede Menge Vampire, aber kein Werwolfrudel, das wir bitten könnten, auf sie aufzupassen. Schlimmer noch, die Vampire dort sind ein chaotischer Haufen.« Der Vampir Frost hatte die Vampire in Oregon vor einigen Jahren angegriffen und kaum organisierte Strukturen zurückgelassen. Bran hatte kurzzeitig die Werwölfe aus Portland nach Eugene beordert, um sie aus Frosts direkter Schusslinie zu bringen. Als Frost aus dem Verkehr gezogen war, hatte Bran dem Rudel erlaubt, nach Portland zurückzukehren, sodass Eugene in den Händen der Vampire blieb, die Frost verschont hatte. »Diese Vampire haben meines Wissens nach kein Zentralorgan oder etwas in der Art, mit dem wir über Schutz für Jesse verhandeln könnten.«
»Das bedeutet, dass Christy sich in Gefahr befindet«, sagte Auriele mit weit aufgerissenen Augen. »Warum hast du Christy dazu gebracht zu gehen, wo du doch wusstest, dass sie nicht in Sicherheit wäre?«
»Es ist unwahrscheinlich, dass Christy zur Zielscheibe wird«, erwiderte Darryl, bevor ich es konnte. Und das war gut, denn Auriele würde ihm viel eher glauben als mir. »Wir haben doch darüber gesprochen, Auriele. Die meisten sehen in Adams Ex-Frau keine gute Geisel. Es gab niemals eine Gefährtenverbindung zwischen ihnen.«
Auriele holte tief Luft, sagte allerdings nichts. Ich wusste, dass Christy während ihrer Ehe immer unglücklich darüber gewesen war, dass zwischen Adam und ihr keine Gefährtenverbindung bestand.
Nach einer kleinen Pause sprach Darryl weiter: »Die meisten Alphas würden keine Frau beschützen, mit der sie lediglich eine vorübergehende rechtliche Vereinbarung hatten. Wenn Christy seine Gefährtin gewesen wäre«, Darryl warf mir einen Blick zu, »dann stünden die Dinge anders. Aber wenn sie seine Gefährtin gewesen wäre, dann hätte er sie erst gar nicht gehen lassen. Sie ist sehr sicher. Niemand hätte etwas davon, sie anzugreifen oder als Geisel zu nehmen. Sie brauchen nicht zu wissen, dass Christy zu verletzen oder auch nur zu erschrecken, zur Folge hätte, dass Adam und das Rudel kommen und den herumstromernden Vampiren eine Lektion erteilen würden, die sie niemals vergessen werden.«
Aurieles Gesichtsausdruck machte deutlich, dass sie ihm nicht zustimmen wollte, was Christys Sicherheit anging. Aber anscheinend hatten sie darüber schon einmal gesprochen. Auriele wusste genauso gut wie alle anderen im Raum, dass Christy sicherer war, wenn sie sich nicht in der Nähe des Rudels aufhielt, als sie es wäre, würde sie hier wohnen – es sei denn, sie würde wirklich mit dem Rudel zusammenleben. Adams Feinde würden in seinem näheren Umfeld nach einer Schwäche suchen, nicht in Eugene.
Als sich Adams Tür öffnete und mein Gefährte heraustrat, ignorierte ich ihn, auch wenn seine Bewegungen nicht mehr zornig wirkten. Ich würde ein so gut wie unlösbares Problem nach dem anderen angehen.
»Christy ist in Eugene in Sicherheit«, sagte Darryl nachdrücklich, sodass auch Adam es hören konnte, obwohl er den Blick nicht von seiner Frau abwandte. »Jesse ist Adams einziges Kind, wie jeder weiß, und das wäre etwas ganz anderes.«
»Sie hat ihre Collegepläne bereits letztes Frühjahr gemacht und sich dann beworben«, sagte ich. »Aber das war letztes Jahr, als unser Rudel noch zu den Verbündeten des Marrok gehörte und wir – Adam, Jesse und ich – übereingekommen waren, dass es nicht zu gefährlich wäre.«
Der Marrok, Bran Cornick, war eine bedeutende, mächtige Persönlichkeit in der Welt. Es brauchte schon stärkere und leichtsinnigere Kreaturen als Eugenes Vampire, um sich mit ihm anzulegen – obwohl er sich vor allem im Hinterland Montanas aufhielt. Er hatte Leute, die er schicken konnte, um für Gerechtigkeit zu sorgen oder Rache zu nehmen. Nicht nur die Werwölfe hatten Angst vor seinem Sohn Charles – oder dem Mauren – oder einer ganzen Reihe anderer gefährlicher alter Werwölfe in Brans Rudel.
Letzten Sommer hatten Adam und ich überlegt, ob wir Jesse ein oder zwei Leute aus dem Rudel mitgeben und sie dabei rotieren lassen sollten. Aber nachdem ich uns zur Zielscheibe gemacht hatte, indem ich verkündet hatte, dass wir die Tri-Cities als unser Revier erachteten und alle, die dort lebten – ob Menschen oder nicht – schützen würden, musste unser Rudel mehr auf der Hut sein. Damals war es mir als das Richtige erschienen. Doch es hatte vieles für uns verändert. Jesses relativ freie Wahl einer Universität war eines davon.
Ein paar Leute aus dem Rudel mit Jesse gehen zu lassen, um sie zu schützen, könnte bedeuten, dass wir im Notfall zwei Kämpfer weniger hatten. Und da wir nicht mehr unter dem Schutz des Marrok standen, würden wir vielleicht mehr als zwei Werwölfe brauchen, um ihre Sicherheit zu gewährleisten. Doch es brachte nichts, darüber zu diskutieren, denn Jesse würde weder nach Seattle noch nach Eugene gehen.
»Wir haben die Rückendeckung des Marrok nicht mehr«, sagte ich. »Aber möglicherweise spielt das nicht einmal eine Rolle. Die Hardesty-Hexen haben gezeigt, dass sie bereit sind, es mit dem Marrok in seinem eigenen Territorium aufzunehmen – und es sei dahingestellt, wie gut oder schlecht das für sie ausgegangen ist. Der Punkt ist, dass wir, unser Rudel, ein Ziel für diese Hexen darstellen. Mit der Zeit gelingt es uns vielleicht, sie dazu zu bringen, uns und unsere Leute zu respektieren. Aber wie sicher, denkt ihr, wird Jesse nach unserer letzten Begegnung vor ihnen sein?«
Auriele wurde blass und biss sich auf die Lippe. »An die Hexen hatte ich gar nicht gedacht.« Zum ersten Mal klang sie unsicher.
Christy hatte diese verblüffende Fähigkeit, den gesunden Menschenverstand der Leute um sie herum auszuschalten und sich in den Mittelpunkt zu rücken. Nicht, dass mich das nervte oder so.
»Jesse hat an sie gedacht«, sagte ich. »Und sie wollte ihren Vater nicht verletzen, indem sie wartete, bis er ihr sagen musste, dass sie ihrem Traum nicht folgen kann oder sich einen anderen suchen muss. Also hat sie die Sache selbst in die Hand genommen. Sie ist zu einem Beratungsgespräch bei der WSU gegangen, und obwohl die Bewerbungsfrist bereits abgelaufen war, ist es dem Berater gelungen, ihr eine Zusage zu verschaffen. Sie sagte mir, sie würde sich Sorgen machen, dass er wegen ihres Vaters seine Beziehungen hat spielen lassen.«
Die Tri-Cities behandelten Adam, als wäre er ihr persönlicher Superheld. Er reagierte auf diese Ehrungen in der Öffentlichkeit mit Würde, im Privaten mit Humor, Frustration und (hin und wieder) auch Zorn.
»Ich sagte ihr, sie solle die Vorteile, die ihr das Rudel verschafft, annehmen«, sagte ich. »Es hat sie weiß Gott schon genug gekostet.«
Sie hatte sich von ihrem festen Freund, Gabriel, getrennt.
Sie hatte zu mir gesagt, dass es eine Sache war, ihn zu bitten, ein Jahr auf sie zu warten, doch die Beziehung über die Distanz hinweg aufrechtzuerhalten war eine ganz andere. Unter Tränen erzählte sie mir, er hätte bereits eine Woche später eine neue Freundin gefunden. Er hatte gedacht, dass Jesse sie mögen würde.
Manchmal konnten sogar kluge Männer erstaunlich dumm sein.
Aber diese Geschichte musste Jesse den anderen selbst anvertrauen – und ich war mir nicht sicher, ob Auriele, die Jesses Babysitterin und so etwas wie eine Ersatztante gewesen war, noch immer das Privileg einer Vertrauensperson besaß. Nicht, nachdem sie den Brief geöffnet und sich gegen Jesse auf Christys Seite geschlagen hatte. Wäre ich etwas nachsichtiger, dann würde ich Auriele vermutlich zugestehen, dass die Dinge für sie anders lagen. Für sie stand Jesse auf Christys Seite, und ich war die böse Stiefmutter.
»Sie hat sich entschieden«, sagte Adam langsam. »Jesse hat ihre Pläne …« Er sah erst Darryl, dann Auriele und schließlich Joel an, der seinen Blick mit etwas mehr Feuer erwiderte, als noch kurz zuvor in seinen Augen gestanden hatte. »Sie hat ihre Pläne wegen des Rudels geändert.«
Das war allerdings nicht sein erster Gedanke gewesen.
Machte er sich Vorwürfe? Oder mir?
Er hatte mich nicht angesehen. Ich hatte das Rudel in eine andere Rolle gezwungen und damit die Aufmerksamkeit einiger mächtiger übler Typen erregt. So gesehen war es tatsächlich meine Schuld, dass Jesse ihre Pläne ändern musste.
Sein Tonfall war betont neutral gewesen, und unsere Gefährtenverbindung war seit Wochen stillgelegt. Ich konnte nicht sagen, was er dachte. Und im Augenblick war ich mir auch nicht sicher, ob mich das überhaupt interessierte.
Mein erster Impuls war eine bissige Antwort, etwas, das verraten würde, wie verletzt ich war, dass er sich so leicht auf Christys Version der Geschichte eingelassen hatte. Aber ich wollte ihm in diesem Moment meine Gefühle nicht anvertrauen. Also biss ich mir auf die Zunge und versuchte etwas Unvoreingenommeres zu finden, während ich den Kopf drehte und ihn ansah. Mir fiel nichts ein.
Mitten in diese angespannte Stille voller unausgesprochener Worte hinein öffnete Aiden die Hintertür.
Aiden war … ein Teil der Familie, obwohl ich nicht wirklich sagen könnte, wann das passiert war.
Als er in mein Leben getreten war, war er schmutzig und ständig in der Defensive gewesen. Außerdem schuldeten wir ihm einen Gefallen, weil er geholfen hatte, Zee und Tad zu retten.
Wenn Zee nicht gerade in der Werkstatt mit Schraubenschlüsseln hantierte, war er ein alter und mächtiger Fae, dem selbst die Grauen Lords mit Vorsicht, wenn nicht sogar Furcht begegneten. Tad, sein halbmenschlicher Sohn, besaß selbst einiges an Macht. Und Aiden, den man locker für einen Drittklässler halten konnte, solange er den Mund hielt, hatte diese beiden gerettet.
Damals hatte er ausgesehen wie der Junge, der er gewesen war, als ein Fae-Lord ihn nach Annwnn entführt hatte, einem magischen Reich, in dem die Fae regierten – oder zumindest glaubten sie das. Ich wusste nicht, ob Menschen in Annwnn einfach nicht alterten, ob dieser längst verstorbene Fae-Lord Aiden mit einem Zauber belegt hatte oder ob Annwnn selbst ihre menschlichen Besucher als Gesellschaft erhielt, nachdem sie die Fae ausgestoßen hatte, aber genau wie Peter Pan war Aiden niemals erwachsen geworden. In all den Jahrhunderten – er wusste nicht, wie viele es waren –, die er meistens allein in Annwnn gelebt hatte, einem Land voller Monster, die von den Fae eingesperrt und von Annwnn befreit worden waren, war er keinen Zentimeter gewachsen. Letzte Woche mussten wir los und ihm neue Kleidung kaufen. Er würde in einer Gruppe Drittklässler noch immer nicht auffallen, aber es sah so aus, als würde er eines Tages erwachsen werden. Etwas, das ihn ziemlich fröhlich stimmte.
Er war wahnsinnig gefährlich. Vermutlich, um ihm am Leben zu halten – und aus Gründen, die nur sie selbst kannte –, hatte Annwnn ihm die Gabe des Feuers gegeben. Aber auch wir waren gefährlich, also hatten wir ihn in unsere Familie aufgenommen und behandelten ihn meistens wie das Kind, das er zu sein schien. Er schien das tröstlich zu finden, vielleicht sogar zu genießen.
Als er jetzt das Haus betrat, hätte man ihn für ein beliebiges extrem verdrecktes Menschenkind halten können. Irgendwann schien er nass geworden zu sein und sich dann in dem Staub gewälzt zu haben, der im Spätsommer den Boden bedeckte. Mit einer seiner schmutzigen Hände umklammerte er ein ähnlich zerzaustes und verdrecktes Mädchen, das einige Zentimeter kleiner als er war.
Er hielt inne und zerrte die Kleine mit einer Verärgerung, die an Wut grenzte, halb in die Küche. Doch all das schien seine Bedeutung zu verlieren, als er sich im Raum umsah und die Emotionen mit einem Verstand las, der nicht annähernd der eines Kindes war.
»Tut mir leid«, sagte er. »Das ist ein schlechter Zeitpunkt.«
Aber das Kind, das er hinter sich hergeschleift hatte, hörte plötzlich auf, sich zu wehren, und trat einen weiteren Schritt in den Raum hinein.
»Nein«, sagte die Kleine zu ihm, »es ist ein wundervoller Zeitpunkt. Ich liebe Kämpfe. Blut und Tod und danach Tränen und Trauer.« Sie kratzte sich ihr verfilztes Haar und warf mir einen hinterhältigen Blick zu, ehe sie erfreut allen anderen ein Lächeln schenkte.
»Annwnn«, sagte Adam gefährlich ruhig, »was tust du in meinem Haus?«
Annwnn war ein uraltes magisches Land. Sie war mächtig genug, um die Fae zwischen ihren Zähnen zu zermalmen und dann wieder auszuspucken – sogar Fae, die die Macht hatten, die Flut der Meere zu rufen oder die Erde zu spalten, waren ihr gegenüber auf der Hut. Sie war launenhaft bis hin zur Bosheit und konnte sich als Mädchen in Aidens Alter manifestieren. Als Aiden noch ein Kind war und versucht hatte, in Annwnns Reich am Leben zu bleiben, hatte sie sich als weitere Überlebende ausgegeben und sich seiner kleinen Gruppe von Freunden angeschlossen. Irgendwann hatte er herausgefunden, wer und was sie war, aber sie behandelte ihn weiterhin wie einen Freund. Mir war immer noch nicht ganz klar, wie Aiden über sie dachte – und möglicherweise wusste er es selbst nicht.
Einem wütenden Werwolf gegenüberzustehen brachte sie, verständlicherweise, nicht besonders aus der Ruhe.
»Ich hörte, hier sei jeder willkommen«, sagte sie hinterlistig. »Der unsterbliche Schmied und sein Sohn, der zwar eine Missgeburt ist, aber doch Macht hat. Der Kojote und der Mann, der von einer Tibicena besessen ist.« Sie lächelte, und Grübchen zeigten sich. »Der Vampir – ihr wisst schon, der, der verrückt ist?«
Sie meinte Wulfe.
In der Nacht, in der die Hexen gestorben waren, war Wulfe verletzt worden. Nicht körperlich, sondern geistig oder spirituell oder so etwas – und es war meine Schuld. Wir hatten Wulfe mit zu uns genommen, der bewusstlos war und unverständliches Zeug brabbelte, und Ogden, das Rudelmitglied, das ihn trug, hatte Wulfe ins Haus gebracht.
Später fanden wir heraus, dass er keine Ahnung gehabt hatte, dass er einen Vampir trug. Er kannte Wulfe nicht persönlich, und irgendetwas – vermutlich die Wucht meiner Magie –, hatte seinen Geruchssinn beeinträchtigt. Aber Ogden hätte gar nicht in der Lage sein sollen, ihn ins Haus zu bringen. Bevor ein Vampir ein Haus betreten durfte, musste jemand, der dort wohnte, ihn ausdrücklich einladen. Vermutlich könnte angesichts der Bedeutung, die unser Haus für das Rudel hatte, jeder der Wölfe einen Vampir hereinbitten, doch Ogden schwor, dass er zu niemandem einen Ton gesagt hatte.
Wulfe konnte also in unserem Haus ein- und ausgehen, wie es ihm passte. Vielleicht konnte er das ja schon immer.
»Auch das ist deine Schuld«, sagte Auriele und sah mich an.
Ich habe keine Ahnung, wie sie darauf kam, außer vielleicht, dass ich es war, die Wulfe ausgeknockt hatte, sodass er überhaupt erst ins Haus getragen werden musste. Da war etwas dran, musste ich zugeben, zumindest wenn man verzweifelt nach Gründen suchte, mir die Schuld daran zu geben, dass die Sonne im Osten aufging.
Ich sah zu Auriele, dann zu Darryl. Ich sah zu Aiden und Annwnn, einem uralten Wesen, das in unserer Welt relativ wenig Macht besaß. Wie gesagt, »relativ«, denn ich war mir sicher, dass sie sich nicht viel Mühe geben müsste, unser Haus mit allen, die sich darin befanden, dem Erdboden gleichzumachen. Ich blickte zu Adam, der mich nicht ansah – meinem Gefährten, der Auriele nicht widersprochen hatte.
Und jetzt reichte es mir.
Wortlos schob ich mich an Annwnn und Aiden vorbei und durch die offene Hintertür nach draußen, wobei ich mir auf dem Weg meine Schuhe schnappte. Niemand versuchte mich aufzuhalten, und das war gut so, denn ich wusste nicht, ob ich noch eine erwachsene Reaktion zustande gebracht hätte.
Unser Garten war so gestaltet, dass dort jederzeit Rudeltreffen stattfinden konnten. Es gab kleine Picknickbereiche und Bänke und seit Neuestem auch ein riesiges Klettergerüst mit einem Piratenschiff-Ausguck ganz oben, von dem sogar eine Totenkopf-Flagge flatterte.
Wir hatten das Rudel mitsamt ihren Familien für einige Tage hier einsperren müssen und dachten uns, es wäre gut, etwas zu haben, wo die Kinder spielen konnten. Was wir nicht geahnt hatten, war, dass das ganze Rudel darauf spielen würde, aber sie liebten es.
In die Balken hatten sich Werwolfklauen eingegraben, und die Flagge hatte einen Riss an der Ecke, nachdem sich ein paar der Wölfe darum gebalgt hatten.
Ich hielt kurz inne und sah mir die andere Sache an, die neu in unserem Garten war.
In einer Ecke des Grundstücks war ein Teil einer Mauer errichtet worden, etwa zwei Meter hoch und aus Flusssteinen, die überwiegend grau und unregelmäßig waren. Sie war ohne Mörtel gebaut, die Formen der Steine griffen ineinander wie bei einem Puzzle. Die Mauer erstreckte sich von der Ecke aus etwa sechs Meter in beide Richtungen.
Etwa einen Meter von der Ecke entfernt, in der Mauer, die auf der Linie stand, die früher die Grenze zwischen meinem und Adams Haus markiert hatte, gab es eine abgenutzte Eichentür – obwohl man auch einfach ohne viel Mühe um die Mauer herumgehen konnte.
Die Mauer und die Tür darin waren noch nicht da gewesen, als ich vor nicht einmal einer Stunde von der Arbeit gekommen war.
Und jetzt war mir klar, warum Aiden so aufgebracht gewesen war, als er in die Küche kam. Annwnn hatte die Mauer gebaut, damit sie eine Tür haben konnte.
Als Aiden Annwnn verließ, vermisste sie ihn. Nach einem kleinen Ausflug in Annwnns Reich waren wir einen Pakt eingegangen. Ein paarmal im Monat eskortierten wir Aiden in das Fae-Reservat in Walla Walla, wo es viele Türen ins Land unter dem Feenhügel gab.
Und nun war da eine Tür nach Annwnn in unserem Garten.
Zu einem anderen Zeitpunkt wäre ich zurück ins Haus gerannt. Aber allein der Gedanke an all die feindseligen Blicke … an Adams feindseligen Blick … war zu viel für mich. In meinem Magen rumorte es, und mir blutete das Herz. Sollten sich doch Adam, Darryl und Auriele mit Annwnn herumschlagen.
Ich sprang über den alten Stacheldrahtzaun, der dort weiterging, wo die Mauer endete, und bahnte mir einen Weg durch Wermutkraut und Süßgräser zu meinem alten Haus – oder zumindest zu dem Haus, das dort stand, wo früher mein Zuhause gewesen war.
Ein Feldhase sprang irgendwo hervor, und mein innerer Kojote merkte auf. Etwas stimmte nicht mit dem Hasen, sonst wäre mein Kojote nicht so interessiert, obwohl ich gar keinen Hunger hatte.
Ich sah ihm hinterher. Der Rhythmus seiner Bewegungen war etwas beeinträchtigt – er hinkte nicht direkt, aber er lief merkwürdig. Doch Feldhasen waren ziemlich schnell, sogar wenn sie krank waren, deshalb war er außer Sicht, bevor ich mir darüber klar werden konnte, was mit ihm nicht stimmte.
Ich blieb bei dem alten VW Golf stehen, den ich ursprünglich hier abgestellt hatte, um Adam zu ärgern, wenn er es mal wieder zu weit trieb, damals als wir lediglich Nachbarn gewesen waren. Adam gehörte zu der Sorte Mensch, die durchs Museum ging und die Bilder geraderückte. Der alte Wagen, den ich nur noch als Ersatzteillager nutzte und dem mehrere Teile fehlten, würde ihn, so hatte ich es mir ausgerechnet, in den Wahnsinn treiben.
Ich überlegte, noch etwas anderes mit ihm zu machen – aber der Golf war Teil der spielerischen Kabbeleien zwischen Adam und mir. Ich war nicht wütend auf Adam, wir stritten nicht – vielleicht wäre ich morgen wütend, wenn mein Herz nicht mehr so wehtat. Heute war ich einfach nur verwirrt und traurig.
Ich war mir ziemlich sicher, dass es etwas mit den Hexen zu tun hatte, dass Adam sich so von mir distanzierte.
In den ersten Wochen nachdem wir die Hexen getötet hatten, schien er noch in Ordnung zu sein. Er hatte Albträume, doch die hatte ich auch.
Wann er sich entschlossen hatte, unsere Gefährtenverbindung stillzulegen, wusste ich nicht, denn zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich es anfangs gar nicht gemerkt hatte.
Ich war an meinen Gefährten gebunden, an das Rudel und an einen Vampir. Und wenn ich zu sehr an irgendjemanden von ihnen dachte, konnte ich verstehen, warum Tiere, die in einer Bärenfalle gefangen waren, sich Gliedmaßen abnagten, um freizukommen. Das Band zu Adam war dasjenige, das mir am wenigsten ausmachte. Und als diese Verbindung blockiert wurde, musste ich feststellen, dass sie … mich komplettierte.
Trotzdem hatte ich mir kaum die Mühe gemacht herauszufinden, wie sie funktionierte, das hatte ich Adam überlassen. Normalerweise gab es da nur eine kleine Öffnung in unserer Verbindung, genug, um mich wissen zu lassen, dass es Adam gut ging und er sich vergewissern konnte, dass es bei mir genauso war. Manchmal ließ er sie weit offen – normalerweise, wenn wir uns liebten, und das war gleichermaßen wundervoll und überwältigend.
Wir lebten nicht im Kopf des jeweils anderen, aber für gewöhnlich wusste ich, ob er einen guten oder einen schlechten Tag hatte, auch wenn nur starke Emotionen zu mir durchdrangen. Ich wusste, wo er war und ob er Schmerzen hatte oder nicht. Und er wusste all diese Dinge auch über mich. Doch dass er die Öffnung so klein hielt, ließ uns auch etwas Privatsphäre. Auf diese Weise, das sagte er mir, würde ich nicht versuchen, mir den Fuß abzunagen, um freizukommen.
Irgendwann nach der Sache mit den Hexen hatte er sie komplett dichtgemacht, und mir war das bis vor einigen Tagen nicht aufgefallen. Als ich es schließlich bemerkte, blickte ich zurück, und mir wurde klar, dass es Wochen her war, seit ich das letzte Mal wirklich etwas über unsere Verbindung gespürt hatte. Und so, wie es jetzt war, sagte sie mir gar nichts, außer dass er noch am Leben war.
Er hatte viele Überstunden gemacht – genau wie ich, weil meine gerade erst wieder eröffnete Werkstatt mehr Arbeit mit sich brachte als normal. Mir war es nicht seltsam vorgekommen, dass wir so wenig Zeit miteinander verbrachten, bis ich innehielt und darüber nachdachte. Er hatte viel gearbeitet, aber weiterhin für Rudelangelegenheiten und die Probleme einzelner Werwölfe ein offenes Ohr. Zeit für uns als Paar, was uns früher immer wichtig war, nahmen wir uns hingegen nicht mehr.
Ich wusste nicht, wann genau es geschehen war oder warum, doch ich war mir sicher gewesen, dass es eine Nachwirkung der Sache mit den Hexen und Elizavetas Tod war. Aber seine Reaktion heute Abend, wie bereitwillig er geglaubt hatte, dass ich Jesse dazu gedrängt hätte, ihre Pläne zu ändern, ohne ihm etwas davon zu sagen, ließ in mir den Gedanken aufkommen, dass der Grund ich sein könnte.
Hatte er schließlich genug von dem Ärger, den ich verursachte? Oder von dem ich zumindest umgeben zu sein schien?
Seit Wochen hatten wir nicht miteinander geschlafen. Mein Gefährte war kein Mann, der sich nach einem Mal umdrehte und einschlief, es sei denn, einer von uns war zu erschöpft. Und mit ihm hatte ich auch nicht das Bedürfnis, es bei einem Mal bewenden zu lassen, deshalb hatten wir in diesem Punkt gut harmoniert.
Ich beugte mich hinunter, um den alten VW liebevoll zu tätscheln, und ging dann weiter. Ich wollte nicht mehr nachdenken, und Bewegung schien mir da das Richtige zu sein. Ein besonderes Ziel hatte ich nicht, ich wollte einfach nur weg.
Ich blieb bei der Scheune stehen, die ich während des Wiederaufbaus meiner Werkstatt als zweiten Geschäftssitz verwendet hatte, und spähte hinein. Sie wirkte seltsam leer, nachdem ich die meisten Gerätschaften zurück in die Werkstatt in der Stadt gebracht hatte. Jetzt befand sich nur noch mein alter Vanagon darin.
Ich hatte eine weiße Abdeckplane ausgebreitet und den alten Van darauf abgestellt, in dem Versuch, so das Leck in den Kühlmittelleitungen zu finden, die vom Kühler im vorderen Teil des Vans bis zum fünf Meter weit entfernten Motor verliefen. Es war ein letzter verzweifelter Versuch, das Leck zu finden, bevor ich die Leitungen gänzlich entfernte und sie durch neue ersetzte. Viel Hoffnung hatte ich nicht, aber auch keine große Lust, den ganzen Van auseinanderzunehmen.
Ich schloss die Tür, ohne die Plane zu überprüfen, und ging zu dem kleinen Fertighaus, das meinen alten Wohnwagen ersetzt hatte. Der Garten war in einem besseren Zustand, als er es gewesen war, als ich noch dort gewohnt hatte. Adam hatte ein automatisches Bewässerungssystem installiert und seinen Gärtner beauftragt, sich auch um mein Grundstück zu kümmern.
Die Eiche, das Geschenk eines Eichenmannes, war dem Feuer entronnen, das mein altes Zuhause zerstört hatte. Sie war gewachsen, seit ich sie das letzte Mal bewusst angesehen hatte, und zwar viel mehr, als sie für mein Empfinden sollte – aber ich war auch keine Gärtnerin oder Botanikerin. Ihr Stamm war so dick, dass ich ihn mit beiden Händen nicht mehr umspannen konnte.
Einem Impuls folgend legte ich meine tränenfeuchte Wange an die kühle Rinde und schloss die Augen. Ich spürte nichts, doch mein Kopf musste klarer sein, ehe ich die subtile Magie spüren konnte, die dem Baum innewohnte.
»Hey«, sagte ich zu ihm, »es tut mir leid, dass ich so lange nicht mehr bei dir war.«
Er gab keine Antwort, deshalb wandte ich mich nach einem kurzen Moment dem kleinen Fertighaus zu, in dem ich nie gewohnt hatte. Mein alter Wohnwagen war verbrannt, und ich war bei Adam eingezogen. Gabriel, Jesses Ex-Freund, der früher für mich gearbeitet hatte, hatte darin gelebt, bevor er aufs College ging. Ursprünglich hatte er geplant, den ganzen Sommer dort zu wohnen, aber vor einigen Wochen war er mit seinen ganzen Sachen ausgezogen. Er sagte mir, dass er keinen Sinn darin sehe, hier Platz zu beanspruchen, wenn er eigentlich in Seattle lebte.
Mir war klar gewesen, dass da noch mehr war, etwas, das seine Augen traurig blicken ließ, und ich war mir ziemlich sicher, dass es etwas mit Jesse zu tun hatte, weil sie nicht gekommen war, um ihm beim Umzug zu helfen. Aber ich dachte mir, dass sie mir schon von selbst davon erzählen würden, wenn sie dafür bereit waren. Daher hatte es mich auch nicht überrascht, als Jesse mir erzählte, dass Gabriel und sie sich getrennt hatten, weil sie nicht zu ihm nach Seattle kommen würde.
Gabriels Schlüssel hingen an unserem Schlüsselbrett in der Küche, doch ich würde nicht zurückgehen, um sie zu holen. Der künstliche Stein lag nach wie vor neben der Treppe – an einer Seite war er etwas angekokelt, und ich nahm noch immer leicht den Geruch von Feuer wahr.
Adam wäre fast ums Leben gekommen, als er versuchte, mich zu retten. Ich war nicht zu Hause gewesen, aber er hatte gedacht, ich wäre es. Selbst ein Werwolf kann verbrennen. Als ich dort neben der Holztreppe in die Hocke ging, erinnerte ich mich an die Verbrennungen überall auf seinem Körper.
Doch ich erinnerte mich zudem an den Ausdruck in seinen Augen, als er mir, wenn auch nicht so ausführlich, gesagt hatte, dass er mir zutraute, ihn in einer Sache zu hintergehen, von der ich wusste, dass sie ihm wichtig war. Dass ich seine Tochter zu einer Entscheidung drängen würde, die den Rest ihres Lebens betraf, ohne vorher mit ihm darüber zu sprechen.
Ich schloss die Hand um den Plastikstein und fand den funkelnden neuen Schlüssel. Gabriel hatte seinen Ersatzschlüssel an den gleichen Ort getan wie ich meinen. Adam, der eine Sicherheitsfirma besaß, hätte uns beiden einen Vortrag gehalten, hätte er davon gewusst.
Ich öffnete die Tür.
Vor seinem Aufbruch hatte Gabriel das Haus gereinigt – und dann waren seine Mutter und seine Schwestern gekommen und hatten es gleich noch einmal geputzt. Zu mir sagte sie: »Gabriel ist ein guter Junge, aber es gibt keinen Mann, der ein Haus so gut putzen kann wie eine Frau.«
Und mit dieser sexistischen Aussage war sie zur Tat geschritten, um ihre Theorie zu beweisen. Das Haus roch nicht muffig wie die meisten Wohnräume, die lange leer standen, sondern sauber. Der Teppich sah aus wie neu, der Vinylboden in der Küche und in den Badezimmern war makellos.
Auf der Arbeitsfläche in der Küche lag ein weißer Umschlag, auf dem Jesse stand. Ich ließ ihn liegen. Heute hatte schon einmal jemand Jesses Post geöffnet, und ich würde das nicht wiederholen.
Das Haus war größer als mein ehemaliger Wohnwagen und auch besser gedämmt. Obwohl es ein heißer Tag gewesen und der Strom abgestellt war, war die Temperatur erträglich.
Durch ein leeres, sauberes Haus zu wandern würde mich nicht glücklicher machen. Mir kam der Gedanke, dass ich mich aus dem Kampf zurückgezogen hatte, lange bevor er zu Ende war – und das sah mir gar nicht ähnlich. Ich blickte durchs Schlafzimmerfenster hinüber zu meinem Zuhause. Meinem echten Zuhause.
Es war Zeit zurückzugehen und dafür zu kämpfen.
Ich trat aus dem Schlafzimmer – und eine Frau stand mit dem Rücken zu mir im Wohnzimmer. Ihr blondes Haar war lang und glatt. Sie trug einen dunkelblauen A-Linien-Rock und eine weiße Bluse.
»Entschuldigen Sie?«, sagte ich, während ich mich noch fragte, wie sie ins Haus gekommen war, ohne dass ich sie bemerkt hatte. Ich konnte sie jetzt riechen, ein leichter Duft, der mir bekannt vorkam.
Sie drehte sich um und sah mich an. Auch ihr Gesicht kam mir seltsam bekannt vor. Ihre Züge waren ausgeprägt – eher attraktiv als lieblich. Ein Gesicht wie gemacht für eine Charakterdarstellerin. Ein Gesicht, das man immer und überall wiedererkennen würde – nur dass mir nicht einfiel, wo ich sie schon einmal gesehen hatte. Ihre Augen waren blaugrau.
»Ich verstehe das nicht«, sagte sie. »Er liebt mich. Warum würde er so etwas tun?«
Und bei diesen Worten begann Blut aus Wunden zu fließen, die sich überall an ihrem Körper öffneten – an Schulter, Brust, Bauch, erst an einem Arm und dann am anderen –, und der Geruch von frischem Blut verteilte sich im ganzen Haus.
2
Es war ihre Stimme, die ich schließlich wiedererkannte. Sie war meine alte Nachbarin Anna Cather. Erst vorgestern hatte ich sie an der Tankstelle gesehen. Ich hatte sie eben nur deshalb nicht sofort erkannt, weil die Anna, die ich kannte, über siebzig war. Die Frau, die mich anstarrte, während das Blut zu ihren Füßen in den grauen Teppich sickerte und ihn schwarz färbte, war dagegen in ihren Zwanzigern.
Kummer überkam mich, und obwohl ich es besser wusste – gerade ich musste es besser wissen –, eilte ich an ihre Seite und streckte die Hand nach ihr aus. Ihre Schulter unter meiner Berührung war so fest wie die einer lebenden Person, fest und kalt wie Eis. Viel kälter als eine tatsächliche Leiche gewesen wäre.
Sie war tot. Meine glückliche Nachbarin, die meine Kekse so sehr mochte und mir Blumensträuße aus ihrem Garten brachte.
Die Fähigkeit, Geister zu sehen, war die andere Sache neben der Verwandlung zum Kojoten, die mich besonders machte. Ich wusste, dass ich sie, indem ich ihr Aufmerksamkeit schenkte, realer machte, ihr mehr Macht gab. Nein, nicht ihr, ihm, dem Geist – selbst wenn ich nicht mehr überzeugt war, dass Geister wirklich nichts weiter waren als leere Hüllen der Menschen, die sie einst waren. Ein leeres Ding ohne Gedanken und Gefühle. Was genau sie waren, das wusste ich nicht recht, und ich bezweifelte, dass irgendwer sonst es wusste.
Dass ich sie bewusst wahrgenommen hatte, war schlecht, sie zu berühren war noch schlechter. Wenn ich nicht wollte, dass ihr Schatten die nächsten Jahre in diesem Haus spukte, dann musste ich jetzt gehen. Aber Anna war meine Freundin – gewesen.
Statt mich also abzuwenden, ließ ich meine Hand, wo sie war. »Anna, was ist passiert?«
Tränen liefen ihr über die Wangen, während Blut aus ihrem Mundwinkel zu tropfen begann. Sie hob die Hände, um ihre Lippen zu bedecken, und schlang dann ihre blutigen Arme um ihren Körper und krümmte sich leicht, als hätte sie Bauchschmerzen. Sie blickte mich erschrocken an.
»Warum?«, fragte sie mich und klang dabei fassungslos. »Warum hat er das getan? Er ist so ein sanftmütiger Mensch – du kennst ihn ja. Selbst Spinnen trägt er aus dem Haus statt sie zu töten.«
»Und Mäuse fängt er in einer Lebendfalle«, ergänzte ich fassungslos. »Anna, willst du mir damit sagen, dass Dennis dich getötet hat?«
Dennis, Annas Ehemann, liebte sie mit seiner ganzen sanftmütigen Seele. Sie führten keine perfekte Ehe. Ich wusste, dass sie einmal im Jahr allein in den Urlaub fuhr, und nachdem er in den Ruhestand gegangen war, folgte er ihr durchs Haus wie ein treuer Hund, der bloß auf den nächsten Befehl wartete. Daraufhin hatte sie begonnen, ehrenamtlich in Krankenhäusern, Tierheimen und anderen Einrichtungen zu arbeiten, nur um aus dem Haus zu kommen. Doch sie liebte ihn, und er liebte sie – und so arrangierten sie sich miteinander.
Sie krümmte sich und sah mich an. »Warum?«, wiederholte sie. »Warum hat er es getan? Er ist so ein sanftmütiger Mensch – du kennst ihn ja. Selbst Spinnen trägt er aus dem Haus statt sie zu töten.«
Sie sprach nicht zu mir, sie war auf einer Endlosschleife.
Manchmal verhielten sich Geister mir gegenüber, als wären sie noch immer die Person, deren Schatten sie waren. Aber bloß manchmal. Manchmal waren sie in einem bestimmten Moment gefangen oder in einer Reihe von Momenten. Dass Anna sich so genau wiederholt hatte, ließ vermuten, dass sie zu dieser Sorte gehörte. Sie konnte mir keine Antworten geben.
»Anna«, sagte ich, obwohl ich wusste, dass nichts, was ich von mir gab, etwas ändern würde, »es tut mir so leid.«
Es war möglich, dass die Wunden an ihrem Körper wirklichen Wunden entsprachen – in diesem Fall hatte sie jemand (trotz ihren Worten wollte ich noch immer nicht recht an Dennis glauben) mit einer Stichwaffe attackiert. Doch Geister waren nicht an die physische Realität gebunden. Die Wunden konnten auch dafür stehen, wie sie sich fühlte, als sie starb oder wie sie über ihren Tod dachte.
Eine Neun-Millimeter durchdrang die Geräuschkulisse der frühen Abendstunden, den leisen Verkehrslärm, die zwitschernden Vögel, die bellenden Hunde. Anna und ich drehten uns beide nach ihrem Haus um, auch wenn Wiederholer in der Regel nichts außerhalb ihrer eingeschränkten Realität wahrnahmen.
Obwohl Schüsse in dieser ländlichen Gegend nicht ungewöhnlich waren, ließ mich das Knallen der Pistole mit einer schwerwiegenden Gewissheit in der Brust zurück. Mir war übel. Annas Gesicht erhellte sich mit einem erleichterten Lächeln.
»Oh«, sagte sie. »Dennis?«
Das Blut auf dem Teppich verblasste, wie auch das auf ihrem Körper. Von einem Atemzug zum nächsten waren die dunklen Flecken verschwunden, als wären sie niemals da gewesen. Nur die Tränen auf ihren Wangen waren noch da, und der Duft nach frischem Blut hing nach wie vor in der Luft.
»Dennis?«, fragte sie noch einmal, aber dieses Mal klang es wie jemand, der hörte, wie eine Tür geöffnet wurde, und der sich relativ sicher war, wer eintreten würde.
Glück vertrieb die Anspannung aus ihrem Körper. Ich trat zurück, ließ meine Hand fallen. Sie trat einen Schritt vor, nicht auf mich zu, sondern auf etwas, das ich nicht sehen konnte. Sie hob beide Hände, und ihr ganzer Körper beugte sich nach vorn, um sich an jemanden zu lehnen. Dennis, wie ich vermutete.
»Mein Liebster«, sagte sie und blickte auf – Dennis war ein ganzes Stück größer gewesen als sie.
Und dann war ich wieder allein im Wohnzimmer.
Ich verschwendete keine Zeit, sondern rannte sofort zu den Cathers. Während ich im Haus gewesen war, was nicht lange gedauert hatte, war die Dämmerung zur Nacht geworden. Die Dunkelheit störte mich jedoch nicht – wie jeder Kojote konnte ich gut im Dunkeln sehen. Sie verschaffte mir eine Tarnung, sodass niemand sehen konnte, dass ich, wenn ich mit voller Geschwindigkeit rannte, schneller war, als ich es hätte sein sollen. Die Cathers waren neben Adam meine nächsten Nachbarn, aber bis zu ihrem Haus war es trotzdem fast ein halber Kilometer.
Niemanden sonst schien der Schuss alarmiert zu haben. Doch niemand sonst hatte Annas Geist in seinem Wohnzimmer gesehen.
Als ich bei Annas und Dennis’ Garten ankam, blieb ich stehen und sah mich um. Jemand hatte hier einen Schuss abgefeuert, und auch wenn ich eine Vermutung hatte, was geschehen war, konnte ich mir nicht ganz sicher sein. Es war möglich, dass sich hier noch ein Schütze herumtrieb.
Dennis’ grauer Toyota Truck parkte neben Annas silbernem Jaguar im Carport. Alles war sauber und ordentlich, außer … ich blieb bei einem der großen Hochbeete stehen, die Dennis für Anna gebaut hatte. Auf einem der Holzbalken, die das Beet einrahmten, lag eine Schachtel mit einem neuen Sprinklerkopf. Ich sah, dass jemand ein Loch gegraben hatte – vermutlich um die Sprinkleranlage zu reparieren –, aber nicht weit gekommen war.
Beklommen stieg ich die Stufen zur Eingangstür hinauf. Das Haus der Cathers war ein Fertighaus, wie so viele andere in Finley – eine deutlich größere und eindrucksvollere Version desjenigen, das ich gerade verlassen hatte. Es war in geschmackvollem Grau und Weiß gestrichen und machte passend zu den Cathers einen sauberen und ordentlichen Eindruck. Das einzig Extravagante war die Veranda, die sich rund um das ganze Haus zog.
Ich fragte mich, ob ich auf die Polizei warten sollte – was bedeutete, dass ich sie zuerst anrufen musste –, anstatt einfach die Tür zu öffnen. Wenn ich jetzt einfach hineinging, zerstörte ich möglicherweise Beweismaterial. Aber wenn ich auf die Polizei wartete, dann würden sie zuerst hineingehen und die Geruchsmarker zerstören, die mir vielleicht sagen könnten, was passiert war.
Mir fiel auf, dass die Vordertür leicht offen stand.
So vorsichtig wie nur möglich stieß ich die Tür mit dem Fuß auf, doch sie öffnete sich nur gute dreißig Zentimeter und wurde dann von einem in Jeans gekleideten Bein auf dem Fliesenboden gestoppt. Der Geruch des Todes hüllte mich ein – zuerst Dennis, dann, ein paar Sekunden später, roch ich auch Anna.