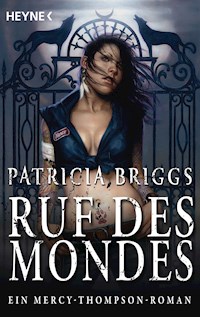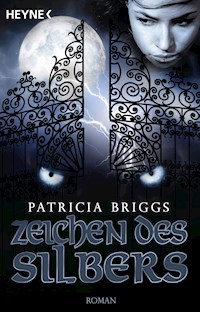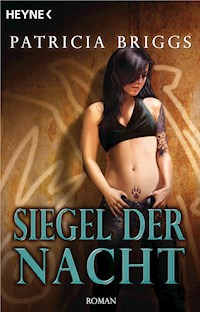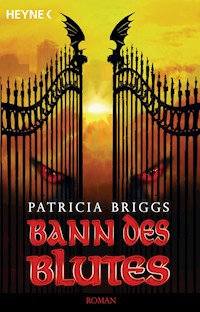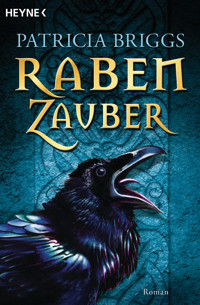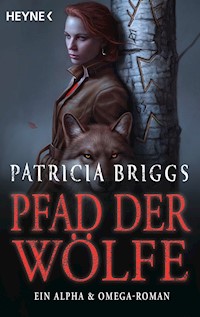9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Mercy-Thompson-Reihe
- Sprache: Deutsch
Der Mystery-Bestseller von der Autorin von „Drachenzauber“ und „Rabenzauber“: Mercy Thompson ist stolze Besitzerin einer kleinen Autowerkstatt. Und sie ist eine Walkerin – das heißt, sie verfügt über die Gabe, sich in einen Kojoten zu verwandeln. Als sie in einen mysteriösen Mordfall hineingezogen wird und auf eigene Faust ermittelt, gerät sie in tödliche Gefahr ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 493
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Das Buch
»Gestatten, mein Name ist Mercedes Thompson, und ich bin kein Werwolf. Warum mir das so wichtig ist? Nun, ich bin in einem Werwolfrudel aufgewachsen, und das ist gar nicht so leicht, wenn man selbst ein Walker ist. Werwölfe können nämlich manchmal ganz schön gefährlich sein …«
Mercy Thompson ist eine talentierte Automechanikerin mit einer Vorliebe für Junk-Food und alte Filme. Und sie kann sich in einen Kojoten verwandeln. Als es im Reservat des Feenvolks zu einer blutigen Mordserie kommt, bittet sie ihr alter Mentor Zee, ihre besonderen Fähigkeiten einzusetzen, um den Täter aufzuspüren. Sie entdeckt, dass offenbar in allen Fällen seltene und mächtige Artefakte gestohlen wurden. Doch dann gerät Zee selbst unter Verdacht, und Mercy bleibt nur wenig Zeit, um seine Unschuld zu beweisen. Und als wäre das nicht genug, fordert Adam, der attraktive Anführer des örtlichen Werwolfrudels, endlich eine Entscheidung von Mercy: Ist sie bereit, seine Gefährtin zu werden?
Die Autorin
Patricia Briggs, Jahrgang 1965, wuchs in Montana auf und interessiert sich seit ihrer Kindheit für Phantastisches. So studierte sie neben Geschichte auch Deutsch, denn ihre große Liebe gilt Burgen und Märchen. Neben erfolgreichen und preisgekrönten Fantasy-Romanen wie »Drachenzauber« und »Rabenzauber« widmet sie sich ihrer Mystery-Saga um Mercy Thompson. Nach mehreren Umzügen lebt die Autorin heute gemeinsam mit ihrem Mann, drei Kindern und zahlreichen Haustieren in Washington State.
Patricia Briggs
Spur der Nacht
Ein Mercy-Thompson-Roman
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Titel der amerikanischen Originalausgabe IRON KISSED Deutsche Übersetzung von Regina Winter
Redaktion: Natalja Schmidt
Copyright © 2008 by Patricia Briggs Copyright © 2009 der deutschsprachigen Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Covergestaltung: animagic Coverdesign: Judith Lagerman Coverillustration: Daniel Dos Santos Karte: Andreas Hancock Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
Für Collin, Sammler von allem Scharfen und Spitzen, Drachentöter
1
Ein Cowboy, ein Anwalt und eine Mechanikerin sehen sich zusammen Die Königin der Verdammten an«, murmelte ich.
Warren – der tatsächlich vor langer Zeit einmal ein Cowboy gewesen war – lachte leise und bewegte die nackten Füße. »Das klingt wie der Anfang eines sehr schlechten Witzes oder einer Horrorgeschichte.«
»Nein«, widersprach Kyle, der Anwalt, der seinen Kopf auf meinen Oberschenkel gelegt hatte. »Wenn du eine Horrorgeschichte willst, musst du mit einem Werwolf, seinem hinreißenden Geliebten und einem Walker anfangen …«
Warren, der Werwolf, lachte und schüttelte den Kopf. »Zu verwirrend. Es gibt nicht mehr viele, die sich daran erinnern, was ein Walker ist.«
Überwiegend verwechselt man uns mit Skinwalkern. Da Walker und Skinwalker beide eingeborene amerikanische Gestaltwandler sind, ist das sogar einigermaßen verständlich. Besonders, weil ich ziemlich sicher bin, dass die Bezeichnung »Walker« ohnehin auf eine dumme weiße Person zurückzuführen ist, die den Unterschied nicht kannte.
Aber ich bin kein Skinwalker. Erstens komme ich aus dem falschen Stamm. Mein Vater war ein Blackfoot, Mitglied eines Stammes in Nordmontana, und Skinwalker kommen aus den südwestlichen Stämmen und sind überwiegend Hopi oder Navajo.
Zweitens müssen Skinwalker die Haut des Tiers tragen, in das sie sich verwandeln, für gewöhnlich ein Kojote oder Wolf, aber sie können ihre Augen nicht verändern. Sie sind böse Magier, die Krankheit und Tod bringen, wohin sie auch gehen.
Wenn ich mich in einen Kojoten verwandle, sehe ich einfach aus wie jeder andere Kojote auch. Also ziemlich harmlos im Vergleich zu vielen anderen magischen Geschöpfen, die noch im Bundesstaat Washington leben. Dieser Aspekt hatte früher nicht unwesentlich dazu beigetragen, für meine Sicherheit zu sorgen. Doch im letzten Jahr hatte sich das geändert. Nicht dass ich mächtiger geworden wäre, aber ich hatte ein paar Dinge getan, die Aufmerksamkeit erregten. Und wenn den Vampiren erst klar würde, dass ich nicht nur einen, sondern sogar zwei von ihnen getötet hatte …
Als hätte ich ihn mit meinen Gedanken heraufbeschworen, tauchte ein Vampir auf dem Fernsehschirm auf – dieser Fernseher war so groß, dass er nicht einmal ins Wohnzimmer meines Trailers gepasst hätte. Der Oberkörper des Vampirs war nackt, und seine enge Hose klebte ein paar Zoll unter seinen sexy Hüften.
Es störte mich, dass ich bei diesem Anblick nur Furcht empfand und keine Begierde. Komisch, dass ich Vampire erst mehr fürchtete, nachdem ich welche getötet hatte. Ich träumte davon, dass Vampire aus Löchern im Boden krochen und mir aus den Schatten heraus Dinge zuflüsterten. Ich träumte davon, wie es sich anfühlte, wenn ein Pflock durch Fleisch drang, und von Reißzähnen, die in meinen Arm geschlagen wurden.
Wenn es Warren gewesen wäre und nicht Kyle, dessen Kopf in meinem Schoß lag, hätte er meine Reaktion gespürt. Aber Warren hatte sich auf dem Boden ausgestreckt und konzentrierte sich auf den Bildschirm.
»Hm.« Ich schmiegte mich tiefer in die unanständig bequeme Ledercouch im Fernsehzimmer im Obergeschoss von Kyles riesigem Haus und versuchte, einen lässigen Eindruck zu machen. »Ich hatte mich schon gefragt, wieso Kyle ausgerechnet diesen Film ausgesucht hat. Wer hätte gedacht, dass es in einem Film mit dem Titel Die Königin der Verdammten so viele nackte Männeroberkörper zu sehen gibt?«
Warren lachte, aß eine Handvoll Popcorn aus der Schüssel, die er auf seinem flachen Bauch balancierte, und sagte dann mit rauer Stimme und etwas mehr als einer Spur von Texas-Akzent: »Du hast mehr nackte Frauen und weniger halb bekleidete Männer erwartet, Mercy? Du solltest Kyle wirklich besser kennen.« Wieder lachte er leise und zeigte auf den Schirm. »Hey, ich hätte nicht gedacht, dass Vampire gegen die Schwerkraft immun sind. Hast du je gesehen, dass einer an der Decke baumelte?«
Ich schüttelte den Kopf und sah zu, wie der Vampir sich auf zwei seiner Groupie-Opfer fallen ließ. »Aber ich traue es ihnen durchaus zu. Ich habe auch noch nie gesehen, wie sie Leute gegessen haben. Igitt.«
»Seid still. Ich mag diesen Film.« Kyle, der Anwalt, verteidigte seine Auswahl. »Viele hübsche Jungs, die sich auf Bettlaken wälzen und in Hüfthosen und ohne Hemden rumlaufen. Ich dachte, das könnte dir ebenfalls gefallen, Mercy.«
Ich schaute hinunter zu ihm – auf jeden reizenden, sonnengebräunten Zoll – und dachte, dass er viel interessanter war als einer der hübschen Männer auf dem Bildschirm. Er war wirklich.
Dem Aussehen nach entsprach er beinahe vollkommen dem Stereotyp des Schwulen, vom Gel in seinem wöchentlich geschnittenen dunkelbraunen Haar bis zu seiner geschmackvollen, teuren Designerkleidung. Wenn die Leute nicht genauer hinschauten, entging ihnen die scharfe Intelligenz, die sich hinter diesem ansprechenden Äußeren verbarg. Was, weil er nun einmal Kyle war, einen wichtigen Grund für die Fassade darstellte.
»Dieses Machwerk ist wirklich nicht schlecht genug für einen Abend des schlechten Films«, fuhr Kyle fort und störte sich nicht daran, die Ausführungen des Leinwandvampirs damit zu unterbrechen; wir sahen uns den Streifen schließlich nicht wegen der spannenden Dialoge an. »Ich hätte ja Blade III ausgeliehen, aber seltsamerweise war der schon weg.«
»Jeder Film mit Wesley Snipes ist es wert, ihn sich anzusehen, selbst wenn man den Ton abstellen muss.« Ich drehte und wand mich, damit ich eine Handvoll Popcorn aus Warrens Schüssel greifen konnte. Er war immer noch zu dünn; das und ein Hinken erinnerten daran, dass er nur einen Monat zuvor so schwer verletzt worden war, dass ich gedacht hatte, er würde es nicht überleben. Werwölfe sind Gott sei Dank zäh, denn sonst hätten wir ihn an einen von einem Dämon besessenen Vampir verloren. Dieser Vampir war der erste gewesen, den ich getötet hatte – mit dem Wissen und der Erlaubnis der hiesigen Herrin der Vampire. Sie hatte nicht unbedingt gewollt, dass ich ihn beseitigte, aber das änderte nichts an ihrer Billigung. Sie konnte mir wegen seines Todes nichts anhaben – und noch wusste sie nicht, dass ich auch noch für einen zweiten toten Vampir verantwortlich war.
»Solange er keine Frauenkleidung trägt«, warf Warren mit seinem schleppenden Akzent ein.
Kyle schnaubte zustimmend. »Wesley Snipes mag ein wunderschöner Mann sein, aber er gibt eine verdammt hässliche Frau ab.«
»Hey«, widersprach ich und konzentrierte mich wieder auf das Gespräch. »To Wong Foo war ein verdammt guter Film.« Wir hatten ihn letzte Woche bei mir zu Hause angesehen.
Ein leises Summen erklang aus dem Erdgeschoss, Kyle rollte sich von der Couch und kam mit einer geschmeidigen, tänzelnden Bewegung auf die Beine, die Warren leider entging. Er konzentrierte sich immer noch auf den Bildschirm, obwohl sein Grinsen wahrscheinlich nicht die Reaktion war, die die Filmmacher bei der blutdürstigen Szene im Sinn gehabt hatten. Meine Gefühle lagen dem erwünschten Ergebnis viel näher. Es fiel mir nur allzu leicht, mir mich selbst als das Opfer vorzustellen.
»Die Brownies sind fertig, meine Lieben«, sagte Kyle. »Will jemand noch etwas trinken?«
»Nein danke.« Es ist nur ein Film, dachte ich, während ich den Vampir beim Bluttrinken beobachtete.
»Warren?«
Dass er seinen Namen hörte, veranlasste Warren schließlich doch noch, den Blick vom Bildschirm loszureißen. »Wasser wäre nett.«
Warren war nicht so hübsch wie Kyle, aber er hatte den Raubein-Look wirklich drauf. Er sah Kyle mit gierigem Blick hinterher, als dieser die Treppe hinunterging.
Ich lächelte in mich hinein. Es war schön zu sehen, dass Warren endlich doch glücklich war. Aber der Blick, den er mir zuwarf, als Kyle nicht mehr zu sehen war, war ernst. Er benutzte die Fernbedienung, um die Lautstärke zu erhöhen, und als damit sichergestellt war, dass Kyle uns über den Film hinweg nicht hören würde, setzte er sich und sah mich an.
»Du musst dich entscheiden«, sagte er eindringlich. »Adam oder Samuel oder keiner von beiden. Aber du kannst sie nicht ewig warten lassen.«
Adam war der Alpha des hiesigen Werwolfsrudels, und manchmal ging ich mit ihm aus. Samuel war meine erste Liebe gewesen, der erste Mann, der mir das Herz gebrochen hatte, und derzeit war er mein Mitbewohner. Nur mein Mitbewohner – obwohl er gerne mehr als das gewesen wäre.
Ich traute keinem von ihnen. Samuels scheinbare Unbeschwertheit war eine Fassade, hinter der sich ein geduldiges und gnadenloses Raubtier verbarg. Und Adam … nun, Adam machte mir ganz einfach Angst. Und ich fürchtete sehr, dass ich sie beide liebte.
»Ich weiß.«
Warren wandte den Blick ab, ein eindeutiges Zeichen, dass er nervös war. »Ich habe mir heute Früh die Zähne nicht mit Schießpulver geputzt, damit ich solche Bemerkungen einfach abfeuern kann, Mercy, aber die Situation ist wirklich ernst. Ich weiß, es ist schwierig für dich, aber wenn zwei dominante Werwölfe um die gleiche Frau werben, geht das auf die Dauer nicht ohne Blutvergießen ab. Ich kenne keine anderen Wölfe, die dir so viel Freiheit gegeben hätten, wie diese beiden, aber mindestens einer von ihnen wird bald an der Situation zerbrechen.«
Mein Handy spielte das Thema aus Hatari. Ich holte es aus der Hüfttasche und warf einen Blick auf das Display.
»Ich glaube dir«, sagte ich zu Warren. »Ich weiß nur nicht, was ich tun soll.« Samuel und ich hatten noch andere Probleme als unsterbliche Liebe, aber das ging nur ihn und mich etwas an und nicht Warren. Und Adam … zum ersten Mal fragte ich mich, ob es nicht einfacher sein würde, wenn ich einfach von hier wegzöge.
Das Telefon klingelte weiter.
»Das ist Zee«, sagte ich. »Ich sollte lieber rangehen.«
Zee war mein ehemaliger Boss und Mentor. Er hatte mir beigebracht, wie man einen Motor von Grund auf neu zusammenbaute – und er hatte mir die Gegenstände gegeben, die ich brauchte, um die Vampire umzubringen, die für Warrens Hinken und die Alpträume verantwortlich waren, die so deutliche Falten um seine Augen hinterließen. Für mich hatte Zee das Recht, unseren Videoabend zu unterbrechen.
»Denk einfach noch mal darüber nach.«
Ich lächelte dünn und klappte das Handy auf. »Hallo, Zee.«
Am anderen Ende war zunächst nichts zu hören. »Mercedes«, sagte er dann, und nicht einmal sein ausgeprägter deutscher Akzent konnte über das Zögern in seiner Stimme hinwegtäuschen. Etwas stimmte nicht.
»Was kann ich für dich tun?«, fragte ich, richtete mich auf und stellte die Füße auf den Boden. »Warren ist auch hier«, fügte ich hinzu, damit Zee wusste, dass wir Zuhörer hatten. Es war sehr schwierig, in Gegenwart eines Werwolfs ein Privatgespräch zu führen.
»Würdest du mit mir zum Reservat rausfahren?«
Theoretisch hätte es sein können, dass er vom Umatilla-Reservat sprach, das nur eine kurze Fahrt von den Tri-Cities entfernt lag. Aber es war Zee, also meinte er wahrscheinlich das Ronald-Wilson-Reagan-Feenvolk-Reservat vor Walla Walla, besser bekannt als Feenland.
»Jetzt?«, fragte ich.
Ich sah den Vampir auf dem großen Fernseher an. Sie hatten es nicht ganz richtig getroffen, hatten nicht das wahre Böse abgebildet – aber es war für mich dennoch zu nahe dran. Irgendwie tat es mir nicht besonders Leid, den Rest des Films zu verpassen – oder weitere Gespräche über mein Liebesleben.
»Nein«, knurrte Zee gereizt. »Nächste Woche. Selbstverständlich jetzt. Wo bist du? Ich werde dich abholen.«
»Weißt du, wo Kyles Haus ist?«, fragte ich.
»Kyle?«
»Warrens Freund.« Zee kannte Warren; ich hatte vergessen, dass er Kyle noch nicht begegnet war. »Wir sind in West Richland.«
»Gib mir die Adresse. Ich finde es schon.«
Zees Pickup schnurrte über den Highway, obwohl das Auto älter war als ich. Schade, dass die Sitze nicht in so guter Verfassung waren wie der Motor – ich musste zur Seite rutschen, um zu verhindern, dass sich eine Sprungfeder in mein Hinterteil bohrte.
Die Lichter am Armaturenbrett beleuchteten das zerfurchte Gesicht, das Zee der Welt gegenüber trug. Sein dünnes weißes Haar war ein wenig zerzaust, als wäre er gerade mit den Fingern hindurchgefahren.
Warren hatte nichts weiter über Adam oder Samuel gesagt, nachdem ich aufgelegt hatte, denn Gott sei Dank war Kyle mit den Brownies zurückgekommen. Nicht dass es mich störte, wenn Warren mir ein paar ungebetene Ratschläge gab – ich hatte mich oft genug in sein Liebesleben eingemischt, so dass er wirklich jedes Recht dazu hatte. Ich wollte nur einfach nicht mehr darüber nachdenken.
Zee und ich hatten den größten Teil der Fahrt von West Richland aus schweigend zurückgelegt, bis wir das andere Ende von Pasco erreichten. Ich kannte den alten Gremlin gut genug, um nicht zu versuchen, ihm etwas aus der Nase zu ziehen, also ließ ich ihn in Ruhe – zumindest nach den ersten zehn oder fünfzehn Fragen, die er nicht beantwortet hatte.
»Warst du schon mal im Reservat?«, fragte er abrupt, als wir auf dem Highway nach Walla Walla hinter Pasco den Fluss überquerten
»Nein.« Das Feenvolk-Reservat in Nevada freute sich über Besucher. Sie hatten ein Casino und einen kleinen Vergnügungspark gebaut, um Touristen anzulocken. Das Reservat bei Walla Walla hingegen ermutigte niemanden, der nicht zum Feenvolk gehörte, zu einem Besuch. Ich war nicht ganz sicher, ob die Feds oder das Feenvolk selbst für diesen unfreundlichen Ruf verantwortlich waren.
Zee trommelte unglücklich mit den Fingern auf dem Lenkrad herum – Fingern, denen man deutlich ansah, dass ihr Besitzer sein Leben mit der Reparatur von Autos verbracht hatte, zäh und vernarbt, und mit so tief sitzenden Ölflecken, dass nicht einmal Bimssteinseife sie entfernen konnte.
Es waren die richtigen Hände für den Menschen, als der Zee sich ausgab. Als die Grauen Lords, die mächtigen und unbarmherzigen Wesen, die insgeheim über das Feenvolk herrschten, ihn vor ein paar Jahren gezwungen hatten, gegenüber der Öffentlichkeit zuzugeben, was er war, hatte Zee sich nicht die Mühe gemacht, sein Äußeres zu ändern.
Ich kannte ihn ein wenig länger als zehn Jahre, und dieses mürrische Altmännergesicht war das einzige, das ich je gesehen hatte. Er hatte noch ein anderes, das wusste ich. Die meisten Angehörigen des Feenvolks, die unter Menschen lebten, benutzten einen Schutzzauber, selbst wenn sie offiziell zugaben, was sie waren. Die Menschen waren einfach nicht dazu in der Lage, mit dem wahren Aussehen des Feenvolks fertig zu werden. Sicher, einige von ihnen sahen beinahe menschlich aus, aber sie alterten nicht. Zees schütter werdendes Haar und die faltige Haut mit den Altersflecken waren deutliche Anzeichen, dass er nicht sein wahres Gesicht zeigte. Seine mürrische Miene stellte allerdings keine Verkleidung dar.
»Iss oder trink nichts, wenn wir dort sind«, sagte er plötzlich.
»Ich habe die Märchen gelesen«, erinnerte ich ihn. »Nichts essen, nichts trinken. Niemandem einen Gefallen tun. Und ich werde mich auch bei niemandem bedanken.«
Er grunzte. »Märchen. Verdammte Kindergeschichten.«
»Ich habe auch Katherine Briggs gelesen«, widersprach ich. »Und Grimms Märchen in der ursprünglichen Fassung.« Überwiegend hatte ich versucht, dort einen Angehörigen des Feenvolks zu finden, der Zee hätte sein können. Er redete nicht darüber, aber ich denke, er war einmal eine wichtige Person. Also hatte ich eine Art Hobby daraus gemacht, herausfinden zu wollen, wer er war.
»Besser. Aber nicht viel.« Er trommelte schneller. »Briggs war eine Archivarin. Ihre Bücher sind nur so korrekt wie ihre Quellen, und die sind überwiegend gefährlich unvollständig. In den Geschichten der Brüder Grimm steht mehr der Unterhaltungswert im Vordergrund als die Wirklichkeit. Sie sind beide nur Schatten …« Das Letztere sagte er auf Deutsch. »Nur Schatten der Wirklichkeit.« Dann warf er mir einen raschen, suchenden Blick zu. »Onkel Mike ist auf die Idee gekommen, dass du uns bei dieser Sache helfen könntest. Ich dachte, es wäre eine bessere Bezahlung, als du sonst erwarten könntest.«
Damit ich den Vampir töten konnte, der immer mehr von dem Dämon übernommen worden war, der ihn zu einem Zauberer gemacht hatte, war Zee bereit gewesen, sich dem Zorn der Grauen Lords auszusetzen, um mir ein paar Schätze des Feenvolks zu leihen. Ich hatte diesen Vampir tatsächlich umgebracht, und dann auch den, der ihn erschaffen hatte. Und wie in den Geschichten hat es Folgen, wenn man ein Geschenk des Feenvolks einmal zu oft benutzt.
Wenn ich gewusst hätte, dass das hier Bezahlung für die erwiesenen Gefallen sein würde, wäre ich vorsichtiger gewesen: Als ich das letzte Mal einen Gefallen erwidern wollte, war das nicht gut ausgegangen.
»Schon in Ordnung«, sagte ich trotz des Knotens in meinem Magen.
Er sah mich mürrisch an. »Ich habe nicht daran gedacht, was es bedeuten könnte, dich nach Einbruch der Dunkelheit zum Reservat zu bringen.«
»Es gibt doch auch andere, die ins Reservat gehen«, sagte ich, obwohl ich nicht wirklich sicher war, ob das stimmte.
»Nicht Leute wie du, und nach Einbruch der Dunkelheit gibt es keine Besucher.« Er schüttelte den Kopf. »Wenn ein Mensch das Reservat betritt, sieht er, was er sehen soll, besonders bei Tageslicht, wenn Menschenaugen leichter zu täuschen sind. Aber du … Die Grauen Lords haben verboten, Menschen zu jagen, aber es gibt Raubtiere unter uns, und es fällt ihnen schwer, gegen ihre Natur zu handeln. Besonders, wenn die Grauen Lords, die diese Regeln aufgestellt haben, nicht hier sind – nur ich bin hier. Und wenn du etwas siehst, was du nicht sehen solltest, wird es Leute geben, die behaupten, nur schützen zu wollen, was sie schützen sollten …«
Erst als er ins Deutsche überging erkannte ich, dass er überwiegend mit sich selbst geredet hatte. Dank Zee war mein Deutsch inzwischen besser als nach zwei Jahren auf dem College, aber nicht gut genug, um ihm noch folgen zu können, wenn er richtig loslegte.
Es war nach acht Uhr abends, doch die Sonne warf immer noch ihr warmes Licht auf die Bäume auf den Bergausläufern seitlich der Straße. Die größeren Bäume waren immer noch grün, aber einige kleinere Büsche zeigten schon ihre hinreißenden Herbstfarben.
Die einzigen Bäume der Stadt befanden sich in der Nähe der Tri-Cities, wo die Einwohner sie während der brutalen Sommer gossen, und in den Flusstälern. Aber als wir uns Walla Walla näherten, wo die Blue Mountains halfen, ein bisschen mehr Feuchtigkeit aus der Luft zu ziehen, wurde das Land langsam grüner.
»Das Schlimmste ist«, sagte Zee, der schließlich doch wieder zu Englisch überging, »dass ich nicht glaube, dass du uns wirklich etwas sagen kannst, was wir noch nicht wissen.«
»Worüber?«
Er schaute mich verlegen an, was in seinem Gesicht seltsam aussah. »Ja, ich bringe alles durcheinander. Lass mich noch mal von vorne anfangen.« Er holte tief Luft und seufzte laut. »Wir haben im Reservat unsere eigenen Gesetzeshüter – dazu haben wir das Recht. Wir üben unsere Gerechtigkeit unauffällig aus, denn die Menschenwelt ist noch nicht bereit für die Möglichkeiten, die wir dazu haben. Es ist zum Beispiel nicht so einfach, einen von uns gefangen zu halten.«
»Die Werwölfe haben das gleiche Problem«, erwiderte ich.
»Das kann ich mir vorstellen.« Er nickte, ein rasches Rucken des Kopfs. »Also. In der letzten Zeit sind im Reservat einige Leute umgekommen. Und wir glauben, dass der Mörder immer derselbe war.«
»Du gehörst zur Reservatspolizei?«, fragte ich ihn.
Er schüttelte den Kopf. »So etwas haben wir nicht. Jedenfalls nicht direkt. Aber Onkel Mike sitzt im Rat. Er dachte, deine gute Nase könnte uns helfen, und er hat mich geschickt, um dich zu holen.«
Onkel Mike betrieb eine Bar in Pasco, nur für Angehörige des Feenvolks und einige der anderen magischen Wesen, die in der Stadt lebten. Ich hatte immer gewusst, dass er über ziemliche Macht verfügte – wie sonst konnte er verbergen, dass in seiner Bar so viel Feenvolk zusammenkam? Mir war allerdings nicht klar gewesen, dass er ein Ratsmitglied war. Vielleicht hätte ich das vermutet, wenn ich gewusst hätte, dass es so etwas wie einen Rat gab.
»Könnte das nicht auch einer von euch tun?« Ich hob die Hand, um ihn davon abzuhalten, sofort zu antworten. »Es geht nicht darum, dass es mich stört. Ich kann mir erheblich schlimmere Arten vorstellen, meine Schulden zu bezahlen. Aber warum ich? Konnte Jacks Riese nicht sogar das Blut eines Engländers riechen? Was ist mit Magie? Könnte nicht einer von euch den Mörder auf magische Weise finden?«
Ich wusste nicht viel über Magie, aber ich nahm an, dass es in einem Reservat des Feenvolks jemanden gab, dessen Magie nützlicher sein würde als meine Nase.
»Vielleicht könnten die Grauen Lords Magie einsetzen, die ihnen den Schuldigen zeigt«, erwiderte Zee. »Aber wir wollen ihre Aufmerksamkeit nicht erregen – das ist zu riskant. Und andere als die Grauen Lords …« Er zuckte die Achseln. »Dieser Mörder erweist sich als erstaunlich schwer zu fassen. Was den Geruchssinn angeht, so sind viele von uns in dieser Hinsicht nicht sonderlich begabt – das war ein Talent, das überwiegend den Tierähnlichen gegeben wurde. Sobald sie zu dem Schluss kamen, dass es sicherer für uns alle wäre, uns unter die Menschen zu mischen als von ihnen getrennt zu leben, haben die Grauen Lords die meisten Tiere unter uns getötet, die die Ankunft Christi und das kalte Eisen überlebt hatten. Es gibt hier vielleicht einen oder zwei, die Leute erschnüffeln könnten, aber sie sind so machtlos, dass man ihnen nicht trauen kann.«
»Wie meinst du das?«
Er sah mich finster an. »Unsere Art ist nicht die deine. Wenn jemand keine Macht hat, um sich zu schützen, kann er es sich nicht leisten, andere gegen sich aufzubringen. Wenn der Mörder mächtig ist oder gute Beziehungen hat, würde keiner vom Feenvolk, der ihn riechen kann, es wagen, ihn zu bezichtigen.«
Er lächelte, ein säuerliches Verziehen der Lippen. »Wir können vielleicht nicht lügen … aber es gibt große Unterschiede zwischen Wahrheit und Ehrlichkeit.«
Ich war von Werwölfen aufgezogen worden, die in den meisten Fällen eine Lüge auf hundert Schritt wittern konnten. Ich wusste alles über die Unterschiede zwischen Wahrheit und Ehrlichkeit.
Etwas an dem, was er gesagt hatte … »Äh, ich bin ebenfalls nicht mächtig. Was passiert, wenn ich etwas sage, das andere gegen mich aufbringt?«
Er lächelte. »Du bist hier als mein Gast. Es wird vielleicht nicht zu verhindern sein, dass du zu viel siehst – und unsere Gesetze sind eindeutig, was Sterbliche angeht, die sich unter den Feenhügel wagen und dort mehr sehen, als sie sehen sollten. Aber dass du vom Rat eingeladen wurdest, der weiß, dass du nicht wirklich ein Mensch bist, sollte dir eine gewisse Immunität gewähren. Außerdem müssen sich alle, die sich aufregen, wenn du die Wahrheit sagst, unseren Gesetzen der Gastfreundschaft entsprechend eher an mich wenden als an dich. Und ich kann sehr gut auf mich aufpassen.«
Das glaubte ich ihm sofort. Zee bezeichnet sich selbst als Gremlin, was wahrscheinlich recht zutreffend ist – nur dass das Wort Gremlin erheblich jünger ist als Zee. Er ist einer der wenigen Angehörigen des Feenvolks, die mit Eisen umgehen können, was ihm alle möglichen Vorteile einbringt. Eisen ist für die meisten vom Feenvolk tödlich.
Es gab kein Schild an der gepflegten Seitenstraße, die vom Highway abbog. Die Straße zog sich durch kleine, bewaldete Hügel, die mich mehr an Montana erinnerten als an das unfruchtbare, von Trespe und Salbeigebüsch bedeckte Land rings um die Tri-Cities.
Wir bogen um eine Ecke, fuhren durch einen kleinen Pappelwald und erreichten dann Mauern aus zimtfarbenem Beton zu beiden Seiten der Straße, sechzehn Fuß hoch und mit Stacheldraht auf der Mauerkrone, um Besuchern noch mehr das Gefühl zu geben, dass sie hier nicht willkommen waren.
»Es sieht aus wie ein Gefängnis«, sagte ich. Die Kombination von enger Straße und hohen Mauern verursachte bei mir eine leichte Klaustrophobie.
»Ja«, stimmte Zee ein wenig verärgert zu. »Ich habe vergessen zu fragen, ob du deinen Führerschein dabeihast.«
»Ja.«
»Gut. Bitte vergiss nicht, Mercy, dass es hier im Reservat viele Geschöpfe gibt, die Menschen nicht besonders mögen – und du bist nahe genug dran, ein Mensch zu sein, dass sie dir keine Freundlichkeit entgegenbringen werden. Wenn du zu viele Grenzen überschreitest, werden sie dich schnell umbringen und es mir erst dann überlassen, Gerechtigkeit zu verlangen.«
»Ich werde aufpassen, was ich sage«, versprach ich ihm.
Er schnaubte amüsiert, auf eine Art, die alles andere als schmeichelhaft war. »Das glaube ich, wenn ich es sehe. Ich wünschte, Onkel Mike wäre ebenfalls hier. Dann würden sie es nicht wagen, dich zu belästigen.«
»Ich dachte, das hier wäre Onkel Mikes Idee gewesen.«
»Ja, aber er muss arbeiten und kann seine Bar heute Abend nicht verlassen.«
Wir waren wohl eine halbe Meile weiter gekommen, als die Straße plötzlich nach rechts abbog und ein Wachhaus und ein Tor in Sicht kamen. Zee hielt den Pickup an und rollte das Fenster herunter.
Der Wachtposten trug eine militärisch aussehende Uniform mit einem großen BFA-Zeichen auf dem Arm. Ich kannte mich mit dem BFA (Büro für Feenvolk-Angelegenheiten) nicht gut genug aus, um zu wissen, zu welchem Zweig des Militärs sie gehörten – wenn überhaupt. Der Wachtposten sah eher nach einem privaten Sicherheitsmann aus, als wäre er ein wenig fehl am Platz in der Uniform, obwohl ihm die Macht, die sie ihm verlieh, offenbar zusagte. Auf dem Abzeichen auf seiner Brust stand O’DONNELL.
Er beugte sich vor, und ich konnte Knoblauch und Schweiß wittern, wenn er auch nicht ungewaschen roch. Meine Nase ist einfach nur empfindlicher als die der meisten anderen Leute.
»Ausweis«, sagte er.
Trotz seines irischen Namens wirkte er nicht wie ein Ire, eher wie ein Italiener oder Franzose. Er hatte ausgeprägte Züge, und sein Haaransatz war schon ein wenig zurückgewichen.
Zee klappte die Brieftasche auf und reichte dem Mann seinen Führerschein. Der Wachtposten machte ein großes Theater darum, sich das Foto forschend anzusehen und dann mit Zees Gesicht zu vergleichen. Dann nickte er und knurrte: »Ihren Ausweis ebenfalls.«
Ich hatte bereits das Portemonnaie aus der Tasche geholt und reichte Zee nun meinen Führerschein, damit er ihn an den Wachtposten weitergab.
»Ihr Wohnort liegt nicht im Reservat«, sagte O’Donnell und schnippte mit dem Daumen gegen meinen Führerschein.
»Sie gehört nicht zum Feenvolk, Sir«, sagte Zee in einem unterwürfigen Ton, wie ich ihn noch nie von ihm gehört hatte.
»Ach ja? Was hat sie dann hier zu suchen?«
»Sie ist mein Gast«, erklärte Zee rasch, als wüsste er genau, dass ich dem Idioten gerade sagen wollte, das ginge ihn nichts an.
Und er war tatsächlich ein Idiot, er und wer immer sonst sich hier um die Sicherheit kümmerte. Ein Ausweis mit Foto für das Feenvolk? Das Einzige, was alle vom Feenvolk gemeinsam haben, ist die Fähigkeit, ihr Aussehen mittels eines Schutzzaubers zu verändern. Die Illusion ist so gut, dass sie nicht nur menschliche Sinne täuscht, sondern auch die physische Wirklichkeit. Deshalb kann ein 220-Kilo-Oger, der zehn Fuß groß ist, sich in Kleidergröße 36 hüllen und einen Miata fahren. Es hat mit Gestaltwandlung nichts zu tun, hat man mir erklärt. Aber es ist ähnlich genug, das ist zumindest meine Meinung.
Ich weiß nicht, welche Art von Ausweis ich für Angehörige des Feenvolks vorgeschrieben hätte, aber einer mit Foto hatte jedenfalls keinen Sinn. Selbstverständlich strengte sich das Feenvolk gewaltig an, so zu tun, als könnten sie nur eine einzige menschliche Gestalt annehmen. Vielleicht hatten sie einen Bürokraten überzeugen können, ihnen zu glauben.
»Würden Sie bitte aussteigen, Ma’am«, sagte der Idiot, kam aus seinem Wachhaus und ging um den Pickup herum, bis er sich auf meiner Seite befand.
Zee nickte. Ich stieg aus.
Der Wachtposten ging um mich herum, und ich musste mich anstrengen, ihn nicht anzuknurren. Ich mochte es nicht, wenn sich Leute, die ich nicht kannte, hinter mich bewegten. Der Mann war anscheinend nicht ganz so dumm, wie er mir auf den ersten Blick vorgekommen war, denn er bemerkte meinen Ärger offenbar und kam wieder nach vorn.
»Die da oben mögen keine zivilen Besucher, besonders nicht nach Einbruch der Dunkelheit«, sagte er zu Zee, der ausgestiegen war und sich neben mich gestellt hatte.
»Ich habe die Erlaubnis, Sir«, erwiderte Zee, immer noch in diesem irritierend unterwürfigen Tonfall.
Der Wachtposten schnaubte und ging ein paar Seiten auf seinem Klemmbrett durch, obwohl ich nicht glaubte, dass er dort tatsächlich etwas las. »Siebold Adelbertsmiter.« Er sprach es falsch aus, so amerikanisch wie möglich. »Michael McNellis und Olwen Jones.« Michael McNellis konnte Onkel Mike sein – oder auch nicht. Ich kannte niemanden beim Feenvolk, der Olwen hieß, aber ich konnte die Angehörigen des Feenvolks, deren Namen ich wusste, auch an einer Hand abzählen. Und ich würde noch Finger übrig haben. Die meisten blieben unter sich.
»Genau«, sagte Zee mit aufgesetzter Geduld, die sich aber echt anhörte; ich wusste nur deshalb, dass sie aufgesetzt war, weil Zee normalerweise keine Geduld mit Idioten hatte – und auch nicht mit anderen Leuten. »Siebold – das bin ich«. Er sprach den Namen ebenso amerikanisch aus, wie O’Donnell es getan hatte.
Der Mini-Tyrann behielt meinen Führerschein und ging wieder in sein kleines Büro. Ich blieb, wo ich war, also konnte ich nicht genau sehen, was er tat, aber ich hörte, wie jemand auf einer Computertastatur etwas tippte. Nach ein paar Minuten kehrte der Mann zurück und reichte mir meinen Führerschein.
»Machen Sie keinen Ärger, Mercedes Thompson. Das Feenland ist kein Platz für brave kleine Mädchen.«
O’Donnell hatte offenbar an dem Tag mit dem Kurs, der ihn sensiblen Umgang mit anderen lehren sollte, krankgefeiert. Normalerweise kratzten mich solche Dinge nicht, aber etwas an der Art, wie er »kleines Mädchen« sagte, ließ mich die Beleidigung zu deutlich spüren. Ich sah Zees warnenden Blick, nahm den Führerschein, steckte ihn wieder ein und versuchte, für mich zu behalten, was ich wirklich dachte.
Offenbar war meine Miene jedoch nicht ausdruckslos genug, denn der Wachmann brachte sein Gesicht ganz nah an meins. »Haben Sie mich verstanden, Kleine?«
Ich konnte den Honigschinken und den Senf des Sandwichs riechen, das er zum Abendessen gehabt hatte. Den Knoblauch hatte er wahrscheinlich am Vorabend gegessen. Vielleicht auf einer Pizza oder Nudeln.
»Verstanden«, sagte ich so neutral wie möglich, was, wie ich zugeben muss, nicht besonders überzeugend war.
Er nestelte an der Handfeuerwaffe an seiner Hüfte. Dann sah er Zee an. »Sie darf zwei Stunden bleiben. Wenn sie bis zehn nicht wieder draußen ist, kommen wir sie suchen.«
Zee neigte den Kopf, wie es Kämpfer in Karatefilmen vor Duellen taten, ohne den Blick vom Gesicht des Wachtpostens zu nehmen. Er wartete, bis O’Donnell in sein Büro zurückgekehrt war, bevor er wieder ins Auto stieg, und ich folgte seinem Beispiel.
Das Metalltor glitt mit einem Widerstreben auf, das O’Donnells Haltung zu entsprechen schien. Der Stahl, aus dem es bestand, war das erste Anzeichen von Kompetenz, das ich hier gesehen hatte. Falls es in den Mauern keine Verstärkung aus Stahl gab, würde der Beton vielleicht Leute wie mich fernhalten, aber nie genügen, um das Feenvolk einzusperren. Der Stacheldraht glänzte zu intensiv, um nicht aus Aluminium zu sein, und Aluminium stört das Feenvolk überhaupt nicht. Nach außen hin war das Reservat selbstverständlich auch eingerichtet worden, um das Feenvolk zu schützen, also sollte es nicht zählen, dass sie kommen und gehen konnten, wie sie wollten, bewachtes Tor oder nicht.
Zee fuhr durch das Tor.
Ich weiß nicht, was ich vom Reservat erwartet hatte; vielleicht militärische Kasernen oder englische Cottages. Stattdessen gab es Reihen von gepflegten einstöckigen Häusern mit angebauten Garagen für ein einzelnes Auto, Gärten von identischer Größe mit identischen Zäunen, Maschendraht vorn am Grundstück und sechs Fuß hohe Zedernbretter, die Hinterhöfe einzäunten.
Das Einzige, was die Häuser voneinander unterschied, waren die Verputzfarbe und die Pflanzen in den Vorgärten. Ich wusste, dass dieses Reservat seit den achtziger Jahren bestand, aber es sah aus, als wäre alles erst vor einem Jahr gebaut worden.
Hier und da gab es Autos, überwiegend SUVs und Pickups, aber ich sah keine Leute. Das einzige Anzeichen von Leben – außer Zees und meiner Anwesenheit – war ein großer schwarzer Hund, der uns aus dem Vorgarten eines hellgelben Hauses heraus mit intelligentem Blick beobachtete.
Der Hund machte die Vorstadtidylle ein wenig zu unheimlich.
Ich wollte gerade etwas darüber sagen, als mir klar wurde, dass meine Nase mir seltsame Dinge mitteilte.
»Wo ist das Wasser?«, fragte ich.
»Welches Wasser?« Er zog eine Braue hoch.
»Ich rieche Sumpf; Wasser, Fäulnis und Dinge, die wachsen.«
Er sah mich auf eine Weise an, die ich nicht deuten konnte. »Das habe ich Onkel Mike schon ein paarmal gesagt. Unsere Schutzzauber funktionieren gut gegenüber dem Augenlicht und dem Tastsinn, sehr gut, was Geschmackssinn und Hörvermögen angeht, aber nicht so gut beim Geruchssinn. Die meisten Menschen können allerdings nicht gut genug riechen, um etwas zu bemerken. Du hast gerochen, dass ich zum Feenvolk gehöre, sobald wir uns kennen gelernt haben.«
Tatsächlich irrte er sich. Mir waren noch keine zwei Personen begegnet, die genau gleich rochen – ich hatte angenommen, dass dieser erdige Geruch, den er und sein Sohn Tad teilten, einfach nur ihre individuelle Ausdünstung war. Erst lange Zeit später hatte ich gelernt, zwischen Feenvolk und Menschen zu unterscheiden. Wenn man nicht innerhalb einer Autostunde von einem ihrer vier Reservate lebte, waren die Chancen, einem vom Feenvolk zu begegnen, nicht sonderlich groß. Bevor ich in die Tri-Cities gezogen war und angefangen hatte, für Zee zu arbeiten, war ich nie wissentlich einem von ihnen begegnet.
»Wo ist der Sumpf also?«, fragte ich.
Er schüttelte den Kopf. »Ich hoffe, du wirst alles durchschauen können, was unser Mörder anwendet, um sich zu verbergen. Aber um deiner selbst willen, mein Schatz, hoffe ich, dass du dem Reservat seine Geheimnisse lässt.«
Er bog in eine Straße ein, die genauso aussah wie die ersten vier, an denen wir vorbeigefahren waren – nur dass hier in einem der Vorgärten ein kleines Mädchen von etwa acht oder neun Jahren mit einem Jojo spielte. Sie behielt das sich drehende, schwingende Spielzeug gut im Auge, und das änderte sich auch nicht, als Zee den Wagen vor ihrem Haus parkte. Als Zee die Gartentür öffnete, fing sie das Jojo mit einer Hand auf und sah uns aus Augen an, die zu einer Erwachsenen gehörten.
»Niemand hat das Haus betreten«, sagte sie.
Zee nickte. »Das hier ist der letzte Tatort«, sagte er. »Wir haben den Mord heute früh entdeckt. Es gibt noch sechs andere. In den anderen Häusern sind in der Zwischenzeit viele ein und aus gegangen, aber außer ihr hier« – er nickte dem Mädchen zu –, »die zum Rat gehört, und Onkel Mike ist seit dem Mord niemand in diesem Haus gewesen.«
Ich sah das Mädchen an, das angeblich zum Rat gehörte, und sie lächelte mich an und ließ ihren Kaugummi knallen.
Ich kam zu dem Schluss, dass es am sichersten wäre, sie zu ignorieren. »Du willst, dass ich versuche, ob ich riechen kann, wer in all den Häusern war?«
»Wenn das möglich ist.«
»Es gibt keine Datei, in der Gerüche aufbewahrt werden wie Fingerabdrücke. Selbst wenn ich ihn wittere, werde ich nicht sagen können, wer es ist – es sei denn, du bist es oder Onkel Mike oder unser Ratsmitglied hier.« Ich nickte zu dem Jojo-Mädchen hin.
Zee lächelte freundlos. »Wenn du einen Geruch finden kannst, der sich an jedem einzelnen Tatort befindet, werde ich dich persönlich durch das Reservat und von mir aus auch durch den gesamten Bundesstaat Washington führen, bis du diesen mörderischen Mistkerl findest.«
In diesem Augenblick wusste ich, dass die Morde für ihn etwas Persönliches waren. Zee benutzte nicht viele Schimpfworte und vor allem nicht auf Englisch. Und vor allem nicht in meiner Gegenwart.
»Dann wäre es besser, wenn ich alleine reingehe«, sagte ich. »Damit die Gerüche, die du an dir hast, nicht verfälschen, was bereits dort ist. Stört es dich, wenn ich mich im Pickup verwandle?«
»Nein, nein«, sagte er. »Mach schon.«
Ich stieg wieder in den Pickup und spürte den Blick des Mädchens im Nacken, bis ich im Auto saß. Sie sah zu unschuldig und hilflos aus, um etwas anderes zu sein als richtig fies.
Ich stieg auf der Beifahrerseite ein, um so viel Platz wie möglich zu haben, und zog mich aus. Für Werwölfe ist die Veränderung sehr schmerzhaft, besonders, wenn sie bei Vollmond zu lange damit warten und der Mond eine Verwandlung praktisch erzwingt.
Mich stört meine Veränderung überhaupt nicht – wenn überhaupt, fühlt es sich gut an, so als würde ich mich nach dem Training ausführlich strecken. Aber ich bekomme Hunger, und wenn ich zu oft die Gestalt wechsele, macht es mich müde.
Ich schloss die Augen und nahm meine Kojotengestalt an. Ich kratzte das letzte Kribbeln mit der Hinterpfote aus dem Ohr, dann sprang ich aus dem Fenster, das ich offen gelassen hatte.
Schon wenn ich ein Mensch bin, sind meine Sinne scharf. Wenn ich die Gestalt wechsle, werden sie noch ein wenig besser, aber es ist mehr als nur das. Die Kojotengestalt verarbeitet die Informationen, die meine Ohren und meine Nase mir liefern, besser, als ich es tun kann, wenn ich ein Mensch bin.
Ich fing direkt innerhalb des Tors an, den Gehweg zu beschnuppern, und versuchte, ein Gefühl für den Geruch des Hauses zu entwickeln. Als ich die Veranda erreichte, kannte ich den Geruch des männlichen Wesens (er war bestimmt kein Menschenmann, obwohl ich nicht genau feststellen konnte, was er denn nun war), das sich hier angesiedelt hatte. Ich nahm auch die Gerüche der Leute wahr, die häufiger zu Besuch gekommen waren, wie zum Beispiel das kleine Mädchen, das inzwischen wieder angefangen hatte, sein Jojo herumzuwirbeln – obwohl sie nun eher mich als ihr Spielzeug im Auge behielt.
2
Es war nicht schwer, dem durchdringenden Blutgeruch ins Wohnzimmer zu folgen, wo der Mann getötet worden war. Blut war großzügig über diverse Möbelstücke und den Teppich gespritzt, mit einem größeren Fleck an der Stelle, wo die Leiche schließlich gelegen hatte. Man hatte den Toten weggebracht, aber nicht weiter versucht, sauber zu machen.
Für meine unerfahrenen Augen sah es nicht so aus, als hätte das Opfer sich sonderlich gewehrt, denn nichts war zerbrochen oder umgeworfen. Es war mehr, als hätte der Mörder es genossen, ihn zu zerreißen.
Es war ein gewaltsamer Tod gewesen, perfekt geeignet, um einen Geist zu erzeugen.
Ich war nicht sicher, ob Zee oder Onkel Mike von der Sache mit den Geistern wussten. Dabei hatte ich nicht versucht, es zu verbergen – lange Zeit hatte ich nicht einmal erkannt, dass es nicht etwas war, was jeder tun konnte.
So hatte ich den zweiten Vampir getötet. Vampire können die Orte, an denen sie tagsüber ruhen, sehr gut verbergen, selbst vor der Nase eines Werwolfs – oder eines Kojoten. Man kann diese Schutzzauber nicht einmal mit machtvoller Magie brechen.
Aber ich kann sie dennoch aufspüren, denn die Opfer eines traumatischen Todes neigen dazu, als Geister dort zu bleiben, wo sie gestorben sind – und Vampire haben viele traumatisierte Opfer.
Deshalb gibt es auch nicht viele Walker (ich war jedenfalls nie einem begegnet) – die Vampire haben sie alle umgebracht.
Wenn der Mann, dessen Blut den Boden und die Wände überzog, einen Geist zurückgelassen hatte, hatte der jedoch nicht das Bedürfnis, sich sehen zu lassen. Noch nicht.
Ich duckte mich im Durchgang zwischen Flur und Wohnzimmer und schloss die Augen, damit ich mich besser darauf konzentrieren konnte, was ich roch. Den Geruch des Mordopfers schob ich beiseite. Wie jede Person hat auch jedes Haus seinen eigenen Geruch. Ich würde damit anfangen und mich dann zu den Gerüchen vorarbeiten, die nicht hierhergehörten. Ich identifizierte den grundlegenden Geruch des Raums, in diesem Fall überwiegend Pfeifenrauch, Holzrauch und Wolle. Die Holzrauch-Note war seltsam.
Ich öffnete die Augen wieder und sah mich noch einmal um, aber es gab keine Spur von einem offenen Kamin. Wenn der Geruch schwächer gewesen wäre, hätte ich vermutet, dass er an einem Kleidungsstück hing, aber er war durchdringend. Vielleicht hatte das Opfer Räucherwerk besessen, das wie ein Holzfeuer roch.
Da es wahrscheinlich nicht besonders hilfreich sein würde, den geheimnisvollen Grund für den Geruch nach verbranntem Holz zu finden, legte ich das Kinn wieder auf die Vorderpfoten und schloss erneut die Augen.
Sobald ich wusste, wie das Haus roch, konnte ich die Oberflächendüfte besser unterscheiden, die zu den Lebewesen gehörten, die hier ein und aus gegangen waren. Wie angenommen stellte ich fest, dass Onkel Mike hier gewesen war. Ich fand auch den Gewürzgeruch des Jojo-Mädchens, sowohl aus der letzten Zeit, als auch von früher. Sie war oft hier gewesen.
Alle Gerüche, die noch blieben, nahm ich auf, bis ich sicher war, mich wenn nötig wieder an sie erinnern zu können. Ich erinnere mich besser an Gerüche als an Gesichter. Ich mochte die Züge einer Person vergessen, aber nur selten ihren Duft – oder ihre Stimme.
Ich öffnete die Augen, um das Haus weiter zu durchsuchen … und stellte fest, dass sich alles verändert hatte.
Das Wohnzimmer war eher klein gewesen, gut aufgeräumt und ebenso langweilig wie die Fassade des Hauses. Der Raum, in dem ich nun stand, war beinahe doppelt so groß. Statt Rigips überzog nun poliertes Eichenholz die Wände, geschmückt mit kleinen, aufwändigen Wandbehängen, die einen Wald zeigten. Das Blut des Opfers, das ich zuvor auf einem haferflockenfarbenen Teppichboden gesehen hatte, überzog nun einen Flickenteppich und den glänzenden Holzboden.
An der Außenwand befand sich ein Kamin aus Flusssteinen, wo zuvor ein Fenster zur Straße gewesen war. Auf dieser Seite des Raums gab es jetzt keine Fenster mehr, aber viele auf der anderen Seite, und durch sie hindurch konnte ich einen Wald sehen, wie er im trockenen Klima von Ostwashington niemals wachsen würde. Er war viel, viel zu groß um sich in dem kleinen Hof zu befinden, der von einem Zedernzaun von sechs Fuß Höhe umgeben gewesen war.
Ich stellte die Vorderpfoten auf die Fensterbank und starrte den Wald an, und meine vorherige kindische Enttäuschung darüber, dass das Reservat nichts als eine langweilige Durchschnittssiedlung war, wich schnell dem Staunen.
Die Kojotin hätte gerne den Gerüchen nachgespürt, von denen ich genau wusste, dass sie in diesem tiefen grünen Wald lagen. Aber ich hatte zu tun. Also nahm ich die Nase vom Glas weg und sprang auf die trockenen Stellen des Bodens, bis ich wieder in den Flur kam – der noch genauso aussah wie vorher.
Es gab zwei Schlafzimmer, zwei Badezimmer und eine Küche. Meine Aufgabe wurde leichter, weil mich jetzt nur noch die frischen Gerüche interessierten, also brauchte ich nicht lange.
Als ich auf dem Weg nach draußen noch einmal ins Wohnzimmer schaute, zeigten seine Fenster immer noch einen Wald und keinen kleinen Hof. Ich sah einen Moment den Sessel an, der so gedreht war, dass man von dort den Wald sehen konnte. Ich konnte den Besitzer beinahe dort sitzen sehen, wie er die Wildnis genoss, wenn er am Kamin saß und seine Pfeife rauchte.
Aber ich sah ihn nicht wirklich. Er war kein Geist, nur etwas, was ich mir einbildete, wobei der Pfeifenrauch und der Waldgeruch halfen. Ich wusste immer noch nicht, wer oder was er gewesen war, nur, dass er sehr mächtig war. Dieses Haus würde sich lange an ihn erinnern, aber es gab keine unruhigen Geister.
Ich ging wieder durch die offene Vordertür hinaus und in die langweilige kleine Welt, die die Menschen für das Feenvolk gebaut hatten, um es von ihren Städten fernzuhalten. Ich fragte mich, wie viele dieser undurchsichtigen Zäune Wälder verbargen – oder Sümpfe – und war dankbar, dass meine Kojotengestalt mich davon abhielt, Fragen zu stellen. Ich bezweifle, dass ich die Willenskraft gehabt hätte, den Mund zu halten, und ich nahm an, dass der Wald zu den Dingen gehörte, die ich eigentlich nicht sehen sollte.
Zee öffnete die Tür des Pickups für mich, und ich sprang hinein, damit er mich zum nächsten Tatort fahren konnte. Das Mädchen blickte uns hinterher, immer noch ohne ein Wort. Ich konnte ihren Gesichtsausdruck nicht deuten.
Das zweite Haus, vor dem wir stehen blieben, sah aus wie eine detailgetreue Kopie des ersten, bis hin zur Farbe der Fensterläden. Der einzige Unterschied bestand darin, dass es hier im Vorgarten einen kleinen Fliederbusch und ein Blumenbeet gab, eins der wenigen Blumenbeete, die ich gesehen hatte, seit ich hergekommen war. Die Pflanzen waren alle eingegangen, und der Rasen war gelb und musste unbedingt gemäht werden.
Hier wartete niemand auf uns. Zee legte die Hand an die Tür, blieb aber stehen, ohne sie zu öffnen. »Das Haus, aus dem du gerade kommst, gehörte dem letzten Mordopfer. Dieses Haus hier gehörte der ersten, die getötet wurde, und ich nehme an, dass seitdem viele Leute hier gewesen sind.«
Ich setzte mich hin und sah ihm ins Gesicht: Er hatte die Person gemocht, der dieses Haus gehört hatte.
»Sie war eine Freundin«, sagte er bedächtig, und er ballte die Hand an der Tür zur Faust. »Sie hieß Connora. Sie hatte Menschenblut, wie Tad. Ihres war älter, aber es schwächte sie.« Tad war sein Sohn, ein halber Mensch, und derzeit im College. Sein Menschenblut hatte, soweit ich das sehen konnte, nicht seine Freude an Metallarbeit geschwächt, die er mit seinem Vater teilte. Ich weiß nicht, ob er die Unsterblichkeit seines Vaters geerbt hatte. Er war neunzehn, und so sah er auch aus.
»Sie war unsere Bibliothekarin und Archivarin, die Sammlerin von Geschichten. Sie kannte jedes Märchen, jede Macht, die kaltes Eisen und das Christentum uns genommen haben. Sie hasste es, schwach zu sein, und hasste und verachtete die Menschen noch mehr. Aber sie war gut zu Tad.«
Zee wandte sich ab, so dass ich sein Gesicht nicht mehr sehen konnte, und riss abrupt und zornig die Tür auf.
Wieder betrat ich das Haus allein. Selbst wenn Zee mir nicht gesagt hätte, dass Connora Bibliothekarin gewesen war, war es nicht schwer, darauf zu kommen. Überall gab es Bücherstapel. Auf Regalen, auf dem Boden, auf Stühlen und Tischen. Die meisten Bände waren nicht aus diesem Jahrhundert – und keiner der Titel, die ich sah, war in Englisch.
Wie in dem letzten Haus hing überall der Geruch nach Tod, obwohl der Mord, wie Zee schon gesagt hatte, bereits längere Zeit zurücklag. Das Haus roch überwiegend muffig, mit einer schwachen Spur von verrottenden Lebensmitteln und Putzmitteln.
Zee hatte nicht gesagt, wann sie gestorben war, aber ich ging davon aus, dass sich für einen Monat oder länger niemand mehr hier aufgehalten hatte.
Vor etwa einem Monat hatte der Dämon schon durch seine Anwesenheit alle möglichen Arten von Gewalttätigkeit bewirkt. Ich war ziemlich sicher, dass das Feenvolk ebenfalls bereits daran gedacht hatte, nahm aber an, dass sich das Reservat weit genug von den Tri-Cities entfernt befand, um diesem Einfluss entgangen zu sein. Dennoch, wenn ich schließlich meine Menschengestalt wieder annahm, würde ich Zee danach fragen.
Connoras Schlafzimmer war feminin eingerichtet, in diesem englischen Cottagestil. Der Boden bestand aus Kiefernholz oder einem anderen Weichholz, und es gab viele handgewebte kleine Teppiche. Ihre Tagesdecke bestand aus dünnem weißem Stoff mit Knoten, etwas, das ich immer mit Bed-and-Breakfasts oder Großmüttern in Verbindung gebracht habe. Was seltsam ist, da ich meine Großeltern nie kennen gelernt und auch noch nie in einem Bed-and-Breakfast übernachtet habe.
Eine tote Rose in einer kleinen Vase stand auf dem Nachttisch – und nirgendwo war ein Buch zu sehen.
Das zweite Schlafzimmer hatte sie als Büro eingerichtet. Als Zee gesagt hatte, dass sie Geschichten sammelte, hatte ich Unmengen Notizbücher und Papier erwartet, aber es gab nur einen kleinen Bücherschrank mit einem ungeöffneten Päckchen brennbarer CDs. Der Rest der Regale war leer. Jemand hatte den Computer mitgenommen, aber sie hatten ihren Drucker und den Monitor stehen lassen; vielleicht hatten sie auch das mitgenommen, was sich auf den Regalen befunden hatte.
Ich verließ das Büro und untersuchte das Haus weiter.
Die Küche war vor kurzem mit Ammoniak geputzt worden, aber im Kühlschrank faulte immer noch etwas vor sich hin. Vielleicht befand sich deshalb einer dieser widerwärtigen Lufterfrischer auf der Frühstückstheke. Ich nieste und ging. In diesem Raum würde ich nichts weiter wittern – und wenn ich es versuchte, würde ich mir die Nase nur mit künstlichem Raumduft verderben.
Ich ging durch den Rest des Hauses und kam zu dem Schluss, dass sie in der Küche gestorben war. Da die Küche eine Tür und zwei Fenster hatte, hätte der Mörder leicht eindringen und wieder gehen können, ohne woanders seinen Duft zu hinterlassen. Ich merkte mir das, sah mich aber dennoch ein zweites Mal um. Ich nahm Zees Duft wahr, und schwächer auch den von Tad. Es gab drei oder vier Leute, die hier oft vorbeigekommen waren, und ein paar weniger regelmäßige Besucher.
Falls dieses Haus ebenfalls Geheimnisse hatte, konnte ich sie nicht durchdringen.
Als ich wieder nach draußen ging, war das letzte Tageslicht beinahe verschwunden. Zee wartete auf der Veranda, die Augen geschlossen, das Gesicht leicht dem letzten, schwindenden Licht zugewandt. Ich musste kläffen, damit er mich bemerkte.
»Fertig?«, fragte er mit einer Stimme, die ein wenig dunkler und ein wenig anders war als sonst. »Da der Mord an Connora der erste war, könnten wir jetzt die Tatorte in der weiteren Reihenfolge aufsuchen«, schlug er vor.
Der zweite Tatort roch überhaupt nicht nach Tod. Wenn hier jemand gestorben war, hatte man danach so gründlich geputzt, dass ich es nicht riechen konnte – oder der Angehörige des Feenvolks, der hier gelebt hatte, war so wenig Mensch gewesen, dass sein Tod keine der vertrauten Geruchsmarken hinterließ.
Es gab jedoch ein paar Besucher, die dieses Haus mit den beiden ersten gemein hatte, und einige, deren Geruch ich nur im ersten und diesem dritten Haus fand. Ich behielt sie auf der Verdächtigenliste, denn ich hatte in der Küche von Connora, der Bibliothekarin, keine gute Witterung aufnehmen können. Und dieses Haus hier war so sauber, dass ich nicht jeden vollkommen eliminieren konnte, der nur im ersten Haus gewesen war. Es hätte geholfen, aufzuzeichnen, wo ich wen gerochen hatte, aber ich würde nie eine Möglichkeit finden, einen Geruch mit Papier und Bleistift zu beschreiben. Ich musste einfach mein Bestes tun.
Das vierte Haus, zu dem Zee mich brachte, wirkte nicht bemerkenswerter als die anderen. Ein beigefarbenes Haus mit einfallslosen weißen Zierleisten und nichts als totem und sterbendem Gras im Hof.
»Das hier ist nicht geputzt worden«, sagte er säuerlich, als er die Tür öffnete. »Nachdem wir ein drittes Opfer hatten, haben wir nicht mehr versucht, das Verbrechen vor den Menschen zu verbergen, sondern wollten vor allem herausfinden, wer der Mörder war.«
Er hatte keinen Witz gemacht, als er sagte, es sei nicht geputzt worden. Ich sprang über alte Zeitungen und verstreute Kleidung, die im Eingang liegen gelassen worden waren.
Dieses Opfer war nicht im Wohnzimmer oder in der Küche umgebracht worden, und auch nicht im großen Schlafzimmer, wo sich inzwischen eine Mäusefamilie niedergelassen hatte. Ihre Mitglieder huschten davon, als ich hereinkam.
Das größere Schlafzimmer roch aus einem unerfindlichen Grund mehr nach Meer als nach Mäusen, ebenso wie der Rest dieser Ecke des Hauses. Impulsiv schloss ich die Augen, wie ich es in dem ersten Haus getan hatte, und konzentrierte mich darauf, was meine anderen Sinne mir sagten.
Erst hörte ich es: das Geräusch von Brandung und Wind. Dann bewegte eine kühle Brise mein Fell. Ich machte zwei Schritte, und die kühlen Kacheln unter meinen Füßen wurden zu Sand. Als ich die Augen wieder öffnete, stand ich auf einer Sanddüne an der Küste.
Sand wurde vom Wind umhergewirbelt, stach mir in Nase und Augen, und die Brise zauste mein Fell, als ich verdutzt zum Wasser hin starrte, während meine Haut von der Magie dieses Ortes summte. Auch hier ging die Sonne gerade unter, und das Licht tauchte das Meer in tausend Schattierungen von Orange, Rot und Pink.
Ich schlich die Düne hinunter durch das Gras mit den scharfen Halmen, bis ich auf dem festen Sandstrand stand. Immer noch konnte ich kein Ende des Wassers erkennen, dessen Wellen sich sanft am Ufer brachen. Ich beobachtete diese Wellen lange genug, bis die Flut herankam und meine Zehen berührte.
Das eisige Wasser erinnerte mich daran, dass ich zum Arbeiten hier war, und so schön und unmöglich dieser Ort auch sein mochte, ich würde hier wohl kaum einen Mörder finden. Ich konnte nichts anderes riechen als See und Sand. Also drehte ich mich um und wollte zurückkehren, bevor es wirklich dunkel wurde, aber hinter mir sah ich nur noch endlose Dünen und sanfte Hügel.
Entweder hatte der Wind meine Pfotenabdrücke weggewischt, während ich das Wasser betrachtet hatte, oder sie waren nie da gewesen. Ich konnte nicht einmal sicher sagen, von welcher Düne ich heruntergekommen war.
Ich erstarrte, irgendwie überzeugt, dass ich, wenn ich mich auch nur einen einzigen Schritt von meinem derzeitigen Standpunkt entfernte, niemals zurückfinden würde. Der friedliche Eindruck des Ozeans war vollkommen verschwunden, und die immer noch schöne Landschaft wirkte nun eher bedrohlich.
Langsam setzte ich mich hin und schauderte in dem kalten Wind. Ich konnte nur hoffen, dass Zee mich finden würde, oder dass diese Landschaft so schnell wieder verschwand, wie sie erschienen war. Ich duckte mich, bis mein Bauch auf dem Sand lag, und behielt das Meer im Rücken.
Ich legte das Kinn auf die Vorderpfoten, schloss die Augen und dachte an Badezimmer, und dass es nach Maus riechen sollte, versuchte, das Meersalz und den Wind zu ignorieren, der an meinem Fell zerrte. Aber die Umgebung verschwand einfach nicht.
»Sieh an«, sagte eine Männerstimme. »Was haben wir denn hier? Ich habe noch nie von einem Kojoten gehört, der sich unter den Feenhügel gewagt hätte.«
Ich öffnete die Augen und fuhr herum, duckte mich in Vorbereitung auf einen Angriff oder darauf, davonzurennen – was immer angemessener sein mochte. Etwa zehn Fuß entfernt stand zwischen mir und dem Meer ein Mann und beobachtete mich. Zumindest sah er überwiegend wie ein Mann aus. Seine Stimme hatte sich normal angehört, irgendwie nach Harvard-Professor, so dass ich einen Moment brauchte, um zu erkennen, wie weit er tatsächlich vom Aussehen normaler Menschenmänner entfernt war.
Seine Augen waren grüner als das Lincolngrün, das Onkel Mike zur Uniform seiner Angestellten gemacht hatte, so grün, dass nicht einmal die wachsende Dunkelheit die Farbe verblassen ließ. Langes, helles Haar, feucht von Salzwasser und mit Stücken von Wasserpflanzen darin, reichte ihm bis in die Kniekehlen. Er war vollkommen nackt und störte sich kein bisschen daran.
Ich konnte keine Waffen an ihm sehen. In seiner Haltung oder Stimme lag keine Aggression, aber mein Instinkt ließ all meine Alarmsirenen schrillen. Ich senkte den Kopf, behielt den Augenkontakt bei und schaffte es, nicht zu knurren.
In Kojotengestalt zu bleiben, schien das Sicherste zu sein. Vielleicht würde er glauben, dass ich tatsächlich nur ein Kojote war, der ins Badezimmer des Ermordeten und von dort aus hierhergeraten war. Nicht sehr wahrscheinlich, das musste ich zugeben. Vielleicht gab es noch andere Möglichkeiten, hierherzugelangen. Ich hatte keine Spuren von einem anderen Lebewesen gesehen, aber vielleicht würde er glauben, dass ich genau das war, wonach ich aussah.
Wir starrten einander lange an, und keiner von uns bewegte sich. Seine Haut war mehrere Schattierungen heller als sein Haar. Ich konnte die bläulichen Spuren von Adern direkt darunter sehen.
Seine Nasenlöcher zuckten, als er meinen Geruch aufnahm, aber ich wusste, dass ich wie ein Kojote roch.
Warum hatte Zee nicht ihn gebeten, ihm bei der Untersuchung zu helfen? Dieser Angehörige des Feenvolks benutzte offensichtlich seine Nase, und er kam mir alles andere als machtlos vor.
Vielleicht dachten sie, er könne der Mörder sein.
Ich ging im Kopf Märchen und Legenden durch, während er mich weiterhin beobachtete, und versuchte, mich an alle menschlich aussehenden Wesen zu erinnern, die im oder am Meer lebten. Es gab ziemlich viele, aber nur wenige, über die ich viel wusste.
Selkies waren, soweit ich mich erinnern konnte, die Einzigen, die auch nur neutral waren. Ich glaubte nicht, dass ich hier einen Selkie vor mir hatte – vor allem, weil ich einfach nicht solches Glück haben würde –, und er roch auch nicht wie etwas, in das sich ein Säugetier verwandeln würde. Er roch kalt und nach Fisch. In Seen und Lochs gab es freundlichere Wesen, aber über Meeresgeschöpfe hörte man überwiegend Horrorgeschichten. Sie waren keine sanftmütigen Kobolde, die das Haus sauber hielten.
»Du riechst wie ein Kojote«, sagte er schließlich. »Du siehst aus wie ein Kojote. Aber kein Kojote ist je unter den Feenhügel in das Reich des Seekönigs gekommen. Was bist du?«
»Gnädiger Herr«, sagte Zee zaghaft irgendwo direkt hinter mir auf Deutsch. »Die da arbeitet für uns und hat sich verlaufen.«
Das Meereswesen regte sich nicht, sondern hob nur den Blick, bis ich ziemlich sicher sein konnte, dass es Zee ansah. Ich wollte den Blick nicht abwenden, aber ich machte einen Schritt zurück, bis meine Hüfte gegen Zees Bein stieß, um mich zu überzeugen, dass ich mir seine Anwesenheit nicht nur eingebildet hatte.
»Sie gehört nicht zum Feenvolk«, sagte der Mann.
»Aber sie ist auch kein Mensch.« Etwas in Zees Stimme klang schrecklich unterwürfig, und ich wusste plötzlich, dass ich allen Grund besaß, Angst zu haben.
Der Fremde kam plötzlich auf uns zu und ließ sich vor mir auf ein Knie nieder. Er packte meine Schnauze, ohne auch nur zu fragen, und fuhr mit der freien Hand über meine Augen und Ohren. Seine eisigen Hände waren nicht unsanft, aber ohne einen kleinen Schubs von Zee hätte ich vielleicht dennoch protestiert. Dann ließ er meinen Kopf plötzlich wieder los und richtete sich wieder auf.
»Sie trägt keine Elfensalbe, und sie stinkt auch nicht nach den Drogen, die hin und wieder bewirken, dass sich jemand hierher verläuft und stirbt. Und soweit ich weiß – obwohl ich mich irren könnte –, ist deine Magie nicht von der Art, so etwas tun zu können. Wie ist sie also hierhergekommen?«
Erst bei diesen Worten erkannte ich, dass es kein Harvardakzent war, den ich da hörte, sondern Merry Old England.
»Ich weiß es nicht, mein Herr.