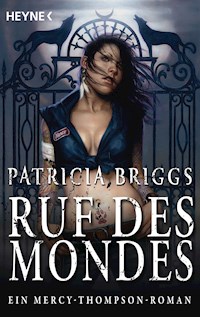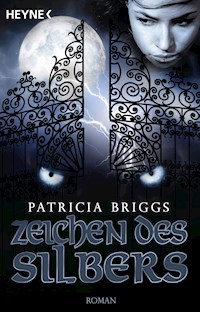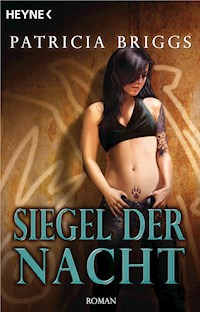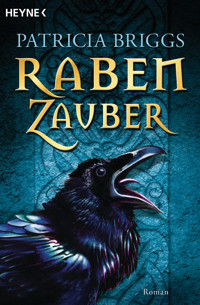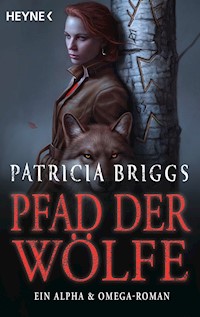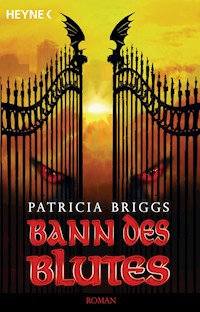
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Mercy-Thompson-Reihe
- Sprache: Deutsch
Mercy Thompson ist stolze Besitzerin einer kleinen Autowerkstatt. Und sie ist eine Walkerin – das heißt, sie kann sich in einen Kojoten verwandeln. Manchmal wäre Mercy gerne eine ganz normale junge Frau, mit normalen Freunden. Doch ihre Welt ist dunkel und gefährlich – wie sehr, erfährt Mercy, als ihr attraktiver Nachbar, ein Vampir, ihre Hilfe benötigt und sie in tödliche Gefahr bringt ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 525
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Das Buch
»Gestatten, mein Name ist Mercedes Thompson, und ich bin kein Werwolf. Warum mir das so wichtig ist? Nun, ich bin in einem Werwolfrudel aufgewachsen, und das ist gar nicht so leicht, wenn man selbst ein Walker ist. Werwölfe können nämlich manchmal ganz schön gefährlich sein …«
Mercy Thompson ist eine talentierte Automechanikerin mit einer Vorliebe für Junk-Food und alte Filme. Und sie teilt ihren Trailer mit einem Werwolf. Kaum hat Mercy sich nach den Ereignissen des vergangenen Jahres wieder in ihrem Alltagsleben eingerichtet, steht der attraktive Vampir Stefan vor ihrer Tür und fordert eine alte Schuld ein: Mercy soll ihn in Kojotengestalt zu einem Vampirtreffen begleiten. Schnell gerät Mercy zwischen die Fronten eines unbarmherzigen Kriegs der örtlichen Vampirsiedhe. Als sie herausfindet, wer hinter der blutigen Spur der Verwüstung steckt, die Tri-Cities heimsucht, schaltet sich auch Adam in die Geschehnisse ein – Mercys Nachbar und Anführer des Werwolfrudels der Stadt ...
Die MERCY-THOMPSON-Serie Erster Roman: Bann des Blutes Zweiter Roman: Ruf des Mondes Dritter Roman: Spur der Nacht
Die Autorin
Patricia Briggs, Jahrgang 1965, wuchs in Montana auf und interessiert sich seit ihrer Kindheit für Phantastisches. So studierte sie neben Geschichte auch Deutsch, denn ihre große Liebe gilt Burgen und Märchen. Neben erfolgreichen und preisgekrönten Fantasy-Romanen wie »Drachenzauber« und »Rabenzauber« widmet sie sich ihrer Mystery-Saga um Mercy Thompson. Nach mehreren Umzügen lebt die Autorin heute gemeinsam mit ihrem Mann, drei Kindern und zahlreichen Haustieren in Washington State.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Titel der amerikanischen Originalausgabe BLOOD BOUND Deutsche Übersetzung von Regina Winter
Deutsche Erstausgabe 07/2008 Redaktion: Natalja Schmidt
Copyright © 2007 by Patricia Briggs Copyright © 2008 der deutschsprachigen Ausgabe by
Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Umschlaggestaltung: Animagic, Bielefeld Karte: Andreas Hancock Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-08650-3V002
www.heyne.de
Ich widme dieses Buch voller Zuneigung den Leutchen aus den Tri-Cities im Staat Washington, die keine Ahnung hatten, wer da mitten unter ihnen lebte.
1
Wie die meisten Leute, die ein eigenes Geschäft haben, beginne ich schon sehr früh am Morgen mit der Arbeit und bleibe oft sehr lange auf. Wenn mich daher jemand mitten in der Nacht anruft, sollte es lieber um Leben oder Tod gehen.
»Hallo, Mercy«, sagte Stefans freundliche Stimme am Telefon. »Könntest du mir wohl einen Gefallen tun.«
Stefan hatte seinen Tod schon lange hinter sich, also sah ich keinen Grund, nett zu sein. »Ich bin um« – verschlafen blinzelte ich die Ziffern meines Weckers an – »drei Uhr morgens ans Telefon gegangen.«
Na gut, das ist nicht alles, was ich sagte. Ich habe noch ein paar von diesen Worten hinzugefügt, die Mechaniker bei widerspenstigen Schrauben oder Lichtmaschinen benutzen, die auf ihren Zehen landen.
»Ich nehme an, du brauchst noch einen zweiten Gefallen«, fuhr ich fort, »aber ich würde es vorziehen, wenn du jetzt auflegst und mich zu einem zivilisierteren Zeitpunkt wieder anrufst.«
Er lachte. Vielleicht dachte er, ich mache Witze. »Man hat mir einen Auftrag erteilt, und ich glaube, deine besondere Begabung würde mir dabei eine große Hilfe sein.«
Alte Geschöpfe neigen zumindest nach meiner Erfahrung dazu, sich ein bisschen vage auszudrücken, wenn sie einen um etwas bitten. Ich bin Geschäftsfrau, und ich glaube fest daran, dass es hilfreich ist, so schnell wie möglich zur Sache zu kommen.
»Du brauchst um drei Uhr nachts eine Mechanikerin?«
»Ich bin ein Vampir, Mercedes«, sagte er sanft. »Drei Uhr morgens ist eine gute Zeit für mich. Aber ich brauche keine Mechanikerin. Ich brauche dich. Und du bist mir einen Gefallen schuldig.«
So ungern ich das zugab – das stimmte. Er hatte mir geholfen, als die Tochter des hiesigen Alpha-Werwolfs entführt worden war. Und er hatte mich gewarnt, dass er diese Schuld irgendwann eintreiben würde.
Also gähnte ich, setzte mich hin und gab alle Hoffnung auf, bald wieder schlafen gehen zu können. »Na gut. Was kann ich für dich tun?«
»Ich soll einem Vampir, der sich ohne Erlaubnis meiner Herrin hier aufhält, eine Nachricht überbringen«, rückte er endlich mit der Sprache raus. »Und ich brauche einen Zeugen, den er nicht bemerken wird.«
Er legte auf, ohne auf meine Antwort zu warten oder mir auch nur zu sagen, wann er vorbeikommen würde. Es würde ihm nur recht geschehen, wenn ich wieder einschlief.
Leise fluchend zog ich mich stattdessen an: Jeans, das T-Shirt von gestern – inklusive Senffleck – und zwei Socken, die zusammen nur ein Loch hatten. Sobald ich mehr oder weniger bekleidet war, schlurfte ich in die Küche und goss mir ein Glas Kronsbeerensaft ein. Es war Vollmond, und mein Mitbewohner, der Werwolf, war mit dem Rudel unterwegs, also brauchte ich ihm nicht zu erklären, wieso ich mich mit Stefan treffen würde. Was ein glücklicher Umstand war.
Samuel war kein schlechter Mitbewohner, aber er hatte eine besitzergreifende und diktatorische Ader. Nicht, dass ich ihm das durchgehen ließ, aber Streitereien mit Werwölfen verlangten eine gewisse Subtilität, die mir für gewöhnlich abging, besonders – ich warf einen Blick auf meine Armbanduhr – morgens um Viertel nach drei.
Ich bin von Werwölfen aufgezogen worden, aber ich selbst bin keiner. Ich bin keine Dienerin der Mondphasen, und wenn ich meine Kojotengestalt annehme, sehe ich aus wie alle anderen Canis Latrans. Die Schrotnarben an meinem Rücken beweisen das.
Eigentlich kann man einen Werwolf nicht mit einem normalen Wolf verwechseln: Werwölfe sind viel größer als ihre nicht-übernatürlichen Gegenstücke, und erheblich furchterregender.
Ich nenne mich Walker, obwohl ich sicher bin, dass es auch einmal einen anderen Namen dafür gab – einen indianischen Namen, der verloren ging, als die Europäer die Neue Welt überrannten. Mein Vater hätte ihn mir vielleicht verraten können, wäre er nicht bei einem Autounfall gestorben, bevor er auch nur erfuhr, dass meine Mutter schwanger war. Also weiß ich nur, was die Werwölfe mir sagen konnten, und das war nicht viel.
Der Begriff »Walker« lässt sich zurückführen auf die Skinwalker der südwestlichen Indianerstämme, aber zumindest nach allem, was ich gelesen habe, habe ich mit einem Skinwalker weniger gemein als mit den Werwölfen. Ich übe keine Magie aus. Ich brauche keine Kojotenhaut, um die Gestalt zu wechseln – und ich bin nicht bösartig.
Ich trank meinen Saft und schaute aus dem Küchenfenster. Den Mond selbst konnte ich nicht sehen, nur das silberne Licht, das die Nachtlandschaft berührte. Gedanken an das Böse schienen irgendwie angemessen zu sein, während ich darauf wartete, dass ein Vampir mich abholte. Wenn schon sonst nichts, würden sie mich davon abhalten, wieder einzuschlafen. Angst hat diese Wirkung auf mich. Ich habe Angst vor dem Bösen.
In unserer modernen Welt kommt einem selbst das Wort altmodisch vor. Wenn sich das Böse dennoch zeigt, wie bei Charles Manson oder Jeffrey Dahmer, versuchen wir es mit Drogensucht, einer unglücklichen Kindheit oder Geisteskrankheit zu begründen.
Amerikaner im Besonderen sind seltsam unschuldig in ihrem Glauben, dass die Wissenschaft alles erklären kann. Als die Werwölfe vor ein paar Monaten schließlich ihre Existenz zugaben, begannen die Wissenschaftler sofort nach einem Virus zu suchen, das die Veränderung verursachte – Magie ist etwas, das ihre Labors und Computer nicht erfassen können. Zuletzt hatte ich gehört, dass die Johns-Hopkins-Universität ein ganzes Team für diese Sache abgestellt hat. Zweifellos würden sie auch etwas finden, aber ich wette, sie werden nie erklären können, wie sich ein Mann von 80 Kilo in einen 120 Kilo schweren Werwolf verwandelt. Die Wissenschaft hat keinen Platz für Magie, ebenso wenig wie für das Böse.
Der fromme Glaube, dass die Welt vollständig erklärbar sei, stellt gleichzeitig eine schreckliche Verwundbarkeit und einen festen Schild dar. Das Böse zieht es vor, dass die Leute nicht an es glauben. Nehmen wir das nicht vollkommen zufällige Beispiel von Vampiren. Sie töten selten willkürlich. Wenn sie jagen, finden sie jemanden, der nicht vermisst wird, und bringen diese Person zu sich nach Hause, wo sie sich um sie kümmern – wie um eine Kuh auf der Weide.
Unter der Herrschaft der Wissenschaft ist keine Hexenverbrennung erlaubt, es gibt keine Wasserproben und kein öffentliches Lynchen mehr. Im Austausch dafür müssen sich gesetzestreue, solide Bürger wegen seltsamer Dinge, die sich in der Nacht ereignen, keine sonderlichen Gedanken machen. Manchmal wünschte ich mir, ich wäre auch ein solcher Durchschnittsbürger.
Durchschnittsbürger werden nicht von Vampiren besucht.
Und sie machen sich auch keine Gedanken über ein Werwolfsrudel, oder zumindest nicht in der Art, wie ich es tue.
In die Öffentlichkeit zu treten, war für die Werwölfe ein großer Schritt, einer, der leicht hätte schiefgehen können. Als ich in die mondhelle Nacht hinausschaute, fragte ich mich, was passieren würde, wenn die Leute wieder anfingen, sich vor ihnen zu fürchten. Werwölfe sind nicht böse, aber sie sind auch nicht unbedingt die friedlichen, gesetzestreuen Helden, als die sie sich gerne darstellen.
Etwas klopfte an meine Haustür.
Vampire sind wirklich böse. Das wusste ich – aber Stefan war mehr als nur ein Vampir. Manchmal glaubte ich sogar, dass er mein Freund war. Also hatte ich keine Angst, bis ich die Tür öffnete und auf meine Veranda blickte.
Er hatte sich das dunkle Haar mit Gel zurückgekämmt, und seine Haut wirkte im Mondlicht sehr blass. Er trug ausschließlich Schwarz und hätte aussehen sollen wie ein Komparse aus einem schlechten Dracula-Film, aber irgendwie erschien mir dieser Aufzug – vom langen schwarzen Ledermantel bis hin zu den Seidenhandschuhen – an Stefan authentischer als seine üblichen bunten T-Shirts und schmuddeligen Jeans. Es sah aus, als hätte er sich eines Kostüms entledigt.
Er wirkte wie jemand, der so leicht töten konnte, wie ich einen Reifen wechselte, und mit ebenso wenig Bedenken.
Dann verzog er das Gesicht – und war plötzlich wieder der gleiche Vampir, der seinen alten VW-Bus wie Scooby Doos Mystery Machine angemalt hatte.
»Du scheinst dich nicht sonderlich zu freuen, mich zu sehen«, sagte er mit einem müden Grinsen, das seine Eckzähne nicht enthüllte. Im Dunkeln wirken seine Augen eher schwarz als braun – aber das Gleiche gilt für meine.
»Komm rein.« Ich trat von der Tür zurück, um ihn durchzulassen, und weil er mir Angst gemacht hatte, fügte ich boshaft hinzu: »Wenn du wirklich willkommen sein willst, musst du allerdings zu einer vernünftigeren Zeit kommen.«
Er zögerte, deutete lächelnd auf die Schwelle und sagte: »Auf deine Einladung.« Dann betrat er mein Haus.
»Das mit der Schwelle funktioniert wirklich?«, fragte ich.
Sein Lächeln wurde breiter, und diesmal sah ich das Aufblitzen weißer Fänge. »Nicht mehr, nachdem du mich eingeladen hast.«
Er ging an mir vorbei ins Wohnzimmer und wirbelte dann herum wie ein Model auf dem Laufsteg. Sein Ledermantel breitete sich ein wenig aus, beinahe wie ein Cape.
»Und, wie gefalle ich dir à la Nosferatu?«
Ich seufzte und gab zu: »Es macht mir Angst. Ich dachte, du willst nichts mit diesen Schauergeschichten zu tun haben.« Ich hatte ihn selten in etwas anderem als Jeans und T-Shirt gesehen.
Sein Lächeln wurde noch ausgeprägter. »Normalerweise stimmt das auch. Aber der Dracula-Look hat seinen Platz. Es ist seltsam, aber wenn man ihn sparsam einsetzt, erschreckt er die anderen Vampire beinahe ebenso sehr wie ein Kojotenmädchen. Mach dir keine Gedanken, ich habe dir auch ein Kostüm mitgebracht.«
Er griff unter den Mantel und holte ein mit Silber beschlagenes Geschirr heraus.
Ich starrte ihn einen Moment lang an. »Willst du in einen Sado-Maso-Club gehen? Es muss mir entgangen sein, dass es hier so was gibt.« Und nach allem, was ich wusste, gab es auch keinen – Ost-Washington ist prüder als Seattle oder Portland.
Er lachte. »Nein, nicht heute Nacht, mein Schatz. Das hier ist für dein Alter Ego.« Er schüttelte die Riemen aus, so dass ich sehen konnte, dass es sich um ein Hundegeschirr handelte.
Ich nahm es ihm ab. Es war aus gutem Leder, weich und biegsam und mit so viel Silber beschlagen, dass es aussah wie Schmuck. Wäre ich nur ein Mensch gewesen, hätte mich der Gedanke, so etwas anzuziehen, wahrscheinlich sofort abgeschreckt. Aber wenn man einen großen Teil seines Lebens als Kojote verbringt, können Halsbänder recht nützlich sein.
Der Marrok, der Anführer der nordamerikanischen Werwölfe, besteht darauf, dass alle Wölfe ein Halsband tragen, wenn sie in den Städten unterwegs sind, mit einem Anhänger, der sie als jemandes Haustier identifiziert. Er besteht auch darauf, dass die Namen auf diesem Anhänger so unschuldig sind wie Fred oder Fleck und nicht Killer oder Reißer lauten. So ist es ungefährlicher – sowohl für die Werwölfe als auch für die Behördenvertreter, mit denen sie vielleicht zu tun bekommen. Dennoch sind die Werwölfe darüber in etwa so erfreut, wie es die Motorradfahrer waren, als die Helmpflicht in Kraft trat. Nicht, dass einer sich auch nur im Traum einfallen lassen würde, dem Marrok nicht zu gehorchen.
Da ich kein Werwolf bin, gelten die Regeln des Marrok für mich nicht. Andererseits gehe ich auch nicht gern unnötige Risiken ein. In einer unaufgeräumten Küchenschublade habe ich ein Halsband – aber es besteht nicht aus geschmeidigem schwarzem Leder.
»Ich bin also Teil deines Kostüms«, stellte ich fest.
»Sagen wir einfach, dieser Vampir muss vielleicht mehr eingeschüchtert werden als andere«, erwiderte er unbeschwert, obwohl mich etwas in seinen Augen vermuten ließ, dass es um noch mehr ging.
Medea kam von dort zu uns, wo sie bis eben geschlafen hatte, wahrscheinlich Samuels Bett. Sie schnurrte laut, wand sich um Stefans linkes Bein und rieb ihre Nase dann an seinem Stiefel, um ihn als ihr Eigentum zu markieren.
»Katzen und Geister mögen keine Vampire«, sagte Stefan und starrte auf sie herab.
»Medea mag alles, was sie füttern oder streicheln kann«, erklärte ich. »Sie ist ansonsten nicht wählerisch.«
Er bückte sich und hob sie hoch. Hochgehoben zu werden, gefällt Medea nicht besonders, also miaute sie mehrmals, bevor sie wieder zu schnurren begann und ihre Krallen in seinen teuren Lederärmel schlug.
»Du bittest mich nicht um diesen Gefallen, um furchterregender zu wirken«, stellte ich fest und blickte von dem Ledergeschirr zu ihm auf. Direkter Blickkontakt war bei Vampiren nicht das klügste Vorgehen, das hatte er mir selbst gesagt, aber ich stieß nur auf undurchlässige Dunkelheit. »Du hast gesagt, du würdest einen Zeugen brauchen. Einen Zeugen wofür?«
»Nein, ich brauche dich nicht, um jemandem Angst einzujagen«, stimmte er mir leise zu, nachdem ich ihn ein paar Sekunden angestarrt hatte. »Aber er wird denken, dass ich einen Kojoten an der Leine habe, weil ich ihn einschüchtern will.« Er zögerte und zuckte schließlich die Achseln. »Dieser Vampir war schon einmal hier, und ich denke, es ist ihm gelungen, einen unserer jungen Leute zu betrügen. Du bist von Natur aus immun gegen viele Kräfte der Vampire, und das gilt besonders, wenn der fragliche Vampir nicht weiß, wen er vor sich hat. Wenn er dich einfach für einen Kojoten hält, wird er seine Magie wahrscheinlich nicht an dich verschwenden. Es ist unwahrscheinlich, aber er könnte mich ebenso täuschen, wie er Daniel getäuscht hat. Aber ich glaube nicht, dass er dich täuschen kann.«
Ich hatte von dieser Kleinigkeit, gegenüber Vampirmagie immun zu sein, erst vor kurzer Zeit erfahren. Es erschien mir nicht sonderlich nützlich, denn ein Vampir kann mir immer noch das Genick brechen, etwa mit so viel Anstrengung, wie ich für eine Selleriestange brauchen würde.
»Er wird dir nichts tun«, sagte Stefan, als ich zu lange schwieg. »Ich gebe dir mein Ehrenwort.«
Ich wusste nicht, wie alt Stefan war, aber er benutzte diese Wendung wie jemand, der es ernst meinte. Manchmal fiel es mir bei ihm schwer, mich daran zu erinnern, dass Vampire böse sind. Aber das alles zählte nicht wirklich. Ich war ihm etwas schuldig.
»Also gut«, sagte ich.
Ich betrachtete das Geschirr einen Moment lang und dachte daran, mein eigenes Halsband vorzuschlagen. Ich konnte die Gestalt ändern, wenn ich ein Halsband trug – mein Hals in Menschengestalt war nicht dicker als der eines Kojoten. Das Geschirr war für einen Kojoten von etwa dreißig Pfund gedacht und würde zu eng sein, um mich darin wieder in einen Menschen zu verwandeln. Der Vorteil bestand allerdings darin, dass die Verbindung zu Stefan nicht direkt zu meinem Hals verlief.
Allerdings war mein Halsband leuchtend Lila und mit gestickten rosa Blüten verziert. Nicht besonders Nosferatu.
Ich reichte Stefan das Geschirr. »Du musst es mir anlegen, wenn ich mich verwandelt habe«, sagte ich. »Ich bin gleich wieder da.«
Ich veränderte die Gestalt in meinem Schlafzimmer, weil ich dazu die Kleidung ausziehen muss. Ich bin nicht schüchtern – ein Gestaltwandler verliert das ziemlich schnell –, aber ich versuche, mich nicht vor Leuten auszuziehen, die meine beiläufige Nacktheit mit Nachlässigkeit in anderen Bereichen verwechseln könnten.
Ich wusste, dass Stefan mindestens drei Autos besaß, aber er war offenbar auf einem »schnelleren Weg«, wie er es ausdrückte, zu meinem Haus gekommen. Also fuhren wir in meinem Golf zu seinem Treffen.
Ein paar Minuten war ich sicher, dass es ihm nicht gelingen würde, das Auto anzulassen. Der alte Diesel wurde so früh am Morgen nicht gerne geweckt, ebenso wenig wie ich. Stefan murmelte ein paar italienische Schimpfworte, und schließlich sprang doch noch der Motor an, und wir fuhren los.
Man sollte nie mit einem Vampir fahren, der es eilig hat. Ich wusste vorher nicht, dass mein Golf überhaupt so schnell sein konnte. Wir fuhren mit einer beträchtlichen Umdrehungszahl auf den Highway auf. Das Auto blieb auf allen vier Rädern, aber nur gerade eben so.
Der Wagen schien die Fahrt lieber zu mögen als ich – das raue Motorgeräusch, das ich seit Jahren loswerden wollte, wurde erheblich besser, und die Maschine schnurrte. Ich schloss die Augen und hoffte, dass die Räder an ihren Achsen blieben.
Als Stefan uns über die Cable Bridge und mitten nach Pasco brachte, fuhr er vierzig Meilen die Stunde schneller, als es das Tempolimit erlaubte. Er wurde auch nicht merklich langsamer, als er den Golf durch das Industriegelände zu einer Gruppe von Hotels lenkte, die sich am Rand der Stadt nahe der Auffahrt zum Highway befanden, der nach Spokane und anderen nördlicheren Städten führte. Irgendein Wunder – und wahrscheinlich die frühe Tageszeit – sorgten dafür, dass wir keinen Strafzettel bekamen.
Das Hotel, zu dem Stefan uns brachte, war weder das beste noch das schlechteste am Platz. Hier stiegen für gewöhnlich die Lastwagenfahrer ab, aber es stand nur eine der großen Zugmaschinen auf dem Parkplatz. Vielleicht war dienstags nicht besonders viel los. Stefan parkte den Golf direkt neben dem einzigen anderen PKW, einem schwarzen BMW, obwohl es so viele freie Parkplätze gab.
Ich sprang aus dem offenen Fenster des Autos und bemerkte sofort den Geruch nach Vampir und Blut. Meine Nase ist sehr fein, besonders, wenn ich ein Kojote bin, aber wie jedem anderen ist mir nicht immer klar, was ich rieche. Meistens ist es, als versuchte man, allen Gesprächen in einem überfüllten Restaurant gleichzeitig zu lauschen. Aber dieser Duft hier konnte meiner Nase unmöglich entgehen.
Vielleicht genügte er bereits, um normale Menschen abzuschrecken, und vielleicht war der Parkplatz deshalb beinahe leer.
Ich warf Stefan einen Blick zu, um zu sehen, ob er den Geruch ebenfalls bemerkte, aber er hatte seine Aufmerksamkeit auf den Wagen gerichtet, neben dem wir parkten. Sobald er meine Aufmerksamkeit darauf lenkte, wurde mir klar, dass der Geruch unter anderem auch von dem BMW ausging. Wie war es möglich, dass dieses Auto mehr nach Vampir roch als Stefan der Vampir selbst?
Ich bemerkte einen weiteren, subtileren Geruch, der bewirkte, dass ich die Zähne fletschte, obwohl ich nicht hätte sagen können, was dieses bittere, dunkle Miasma war. Sobald es meine Nase berührte, wickelte es sich um mich, bis es alle anderen Düfte verdrängt hatte.
Stefan kam eilig um das Auto herum, griff nach der Leine und zog fest daran, damit ich aufhörte zu knurren. Ich zog zurück und schnappte nach ihm. Ich war kein verdammter Hund. Er hätte mich einfach bitten können, still zu sein.
»Ganz ruhig«, sagte er, sah mich aber nicht an. Er betrachtete das Hotel. Ich roch nun noch eine neue Note, den Hauch eines Dufts, der schnell wieder von dem stärkeren Geruch verdrängt wurde. Aber selbst diese Spur genügte, um die vertraute Ausdünstung von Angst zu erkennen – Stefans Angst. Was konnte einem Vampir Angst machen?
»Komm«, sagte er und zog mich aus meiner Verwirrung heraus und auf das Hotel zu. Nachdem ich aufgehört hatte, mich dem Ziehen zu widersetzen, sagte er schnell und leise: »Ich will nicht, dass du irgendetwas tust, Mercy, ganz gleich, was du siehst oder hörst. Du bist einem Kampf mit diesem Gegner nicht gewachsen. Ich brauche nur eine unparteiische Zeugin, die sich nicht umbringen lässt. Also spiel die Kojotin, so gut du kannst, und wenn ich es nicht hier herausschaffen sollte, geh und sag der Herrin, um was ich dich gebeten habe und was du gesehen hast.«
Wie konnte er erwarten, dass ich aus einer Situation entkommen konnte, die ihn umbringen würde? Vor unserem Aufbruch hatte er nicht so geklungen, und er hatte auch keine Angst gehabt. Vielleicht konnte er riechen, was ich roch, und wusste, was es war. Ich konnte ihn jedoch nicht fragen, denn ein Kojote hat nicht denselben Stimmapparat wie ein Mensch.
Er führte mich zu einer Rauchglastür. Sie war verschlossen, aber es gab einen Kasten für eine Schlüsselkarte mit einem kleinen, blinkenden LED-Licht. Er tippte mit dem Finger auf den Kasten, und das Licht wurde grün, als hätte er eine magnetisierte Karte eingesteckt. Die Tür ging ohne Widerstand auf und schloss sich hinter uns mit einem endgültig klingenden Klicken.
Der Flur hatte nichts Unheimliches an sich, aber er beunruhigte mich trotzdem. Wahrscheinlich war es Stefans Nervosität, die mich ansteckte. Was konnte einem Vampir Angst machen?, fragte ich mich erneut.
Irgendwo warf jemand eine Tür zu, und ich zuckte zusammen.
Stefan wusste entweder, wo der Vampir wohnte, oder seine Nase wurde nicht so sehr von diesem anderen Geruch behindert wie die meine. Er führte mich schnell durch den langen Flur und blieb dann etwa auf halbem Weg stehen. Er klopfte an die Tür, obwohl er wahrscheinlich ebenso gut wie ich hören konnte, dass jemand im Raum schon auf die Tür zuging, sobald wir davor stehen geblieben waren.
Nach diesem Augenblick der Spannung war der Vampir, der die Tür schließlich öffnete, beinahe enttäuschend, so als ob man erwartet, dass Pavarotti Wagner singt und stattdessen Bugs Bunny und Elmer Fudd vorgesetzt bekommt.
Der neue Vampir war glatt rasiert und trug das Haar zu einem kurzen, ordentlichen Zopf zurückgebunden. Seine Kleidung war anständig und sauber, wenn auch ein wenig verknittert, als käme sie aus einem Koffer – aber irgendwie vermittelte er insgesamt den Eindruck von Unordnung und Schmutz. Er war erheblich kleiner als Stefan und erheblich weniger Furcht einflößend. Der erste Punkt ging an Stefan, und das war gut so, denn immerhin hatte er viel Sorgfalt auf seine Fürst-der-Finsternis-Aufmachung verwendet.
Das langärmlige Polohemd des Fremden hing an ihm, als bekleidete es ein Skelett und kein lebendes Wesen. Als er sich bewegte, rutschte einer der Ärmel nach oben und enthüllte einen Arm, der so dünn war, dass man zwischen den Knochen des Unterarms eine Höhlung erkennen konnte. Er hielt sich ein wenig geduckt, als könne er nicht die Energie aufbringen, um sich gerade aufzurichten.
Ich war zuvor schon anderen Vampiren begegnet, beängstigenden Blutsaugern mit glühenden Augen und Reißzähnen. Dieser hier sah eher aus wie ein Junkie, von dem fast keine Substanz mehr übrig geblieben war. Er wirkte, als könnte er jeden Augenblick verblassen.
Stefan jedoch schien die offensichtliche Gebrechlichkeit des anderen nicht beruhigend zu finden – wenn überhaupt, wuchs seine Anspannung noch. Dass ich in dieser durchdringenden unangenehmen Bitterkeit, die mich umgab, nicht viel wahrnehmen konnte, beunruhigte mich mehr als der Vampir selbst, der nicht sonderlich nach einem gefährlichen Gegner aussah.
»Meine Herrin hat erfahren, dass du hier bist«, sagte Stefan mit ruhiger Stimme, wenn er auch ein wenig abgehackter als sonst sprach. »Sie ist sehr enttäuscht, dass du es nicht für nötig gehalten hast, ihr vorher zu sagen, dass du ihr Territorium aufsuchen würdest.«
»Komm herein, komm herein«, sagte der andere Vampir und machte ein paar Schritte zurück, damit Stefan das Zimmer betreten konnte. »Du brauchst nicht im Flur zu stehen und Leute zu wecken, die schlafen wollen.«
Ich hätte nicht sagen können, ob er wusste, dass Stefan Angst hatte oder nicht. Ich war mir nie ganz sicher, was Vampire riechen können und was nicht – obwohl sie zweifellos empfindlichere Nasen haben als Menschen. Er schien Stefan in seiner schwarzen Kleidung nicht zu fürchten; tatsächlich wirkte er beinahe zerstreut, als hätten wir ihn bei etwas Wichtigem unterbrochen.
Die Badezimmertür, an der wir vorbeikamen, war geschlossen. Ich spitzte die Ohren, konnte dahinter aber nichts hören. Meine Nase war nutzlos. Stefan brachte uns bis zur anderen Seite des Zimmers, in die Nähe der Schiebetüren, die hinter schweren, vom Boden bis zur Decke reichenden Vorhängen beinahe verborgen waren. Das Zimmer war kahl und unpersönlich, wenn man einmal von dem geschlossenen Koffer absah, der auf der Kommode lag.
Stefan wartete, bis der andere Vampir die Tür geschlossen hatte, dann sagte er kühl: »Niemand versucht heute Nacht in diesem Hotel zu schlafen.«
Das schien mir eine seltsame Bemerkung zu sein, aber der Fremde wusste offenbar, was Stefan meinte, denn er lachte leise und legte dabei die Hand auf den Mund, eine neckische Geste, die eher zu einem zwölfjährigen Mädchen gepasst hätte als zu einem Mann gleich welchen Alters. Es war so merkwürdig, dass ich eine Weile brauchte, um Stefans Satz zu verstehen.
Er hatte es sicher nicht so gemeint, wie es sich anhörte. Kein Vampir, der noch bei Verstand war, hätte alle Menschen in einem Hotel getötet. Vampire waren ebenso gnadenlos wie Werwölfe, wenn es darum ging, für die Einhaltung von Gesetzen zu sorgen, die dafür sorgten, unerwünschte Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Und das beliebige Niedermetzeln von Menschen würde zweifellos einige Aufmerksamkeit erreichen. Selbst wenn es nicht viele Gäste gab, hatte das Hotel immer noch Angestellte.
Der Vampir senkte die Hand wieder und stellte nun einen freudlosen Ausdruck zur Schau. Das bewirkte nicht, dass ich mich besser fühlte. Es war, als beobachtete man Dr. Jekyll und Mr. Hyde, so groß war die Veränderung.
»Niemand, der aufwacht?«, fragte er, als hätte er bisher noch nicht auf Stefans Bemerkung reagiert. »Da könntest du Recht haben. Dennoch, es ist unhöflich, jemanden an der Tür warten zu lassen, oder? Welcher von ihren Schergen bist du denn?« Er hob eine Hand. »Nein, warte, sag es mir nicht, lass mich raten.«
Während Stefan wartete, schien seine übliche Lebhaftigkeit vollkommen verschwunden zu sein. Der Fremde ging um ihn herum und blieb hinter uns stehen. Nur durch die Leine ein wenig behindert, drehte ich mich zu ihm um.
Als er direkt hinter Stefan stand, beugte er sich vor und kraulte mich hinter den Ohren.
Es macht mir für gewöhnlich nichts aus, gestreichelt zu werden, aber sobald seine Finger mein Fell streiften, wusste ich, dass ich diese Berührung nicht wollte. Unwillkürlich duckte ich mich vor seiner Hand und gegen Stefans Bein. Mein Fell sorgte dafür, dass seine Haut mich nicht direkt berührte, aber das änderte nichts daran, dass ich mich durch ihn schmutzig und besudelt fühlte.
Sein Geruch blieb an meinem Fell hängen, und ich erkannte, dass der unangenehme Gestank, der meine Nase verstopft hatte, von ihm ausging.
»Vorsicht«, sagte Stefan, ohne sich umzudrehen. »Sie beißt.«
»Tiere lieben mich.« Die Bemerkung ließ mich schaudern; sie war so unangemessen von diesem … diesem widerwärtigen Ungeheuer. Er hockte sich auf die Fersen und rieb noch einmal meine Ohren. Ich hätte nicht sagen können, ob Stefan wollte, dass ich ihn biss, oder nicht. Also ließ ich es lieber bleiben, denn ich wollte seinen Geschmack nicht auf meiner Zunge haben. Ich konnte ihn später immer noch beißen, wenn es notwendig wurde.
Stefan sagte nichts mehr, und er schaute auch in keine andere Richtung als geradeaus. Ich fragte mich, ob er Status verlieren würde, wenn er sich bewegte. Werwölfe spielen ebenfalls Machtspielchen, aber die Regeln dafür kenne ich gut. Ein Werwolf hätte einem fremden Wolf nie gestattet, hinter ihm zu stehen.
Er ließ davon ab, mich zu streicheln, richtete sich wieder auf und ging um mich herum, bis er Stefan erneut gegenüberstand. »Du bist Stefan, Marsilias kleiner Soldat. Ich habe tatsächlich von dir gehört – obwohl dein Ruf nicht mehr das ist, was er einmal war. Auf diese Weise aus Italien zu fliehen, würde die Ehre jedes Mannes besudeln … Dennoch, irgendwie hatte ich mehr von dir erwartet. All diese Geschichten … ich erwartete, ein Ungeheuer unter Ungeheuern zu finden, ein Wesen aus einem Alptraum, das selbst andere Vampire einschüchtert – und ich sehe nur eine vertrocknete, abgehalfterte Möchtegern-Bestie. Ich nehme an, so etwas passiert, wenn man sich jahrhundertelang im Hinterland verkriecht.«
Nach den letzten Worten des anderen Vampirs schwiegen beide kurz.
Dann lachte Stefan und sagte: »Während du überhaupt keinen Ruf hast.« Er klang unbeschwerter als sonst und beinahe ein bisschen eilig, als hätte das, was er sagte, ohnehin keine Bedeutung. Ich machte unwillkürlich einen Schritt von ihm weg, irgendwie eingeschüchtert von dieser unbeschwerten, amüsierten Stimme. Stefan lächelte den anderen Vampir freundlich an und seine Stimme wurde noch leiser, als er sagte: »So etwas passiert, wenn man neu erschaffen und verlassen wird.«
Das musste eine vampirische Superbeleidigung gewesen sein, denn der zweite Vampir explodierte, als wären Stefans Worte eine extreme Provokation. Er stürzte sich allerdings nicht auf ihn.
Stattdessen bückte er sich, packte die Unterseite des Sprungfederkastens des Doppelbetts und hob es zusammen mit der Matratze und dem Bettzeug über seinen Kopf. Er drehte seine Last zur Flurtür und drehte sie dann so, dass die Enden von Sprungfederkasten, Matratze und Bettzeug einen Augenblick lang in der Luft zu hängen schienen.
Dann veränderte er seinen Griff und warf das ganze Bett durch die Wand in das leere Nachbarzimmer, wo es in einer Wolke von Gipsstaub auf dem Boden landete. Zwei Wandstützbalken splitterten, hingen verbogen im Putz und ließen das Loch aussehen wie eine grinsende Kürbislaterne. Das verbliebene Kopfende des Betts, das an die Wand geschraubt war, sah ziemlich verloren aus, als es dort einen Fuß über dem Boden hing.
Das Tempo und die Kraft des Vampirs überraschten mich nicht – ich hatte schon ein paar Werwölfe während eines Wutanfalls gesehen. Also wusste ich auch, wenn der Vampir wirklich wütend gewesen wäre, hätte er nicht über die Beherrschung verfügt, die Einzelteile des Bettes zusammen durch die Wand zu werfen. Offenbar gab es ebenso wie bei Kämpfen unter Werwölfen auch bei Vampiren eine Menge beeindruckenden Feuerwerks vor dem Hauptakt.
In dem folgenden Schweigen hörte ich ein heiseres Geräusch hinter der geschlossenen Badezimmertür – als hätte, wer immer es von sich gab, schon so viel geweint, dass die Person nur noch ein leises Wimmern von sich geben konnte, welches aber von viel mehr Entsetzen kündete als ein lauter Schrei.
Ich fragte mich, ob Stefan wusste, was sich im Bad befand, und ob er deshalb schon auf dem Parkplatz nervös gewesen war. Ich holte tief Luft, konnte aber weiterhin nur die bittere Dunkelheit spüren – und das immer stärker. Ich nieste, versuchte, meine Nase zu befreien, aber das funktionierte nicht. Beide Vampire blieben stehen, bis der Lärm sich gelegt hatte. Dann rieb der Fremde sich leicht die Hände, ein dünnes Lächeln auf den Lippen, als hätte er nicht erst einen Augenblick zuvor die Nerven verloren.
»Oh, ich bin wirklich ein bedauerlich nachlässiger Gastgeber«, sagte er, aber die altmodischen Worte klangen falsch, als würde er nur vorgeben, ein Vampir zu sein, so wie die alten Vampire vorgegeben hatten, Menschen zu sein. »Du weißt offensichtlich nicht, wer ich bin.«
Er deutete eine Verbeugung vor Stefan an. Es war selbst für mich deutlich zu sehen, dass dieser Vampir in einer Zeit und an einem Ort aufgewachsen war, wo man das Verbeugen eher aus einem Kung-Fu-Film lernte als im Alltagsleben. »Ich bin Asmodeus«, erklärte er prahlerisch und klang wie ein Kind, das sich als König vorstellte.
»Ich sagte schon, dass dir kein Ruf vorausgeht«, erwiderte Stefan, immer noch auf diese lässige, beiläufige Weise. »Damit meinte ich nicht, dass ich deinen Namen nicht kenne, Cory Littleton. Asmodeus wurde schon vor Jahrhunderten vernichtet.«
»Dann eben Kurfel«, sagte Cory, der plötzlich nichts Kindliches mehr an sich hatte.
Ich kannte diese Namen, Asmodeus und Kurfel, beide, und sobald ich mich erinnerte, wo ich sie gehört hatte, wusste ich auch, was das für ein Geruch war. Und sobald mir das eingefallen war, kam mir Stefans Angst nicht mehr so überraschend vor. Dämonen machten jedem Wesen Angst.
»Dämon« ist ein Sammelbegriff wie »Feenvolk« und beschreibt Wesen, die unfähig sind, sich selbst in körperlicher Form auf dieser Welt zu manifestieren. Stattdessen ergreifen sie Besitz von ihren Opfern und nähren sich von ihnen, bis nichts mehr übrig bleibt. Dieser hier hieß ebenso wenig Kurfel wie Asmodeus – den Namen eines Dämons zu kennen, verleiht nämlich Macht über ihn. Ich hatte allerdings noch nie von einem Vampir gehört, der von einem Dämon besessen war. Ich versuchte, mir vorzustellen, was das bedeuten mochte.
»Du bist auch nicht Kurfel«, sagte Stefan. »Obwohl einer wie er dir den Gebrauch seiner Fähigkeiten erlaubt, wenn du ihn gut genug amüsierst.« Er schaute zur Badezimmertür hin. »Was hast du getan, um ihn zu amüsieren, Zauberer?«
Zauberer.
Ich hatte immer gedacht, das wären nur Geschichten – ich meine, wer würde schon so dumm sein, einen Dämon in sich einzuladen? Und warum würde ein Dämon, der von jeder korrupten Seele Besitz ergreifen konnte (und sich einem Dämon anzubieten, setzte eine korrupte Seele voraus, oder?), einen Handel mit jemandem eingehen? Ich glaubte nicht an Zauberer, und ich glaubte ganz bestimmt nicht an Vampirzauberer.
Ich nehme an, jemand, der von Werwölfen aufgezogen wurde, hätte offener für so etwas sein sollen – aber irgendwo musste ich eine Grenze ziehen.
»Ich mag dich nicht«, sagte Littleton kühl, und mein Nackenhaar sträubte sich von der Magie, die er um sich herum sammelte. »Ich mag dich überhaupt nicht.«
Er streckte die Hand aus und berührte Stefan in der Mitte der Stirn. Ich wartete darauf, dass Stefan seine Hand wegstieß, aber er tat nichts, um sich zu verteidigen, sondern fiel auf die Knie und kam mit lautem Krachen auf dem Boden auf.
»Ich hätte gehofft, du würdest interessanter sein, aber nein«, sagte Cory. Sein Tonfall und seine Art zu reden hatten sich stark verändert. »Überhaupt nicht witzig. Ich muss etwas dagegen tun.«
Er ließ Stefan vor sich knien und ging zur Badezimmertür.
Ich winselte Stefan an und stellte mich auf die Hinterbeine, um ihm über das Gesicht zu lecken, aber er sah mich nicht einmal an. Sein Blick war vage und unkonzentriert, und er atmete nicht. Vampire brauchen das selbstverständlich auch nicht zu tun, aber Stefan atmete meistens.
Der Zauberer hatte ihn offenbar mit einem Bann belegt.
Ich riss an der Leine, aber Stefan hatte die Hand immer noch darum geschlossen. Vampire sind stark, und selbst als ich meine ganzen zweiunddreißig Pfund dagegenwarf, bewegte sich seine Hand nicht. Wenn ich eine halbe Stunde gehabt hätte, hätte ich das Leder durchkauen können, aber ich wollte lieber schon frei sein, wenn der Zauberer zurückkehrte.
Hechelnd sah ich mich um, schaute zur offenen Badezimmertür. Welches neue Ungeheuer wartete dort? Wenn ich hier lebendig herauskam, würde ich mir nie wieder eine Leine anlegen lassen. Werwölfe haben Kraft, Krallen, die sich halb einziehen lassen, und einen Zoll lange Reißzähne – Samuel hätte nicht in diesem dummen Ledergeschirr festgesessen. Ein Biss, und er wäre weg gewesen. Ich war nur schnell – und selbst diese Schnelligkeit wurde durch die Leine deutlich eingeschränkt.
Ich war auf einen schrecklichen Anblick vorbereitet, etwas, das Stefan vernichten konnte. Aber was Cory Littleton aus dem Zimmer zog, erfüllte mich mit einer ganz anderen Art von Entsetzen.
Die Frau trug eine Zimmermädchenuniform im Stil der Fünfzigerjahre, mintgrün mit einer gestärkten blauen Schürze. Die Farben passten zu den Vorhängen und den Teppichen im Flur, aber das Seil um ihre Handgelenke, dunkel von Blut, tat das nicht.
Von ihren blutenden Handgelenken einmal abgesehen, schien sie unverletzt zu sein, obwohl die Geräusche, die sie von sich gab, mich das bezweifeln ließen. Ihre Brust hob und senkte sich krampfhaft durch ihr angestrengtes Weinen, aber selbst ohne die Badezimmertür zwischen uns war es nicht sonderlich laut, es war eher ein leises Stöhnen.
Ich riss wieder an der Leine, und als Stefan sich immer noch nicht regte, biss ich ihn so fest, dass er blutete. Er zuckte nicht einmal zusammen.
Ich konnte nicht ertragen, wie erschrocken die Frau war. Sie atmete heiser und abgerissen und wehrte sich gegen Littletons Griff, so auf ihn konzentriert, dass sie Stefan und mich vermutlich überhaupt nicht bemerkte.
Wieder zerrte ich an der Leine. Wieder half es nichts. Ich fauchte und schnappte und drehte mich um, so dass ich am Leder kauen konnte. Mein eigenes Halsband hatte einen Schnappverschluss, den ich hätte lösen können, aber Stefans Ledergeschirr hatte altmodische Schnallen.
Der Zauberer ließ sein Opfer vor mir auf den Boden fallen, gerade so außer Reichweite – obwohl ich nicht sicher war, was ich hätte für sie tun können, selbst wenn ich sie hätte berühren können. Sie sah mich nicht, sie war zu sehr damit beschäftigt, Littleton nicht anzusehen. Aber meine Anstrengungen hatten die Aufmerksamkeit des Zauberers erregt, und er hockte sich nun vor mich hin.
»Ich frage mich, was du tun würdest, wenn ich dich losließe«, fragte er mich. »Hast du Angst? Würdest du fliehen? Würdest du mich angreifen, oder erregt dich der Geruch ihres Blutes so wie einen Vampir?« Er blickte zu Stefan auf. »Ich sehe deine Zähne, Soldat. Der schwere Geruch von Blut liegt in der Luft. Er ruft uns, nicht wahr? Er hält uns an einer so festen Leine wie du deinen Kojoten.« Er sprach die Worte aus, als wäre Spanisch seine Muttersprache. »Sie verlangen, dass wir nur einen kleinen Schluck nehmen, wenn unsere Herzen sich doch nach so viel mehr sehnen. Blut zu trinken ist nicht wirklich erfüllend, wenn niemand dabei stirbt, findest du nicht auch? Du bist alt genug, um dich an frühere Zeiten zu erinnern, oder, Stefan? Als wir Vampire tranken, so viel wir wollten, und wir uns in dem Entsetzen und den Todeszuckungen unserer Beute suhlten. Als wir uns wirklich nährten.«
Stefan gab endlich ein Geräusch von sich, und ich wagte es, ihn anzusehen. Sein Blick hatte sich verändert. Ich weiß nicht, was das Erste war, was mir an ihm auffiel, wenn sich so viel anderes ebenfalls verändert hatte. Stefans Augen hatten für gewöhnlich die Farbe von geöltem Walnussholz, aber nun glühten sie wie Blutrubine. Er hatte die Lippen zurückgezogen und zeigte Reißzähne, die kürzer und zierlicher waren als die eines Werwolfs. Seine Hand, die meine Leine fest gepackt hielt, hatte nun gebogene Klauen an den Enden verlängerter Finger. Nach einem kurzen Blick wandte ich mich ab, denn er machte mir beinahe ebenso viel Angst wie der Zauberer.
»Ja, Stefan«, sagte Littleton und lachte wie die Schurken in alten Schwarzweißfilmen. »Ich sehe, du erinnerst dich an den Geschmack des Todes. Benjamin Franklin sagte einmal, dass jene, die ihre Freiheit für Sicherheit aufgeben, keins von beidem verdienen.« Er beugte sich dichter heran. »Fühlst du dich sicher, Stefan? Oder fehlt dir das, was wir einmal hatten, und was uns allen genommen wurde?«
Dann wandte er sich wieder seinem Opfer zu. Sie gab einen leisen Laut von sich, als er sie berührte. Ihr Weinen war so heiser, dass es für einen Menschen, der sich außerhalb des Zimmers befand, unhörbar gewesen wäre. Ich kämpfte gegen das Geschirr an, bis es mir in die Schultern schnitt, aber das half nichts. Meine Klauen rissen Löcher in den Teppich, aber Stefan war zu schwer, als dass ich ihn hätte bewegen können.
Als Littleton sie tötete, ließ er sich Zeit damit; sie hörte auf, sich zu wehren, bevor ich es tat. Am Ende kamen die einzigen Geräusche im Raum von den Vampiren, von dem vor mir, der sich schlürfend nährte, und von dem neben mir, der hilflose, gierige Laute von sich gab, obwohl er sich ansonsten nicht regte.
Der Körper der Frau bog sich, und ihr Blick begegnete dem meinen, nur einen Augenblick, bevor ihre Augen glasig wurden und sie starb. Ich spürte Magie, als sie erstarrte, und den bitteren Gestank des Dämons, der sich aus dem Raum zurückzog, bis nur noch eine schwache Spur von ihm zurückblieb.
Ich konnte wieder besser riechen und hätte mir beinahe gewünscht, das wäre nicht der Fall. Der Geruch des Todes ist nicht viel besser als der eines Dämons.
Hechelnd, zitternd und hustend, weil ich mich halb erwürgt hatte, sackte ich zu Boden. Ich konnte jetzt nichts mehr tun, um ihr zu helfen, wenn es denn je eine Möglichkeit dazu gegeben hatte. Littleton nährte sich weiter. Ich warf einen Blick zu Stefan, der aufgehört hatte, diese verstörenden Geräusche von sich zu geben. Er schien weiterhin erstarrt zu sein. Obwohl ich wusste, dass er die Szene mit Gier und nicht mit Entsetzen beobachtet hatte, war Stefan Littleton immer noch vorzuziehen, und ich wich zu ihm zurück, bis meine Hüfte gegen seinen Oberschenkel stieß.
Ich drängte mich gegen ihn, als Littleton, das weiße Hemd getränkt von dem Blut der Frau, die er getötet hatte, von seinem Opfer aufblickte, um Stefan forschend ins Gesicht zu blicken. Er lachte leise und keuchte nervös. Ich hatte solche Angst vor ihm, vor dem Ding, das von ihm Besitz ergriffen hatte, dass ich kaum atmen konnte.
»Oh, du wolltest das ebenso wie ich«, gurrte er, streckte eine Hand aus und strich Blut auf Stefans Mund. Einen Moment später leckte Stefan sich die Lippen.
»Lass mich mit dir teilen«, sagte der andere Vampir leise. Er beugte sich zu Stefan und küsste ihn leidenschaftlich. Er schloss die Augen, und ich erkannte, dass er endlich in meiner Reichweite war.
Zorn und Angst unterscheiden sich manchmal nur um Haaresbreite. Ich sprang mit aufgerissenem Rachen nach oben und packte Littleton, schmeckte erst das Menschenblut der Frau auf seiner Haut, und dann etwas anderes, bitter und widerlich, das von meinem Maul durch meinen Körper ging wie ein Blitz. Ich kämpfte darum, meine Kiefer wieder zu schließen, aber ich hatte mich verrechnet, und meine oberen Reißzähne stießen auf sein Rückgrat und rutschten ab.
Ich war kein Werwolf und keine Bulldogge, also konnte ich keinen Knochen zermalmen, sondern nur tief ins Fleisch beißen, bis der Vampir mich an den Schultern packte und sich losriss, wobei er Stefan die Leine aus der Hand nahm.
2
Ich erwachte auf meiner Couch, weil jemand mein Gesicht ableckte, und dazu ertönte Medeas deutlich erkennbares Schnurren. Stefans Stimme zu hören, war eine Erleichterung, denn es bedeutete, dass er ebenfalls noch lebte, genau wie ich. Aber als Samuel antwortete, war sein grollender Unterton dem meiner Katze zwar äußerlich sehr ähnlich, in dem drohenden Unterton lag jedoch kein Trost.
Adrenalin flutete durch meinen Körper, als ich das hörte. Ich schob die Erinnerung an die Schrecken der Nacht beiseite. Wichtig war im Moment, dass heute Nacht Vollmond war, und ein zorniger Werwolf sich keine zwei Fuß von mir entfernt befand.
Ich versuchte, die Augen zu öffnen und aufzustehen, aber dabei stieß ich auf mehrere Probleme. Erstens schienen meine Augen zugeklebt zu sein. Zweitens schlafe ich selten in Kojotengestalt, und ich versuchte, mich wie ein Mensch aufzusetzen. Das Problem wurde noch größer, weil mein steifer, wunder Körper auf Bewegung nicht sonderlich gut reagierte. Und schließlich wurde ich, sobald ich den Kopf bewegte, mit pochenden Schmerzen und Übelkeit belohnt. Medea fauchte erbost und sprang von der Couch.
»Ruhig, Mercy.« Alles Bedrohliche verschwand aus Samuels Stimme, als er mich ansprach und sich neben die Couch kniete. Er fuhr mit wissenden, sanften Händen über meinen geschundenen Körper.
Ich öffnete mein rechtes Auge und sah ihn misstrauisch an, denn ich wollte nicht so recht glauben, dass sein Tonfall ein Zeichen für seine Stimmung war. Seine Augen lagen im Schatten, aber der breite Mund unter der aristokratischen Nase wirkte nicht verkniffen. Ich bemerkte zerstreut, dass er einen Haarschnitt brauchte, und dass ihm das aschblonde Haar tief in die Stirn hing. Ja, seine breiten Schultern waren angespannt, und jetzt, da ich vollkommen aufgewacht war, konnte ich die Aggression riechen, die sich im Zimmer aufgebaut hatte. Er bewegte den Kopf, um mit dem Blick seinen Händen zu folgen, die vorsichtig über meine Hinterbeine strichen, und ich konnte seine Augen sehen.
Hellblau – nicht weiß, wie sie es gewesen wären, wenn der Wolf zu dicht an der Oberfläche gelauert hätte.
Ich entspannte mich genug, um ehrlich dankbar zu sein, dass ich, obwohl zerschlagen und elend, auf meiner eigenen Couch lag und nicht tot war, oder schlimmer, mich immer noch in Gesellschaft von Cory Littleton, Vampir und Zauberer, befand.
Samuels Hände berührten meinen Kopf, und ich wimmerte.
Mein Mitbewohner ist nicht nur ein Werwolf, sondern auch ein Arzt, und zwar ein sehr guter. Das sollte er wahrscheinlich auch sein. Er arbeitete schon sehr lange in diesem Bereich und hatte in zwei Jahrhunderten mindestens drei Doktorgrade erworben. Werwölfe können sehr lange leben.
»Ist sie in Ordnung?«, fragte Stefan. Etwas in seiner Stimme beunruhigte mich.
Samuel spannte sich ein wenig an. »Ich bin kein Tierarzt. Ich kann Ihnen sagen, dass sie keine gebrochenen Knochen hat, aber solange sie nicht mit mir sprechen kann, ist das alles, was ich weiß.«
Ich versuchte, mich zu verändern, damit ich ihm helfen konnte, aber ich spürte nur einen brennenden Schmerz um meine Brust und die Rippen herum. Erschrocken gab ich ein leises Kläffen von mir.
»Was ist los?« Samuel fuhr sanft mit dem Finger an meinem Kinn entlang.
Auch das tat weh. Ich zuckte zusammen, und er nahm die Hände weg.
»Warten Sie«, sagte Stefan vom anderen Ende der Couch.
Seine Stimme klang irgendwie seltsam. Nach dem, was der von einem Dämon besessene Vampir mit ihm gemacht hatte, musste ich mich davon überzeugen, dass es Stefan gut ging. Ich drehte mich um, winselnd vor Unbehagen, bis ich ihn ansehen konnte.
Er hatte am Fuß der Couch auf dem Boden gesessen, aber als ich ihn ansah, kniete er sich hin – genau in der Position, die er eingenommen hatte, als der Zauberer ihn im Bann hielt.
Ich sah aus dem Augenwinkel, wie Samuel sich plötzlich nach vorn bewegte. Aber Stefan wich seiner Hand aus. Er bewegte sich auf seltsame Weise. Erst dachte ich, er sei verletzt, aber dann wurde mir klar, dass er sich bewegte wie Marsilia, die Herrin der hiesigen Siedhe – wie eine Marionette, oder wie ein steinalter Vampir, der vergessen hat, wie man sich als Mensch benimmt.
»Friede, Wolf«, sagte Stefan, und ich erkannte, was mit seiner Stimme nicht in Ordnung war. Sie war tot, aller Gefühle beraubt. »Versuchen Sie, ihr das Geschirr abzunehmen. Ich denke, sie wollte sich verändern, aber das kann sie nicht, solange sie es trägt.«
Mir war nicht klar gewesen, dass ich das Ledergeschirr immer noch anhatte. Samuel zischte, als er die Schnallen berührte.
»Sie sind aus Silber«, sagte Stefan, ohne sich weiter zu nähern. »Ich kann sie aufmachen, wenn Sie mich lassen.«
»Sie werden einiges erklären müssen, Vampir«, knurrte Samuel.
Samuel war der ruhigste, gleichmütigste Werwolf, den ich kannte – was nicht unbedingt viel zu sagen hat –, aber ich konnte die Drohung in seiner Stimme hören, die meinen Brustkorb zum Vibrieren brachte.
»Sie haben mir Fragen gestellt, die ich nicht beantworten kann«, antwortete Stefan ruhig, aber nun klang er wieder menschlicher. »Ich gehe davon aus, dass Mercedes Ihre Neugier befriedigen kann, ebenso wie die meine. Aber erst muss ihr jemand dieses Geschirr abnehmen, damit sie sich wieder in einen Menschen verwandeln kann.«
Samuel zögerte, dann trat er ein wenig zurück. »Also machen Sie schon.« Diesmal lag noch mehr Knurren in seiner Stimme.
Stefan bewegte sich langsam und wartete darauf, dass Samuel zur Seite trat, bevor er mich berührte. Er roch nach meinem Shampoo, und sein Haar war feucht. Er hatte sich offenbar geduscht, und irgendwo saubere Kleidung gefunden. Nichts in dem Hotelzimmer war dem Blut der Ermordeten entgangen. Meine eigenen Pfoten waren immer noch blutig.
Sofort hatte ich wieder ein lebhaftes Bild vor Augen, wie nass der Teppichboden von dunklen Körperflüssigkeiten gewesen war. Ich hätte mich übergeben, aber der plötzliche, scharfe Schmerz in meinem Kopf schnitt durch die Übelkeit – eine willkommene Ablenkung.
Stefan brauchte nicht lange, um das Geschirr aufzuschnallen, und sobald er zurückgetreten war, veränderte ich mich. Stefan überließ Samuel wieder den Platz an meiner Seite.
Mein Mitbewohner kniff zornig die Lippen zusammen, als er meine Schulter berührte. Ich schaute hinunter und sah, wie geprellt und aufgescheuert meine Haut dort war, wo das Geschirr gesessen hatte. Überall gab es kleine rostfarbene Flecken von getrocknetem Blut. Ich sah aus, als hätte ich einen Autounfall gehabt.
Der Gedanke an Autos ließ mich an die Werkstatt denken. Ich schaute aus dem Fenster, aber der Himmel war noch dunkel.
»Wie spät ist es?«, fragte ich. Meine Stimme war ein heiseres Krächzen.
Es war der Vampir, der antwortete. »Viertel vor sechs.«
»Ich muss mich anziehen«, sagte ich und stand abrupt auf, was ein Fehler war. Ich fasste an meinen Kopf, fluchte und setzte mich wieder hin, um nicht umzufallen.
Samuel nahm mir die Hände von der Stirn. »Mach die Augen auf, Mercy.«
Ich tat mein Bestes, aber mein linkes Auge wollte sich nicht sonderlich gut öffnen. Sobald beide annähernd offen waren, blendete er mich mit einer kleinen Taschenlampe.
»Verdammt noch mal, Sam«, sagte ich und versuchte, mich ihm zu entziehen.
»Nur noch einmal.« Er war gnadenlos und zog diesmal mein blaues, linkes Auge auf. Dann legte er die Taschenlampe beiseite und fuhr mit den Händen über meinen Kopf. Ich zischte, als seine Finger eine wunde Stelle fanden. »Keine Gehirnerschütterung, Mercy, aber du hast eine dicke Beule hinten am Kopf, ein prächtiges Veilchen, und wenn ich mich nicht irre, wird die linke Seite deines Gesichts sich ebenfalls verfärben, noch bevor es hell wird. Warum behauptet dieser Blutsauger also, dass du die letzte Dreiviertelstunde bewusstlos gewesen bist?«
»Inzwischen eher eine Stunde«, sagte Stefan. Er saß wieder auf dem Boden, weiter entfernt von mir als zuvor, aber er beobachtete mich mit der Intensität eines Raubtiers.
»Ich weiß es nicht«, sagte ich, und das kam zittriger heraus, als mir lieb war.
Samuel setzte sich neben mich auf die Couch, griff nach der schmalen Decke, die den Schaden verbergen sollte, den Medea an der Couchlehne angerichtet hatte, und wickelte mich hinein. Er streckte die Hände nach mir aus, und ich wich zurück. Der Wunsch eines dominanten Wolfs, die Seinen zu beschützen, war ein mächtiger Instinkt – und Samuel war sehr dominant. Wenn ich ihm auch nur einen Zoll gab, würde er die ganze Welt und mein Leben übernehmen.
Dennoch, er roch nach dem Fluss, nach der Wüste und nach Fell – und diesem vertrauten Duft, der nur zu ihm gehörte. Ich hörte auf, mich ihm zu widersetzen, und ließ meinen schmerzenden Kopf an seinem Arm ruhen. Diese Wärme an meiner Schläfe half gegen die Kopfschmerzen. Vielleicht würde mein Kopf ja doch nicht abfallen, wenn ich mich einfach nicht mehr bewegte. Samuel gab ein leises, beruhigendes Geräusch von sich, und fuhr mit seinen kundigen Fingern durch mein Haar, wobei er die Beule sorgsam vermied.
Ich hatte ihm die Taschenlampe weder vergessen noch verziehen, aber dafür würde ich mich rächen, wenn es mir besser ging. Es war lange her, seit ich mich an jemanden angelehnt hatte, und obwohl ich wusste, wie dumm es war, Samuel sehen zu lassen, dass ich mich schwach fühlte, konnte ich mich nicht dazu durchringen, mich von ihm zu entfernen.
Ich hörte, wie Stefan in die Küche ging, den Kühlschrank öffnete und in den Schränken herumsuchte. Dann kam der Geruch des Vampirs näher, und er sagte: »Lassen Sie Mercy etwas trinken. Das wird helfen.«
»Wogegen helfen?« Samuels Stimme war erheblich tiefer als sonst. Wenn mein Kopf ein bisschen weniger wehgetan hätte, wäre ich abrupt von ihm weggerückt.
»Dehydrierung. Sie ist gebissen worden.«
Stefan hatte Glück, dass ich an Samuel lehnte. Der Werwolf wollte aufspringen, hielt aber auf halbem Weg inne, als ich bei der plötzlichen Bewegung wimmerte.
Na gut, ich spielte ein bisschen Theater, aber es hielt Samuel immerhin davon ab, den Vampir anzugreifen. Nicht Stefan war der Bösewicht. Wenn er sich von mir genährt hatte, war das sicher notwendig gewesen. Ich war nicht in der Verfassung, mich zwischen die beiden zu stellen, also gab ich mich hilflos. Ich wünschte nur, ich hätte mich dazu ein bisschen mehr anstrengen müssen.
Samuel setzte sich wieder hin und strich mir das Haar vom Hals. Seine Fingerspitzen berührten eine wunde Stelle an einer Seite, die mir bisher unter all den anderen Wunden und Prellungen nicht weiter aufgefallen war. Sobald er sie allerdings berührte, brannte sie, und der Schmerz zog sich bis zum Schlüsselbein.
»Das stammt nicht von mir«, sagte Stefan, aber seine Stimme klang unsicher, als wäre er nicht vollkommen überzeugt. Ich hob den Kopf, um ihn anzusehen. Aber was immer in seiner Stimme mitschwang, änderte nichts an seinem leeren Gesichtsausdruck.
»Wenn man von Blutarmut einmal absieht, ist sie nicht in Gefahr«, sagte er zu Samuel. »Es braucht mehr als einen einzigen Biss, um einen Menschen in einen Vampir zu verwandeln – und ich bin nicht sicher, ob das bei Mercy überhaupt möglich wäre. Wenn sie ein Mensch wäre, müssten wir uns Sorgen machen, dass er sie zu sich rufen und ihr befehlen könnte, ihm zu gehorchen – aber Walker lassen sich durch unsere Magie nicht beeinflussen. Sie braucht nur Flüssigkeit und Ruhe.«
Samuel versetzte dem Vampir einen scharfen Blick. »Ein wahrer Quell der Weisheit. Wenn Sie sie nicht gebissen haben, wer dann?«
Stefan lächelte schwach und nicht gerade herzlich, und reichte Samuel das Glas Orangensaft, das er ihm schon vorher zu geben versucht hatte. Ich wusste, warum er es Samuel reichte und nicht mir. Samuel konnte sehr besitzergreifend sein – ich war beeindruckt, dass ein Vampir ihn so gut verstehen konnte.
»Ich glaube, Mercy könnte das besser erzählen«, sagte Stefan mit einer Spur uncharakteristischer Nervosität, die mich davon ablenkte, mir wegen Samuels Besitzansprüchen Gedanken zu machen.
Warum wollte Stefan unbedingt hören, was ich zu sagen hatte? Er war doch ebenfalls dort gewesen.
Ich nahm das Glas von Samuel entgegen, und setzte mich aufrecht hin. Mir war nicht klar gewesen, welchen Durst ich hatte, bevor ich anfing zu trinken. Normalerweise habe ich für Orangensaft nicht viel übrig – Samuel ist derjenige, der ihn trinkt –, aber in diesem Augenblick kam er mir vor wie Ambrosia.
Es war allerdings kein magisches Getränk. Als ich fertig war, tat mein Kopf immer noch weh, und ich wollte unbedingt ins Bett kriechen und mir die Decke über den Kopf ziehen, aber ich würde keine Ruhe bekommen, bevor Samuel alles wusste – und Stefan hatte offenbar nicht vor, zu reden.
»Stefan hat mich vor ein paar Stunden angerufen«, begann ich. »Ich schuldete ihm einen Gefallen, weil er uns geholfen hat, als Jesse entführt worden war.«
Sie hörten beide gebannt zu. Stefan nickte hin und wieder. Als ich zu der Stelle kam, an der wir das Hotelzimmer betraten, setzte er sich in die Nähe meiner Füße auf den Boden. Er lehnte sich gegen die Couch zurück, wandte den Kopf ab und schlug die Hand vor die Augen. Vielleicht wurde er einfach nur müde. Hinter den Fensterläden zeigten sich die ersten schwachen Spuren der Morgendämmerung, als ich den Bericht über meinen vergeblichen Versuch, Littleton umzubringen, und meinen darauffolgenden Aufprall an der Wand beendete.
»Bist du sicher, dass es sich so ereignet hat?«, fragte Stefan, ohne die Hand von den Augen zu nehmen.
Ich setzte mich kerzengerade auf und sah ihn mit gerunzelter Stirn an. »Selbstverständlich bin ich das.« Er war selbst da gewesen, warum klang er also, als zweifelte er an meinen Worten?
Er rieb sich die Augen und sah mich an, und als er etwas sagte, klang er erleichtert. »Nichts für ungut, Mercy. Aber deine Erinnerung an den Tod dieser Frau unterscheidet sich vollkommen von meiner.«
Ich sah ihn forschend an. »Inwiefern?«
»Du sagst, ich hätte einfach auf dem Boden gekniet, während Littleton das Zimmermädchen ermordete?«
»Stimmt.«
»Daran erinnere ich mich nicht«, sagte er so leise, dass ich ihn kaum hören konnte. »Ich erinnere mich daran, dass der Zauberer sie herausbrachte, dass ihr Blut mich rief, und ich antwortete.« Er leckte sich die Lippen, und die Mischung aus Hunger und Entsetzen in seinen Augen ließ mich den Blick abwenden. Er fuhr sehr leise fort, beinahe, als spräche er mit sich selbst. »Ich habe mich lange, lange Zeit nicht mehr von der Blutgier überwältigen lassen.«
»Nun«, begann ich, unsicher, ob das, was ich ihm zu sagen hatte, ihm helfen oder ihm noch mehr wehtun würde. »Du hast nicht gerade anziehend ausgesehen. Deine Augen glühten, und du hast die Zähne gebleckt. Aber du hast ihr nichts getan.«
Einen Augenblick bemerkte ich eine schwache Spiegelung des roten Glühens, das ich im Hotelzimmer gesehen hatte, in seinen Augen. »Ich erinnere mich daran, das Blut der Frau genossen zu haben, ich hatte es an Händen und Gesicht. Es war immer noch da, als ich dich nach Hause brachte, und ich musste es abwaschen.« Er schloss die Augen. »Es gibt eine alte Zeremonie … sie ist jetzt verboten, und das seit langer Zeit, aber ich erinnere mich …« Er schüttelte den Kopf und starrte seine Hände an, die er um ein Knie gelegt hatte. »Ich habe noch immer ihren Geschmack im Mund.«
Diese Worte hingen einige Zeit unbehaglich in der Luft, bevor er fortfuhr.
»Ich bin in ihrem Blut versunken« – das sagte er, als handele es sich um einen ganz bestimmten Begriff, der noch eine zweite Bedeutung hatte. »Als ich wieder zu mir kam, war der andere Vampir fort. Die Frau lag so da, wie ich sie in Erinnerung hatte, und du warst bewusstlos.«
Er schluckte, dann starrte er das heller werdende Fenster an, und seine Stimme wurde eine Oktave tiefer, wie es manchmal auch bei Wölfen passierte. »Ich konnte mich nicht erinnern, was dir zugestoßen war.«
Er streckte die Hand aus und berührte meinen Fuß, den nächsten Körperteil, den er erreichen konnte. Als er wieder sprach, klang er beinahe normal. »Blutgier kann durchaus den Verlust von Erinnerungen bewirken.« Er bewegte die Hand und schloss sie vorsichtig um meine Zehen, seine Haut fühlte sich an meiner kühl an. »Aber für gewöhnlich verdrängt sie nur unwichtige Dinge. Du bist mir wichtig, Mercedes. Ich nahm an, dass du für Cory Littleton wahrscheinlich unwichtig warst. Und dieser Gedanke gab mir Hoffnung, während ich uns hierherfuhr.
Ich war wichtig für Stefan? Ich war nur seine Mechanikerin. Er hatte mir einen Gefallen getan, und letzte Nacht hatte ich meine Schuld mit Zinsen zurückgezahlt. Wir mochten Freunde sein – nur, dass ich nicht glaubte, dass Vampire wirklich Freunde hatten. Ich dachte einen Moment darüber nach und erkannte, dass Stefan mir tatsächlich etwas bedeutete. Wenn ihm heute Nacht etwas zugestoßen wäre, etwas Dauerhafteres als sein Tod, hätte mir das wehgetan. Vielleicht empfand er ebenso.
»Sie glauben, er hat ihr Gedächtnis beeinflusst?«, fragte Samuel, während ich immer noch nachdachte. Er rutschte näher und legte den Arm um meine Schultern. Es fühlte sich gut an. Zu gut. Ich beugte mich auf der Couch nach vorn, weg von Samuel – und Stefan nahm die Hand von meinem Fuß, als ich mich bewegte.
Stefan nickte. »Entweder stimmt meine Erinnerung oder die von Mercy. Aber ich glaube nicht, dass er Mercy beeinflussen konnte, obwohl er ein Zauberer ist. So etwas funktioniert bei Walkern wie ihr nicht – nicht, solange er sich nicht wirklich angestrengt hat.«
Samuel gab ein Brummen von sich. »Ich wüsste nicht, wieso es für ihn wichtig sein sollte, dass Mercy Sie nicht für einen Mörder hält – besonders, wenn er sie ohnehin nur