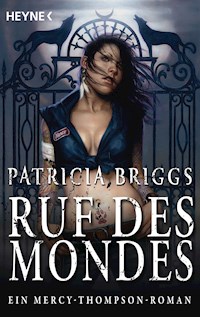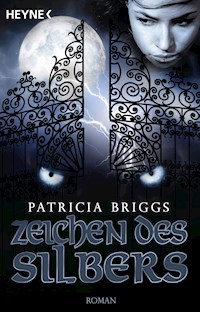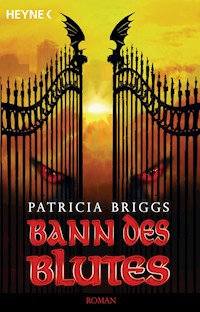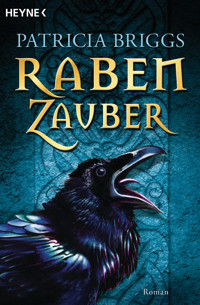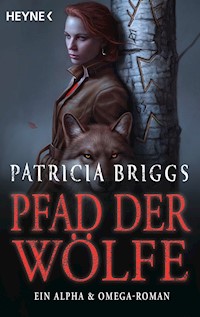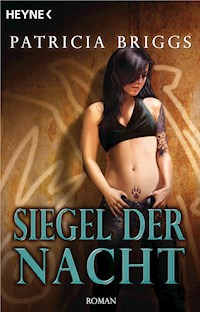
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Mercy-Thompson-Reihe
- Sprache: Deutsch
Aufregend, sexy, magisch
Mercy Thompson ist stolze Besitzerin einer Autowerkstatt. Und sie hat das außergewöhnliche Talent, sich in einen Kojoten zu verwandeln – eine Gabe, die sie von ihrem verstorbenen Vater geerbt hat, zu dem sie niemals Kontakt hatte. Doch als sich in den Tiefen des Columbia River das Böse regt, bleibt Mercy nur eine Möglichkeit, um ihr Leben zu retten: Sie muss die Familie ihres Vaters finden ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 471
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Das Buch
»Gestatten, mein Name ist Mercedes Thompson, und ich bin kein Werwolf …«
Automechanikerin und Walkerin Mercy Thompson hat mehr als nur ein Problem zu bewältigen: Nicht nur, dass ihre im kleinen Kreis geplante Hochzeit mit Werwolf-Alpha Adam in einer riesigen Überraschungsparty endet, auch ihre Hochzeitsreise wird alles andere als idyllisch. Während ihres romantischen Campingurlaubs am Ufer des Columbia River werden Mercy und Adam Zeugen einiger mysteriöser »Unfälle«, die sich im Wasser des Flusses ereignen. Wie sich herausstellt, ist in den Tiefen des Columbia River eine uralte und mächtige Kreatur erwacht, die ihre Opfer ins Wasser lockt, um sie dort zu töten. Mercy kann den Flussteufel aber nur besiegen, wenn sie sich mit den Traditionen und Mythen ihrer indianischen Vorfahren vertraut macht – und die Zeit wird knapp, denn mittlerweile hat das Böse auch sie selbst im Visier …
Die Autorin
Patricia Briggs, Jahrgang 1965, wuchs in Montana auf und interessiert sich seit ihrer Kindheit für Phantastisches. So studierte sie neben Geschichte auch Deutsch, denn ihre große Liebe gilt Burgen und Märchen. Neben erfolgreichen und preisgekrönten Fantasy-Romanen wie Drachenzauber und Rabenzauber widmet sie sich ihrer Mystery-Saga um Mercy Thompson. Nach mehreren Umzügen lebt die Bestsellerautorin heute gemeinsam mit ihrer Familie in Washington State.
Inhaltsverzeichnis
Für Derek, Michelle, Jodi, Kari, Elaine und Megan – es war aber auch Zeit, dass ihr eine bekommt. Und für Laura und Genevieve – willkommen in der Familie.
Aus dem
DALLAS CHRONICLE
Zwei Einheimische immer noch vermisst
Thomas Kerrington (62) und sein Sohn Christopher Kerrington (40) werden weiterhin vermisst, obwohl das Boot, in dem sie zum Angeln gefahren waren, inzwischen gefunden wurde. Das Boot wurde gestern zwei Meilen unterhalb des John-Day-Dammes gefunden. Die Männer sind am Montag zu einem frühen Angelausflug aufgebrochen und nicht mehr zurückgekehrt. Wasserwachtbeamter Max Whitehead erklärte: »In diesem Jahr haben wir außergewöhnlich viele Bootsunfälle auf dem Columbia. Wir erhöhen die Anzahl der Patrouillen und fordern jeden Bootsfahrer auf, Sicherheit groß zu schreiben.« Suchmannschaften gehen den Fluss ab, aber nach vier Tagen gibt es kaum noch Hoffnung, die zwei Männer lebend zu finden.
Aus den
HOOD RIVER NEWS
Die Anzahl der Fische ist diese Woche sowohl am John-Day-Damm als auch am The-Dalles-Damm viel zu niedrig. Allen Robb vom Oregon Department of Fish and Wildlife: »Wir machen uns Sorgen, dass jemand zwischen den Dämmen Giftmüll im Fluss versenkt hat. Es gibt einen signifikanten Einbruch in der Fischpopulation und unsere Mitarbeiter erklären, dass dies besonders für unsere größeren Fische gilt, wie zum Beispiel den ausgewachsenen Silberlachs.« Obwohl großangelegte Testreihen durchgeführt werden, wurden bis jetzt weder Anzeichen für Gift im Fluss noch eine übermäßig hohe Anzahl toter Fische gefunden. »Die Fische sind verängstigt«, erklärte der ansässige Angelführer John Turner Bowman.
Im Licht der Straßenlampen konnte ich erkennen, dass das Gras in Stefans Vorgarten von der Sommerhitze zu einem hellen Gelb getrocknet worden war. Der Rasen war gemäht worden, aber nur mit Blick auf die Länge, nicht auf die Ästhetik. Nach der Länge der gemähten Reste zu schließen, hatte der Rasen so lange frei wachsen dürfen, bis die Stadt verlangt hatte, ihn endlich zu mähen. Das restliche Gras war inzwischen so trocken, dass es wahrscheinlich nie wieder gemäht werden musste, wenn nicht bald jemand anfing zu gießen.
Ich fuhr mit dem Golf vors Haus und parkte. Als ich Stefans Haus das letzte Mal gesehen hatte, hatte es sich perfekt in die schicke Nachbarschaft eingefügt. Die Verwahrlosung des Vorgartens hatte noch nicht auf das Haus übergegriffen, aber ich machte mir Sorgen um seine Bewohner.
Stefan war belastbar, klug, und … einfach Stefan – dazu in der Lage, mit einem tauben Jungen in Zeichensprache über Pokemon zu sprechen und scheußliche Bösewichte zu besiegen, während er in einem Käfig gefangen saß, um dann in seinem VW-Bus davonzufahren, um auch am nächsten Tag wieder gegen das Böse anzutreten. Er war wie Supermann, aber mit Reißzähnen und etwas eigenwilligen Moralvorstellungen.
Ich stieg aus und ging auf die vordere Veranda zu. In der Einfahrt sah Scooby-Doo mich durch eine Staubschicht auf Stefans sonst so sorgfältig gepflegtem Bus erwartungsvoll an. Ich hatte Stefan das riesige Stofftier geschenkt, weil es so gut zur Mystery-Machine-Lackierung passte.
Ich hatte seit Monaten nichts mehr von Stefan gehört, um genau zu sein seit Weihnachten. Ich war ziemlich beschäftigt gewesen und für einen Tag entführt zu werden (was sich für alle anderen als ein Monat herausstellte, weil Feenköniginnen so etwas anscheinend können), war nur ein Teil des Ganzen. Aber im letzten Monat hatte ich ihn einmal pro Woche angerufen und jedes Mal war nur sein Anrufbeantworter angesprungen. Letzte Nacht hatte ich ihn vier Mal angerufen, um ihn zu einem Schundfilm-Abend einzuladen. Uns fehlte noch jemand, nachdem Adam – mein Gefährte, Verlobter und Alpha des Columbia Basin Rudels – geschäftlich unterwegs war.
Adam besaß eine Securityfirma, die bis vor kurzem hauptsächlich für die Regierung gearbeitet hatte. Seitdem die Werwölfe – und Adam – in die Öffentlichkeit getreten waren, erlebte sein Geschäft auch in anderen Bereichen einen Boom. Anscheinend hielt die Welt Werwölfe für herausragende Securityleute. Er suchte bereits nach jemandem, der die ganzen Reisen übernehmen konnte, aber bis jetzt hatte er den Richtigen dafür noch nicht gefunden.
Nachdem Adam nicht da war, konnte ich den anderen Leuten in meinem Leben mehr Aufmerksamkeit schenken. Ich hatte entschieden, dass Stefan genug Zeit gehabt hatte, sich die Wunden zu lecken, aber so wie es aussah, kam ich ein paar Monate zu spät.
Ich klopfte an die Tür. Als das keinerlei Reaktion auslöste, klopfte ich nochmal den universellen Geheimcode Ta-tatatamtam-tamtam. Ich war bereits zu wildem Hämmern übergegangen, als der Riegel endlich zurückgezogen wurde und die Tür aufschwang.
Ich brauchte eine Weile, bis ich Rachel erkannte. Als ich sie das letzte Mal gesehen hatte, hatte sie ausgesehen wie ein Model, das als desillusioniertes Gothik-Mädchen oder weggelaufener Teenager posierte. Jetzt wirkte sie eher wie eine Cracksüchtige. Sie hatte ungefähr fünfzehn Kilo verloren, die sie nie zu viel gehabt hatte. Ihre Haare hingen in fettigen, ungekämmten Strähnen über ihre Schultern. Verblasste Mascara-Spuren zogen sich über ihre Wangen, so dass sie wunderbar in Die Nacht der lebenden Toten gepasst hätte. Sie hatte Verletzungen am Hals und sie bewegte sich als täte ihr alles weh. Ich versuchte, mir mein Entsetzen darüber nicht anmerken zu lassen, dass ihr die letzten zwei Finger an der rechten Hand fehlten. Die Wunde war verheilt, aber die Narben waren noch rot und auffällig.
Marsilia, die Herrin der Vampire im Tri-Cities-Gebiet, hatte Stefan, ihren treuen Ritter, benutzt, um Verräter zu vertreiben. Ein Teil ihres Planes hatte es erfordert, seine Menagerie zu entführen – die Menschen, die er sich hielt, um sich von ihnen zu nähren – und ihn glauben zu lassen, sie wären tot, indem sie seine Blutsbande zu ihm brach. Sie schien zu denken, dass es auch nötig gewesen war, sie zu foltern, aber ich traute keinem Vampir – außer Stefan – zu, dass er tatsächlich die Wahrheit sagte. Marsilia hatte nicht erwartet, dass Stefan noch Einwände gegen diese Instrumentalisierung von ihm und seiner Menagerie erheben würde, wenn er erfuhr, dass sie es nur getan hatte, um sich selbst zu schützen. Er war schließlich ihr loyaler Krieger. Doch sie hatte offenbar unterschätzt, wie schwer es Stefan fiel, ihren Verrat zu verarbeiten. So wie es aussah, erholte er sich nicht besonders gut davon.
»Du verschwindest besser wieder, Mercy«, erklärte mir Rachel ausdruckslos. »Es ist nicht sicher.«
Ich stemmte eine Hand gegen die Tür, bevor sie sie wieder schließen konnte. »Ist Stefan da?«
Sie keuchte ein wenig. »Er wird nicht helfen. Das tut er nicht.«
Wenigstens klang das nicht so, als wäre Stefan die Gefahr, vor der sie mich gewarnt hatte. Sie hatte den Kopf gedreht, als ich die Tür gestoppt hatte, und ich sah, dass jemand an ihrem Hals gekaut hatte. Menschliche Zähne, so wie es aussah, keine Reißzähne, aber die Krusten verliefen an den Sehnen zwischen ihrem Schlüsselbein und ihrem Kinn entlang und sahen furchtbar aus.
Ich rammte die Tür auf und trat weit genug vor, um den Schorf zu berühren. Rachel wich zurück, sowohl vor der Tür als auch vor mir.
»Wer hat das getan?«, fragte ich. Ich konnte einfach nicht glauben, dass Stefan zuließ, dass sie wieder jemand verletzte. »Einer von Marsilias Vampiren?«
Sie schüttelte den Kopf. »Ford.«
Für einen Moment hatte ich keine Ahnung, von wem sie sprach. Dann erinnerte ich mich an den großen Mann, der mich das letzte Mal, als ich Stefans Haus betreten hatte, rausgeworfen hatte. Er war halb in einen Vampir verwandelt und überwiegend verrückt – und war schon so gewesen, bevor Marsilia ihn in die Finger bekommen hatte. Ein wirklich scheußlicher, furchterregender Kerl – und ich ging davon aus, dass er schon beängstigend gewesen war, bevor er überhaupt jemals einen Vampir gesehen hatte.
»Wo ist Stefan?«
Ich habe keinen Nerv für Dramen, die damit enden, dass Leute verletzt werden. Es war Stefans Aufgabe, sich um seine Leute zu kümmern, auch wenn die meisten Vampire ihre Menagerie nur als praktischen Snack sahen und viele der Menschen langsam und scheußlich über einen Zeitraum von bis zu sechs Monaten hinweg starben.
Stefan war anders gewesen. Ich wusste, dass Naomi, die Frau, die ihm den Haushalt führte, seit dreißig Jahren oder mehr bei ihm war. Stefan war vorsichtig. Er hatte versucht zu beweisen, dass Leben möglich war ohne zu töten. So wie Rachel jetzt aussah, bemühte er sich nicht mehr allzu sehr.
»Du kannst nicht reinkommen«, sagte sie. »Du musst gehen. Wir sollen ihn nicht stören, und Ford…«
Der Boden im Flur war dreckig und meine Nase witterte verschwitzte Körper, Schimmel und den sauren Geruch alter Angst. Das gesamte Haus stank für meine empfindliche Kojotennase wie eine Mülldeponie. Für den normalen menschlichen Geruchssinn roch es wahrscheinlich genauso.
»Und wie ich ihn stören werde«, erklärte ich ihr grimmig. Irgendjemand musste es offensichtlich tun. »Wo ist er?«
Als klar wurde, dass sie mir nicht antworten konnte oder wollte, ging ich tiefer ins Haus und schrie seinen Namen, wobei ich den Kopf in den Nacken legte, damit der Schall auch über die Treppe nach oben drang. »Stefan! Schaff deinen Hintern hier runter. Ich habe ein oder zwei Hühnchen mit dir zu rupfen. Stefan! Du hattest jetzt genug Zeit, um dich in Selbstmitleid zu suhlen. Entweder du bringst Marsilia um – und dabei werde ich dir helfen – oder du kommst drüber weg.«
Rachel hatte angefangen, an meiner Kleidung zu zupfen, um mich wieder aus dem Haus zu ziehen. »Er kann nicht nach draußen«, sagte sie drängend. »Stefan zwingt ihn dazu, drinnen zu bleiben. Mercy, du musst wieder rausgehen.«
Ich bin zäh und stark und sie zitterte vor Müdigkeit und, wahrscheinlich, Eisenmangel. Ich hatte keinerlei Problem damit, dort stehen zu bleiben.
»Stefan!«, brüllte ich wieder.
Dann passierten sehr schnell eine Menge Dinge, so dass ich später darüber nachdenken musste, um sie in die richtige Reihenfolge zu bringen.
Rachel sog die Luft ein und erstarrte, während sie plötzlich meinen Arm umklammerte, statt an mir zu ziehen. Aber sie verlor den Halt, als jemand mich von hinten packte und mich auf das Klavier warf, das an einer Wand zwischen Flur und Wohnzimmer stand. Es machte so einen Lärm, dass das Geräusch meines Aufpralls und der Schmerz in meinem Rücken sich zu einer einzigen Empfindung verbanden. Die Übung unzähliger Karatestunden verhinderte, dass ich mich verspannte, und so rollte ich einfach vom Klavier herunter. Nicht witzig. Mein Gesicht knallte auf den Fliesenboden. Dann landete ein schlaffer Haufen neben mir und plötzlich schaute ich Ford ins Gesicht, dem großen, furchterregenden Kerl, der sich unverständlicherweise neben mich geworfen zu haben schien. Aus einem seiner Mundwinkel tropfte Blut.
Er sah anders aus als das letzte Mal, schmaler und dreckiger. Seine Kleidung war mit Schweiß, altem Blut und Sexgerüchen vollgesogen. Aber seine Augen waren weit aufgerissen und überrascht wie die eines Kindes.
Dann blockierten ein verblichenes purpurnes T-Shirt über dreckigen Jeans und lange, verknotete Haare meinen Blick auf Ford.
Mein Beschützer war ebenfalls zu dünn, zu ungepflegt, aber meine Nase verriet mir, dass es Stefan war, noch bevor mein Hirn die Frage ausspucken konnte. Ungewaschener Vampir ist besser als ungewaschener Mensch, aber angenehm ist es auch nicht.
»Nein«, sagte Stefan mit sanfter Stimme. Ford schrie auf und Rachel gab ein Quietschen von sich.
»Mir geht’s gut, Stefan«, erklärte ich und rollte mich steif auf Hände und Knie. Aber er ignorierte mich.
»Wir tun unseren Gästen kein Leid an«, sagte Stefan und Ford wimmerte.
Ich stand auf und ignorierte die Schmerzen in meinen Schultern und meiner Hüfte. Morgen würde ich bestimmt blaue Flecken haben, aber auch nicht mehr – das hatte ich den manchmal brutalen Fall-Lehrstunden meines Sensei zu verdanken. Und auch das Klavier sah aus, als würde es unsere Begegnung überleben.
»Es war nicht Fords Fehler«, sagte ich laut. »Er versucht nur, deinen Job zu machen.« Ich wusste nicht, ob das stimmte oder nicht; ich vermutete, dass Ford einfach verrückt war. Aber ich hätte fast alles probiert, um Stefans Aufmerksamkeit zu erregen.
Immer noch zwischen mir und Ford zusammengekauert, drehte Stefan den Kopf, um mich anzusehen. Seine Augen waren kalt und hungrig und er musterte mich, als wäre ich eine vollkommen Fremde.
Aber es hatten schon schlimmere Monster als er versucht, mich einzuschüchtern, also zuckte ich nicht einmal mit den Wimpern.
»Du sollst auf diese Leute aufpassen«, blaffte ich ihn an. Okay, dann machte er mir eben doch Angst, weshalb ich schnippisch wurde. Wütend zu werden, wenn man Angst hat, ist nicht immer das Klügste, und ich, die ich in einem Werwolfrudel aufgewachsen war, wusste es mit Sicherheit besser. Aber Stefan zu sehen und das, was aus seinem Haus geworden war, trieb mir die Tränen in die Augen – und ich hatte lieber Angst und war wütend, als zu heulen. Falls Stefan dachte, ich hätte Mitleid mit ihm, würde er mich nie helfen lassen. Kritik war leichter zu schlucken.
»Schau sie dir an …« Ich deutete auf Rachel und Stefans Blick folgte meiner Hand genauso wie dem Befehl in meiner Stimme. Diesen Befehlston lernte ich gerade erst von Adam. Es hatte ein paar Vorteile, die Gefährtin des Alpha-Werwolfs zu sein.
Stefan riss den Kopf zurück, als ihm klarwurde, was ich getan hatte. Dann fletschte er seine Reißzähne auf eine Art, die mich mehr an einen Werwolf erinnerte als an einen Vampir. Aber dann verblasste das Knurren auf seinem Gesicht und er blickte wieder zu Rachel.
Die Anspannung in seinen Schultern löste sich und er schaute zu Ford. Ich konnte das Gesicht des großen Mannes nicht sehen, aber für meine rudeltrainierten Augen sprach seine Körpersprache deutlich von Unterwerfung.
»Merda«, sagte Stefan und ließ Ford los.
»Stefan?«
Die Bedrohung war aus seinem Gesicht gewichen, aber mit ihr auch alle anderen Gefühle. Er schien fast wie betäubt.
»Geh duschen. Kämm dir die Haare und zieh dir andere Klamotten an«, befahl ich ihm schnell, um zuzuschlagen, während er noch schwach war. »Und trödle nicht, damit ich nicht zu lange der Gnade deiner Leute ausgeliefert bin. Ich führe dich heute Abend aus und du wirst mit Warren, Kyle und mir Schundfilme schauen. Adam ist nicht in der Stadt, also haben wir einen Platz frei.«
Warren war mein bester Freund, ein Werwolf und der Dritte in der Rangordnung des Columbia Basin Rudels. Kyle war ein Rechtsanwalt, Mensch und Warrens Liebhaber. Schundfilm-Abende waren unsere Art von Therapie, aber manchmal luden wir Leute ein, von denen wir dachten, sie hätten es nötig.
Stefan starrte mich ungläubig an.
»Du brauchst offensichtlich jemanden, der dir eins mit dem Viehtreiber überzieht, damit du dich in Bewegung setzt«, informierte ich ihn, während ich mit einer Geste auf den üblen Zustand seines Hauses und seiner Leute hinwies. »Aber stattdessen hast du mich, den freundlichen Kojoten aus der Nachbarschaft. Du kannst genauso gut gleich aufgeben, weil ich dich einfach nerven werde, bis du es doch tust. Und natürlich kenne ich einen Cowboy, der wahrscheinlich einen Viehtreiber besitzt, falls es so weit kommen sollte.«
Einer seiner Mundwinkel hob sich. »Warren ist ein Werwolf. Er braucht keinen Viehtreiber, um Kühe in Bewegung zu setzen.« Seine Stimme klang rau und ungeübt. Er warf noch einen Blick auf Ford.
»Der wird in nächster Zeit niemandem wehtun«, erklärte ich dem Vampir. »Aber wenn man mir genug Zeit gibt, kann ich die meisten Leute dazu bringen, gewalttätig zu werden, also solltest du dich beeilen.«
Plötzlich erklang ein knallendes Geräusch und Stefan war verschwunden. Ich wusste, dass er sich teleportieren konnte, auch wenn er es nur selten vor mir tat. Seine beiden Leute zuckten zusammen, also nahm ich an, dass sie es auch noch nicht oft gesehen hatten. Ich wischte mir die Hände an der Hose ab und wandte mich an Rachel.
»Wo ist Naomi?«, fragte ich. Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass sie die Dinge so schleifen lassen würde.
»Sie ist gestorben«, erklärte mir Rachel. »Marsilia hat sie gebrochen und wir konnten sie nicht wieder zusammensetzen. Ich glaube, das war für Stefan der letzte Schlag.« Sie warf einen kurzen Blick zur Treppe. »Wie hast du das gemacht?«
»Er will nicht, dass ich den Viehtreiber hole«, erklärte ich ihr.
Sie schlang die Arme um den Körper und ihre misshandelte Hand wurde deutlich sichtbar. Sie war verletzt worden, gebissen, böse zugerichtet – und sagte: »Wir haben uns solche Sorgen um ihn gemacht. Er spricht mit keinem von uns, nicht seitdem Naomi gestorben ist.«
Der arme Stefan hatte versucht, sich zusammenzurollen und zu sterben, weil Marsilia ihn verraten hatte – und er hatte sein Bestes gegeben, die Überreste seiner Menagerie mitzunehmen. Und Rachel machte sich Sorgen um ihn.
Um ihn.
»Wie viele von euch sind noch übrig?«, fragte ich. Naomi war eine ziemlich taffe Lady gewesen. Wenn sie gestorben war, war sie sicherlich nicht die einzige.
»Vier.«
Kein Wunder, dass Rachel so übel aussah. Vier Leute konnten einen Vampir nicht allein ernähren.
»War er jagen?«, fragte ich.
»Nein. Ich glaube nicht, dass er das Haus noch einmal verlassen hat, seitdem wir Naomi beerdigt haben.«
»Ihr hättet mich anrufen sollen.«
»Ja«, sagte Ford vom Boden, und seine Stimme war tief genug, um im Raum widerzuhallen. Er hatte die Augen geschlossen. »Das hätten wir tun sollen.«
Jetzt, wo er mich nicht angriff, erkannte ich, dass auch er viel zu dünn war. Das konnte gerade im Übergang vom Menschen zum Vampir nicht gut sein. Hungrige Jungvampire haben eine Tendenz dazu, auszuziehen und sich ihr eigenes Essen zu besorgen.
Stefan hätte sich darum kümmern müssen, bevor es so schlimm wurde.
Hätte ich wirklich einen Viehtreiber besessen, wäre ich vielleicht in Versuchung gewesen, ihn einzusetzen, zumindest, bis die Stufen knarrten und Stefan die Treppe herunterkam. Ich hatte in meinem Leben schon einiges gesehen – aber niemanden, der so ausgemergelt aussah wie Stefan in seinem grünen Scooby-Doo-T-Shirt, das er noch vor ein paar Monaten problemlos ausgefüllt hatte. Jetzt schlabberte es um seinen Körper. Geduscht sah er schlimmer aus als vorher.
Rachel hatte gesagt, dass Marsilia Naomi gebrochen hatte. Wenn ich mir Stefan so ansah, vermutete ich, dass die Herrin der Vampire auch nah dran gewesen war, Stefan zu brechen. Eines Tages, irgendwann, würde ich mich im selben Raum aufhalten wie Marsilia, während ich einen Holzpflock zur Hand hatte, und bei allen Heiligen, ich würde ihn benutzen. Natürlich nur, falls Marsilia und auch alle ihre Vampire bewusstlos waren. Sonst wäre ich einfach nur tot, weil Marsilia um einiges gefährlicher war als ich. Trotzdem bereitete es mir große Freude, mir vorzustellen, wie ich das Stück Holz in ihre Brust rammte.
Zu Stefan sagte ich: »Brauchst du einen Blutspender, bevor wir losziehen? Damit niemand uns anhält und mich dazu zwingt, dich entweder ins Krankenhaus oder in die Leichenhalle zu fahren?«
Er zögerte und sah zu Rachel und Ford. Dann runzelte er verwirrt und ein wenig verloren die Stirn. »Nein. Sie sind zu schwach. Es sind nicht genug von ihnen übrig.«
»Ich habe nicht von ihnen gesprochen, Zottelbär«, erklärte ich sanft. »Ich habe schon früher Blut gespendet und ich bin bereit, es nochmal zu tun.«
Rot leuchtende Augen richteten sich voller Hunger auf mich, bevor er zweimal blinzelte und sie wieder die Farbe von einem Glas Bier in der Sonne annahmen.
»Stefan?«
Er blinzelte wieder. Es war ein interessanter Effekt: rot, Sonnenbier, rot, Sonnenbier. »Adam wird das nicht gefallen.« Rot, rot, rot.
»Adam würde selbst spenden, wenn er hier wäre«, erklärte ich ihm wahrheitsgemäß und krempelte meinen Ärmel hoch.
Er nährte sich gerade an meiner Armbeuge, als mein Handy klingelte. Rachel half mir dabei, das Gerät aus der Tasche zu ziehen, und klappte es für mich auf. Ich hatte nicht das Gefühl, dass Stefan es auch nur bemerkte.
»Mercy, wo zur Hölle bist du?«
Darryl, Adams Stellvertreter, hatte es zu seiner Aufgabe gemacht, mich auf Kurs zu halten, während Adam nicht da war.
»Hey, Darryl«, sagte ich und bemühte mich, nicht zu klingen, als nährte ich gerade einen Vampir.
Mein Blick fiel auf Ford, der nie vom Boden aufgestanden war, sondern mich mit Augen anstarrte, die aussahen wie polierte gelbe Steine – Zitrin, vielleicht, oder Bernstein. Ich erinnerte mich nicht, welche Farbe seine Augen vor ein paar Minuten gehabt hatten, aber ich war davon überzeugt, dass ich diese abgefahrene Farbe auf jeden Fall bemerkt hätte. Aber noch bevor ich richtig Angst bekommen konnte, unterbrach Darryl meinen Gedankengang.
»Du bist vor einer Stunde zu Kyles Haus aufgebrochen und Warren hat mir gesagt, dass du noch nicht angekommen bist.«
»Das stimmt«, sagte ich gespielt überrascht. »Nein, wirklich. Ich bin noch nicht bei Warren.«
»Klugschwätzerin«, knurrte er.
Darryl und mich verbindet eine Art Hassliebe. Wann immer ich denke, er hasst mich, tut er etwas Nettes, wie mir das Leben zu retten oder mir wichtige Tipps zu geben. Dann entscheide ich, dass er mich mag, und er reißt mir den Arsch auf. Wahrscheinlich verwirre ich ihn einfach furchtbar, und das ist okay, weil dieses Gefühl auf Gegenseitigkeit beruht.
Darryl hasste von allen von Adams Wölfen Vampire am meisten. Hätte ich ihm gesagt, was ich gerade tat, wäre er mir mit Verstärkung zu Hilfe geeilt und es hätte Leichen gegeben. Werwölfe machen alles immer viel komplizierter als nötig.
»Ich habe es über dreißig Jahre lang ohne Babysitter ausgehalten«, erklärte ich ihm mit gelangweilter Stimme. »Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es auch ohne Babysitter zu Kyles Haus schaffe.« Mir wurde ein wenig schwindlig. Weil ich keine andere Möglichkeit hatte, tippte ich Stefan mit der Hand, in der ich das Telefon hielt, auf den Kopf.
»Was war das?«, fragte Darryl und Stefan packte meinen Arm fester.
Ich sog zischend die Luft ein, weil Stefan mir wehtat – und dann ging mir auf, dass Darryl auch das gehört hatte.
»Das war mein Liebhaber«, erklärte ich Darryl. »Entschuldige mich, ich muss ihm jetzt einen runterholen.« Und damit legte ich auf.
»Stefan«, sagte ich, aber es war unnötig. Er ließ mich los, wich ein paar Schritte zurück und ging auf ein Knie.
»Tut mir leid«, knurrte er. Er stützte die Fäuste auf dem Boden vor sich ab.
»Kein Problem«, sagte ich mit einem kurzen Blick auf meinen Arm. Die kleinen Wunden hatten sich bereits geschlossen, weil sein Speichel eine schnelle Heilung anregte. Im letzten Jahr hatte ich mehr über Vampire gelernt als im gesamten Rest meines Lebens. Die Unwissenheit war wunderbar gewesen.
Ich wusste zum Beispiel, dass durch meine Verbindung zu Adam keine negativen Nachwirkungen entstehen würden, weil ich Stefan wieder von mir hatte trinken lassen. Ein Mensch ohne diesen Schutz, der mehr als einmal einen Vampir nährt, wird zum Haustier – wie es alle Leute in seiner Menagerie waren: abhängig von dem Vampir und bereit, jedem Befehl zu folgen, den er gab.
Mein Handy klingelte wieder und diesmal, nachdem ich beide Hände frei hatte, nahm ich mir die Zeit, die Nummer zu kontrollieren. Darryl. Okay, vielleicht hatte es doch negative Auswirkungen, dass ich Stefan genährt hatte – aber das hatte mehr damit zu tun, dass Darryl mich bei Adam verpetzen würde als mit Stefan. Ich drückte einen Knopf an der Seite meines Handys und es hörte auf zu klingeln.
»Ich habe dich in Schwierigkeiten gebracht«, sagte Stefan.
»Mit Darryl?«, fragte ich. »Ich bringe mich ganz prima allein in Schwierigkeiten bei Darryl – und serviere ihm dann seinen eigenen Hintern auf einem Silbertablett, wenn er sich zu übel aufspielt.«
Stefan kam auf die Beine, legte den Kopf schräg und schenkte mir ein kleines Lächeln – und plötzlich sah er schon viel mehr aus wie er selbst. »Du? Miss Kojote gegen den großen bösen Wolf? Das glaube ich nicht.«
Wahrscheinlich hatte er Recht.
»Darryl ist nicht mein Hüter«, erklärte ich beherzt.
Er schnaubte. »Nein. Aber wenn dir etwas passiert, während Adam weg ist, trägt Darryl die Verantwortung dafür.«
»So dumm ist Adam nicht.«
Er wartete.
»Herrgott nochmal«, sagte ich und rief Darryl zurück.
»Mir geht es gut«, sagte ich zu ihm. »Ich dachte, Stefan müsste vielleicht mal wieder vor die Tür und bin vorbeigefahren, um ihn abzuholen. Ich rufe dich gleich aus Kyles Einfahrt an, dann kannst du Adam anrufen und ihm sagen, dass ich sicher angekommen bin. Und du kannst ihm auch ausrichten, dass ich ganz gut auf mich selbst aufpassen kann, solange keine verrückten Feenköniginnen, Sumpfmonster oder größenwahnsinnige Vergewaltiger hinter mir her sind.«
Darryl atmete hörbar ein. Wahrscheinlich war es der Vergewaltigerkommentar, aber ich war es leid, das Thema zu verdrängen. Der Mann war tot und ich hatte ihn umgebracht. Die Alpträume waren sehr selten geworden und wenn sie doch einmal auftraten, hatte ich Adam, um mit mir zusammen gegen sie zu kämpfen. Adam ist genau der, den man in einem Kampf auf seiner Seite haben will, selbst wenn man nur gegen böse Erinnerungen kämpft.
»Du hast von Dämonen besessene Vampire vergessen«, sagte Stefan in die Stille. Vampire können genauso wie Werwölfe private Telefongespräche mithören – so wie ich eigentlich auch. Seitdem ich ins Hauptquartier des Rudels eingezogen war, hatte ich mich ziemlich in die SMS verliebt.
»Allerdings«, sagte Darryl. Seine Stimme klang jetzt gleichzeitig weich und rau. »Wir versuchen, dir Luft zum Atmen zu geben, Mercy. Aber es ist schwer. Du bist so zerbrechlich und …«
»Unbedacht?«, bot ich an. »Dämlich?« Ich hatte gerade meinen braunen Gürtel in Karate errungen und als Lebensunterhalt repariere ich Autos. Zerbrechlich war ich eigentlich nur im Vergleich zu Werwölfen.
»Überhaupt nicht«, widersprach er mir, obwohl ich schon gehört hatte, wie er mich als unbedacht und dämlich und noch eine ganze Latte weiterer, nicht gerade freundlicher Dinge bezeichnete. »Deine Fähigkeit, alles zu überleben, was dir vor die Füße geworfen wird, sorgt dafür, dass der Rest von uns noch Tage danach Medikamente gegen Sodbrennen nehmen muss. Ich finde nicht, dass Maalox toll schmeckt.«
»Ich bin in Sicherheit. Mir geht es gut.« Bis auf ein paar blaue Flecken von meinem Aufprall auf dem Klavier – und, als ich einen Schritt vortrat, ein wenig Schwindel durch den Blutverlust. Darryl würde meine kleine Notlüge allerdings nicht bemerken. Auch wenn er eine Lüge genauso gut wittern konnte wie jeder andere Werwolf, war er doch nicht der Marrock, der meine Lügen schon erkannte, bevor ich sie ausgesprochen hatte, und das sogar am Telefon. Außerdem war ich ja quasi in Sicherheit – zwar beäugte ich Ford wachsam, aber er hatte sich immer noch nicht bewegt.
»Danke«, sagte Darryl. »Ruf mich an, wenn du bei Kyle angekommen bist.«
Ich legte auf. »Ich glaube, mir persönlich war es lieber, als das Rudel mich noch tot sehen wollte«, erklärte ich Stefan. »Bist du bereit zum Aufbruch?«
Stefan streckte eine Hand aus und zog Ford auf die Füße – nur um ihn dann gegen die Wand zu rammen. »Du wirst Mercy in Ruhe lassen«, sagte er.
»Ja, Meister«, antwortete Ford, der sich nicht im Geringsten gewehrt hatte, als Stefan ihn durch die Gegend schob.
Jegliches Gewaltpotenzial verließ Stefans Körper und er lehnte seine Stirn an die Schulter des größeren Mannes. »Es tut mir leid. Ich werde das in Ordnung bringen.«
Ford hob den Arm und tätschelte Stefan die Schulter. »Ja«, sagte er. »Natürlich wirst du das.«
Ich gebe zu, dass ich überrascht war, dass Ford mehr sagen konnte als »Gurgel, gurgel«.
Stefan löste sich von ihm und sah Rachel an.
»Gibt es in der Küche etwas zu essen?«
»Ja.« Dann schluckte sie schwer und sagte: »Ich könnte Hamburger machen und die anderen füttern.«
»Das wäre wunderbar, danke dir.«
Sie nickte, schenkte mir ein kleines Lächeln und verschwand in den Tiefen des Hauses – wahrscheinlich Richtung Küche. Ford folgte ihr wie ein großer Welpe … ein wirklich großer Welpe mit scharfen Zähnen.
Wir verließen das Haus und Stefan musterte die Überreste seines Rasens. Neben seinem Bus hielt er kurz an, schüttelte den Kopf und folgte mir dann zu meinem Auto. Er sagte nichts mehr, bis wir schon auf dem Highway neben dem Columbia River waren.
»Alte Vampire neigen zu Stimmungsschwankungen«, erklärte er mir. »Wir kommen nicht so gut mit Veränderungen klar wie zu der Zeit, als wir noch Menschen waren.«
»Ich bin in einem Werwolfrudel aufgewachsen«, erinnerte ich ihn. »Alte Wölfe gehen auch nicht gerade gut mit Veränderungen um.« Dann fügte ich, nur für den Fall, dass er dachte, ich hätte Mitleid mit ihm, noch hinzu: »Natürlich ziehen sie gewöhnlich nicht noch eine ganze Gruppe von Leuten mit in die Tiefe.«
»Tun sie nicht?«, murmelte er. »Seltsam. Ich dachte, Samuel hätte fast eine ganze Menge Leute mitgenommen.«
Ich schaltete einen Gang runter und überholte eine Großmutter, die in einer Sechziger-Zone gerade mal Fünfzig fuhr. Als das Röhren des kleinen Dieselmotors meines Golfs meine Wut genug abgekühlt hatte, schaltete ich wieder hoch und sagte: »Punkt für dich. Du hast Recht. Es tut mir leid, dass ich nicht früher gekommen bin.«
»Ah«, sagte Stefan und starrte auf seine Hände. »Hätte ich dich gerufen, wärst du gekommen.«
»Wärst du in der Verfassung gewesen, nach Hilfe zu rufen«, entgegnete ich, »hättest du sie wahrscheinlich nicht gebraucht.«
»Also«, sagte er dann, um das Thema zu wechseln. »Was schauen wir uns heute Abend an?«
»Ich weiß es nicht. Warren ist dran mit aussuchen und er ist ein wenig unvorhersehbar. Das letzte Mal, als er den Film ausgewählt hat, haben wir die Nosferatu-Version von 1922 geschaut und davor war es Lost in Space.«
»Ich mochte Lost in Space«, sagte Stefan.
»Den Film oder die Serie?«
»Den Film? Stimmt. Den Film hatte ich ganz vergessen«, sagte er ernüchtert. »Und es war besser so.«
»Manchmal ist Unwissenheit wirklich ein Segen.«
Er sah mich an, dann runzelte er die Stirn. »Orangensaft hilft gegen das Kopfweh.«
Also stand ich gerade in der Reihe im Drive-in und hatte auf Stefans Drängen zwei Orangensaft und einen Burger bestellt, als mein Handy wieder klingelte. Ich nahm an, dass Darryl sich wieder aufregen wollte, also ging ich dran, ohne auf das Display zu schauen. Irgendwann werde ich endlich damit aufhören.
»Mercy«, sagte meine Mutter. »Ich bin ja so froh, dass ich dich erreicht habe. In letzter Zeit war das ziemlich schwierig. Ich muss dir sagen, ich habe wirklich Probleme wegen der weißen Tauben. Ich kann jemanden finden, der normale Tauben hat, aber der Mann, der die weißen Tauben hatte, ist einfach verschwunden. Ich habe heute rausgefunden, dass er anscheinend auch Kampfhunde gehalten hat und jetzt ein paar Jahre hinter Gittern sitzt.«
Plötzlich wurden meine Kopfschmerzen um einiges schlimmer. »Tauben?« Ich hatte ihr gesagt: keine Tauben. Tauben und Werwölfe sind … Auf jeden Fall hatte ich ihr gesagt: keine Tauben.
»Für deine Hochzeit«, erklärte meine Mutter ungeduldig. »Du weißt schon, die im August? Es sind nur noch sechs Wochen bis dahin. Ich dachte, ich hätte die Tauben unter Kontrolle …« – ich war mir sicher, dass ich eine klare Keine-Tauben-Regel aufgestellt hatte – »aber na ja, ich will sowieso niemandem Geld geben, der in Hundekämpfe verwickelt ist. Aber vielleicht macht es Adam ja nichts aus?«
»Doch, es würde Adam etwas ausmachen«, sagte ich. »Und mir auch. Keine Tauben, Mutter, weder weiß noch in anderen Farben. Keine Kampfhunde.«
»Oh, gut«, sagte sie fröhlich. »Ich hatte mir schon gedacht, dass du zustimmst. Die Idee stammt schließlich aus einer indianischen Legende.«
»Was?«
»Schmetterlinge«, sagte sie unbekümmert. »Es wird wunderschön. Stell es dir vor. Wir könnten außerdem noch Ballons steigen lassen. Vielleicht ein paar hundert. Schmetterlinge und goldene Ballons steigen in den Himmel, um euer neues gemeinsames Leben zu feiern. Na ja«, sagte sie dann mit entschlossener Stimme, »ich fange besser an zu organisieren.«
Sie legte auf und ich starrte mein Handy an. Stefan war prustend auf dem Beifahrersitz zusammengebrochen.
»Schmetterlinge«, presste er zwischen hilflosen Lachkrämpfen hervor. »Ich frage mich, wo sie Schmetterlinge gefunden hat?«
»Lach du nur«, sagte ich. »Du musst ja nicht einem Rudel Werwölfe erklären, warum deine Mutter Schmetterlinge freilässt …« Er fing wieder an zu lachen. Es war lächerlich zu hoffen, dass es nur um einen oder zwei ging. Nein, meine Mutter machte nie halbe Sachen. Ich stellte mir tausend Schmetterlinge vor und, der liebe Gott möge mir beistehen, zweihundert goldene Heliumballons.
Langsam lehnte ich mich vor und schlug meine Stirn auf das Lenkrad. »Ich brenne durch. Ich habe Adam schon gesagt, dass wir es tun sollten, aber er wollte die Gefühle meiner Mutter nicht verletzen. Weiße Tauben, Haustauben, Schmetterlinge – es wird mit einem Flugzeug mit einem Banner dahinter und Feuerwerk enden …«
»Eine Marschkapelle«, warf Stefan ein. »Und Dudelsäcke mit gut aussehenden schottischen Spielern, die nichts tragen außer ihren Kilts. Bauchtänzerinnen – es gibt einige ortsansässige Bauchtanzgruppen. Tätowierte Motorradfahrer. Ich wette, ich könnte ihr dabei helfen, einen Tanzbären zu finden …«
Ich bezahlte mein Essen, während er sich noch mehr neue und wundervolle Visionen zur Vertiefung meiner Hochzeitstagpanik ausdachte.
»Danke«, erklärte ich ihm und nahm einen großen Schluck Orangensaft, bevor ich mich wieder in den Verkehr einfädelte. Ich hasse Orangensaft. »Du bist wirklich eine große Hilfe. Ab jetzt ist mein größtes Ziel, dafür zu sorgen, dass du und meine Mutter niemals allein in einem Raum landen, bis Adam und ich geheiratet haben.«
Lachen und Blut hatten Stefan so weit wieder aufleben lassen, dass Warren und Kyle nicht zu bemerken schienen, dass etwas mit ihm nicht stimmte, bis auf Kyles Feststellung: »Jemand sollte sich daran erinnern, dass der Magermodel-Look nicht mal magersüchtigen Models steht.« Sie enthielten sich netterweise auch jeden Kommentars über den Orangensaft, den ich normalerweise nicht mal mit der Kneifzange angefasst hätte.
Wir schnappten uns drei Schüsseln mit Mikrowellen-Popcorn und gingen nach oben ins Heimkino. Kyle ist ein sehr erfolgreicher Rechtsanwalt; sein Haus ist groß genug, um ein Heimkino zu haben. Adams Haus hat auch ein Kino – aber es ist auch das inoffizielle Zuhause des gesamten Rudels. Bei uns übernachten fast immer ein oder zwei Leute. In Kyles Haus gibt es nur Kyle und Warren. Warren wäre auch damit zufrieden, in einem Zelt in der Wildnis zu leben, aber Kyle bevorzugt Perserteppiche, Marmorarbeitsplatten und Ledersessel. Es war vielsagend – auch wenn ich nicht weiß, was genau es bedeutet –, dass sie in Kyles Art von Zuhause lebten und nicht in Warrens.
Warrens Film der Wahl war Shadow of the Vampire, ein satirischer Horrorfilm und eine Hommage an die Entstehung von Nosferatu. Jemand hatte eine Menge Recherche über die Legenden betrieben, die sich um den alten Film rankten, und hatte dann mit ihnen gespielt.
Irgendwann flüsterte ich angesichts Stefans konzentrierter Miene deutlich hörbar: »Weißt du, du bist ein Vampir. Du solltest keine Angst vor ihnen haben.«
»Jeder«, antwortete Stefan voller Überzeugung, »der Max Schreck jemals getroffen hat, hätte für den Rest seines Lebens Angst vor Vampiren. Und sie haben ihn fast perfekt dargestellt.«
Warren, der an seinem Lieblingsplatz saß – auf dem Boden an Kyles Beine gelehnt –, drückte auf Pause, setzte sich auf und drehte sich, um Stefan anschauen zu können, der am anderen Ende der Couch saß. Ich hatte, als das einzige Mädchen, den großen Sessel für mich.
»Der Film liegt richtig? Max Schreck war wirklich ein Vampir?«, fragte Warren. Max Schreck war der Name des Mannes, der in Nosferatu den Vampir gespielt hatte.
Stefan nickte. »Schreck war nicht sein richtiger Name, aber er hat ihn für ein oder zwei Jahrhunderte benutzt, also ist es okay. Furchterregendes altes Monster. Wirklich furchterregend, wirklich alt. Er hatte entschieden, dass er in einem Film mitspielen wollte, und keiner der anderen Vampire war wirklich bereit, ihm zu widersprechen.«
»Warte mal«, sagte Kyle. »Ich dachte, eine der häufigsten Beschwerden über Nosferatu ist, dass alle Szenen mit Schreck offensichtlich tagsüber gefilmt worden sind. Geht ihr Vampire nicht tagsüber alle schlafen?«
Kyle wusste als Warrens Liebhaber mehr über die unheimlichen Geschöpfe der Nacht als die meisten Menschen, für die Vampire nur Filmmonster sind, keine Männer, die Scooby-Doo-T-Shirts tragen und in schicken Häusern in echten Städten wohnen. Meiner Meinung nach würde es nicht mehr lange dauern, bis auch die Vampire an die Öffentlichkeit gingen. Die Werwölfe hatten sich vor eineinhalb Jahren geoutet – obwohl sie sorgfältig darauf geachtet hatten, was sie über sich preisgaben. Das Feenvolk war seit den 1980ern geoutet. Die Leute lernten langsam, dass die Welt ein erschreckenderer Ort war, als die wissenschaftliche Prägung der letzten zwei Jahrhunderte sie hatte glauben machen wollen.
»Wir sterben tagsüber«, sagte Stefan. »Aber Max war sehr alt. Er war zu vielem fähig, und es würde mich nicht wundern, wenn er auch tagsüber wach bleiben konnte. Ich habe ihn nur einmal getroffen – lange vor Nosferatu. Er nahm uneingeladen an einer der feste des Meisters von Mailand teil, dem Herrn der Nacht. Es war seltsam, so viele mächtige Leute vor einem ungewaschenen, schlecht angezogenen, erstaunlich hässlichen Mann kuschen zu sehen. Ich habe gesehen, wie er eine zweihundert Jahre alte Vampirin mit einem Blick getötet hat – er hat sie einfach mit einem Blick zu Staub zerfallen lassen, weil sie über ihn gelacht hatte. Der Herr der Nacht, der ihr Meister war, war selbst zu dieser Zeit schon sehr alt und mächtig – und er hat keinen Einspruch erhoben, obwohl sie die Jüngste in seinem Gefolge war und ihm viel bedeutete.«
»Lebt Schreck noch?«, fragte Warren.
»Ich weiß es nicht«, antwortete Stefan und fügte dann mehr zu sich selbst hinzu: »Ich will es nicht wissen.«
»War er schon immer so hässlich oder wurde es im Alter schlimmer?«, fragte Kyle. Kyle ist schön, und das weiß er auch. Ich war mir nie sicher, ob er wirklich eitel war oder ob es zu den Dingen gehörte, die er nur einsetzte, um den scharfen Verstand hinter seinem hübschen Gesicht zu verstecken. Wahrscheinlich war es letztendlich eine Mischung aus beidem.
Stefan lächelte. »Das ist die Frage, die sich alle älteren Vampire stellen. Man stellt keine Fragen über das Alter, aber meistens ahnen wir es instinktiv. Wulfe ist wahrscheinlich der älteste Vampir – außer Max –, den ich je getroffen habe. Wulfe ist nicht hässlich oder monströs.« Er zögerte, dann fuhr er nachdenklich fort: »Zumindest nicht äußerlich.«
»Vielleicht gehörte er zum Feenvolk oder war ein Halbblut«, schlug ich vor. »Einige von ihnen sehen … sehr ungewöhnlich aus.«
»Die Theorie habe ich noch nie gehört«, sagte Stefan. »Aber wer weiß?«
Warren drückte wieder auf Play und irgendwie machte das Wissen, dass Max Schreck, der im Original den Count Orlok gespielt hatte, ein Alptraum für Vampire gewesen war, den Film um einiges beängstigender. Nur Warren schien gegen diesen Effekt immun zu sein.
Als der Film zu Ende war, warf er Stefan einen Blick zu. »Vampir«, sagte er, ohne dass es eine Beleidigung war, »warum kommst du nicht mit mir in die Küche, während diese beiden hier Kyles erstaunliche Filmbibliothek nach etwas durchforsten, das dafür sorgt, dass Mercy auf dem Heimweg nicht rast.«
»Hey!«, empörte ich mich.
Er grinste mich an, während er aufstand und sich streckte. Sein schlaksiger Körper berührte unter Kyles bewundernden Augen fast die Decke. Warren war nicht so hübsch wie Kyle, aber er war auch kein Max Schreck und er wusste, dass er vor Publikum spielte. Vielleicht war Kyle ja nicht der Einzige hier, der eitel war.
»Hey dich selbst, Mercy«, antwortete Warren. »Wie wäre es noch mit einem zweiten Film? Stefan ist es gewöhnt, lange aufzubleiben, und bei dir zu Hause wartet kein Adam auf dich. Ihr zwei sucht noch etwas raus und Stefan und ich füllen die Popcorn-Schüsseln nach.«
Kyle wartete, bis Warren und Stefan im Erdgeschoss waren, bevor er sagte: »Stefan sieht hungrig aus. Glaubst du, Warren wird ihn nähren, bevor er ihn zurückbringt?«
»Ich halte das für eine gute Idee. Er hat sich heute schon an mir gütlich getan und langsam sah er aus, als könnte er sich dich als sein Abendessen vorstellen. Ich glaube nicht, dass Warren zulassen würde, dass Stefan sich von dir nährt, selbst wenn er fragt und du zustimmst. Werwölfe sind ziemlich besitzergreifend. Ist wahrscheinlich besser, wenn Warren es macht. Da er ein Werwolf mit einem Rudel ist, wird Warren nicht als Stefans guter Freund Renfield enden.«
Kyle verzog das Gesicht.
»Fang so ein Gespräch nicht an, wenn du keine ehrliche Antwort willst«, erklärte ich ihm, hüpfte aus dem Sessel und fing an, das Bücherregal voller Blue-Rays, DVDs und Videokassetten durchzugehen.
Als Warren und Stefan zurückkamen, war für mich offensichtlich, dass Stefan sich nochmal genährt hatte. Er bewegte sich fast wieder mit seiner üblichen Grazie.
»Hast du nicht Frankensteins Braut?«, fragte er, als Kyle The Lost Skeleton of Cadavra hochhielt, um ihn als zweiten Film vorzuschlagen. »Oder Vater der Braut? Vier Hochzeiten und ein Todesfall?«
Er warf mir einen schnellen Blick zu. »Oder Butterfly Effect?« Jau, er fühlte sich besser.
Ich warf ihm ein Kissen an den Kopf. »Halt den Mund. Halt einfach den Mund.«
Stefan fing das Kissen, warf es zu mir zurück und lachte.
»Was ist los?«, fragte Kyle.
Ich vergrub mein Gesicht in dem Kissen. »Meine Mutter hat sich gegen weiße Tauben zu meiner Hochzeit entschieden und – obwohl ich nicht mal wusste, dass das zur Debatte stand – auch gegen normale Tauben. Sie will stattdessen Schmetterlinge und Ballons fliegen lassen.«
Warren wirkte angemessen angewidert, aber Kyle lachte.
»Das ist ein neuer Trend, Mercy«, sagte er. »Genau das Richtige für dich, weil es angeblich auf einer indianischen Legende beruht. Laut der Geschichte bringt ein Schmetterling – wenn man ihn fängt, ihm einen Wunsch zuflüstert und ihn dann wieder fliegen lässt – deine Bitte zum Großen Geist. Da du den Schmetterling freigegeben hast, obwohl du ihn hättest töten oder gefangen halten können, wird der große Geist deine Bitte in einem positiven Licht betrachten.«
»Ich bin verloren«, erklärte ich dem Kissen. »Verurteilt zu Schmetterlingen und Ballons.«
»Zumindest sind es keine Tauben«, verkündete Warren pragmatisch.
Also, was hast du Darryl angetan?«, fragte Adam, als er die Fahrertür meines Golfs zuschlug.
Gewöhnlich fahre ich den Golf, aber Alpha-Werwölfe kommen nicht gerade gut mit dem öffentlichen Luftverkehr klar. Einem Fremden genug zu vertrauen, um sich darauf zu verlassen, dass er das Flugzeug steuern konnte, hatte in Adam einen Drang nach Kontrolle ausgelöst. Also durfte er fahren, nachdem seine Tochter Jesse und ich ihn vom Flughafen abgeholt hatten.
»Ich habe Darryl gar nichts angetan«, widersprach ich.
Adam warf mir einen langen Blick zu, bevor er aus der Parklücke setzte und zur Bezahlschranke des Parkplatzes fuhr.
»Ich habe auf dem Weg zum Schundfilm-Abend bei Stefan angehalten«, sagte ich. »Adam, Stefan steckt wirklich in Schwierigkeiten. Er hat viele aus seiner Menagerie verloren und hat sie noch nicht ersetzt. Sie sterben; und er war auch kurz davor.«
Adam griff nach meinem Arm und drehte ihn so, dass er meine Armbeuge sehen konnte, und auch ich starrte interessiert auf die makellose Haut.
»Mercy«, sagte Adam, als Jesse auf dem Rücksitz kicherte, »hör auf, mich zu verarschen.«
»Es ist am anderen Arm«, erklärte ich. »Nur kleine Verletzungen. In einem Tag oder so sind sie weg. Du weißt, dass er mich nicht verletzen würde. Unsere Gefährtenbindung und das Rudel halten ihn davon ab, mich so an sich zu binden, wie es bei einem Menschen der Fall wäre.«
»Kein Wunder, dass Darryl sich aufgeregt hat«, erklärte Adam, als er sich hinter einem anderen Wagen an der Zahlstelle anstellte. »Er mag keine Vampire.«
»Stefan braucht mehr Leute in seiner Menagerie«, sagte ich. »Er weiß es, ich weiß es … aber ich kann es ihm nicht sagen.«
»Warum nicht?«, fragte Jesse.
»Weil die Menagerie eines Vampirs aus Opfern besteht«, antwortete Adam. »Die meisten von ihnen sterben langsam. Stefan ist besser als der durchschnittliche Vampir, aber trotzdem sind sie Opfer. Wenn Mercy ihn auffordert, jagen zu gehen, erklärt sie ihm damit gleichzeitig, dass sie gutheißt, was er tut.«
»Was ich nicht tue«, erklärte ich streng. Der Fahrer des Wagens vor uns diskutierte mit der Frau in dem Häuschen. Ich spielte an einem losen Faden meiner Jeans herum.
»Außer, wenn es um Stefan geht«, meinte Adam. »Der für einen Vampir gar kein so schlechter Kerl ist.«
»Ja«, stimmte ich ihm nüchtern zu. »Aber trotzdem ist er ein Vampir.«
Die Frau im Häuschen hatte die Diskussion offensichtlich gewonnen, da der Fahrer ihr seine Kreditkarte überreichte. Mir fiel auf, dass neben der Ticket-Dame ein Bund Luftballons hing; auf dem Ballon in der Mitte stand: »Happy Birthday, Oma!«
»Ich möchte dich um etwas bitten«, sagte ich zu Adam, als er der Frau das Parkticket überreichte.
»Und was?« Er wirkte vollkommen erschöpft. Das war diesen Monat schon seine zweite Reise in das andere Washington am anderen Ende des Landes, und es machte ihn fertig. Ich zögerte. Vielleicht sollte ich warten, bis er eine Nacht durchgeschlafen hatte.
Jesse auf dem Rücksitz kicherte. Sie war ein gutes Mädchen, und wir mochten uns. Heute hatte ihr Haar dieselbe dunkelbraune Farbe wie das ihres Vaters. Gestern war es noch grün gewesen. Grün ist für niemanden eine gute Haarfarbe. Ich glaube, nach drei Wochen mit einer Haarfarbe, die an verrottenden Spinat erinnerte, hatte sie mir endlich zugestimmt. Als ich am Morgen aufgestanden war, um in die Arbeit zu gehen, hatte sie es gerade gefärbt. Das Braun war irgendwie schockierender gewesen als das Grün.
»Sei ruhig, du«, ermahnte ich sie mit aufgesetzter Strenge. »Keine Kommentare von den billigen Plätzen.«
»Was brauchst du?«, fragte Adam mich.
Kaum war er zu Hause, fühlte ich mich besser – die unruhige Sorge, die mich ständig begleitete, wann immer er wegfuhr, hatte mich verlassen und auch das panische Gefühl mitgenommen, ich säße irgendwie in der Falle.
Die Frau im Häuschen nickte und winkte uns durch, da wir Adams Flug richtig abgeschätzt hatten und nur fünfzehn Minuten auf dem Parkplatz gestanden hatten – und somit noch innerhalb der Zeitspanne lagen, die kostenlos war.
Titel der amerikanischen Originalausgabe RIVER MARKED Deutsche Übersetzung von Vanessa Lamatsch
Deutsche Erstausgabe 10/2011 Redaktion: Charlotte Lungstrass
Copyright © 2011 by Hurog, Inc. Copyright © 2011 der deutschsprachigen Ausgabe byWilhelm Heyne Verlag, München,in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Umschlaggestaltung: Animagic, Bielefeld Karte »Tri-Cities«: Andreas Hancock Karte »Columbia Gorge«: Michael Enzweiler Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
eISBN 978-3-641-10462-7
www.heyne-magische-bestseller.de
www.randomhouse.de
Leseprobe