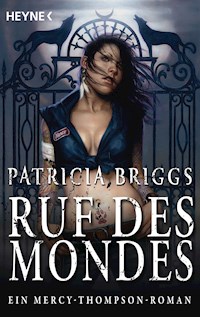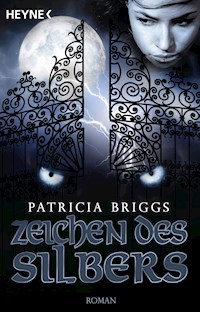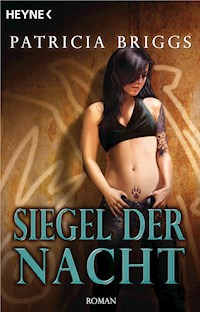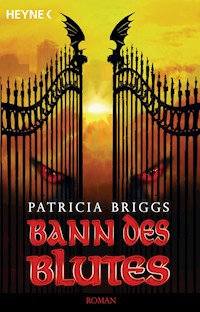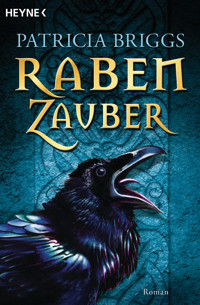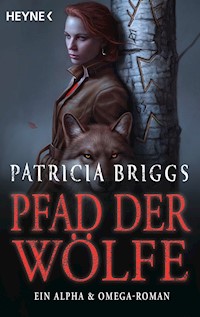9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Alpha & Omega
- Sprache: Deutsch
Ihr neuestes Abenteuer führt Anna und Charles, das gefährlichste Werwolfpärchen der USA, nach Arizona. Eigentlich wollen die beiden dort nur einen Freund besuchen, doch was als harmloser Urlaubstrip beginnt, wird schon bald zu Annas und Charles’ nächstem Spezialauftrag: Eine Fae, ein tückisches und kaltblütiges Geschöpf, stiehlt Menschenkinder und ersetzt sie durch Trugbilder. Wenn es Anna und Charles nicht gelingt, die Entführerin aufzuhalten, ist ein Krieg zwischen Fae und Menschen unausweichlich. Ein Krieg, der auch für die Werwölfe fatale Folgen hätte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 585
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Das Buch
Ein lange gefürchteter Anruf reißt Werwolf Charles Cornick aus seinem Alltag: Sein langjähriger Freund, der Pferdezüchter Joseph Sani, liegt im Sterben. Gemeinsam mit seiner Gefährtin Anna fliegt Charles nach Arizona, um Joseph ein letztes Mal zu sehen. Doch was als friedlicher Besuch auf dem Gestüt der Familie Sani beginnt, wird schon bald zum nächsten Spezialauftrag der beiden Werwölfe. Josephs Schwiegertochter Chelsea verhält sich mit einem Mal höchst merkwürdig und greift sogar ihre eigenen Kinder an. Charles und Anna können zwar das Schlimmste verhindern, doch ihnen ist auch klar, dass die eigentlich so liebevolle Chelsea niemals aus freien Stücken ihre eigene Familie verletzten würde. Wie sich herausstellt, stand Chelsea unter dem Fluch eines mächtigen Feenwesens. Eines Feenwesens, das einen dunklen und grausamen Plan verfolgt …
Die MERCYTHOMPSON-Serie
Erster Roman: Ruf des Mondes
Zweiter Roman: Bann des Blutes
Dritter Roman: Spur der Nacht
Vierter Roman: Zeit der Jäger
Fünfter Roman: Zeichen des Silbers
Sechster Roman: Siegel der Nacht
Siebter Roman: Tanz der Wölfe
Die ALPHA & OMEGA-Serie
Erster Roman: Schatten des Wolfes
Zweiter Roman: Spiel der Wölfe
Dritter Roman: Fluch des Wolfes
Vierter Roman: Im Bann der Wölfe
Die Autorin
Patricia Briggs, Jahrgang 1965, wuchs in Montana auf und interessiert sich seit ihrer Kindheit für Fantastisches. So studierte sie neben Geschichte auch Deutsch, denn ihre große Liebe gilt Burgen und Märchen. Neben erfolgreichen und preisgekrönten Fantasy-Romanen wie Drachenzauber und Rabenzauber widmet sie sich ihrer Mystery-Saga um Mercy Thompson. Nach mehreren Umzügen lebt die Bestsellerautorin heute gemeinsam mit ihrer Familie in Washington State.
PATRICIABRIGGS
Roman
WILHELMHEYNEVERLAGMÜNCHEN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Titel der amerikanischen Originalausgabe
DEADHEAT
Deutsche Übersetzung von Vanessa Lamatsch
Deutsche Erstausgabe 10/2016
Redaktion: Diana Mantel
Copyright © 2015 Hurog, Inc.
Copyright © 2016 der deutschsprachigen Ausgabe by
Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: Animagic, Bielefeld,
unter Verwendung mehrerer Motive von Fotolia
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN: 978-3-641-18387-5V002
www.heyne.de
Für die wunderbaren Menschen, die unsere Reise mit den Araberpferden zu einem solchen Vergnügen gemacht haben: Für Brenda, die schon von Anfang an dabei war; für die wunderbaren Reisebegleiter Ed und Adriana; für Alice, Bill und Joan von Rieckman’s Arabians, die die Reise bereits vor mir unternommen haben und darum nützliche Ratschläge für unterwegs zu bieten hatten; für Dolly, Doug und Peggy von Orrion Farms, die uns Starthilfe gegeben und uns beraten haben; für Deb, Kim und Portia von High Country Training, die aus meinen ohnehin guten Ponys anständige Bürger gemacht haben; für Robert und Dixie North, die Pferde genauso lieben wie ich; und für Nahero, meinen großen Araber-Wallach, der schon seit achtundzwanzig Jahren mein treuer Gefährte ist. Doch besonders für meinen geduldigen Ehemann, dessen Begabung darin liegt, Träume in Erfüllung gehen zu lassen.
Prolog
Dezember
Der Lord des Feenvolkes schritt unruhig in seiner Zelle aus grauem Stein auf und ab. Drei Schritte in die eine Richtung, dann drehte er sich um, vier Schritte in die andere Richtung, dann drehte er sich ein weiteres Mal um, schließlich drei Schritte zurück. Das konnte er den ganzen Tag durchhalten. Und genau das hatte er in den letzten zwei Wochen auch ohne Unterlass getan.
Er trug weiche Stiefel, die seine Schritte geräuschlos machten. Geräusche lenkten ihn über Gebühr von seinem Vorsatz ab – welcher da lautete, sich selbst so sehr zu langweilen, dass sein Kopf von jedem Gedanken befreit werden würde.
Seine Kleidung war praktisch wie seine Stiefel, war aber dennoch seiner Position als hochrangigem Lord angemessen – selbst wenn die Erinnerung an diesen Teil seines Lebens fast verblasst war. Trotzdem trug er seine langen roten Haare in einer komplizierten Frisur aus vielen Zöpfen, die über seinen Rücken bis auf den Boden fielen, wie es vor einem Jahrtausend der Mode bei Hofe entsprochen hatte. Zweifellos würde er, wenn es denn den Hohen Hof, ja überhaupt noch einen Hof gab, deswegen als absolut altmodisch betrachtet werden.
In der ersten Woche seines Aufenthaltes hier hatte er zudem höfische Kleidung getragen, doch nachdem es niemanden gab, den er darin beeindrucken konnte, hatte er diese gegen etwas Bequemeres eingetauscht. Er hätte sich wahrscheinlich sogar in Jeans kleiden können, so nahm er wenigstens an, doch er vergaß Tag für Tag mehr von seinem lange vergangenen Dasein als Lord, und die Kleidung erinnerte ihn daran, was er einst gewesen war – obwohl er sich an manchen Tagen, in manchen Jahren sogar, kaum noch daran erinnern konnte, warum es überhaupt so wichtig war, sich daran zu erinnern.
Es klopfte an seiner Tür. Der Fae-Lord zischte irritiert, weil er es gerade fast geschafft hatte, sich selbst so weit zu betäuben, dass er seine Gefangenschaft vergaß. Unsterblichkeit war ein Fluch, denn egal, wie mächtig man auch sein mochte, es gab immer jemanden, der mächtiger war. Jemanden, dem man gehorchen musste. Jemanden, der einem stahl, was man als sein Eigentum betrachtet hatte und der einen mit Brosamen dessen zurückließ, was man einst besessen hatte. Und dann nahmen sie einem selbst das noch weg. Nun saß er hier in seinem Gefängnis, während sein Magen vor Gier schmerzte und sein Körper die Magie vermisste wie Fleisch das Salz. Ohne Magie besaß sein Leben keinerlei Geschmack.
Wieder klopfte es. Und offensichtlich hatte er die Person vor der Tür wütend gemacht, denn sein gesamtes Gefängnis erzitterte unter einem Geräusch, das ihm in den Ohren und im Herzen wehtat. Wunderbar. Einer der Mächtigen suchte ihn also auf. Fast hätte er nicht reagiert – denn was konnten sie ihm noch antun, was sie ihm nicht bereits angetan hatten?
Dann hielt er in der Mitte des Raumes an, weil ihm bewusst wurde, dass es natürlich immer noch etwas gab, was sie ihm antun konnten. Und es war nicht gut, darüber zu lange nachzudenken. Also rief er unwirsch: »Herein.«
Die Frau, die den Raum betrat, war klein und adrett. Fast hätte sie das Biest in ihm angesprochen. Doch dann begann sie zu sprechen, und die Illusion um sie herum verschwand sofort.
Sie war der spirituelle Archetyp der bösen Königin der Märchen, teilweise auch deswegen, weil sie an einigen der Ereignisse Anteil gehabt hatte, auf denen diese Geschichten beruhten. Und sie liebte es, den kurzlebigen Menschen Unglück und Schmerz zu bereiten. All diese Jahrhunderte der Macht hallten nun in ihrer Stimme mit, selbst wenn es ihr gefiel, sich in einer scheinbar hilflosen Gestalt zu präsentieren.
»Das Land unter dem Feenhügel könnte für dich zu allem Möglichen werden«, sagte sie mit geschürzten Lippen, während sie sich in seiner momentanen Heimstatt umsah, »und du hast dich für ein Gefängnis entschieden.«
Argwöhnisch richtete er sich höher auf. »Ja, Lady.«
Sie schüttelte den Kopf. »Und sie wollen ausgerechnet dich?«
Dabei erklärte sie nicht, wer »sie« waren oder wofür sie ihn wollten. Und er fragte nicht nach, weil ihm doch noch ein Rest Selbsterhaltungstrieb geblieben war.
Sie umrundete den kleinen Raum. »Sie sagen, du hättest Fantasie.«
Im Gehen verschränkte sie die Arme. Zuerst drehte sie ihren Oberkörper, um die Deckensteine zu betrachten, dann wendete sie sich so, dass sie die unauffällige Wölbung der Wand erkennen konnte, die sein Versteck verbarg. Als Nächstes lockerte sie den Granitblock, den einzigen ohne Mörtel. »Sie sagen, du kannst dich vor Menschen, vor dem Feenvolk und vor anderen Kreaturen, die dich vielleicht jagen könnten, verbergen, weil dein Schutzzauber so herausragend ist.«
Er wollte sie aufhalten, sie davon abhalten, seinen Schatz zu finden. Er wollte sie zerstören. Doch sie hatten ihm seine Macht genommen, und ihm war nichts geblieben. Und selbst dieser Gedanke entsprach nur seiner Eitelkeit; ihm war bewusst, dass er selbst mit seiner ganzen Macht nichts gegen einen der Grauen Lords hätte ausrichten können.
Er beobachtete, wie sie den Stein herauszog und die kleine Kammer fand, die sich dahinter verbarg. Sie griff nach der Puppe, die er dort versteckt hielt, glättete deren gelben Rock und ließ ihre Finger über die verblassten Tränenspuren auf dem Stoff gleiten.
Ein Kind weint aus ganzem Herzen, ohne etwas zurückzuhalten. Ein Kind lebt in der Gegenwart, und das verleiht seinem Schmerz den Eindruck von Unendlichkeit. Selbst ohne seine Magie konnte er die Macht dieser Tränenspuren sogar von dort spüren, wo er gerade stand.
Sie legte die Puppe zurück und fügte den Granitblock nachdenklich wieder zurück in die Wand. Dann sah sie ihn an. »Sie haben mir erzählt, du wärst ein geschickter Magier gewesen, hinterlistig und mächtig. Einst wärst du eine Zierde des Hofes gewesen – und später ein Fluch; die erste dunkle Wurzel der Zerstörung. Fähig, dich sogar vor den besten Jägern zu verstecken.«
»Ich weiß nicht, wer sie sind oder was sie über mich sagen«, antwortete er ehrlich, wobei er sich bemühen musste, seine Ungeduld zu verbergen.
Sie lächelte. »Aber du widersprichst der Einschätzung nicht.« Langsam kam sie auf ihn zu und berührte mit der linken Hand sein Gesicht.
Sein Schutzzauber fiel, und damit die Illusion, die aus dem Lord das machte, was er einst gewesen war. Und genau wie seine Magie sich über die Jahre hinweg verändert hatte und schlecht geworden war, hatte auch seine Gestalt sich verändert und war hässlich geworden. Er wartete darauf, dass sie zurückwich; seine Gestalt war wirklich kein schöner Anblick. Doch sie lächelte. »Ich habe ein Geschenk für dich. Ein Geschenk und eine Aufgabe.«
»Welche Aufgabe soll das sein?«, fragte er wachsam.
»Mach dir keine Sorgen«, sagte sie, als sie ihre rechte Hand an seinen Hals legte. »Du wirst sie genießen, das verspreche ich dir.«
Und plötzlich kam seine Magie zurück, ergoss sich in seinen Körper wie die Hitze der Toten. Er schrie, fiel zu Boden und wand sich, während wunderbarer Schmerz ihn erfüllte.
Sie beugte sich vor und flüsterte ihm ins Ohr: »Aber es gibt Regeln.«
1
Okay«, sagte Charles Cornick, der jüngere Sohn von Bran Cornick, der als Marrok die Werwölfe von Nordamerika regierte, und außerdem, wie Anna inzwischen glaubte, ebenso die Wölfe der restlichen Welt. De facto zumindest, wenn nicht sogar offiziell. Denn wenn Bran Cornick befahl: »Steht auf, und gehet hin«, gab es keinen Werwolf auf der ganzen Welt, ob nun Alpha oder nicht, der ihm nicht gehorcht hätte.
Charles hatte dabei die Aufgabe erhalten, einen Großteil der Drecksarbeit zu erledigen, die es seinem Vater ermöglichte, die Sicherheit ihrer Leute, ihrer Werwölfe zu garantieren. Die negative Konsequenz davon, dass ein guter Mann wie Charles gezwungen wurde, schreckliche, aber notwendige Grausamkeiten zu begehen, bestand darin, dass seine Gefühle und Gedanken manchmal sogar ihm selbst verborgen blieben.
Zum Beispiel hatte er gerade »Okay« gesagt, obwohl Anna genau wusste, dass das aktuelle Thema für ihn alles andere als okay war. Das konnte sie daran erkennen, dass ihr Ehemann ganz plötzlich von dem alten Stuhl aufsprang, auf dem er eben noch gesessen hatte, und seine alte ramponierte Gitarre an den Wandhaken hängte. Unruhig wanderte er über den Parkettboden zu dem großen Fenster und starrte in den Februar-Schneefall hinaus. Es schneite heftig: So war es nun einmal im Winter in Montana.
Sie war sich sicher, hätte er nicht solche Selbstbeherrschung besessen, er hätte fröstelnd die Schultern hochgezogen.
»Du hattest gesagt, ich solle mich mal schlaumachen«, erklärte Anna vorsichtig. Sie kannte Charles besser als jeder andere, und trotzdem war ihr wunderbarer, komplexer Mann manchmal unmöglich zu deuten. »Das habe ich getan, angefangen bei deinem Bruder. Samuel hat mir erklärt, dass er das Problem der Werwolfbabys lange erforscht hat, selbst wenn er seine Recherchen aus anderen Gründen begonnen hatte. Bevor er Ariana wiedergefunden hat, war das Thema Kinder anscheinend eine Art Besessenheit von ihm. Wusstest du, dass die Werwolf-DNA mit menschlicher DNA identisch ist? Es ist keinerlei Unterschied zu erkennen, außer, die Proben werden in Werwolf-Form genommen – nur in dieser Form unterscheidet sie sich.«
»Ja, das wusste ich«, antwortete Charles, offenbar glücklich, über etwas – irgendetwas – anderes zu reden. »Samuel hat es mir vor ein paar Jahrzehnten erzählt, als er es gerade herausgefunden hatte. Nicht das erste Mal, dass es sich als nützlich erwiesen hat, einen Arzt in der Familie zu haben. Ich glaube, irgendein menschlicher Wissenschaftler hat diese Erkenntnis letzten Monat in einem minderwertigen Journal veröffentlicht; zweifellos wird die Nachricht früher oder später in den Medien auftauchen.«
Der Themenwechsel entspannte ihn genug, um ihr über die Schulter hinweg ein leichtes Lächeln zuzuwerfen, bevor er wieder in den Schnee starrte. »Mein Dad war überglücklich über diese Erkenntnis. Denn damit ist es unmöglich, über einen Bluttest herauszufinden, ob jemand ein Werwolf ist oder nicht – außer man testet tatsächlich den Wolf, was dann natürlich eigentlich überflüssig ist. Ich bin mir nicht sicher, ob er uns je in die Öffentlichkeit geführt hätte, wenn es einfacher gewesen wäre, uns zu identifizieren.«
»Okay.« Anna nickte. »Das ist gut. Überwiegend. Nur dass es damit auch keinen Weg gibt herauszufinden, ob ein Embryo genetisch ein Mensch oder ein Werwolf ist. Und das spielt eine Rolle, wenn wir uns für eine Leihmutter entscheiden.«
»Eine Leihmutter«, wiederholte er.
Anna setzte große Hoffnungen in den Leihmutter-Vorschlag. Charles’ Mutter war bei seiner Geburt gestorben. Sie wusste, dass ein Teil seines Widerstandes gegen Kinder – vielleicht sogar sein gesamter Widerstand – auf der Gefahr beruhte, die eine Schwangerschaft für Anna bedeuten konnte.
»Wenn ich kein Baby austragen kann, weil ich mich zu jedem Vollmond verwandeln muss, dann ist eine Leihmutter die einfachste Lösung. Und bis jetzt hat es niemand ausprobiert – zumindest, soweit wir wissen.«
Er antwortete nicht, also sprach sie weiter und legte ihm die Sachverhalte dar. »Nachdem es offensichtlich keine Möglichkeit gibt herauszufinden, welches Baby ein Werwolf, Mensch oder eine Kombination aus beidem ist, besteht weiterhin die Gefahr von Fehlgeburten. Dasselbe Problem, das auch die menschlichen Frauen haben, die ein Baby von einem Werwolf erwarten. Und dann ist da noch die Frage, was mit einer menschlichen Frau geschieht, die neun Monate lang ein Werwolf-Baby austrägt. Wird sie sich in einen Werwolf verwandeln? Samuel meinte, wir sollten nach einer Leihmutter suchen, die ein Werwolf werden will. Das würde das Risiko einer Ansteckung … ähm … der Infizierung …«
Charles erwiderte staubtrocken: »Fühlst du dich infiziert, Anna?«
Nein. Aber sie würde sich nicht von ihm vom Thema ablenken lassen.
»Auf jeden Fall würde das die Probleme minimieren, falls sie sich durch die Schwangerschaft wirklich verwandelt, weil unser Baby ein Werwolf ist und kein Mensch«, erklärte sie so würdevoll wie möglich. Dieses Gespräch lief überhaupt nicht gut. »Wir wissen nicht, ob das Austragen und das Gebären eines Werwolf-Babys die Mutter infizieren würde – und wenn ja, wann das geschehen würde. Niemand außer deiner Mutter hat je ein Werwolf-Baby bis zur Geburt ausgetragen. Wenn die Leihmutter sich wünscht, ein Werwolf zu werden, dann wäre dieser Teil des Problems gelöst. Es bleibt natürlich die Frage, ob die Leihmutter sich verwandelt, bevor das Baby lebensfähig ist.«
Inzwischen hatte Charles ihr wirklich den Rücken zugewandt. »Das klingt, als würden wir die Leihmutter bestechen wollen. Trag unser Baby aus, und wir erlauben dir die Verwandlung. Mit der stillschweigend implizierten Konsequenz – egal, ob wir es zugeben oder nicht –, dass wir die Verwandlung nicht erlauben, wenn unser Kind nicht ausgetragen wird. Und außerdem bleibt die Tatsache bestehen, dass die meisten Leute während der ersten Verwandlung sterben und dass weniger Frauen als Männer überleben.«
»Ja«, stimmte sie zu. »Wenn du es so ausdrückst, klingt es ziemlich niederträchtig. Aber es gibt jedes Jahr eine Menge Geburten durch Leihmütter – und auch eine normale Schwangerschaft birgt ein lebensgefährliches Risiko. Wenn die Leihmutter alle Fakten kennt und sie trotzdem bereit ist, sich im Gegenzug für Geld und/oder das Versprechen einer Verwandlung darauf einzulassen, sehe ich darin kein Problem. Es wäre zwar immer noch ein Risiko, aber ein ehrliches Risiko.«
»Also dürfen wir das Leben einer anderen Person dafür aufs Spiel setzen, ja?«, fragte er, und ein wildes Knurren schwang in seiner Stimme mit. »Weil sie dann genauso viel darüber weiß, was mit ihr passieren wird, wie wir – selbst wenn wir eigentlich überhaupt nichts darüber wissen.«
Anna öffnete den Mund, um ihm von den Infos in der dicken Akte zu berichten, die Samuel ihr geschickt hatte, doch dann überlegte sie es sich anders. Vielleicht bekäme sie bessere Resultate, wenn sie das Problem von einer anderen Seite her anging.
»Alternativ dachte ich, dass vielleicht jemand mit Magie ein paar Ideen haben könnte, nachdem die Wissenschaft sich gewöhnlich mit Magie so schwertut. Ich habe Moira angerufen …«
Er drehte sich wieder zu ihr um, und die Veränderung des Lichtwinkels betonte die Struktur seines Gesichtes und seine breiten Schultern. In Annas Augen war Charles wunderschön. Sein indianisches Salish-Erbe schenkte ihm bronzefarbene Haut und dazu Augen und Haare, die fast mitternachtsschwarz waren. Seine Muskeln verdankte er harter Arbeit und seinen Ausflügen in Wolfsgestalt. Doch es war seine Integrität und seine … Charlesartigkeit, die dafür sorgte, dass ihr Herz schneller schlug und das Verlangen nach ihm sie fast in die Knie zwang.
Es ging nicht nur um Lust – denn wer würde sich nicht körperlich nach Charles verzehren? Sie liebte einfach alles an ihm. Wieder dachte sie: Wer konnte sich nicht nach Charles verzehren? Doch sie wurde fast überwältigt von dem Verlangen, ihn für sich zu beanspruchen und sich in sein ganzes Wesen, seine ganze Essenz einzuhüllen.
Charles hatte ihr ermöglicht zu verstehen, warum manche Eheversprechen die Worte »aus zweien werde eins« enthielten. Als Anna neun oder zehn gewesen war, hatte dieser Satz sie unglaublich aufgeregt. Wieso sollte sie ihr Selbst für irgendeinen dämlichen Jungen aufgeben? Sie hatte ihre Einwände ihrem Vater vorgetragen, der nur gesagt hatte: »Falls irgendein ›dämlicher Junge‹ eines Tages verrückt genug sein sollte, dich zu heiraten, dann ist er sicherlich auch bereit, diesen Satz wegzulassen.«
Anna hatte bei ihrer Hochzeit dann nur den Teil aus dem Eheversprechen getilgt, der sich mit »Gehorsam« beschäftigte. Sie wollte nicht lügen. Ja, sie wollte auf Charles hören – aber ihm gehorchen … nein. Anna hatte in ihrem Leben schon mehr als genug gehorcht. Doch den Satz mit dem »eins werden« hatte sie nicht gestrichen.
Bei Charles verlor sie sich nicht, sondern sie gewann Charles hinzu. Sie bildeten eine gemeinsame Front gegen »Pfeil und Schleudern des wütenden Geschicks«. Er war ihr sicherer Rückzugsort im Sturm der Welt, und sie … sie ging davon aus, dass sie sein Zuhause war.
Und sie wollte seine Kinder.
»Auf gar keinen Fall«, erklärte er, und für einen Moment dachte sie schon, er hätte ihre Gedanken gelesen, weil sie den Faden des Gesprächs verloren hatte. »Keine Hexerei.«
Anna war nicht dumm. Er errichtete so viele Hürden wie nur möglich. Sie hätte hier sonst aufgegeben, doch das Gefühl, dass sie durch ihre Gefährtenverbindung empfing, festigte in ihr die tiefe Überzeugung, dass er noch dringender ein Kind wollte als sie selbst.
»Keine Sorge«, hielt sie dagegen. »Ich werde es nicht so machen, wie deine Mutter es getan hat.« Außer es gibt keine andere Möglichkeit. »Eigentlich hatte ich eher gedacht, Moira hätte vielleicht neue Erkenntnisse für Samuel. Ich fand es nur fair, sie vorzuwarnen, dass ich ihn auf sie angesetzt habe … er klang bei diesem Thema sehr angespannt.«
Ihr Ehemann hob den Kopf auf eine Weise, dass sie fast an ein verängstigtes Pferd denken musste. »Ah. Ich habe dich falsch verstanden. Gut.«
Charles mochte Kinder. Anna wusste, dass er Kinder mochte. Warum stieg bei dem Gedanken an ihr Kind Panik in ihm auf? Sie überlegte, ihn zu fragen. Aber das hatte sie bereits auf verschiedene Weisen getan, und er hatte ihr verschiedene Antworten gegeben, die alle irgendwie wahr waren. Doch sie war sich ziemlich sicher, dass sie die eigentliche Antwort immer noch nicht kannte. Es lag an ihr, diese herauszufinden.
Sobald sie die Antwort gefunden hatte, wäre es ihr möglich, einen Weg zu finden, das Problem zu umgehen. Mit seiner Panik konnte sie umgehen, und wenn er wirklich keine Kinder wollte … nun, auch damit könnte sie umgehen. Es war die Trauer hinter der Panik – die Trauer und die Sehnsucht, die ihre Wölfin von ihm empfing –, die dafür sorgten, dass sie nicht locker ließ. Auf ihre Art.
»Okay«, erklärte sie fröhlich. Sie, die kämpft und davonläuft, um am nächsten Tag wieder kämpfen zu können. »Ich wollte dich nur auf den neuesten Stand bringen.« Anna griff nach der Akte mit den gesammelten Informationen und schob sie sich unter den Arm.
Dann ging sie zum Fenster und sah in den gerade fallenden Schnee hinaus, der die dunkelgrünen Bäume und die nicht weit entfernten Berge verhüllte und der die Welt sauber und frisch wirken ließ. Und gleichzeitig sehr kalt.
»Hast du dich schon entschieden, was du mir zum Geburtstag schenken willst?«, fragte sie.
Charles machte gerne Geschenke. Manchmal war es eine Blume, die er für sie gepflückt hatte – manchmal auch teurer Schmuck. Nach und nach hatte er verstanden, dass die wirklich teuren Geschenke, die ihm am meisten Freude bereiteten, bei ihr dagegen eher eine Art Panik hervorriefen. Deswegen sparte er sich so etwas inzwischen für besondere Gelegenheiten auf.
Er legte den Arm um ihre Schultern, und sein Körper entspannte sich. »Noch nicht. Aber ich rechne fest damit, dass mir noch etwas einfällt.«
Charles konnte sich nicht auf die Zahlen konzentrieren, also schaltete er seinen Computer aus. Geld bedeutete Macht, und auf lange Sicht konnte er damit den Werwölfen mehr Sicherheit bieten als nur mit Fängen und Klauen. Nach einer kurzen Auszeit waren die Finanzen des Rudels wieder in seinen Verantwortungsbereich übergegangen.
Sein Blick fiel auf das gelbe Post-it, das er an den Monitor geklebt hatte – Annas Geburtstag, ihr sechsundzwanzigster. Er musste sich bald ein Geschenk einfallen lassen. Charles bevorzugte Schmuck – was, wie sein Dad ihm erklärt hatte, nur eine besondere Art war, sein Territorium zu markieren, die jeder Mann in der Umgebung verstand.
Meine Gefährtin, sagte der Ring an ihrem Finger. Und wenn Anna sich dazu durchrang, auch die Ketten und Ohrringe zu tragen, die er ihr geschenkt hatte, verkündeten diese: Und ich kann besser für sie sorgen, als ihr es könntet. Seit sein Dad ihn darauf aufmerksam gemacht hatte, warum er diesen Drang verspürte, Anna mit Juwelen zu behängen, hatte er angefangen, nach Geschenken zu suchen, die ihr gefielen.
Anna wollte Kinder.
Er starrte auf den leuchtend gelben Klebezettel.
Es war absolut verständlich, dass Anna sich Kinder wünschte. Charles verstand ihren Wunsch vielleicht sogar besser als sie selbst. Sie war noch am College gewesen, als Justin, der Attentäter des Alphas von Chicago, ihr fast alle anderen Wahlmöglichkeiten genommen hatte; seitdem hatte sie eine Menge Zeit damit verbracht, sich alles zurückzuerobern. Ihr Leben von denen zurückzugewinnen, die es ihr fast vollkommen genommen hatten.
Sein Telefon klingelte, geistesabwesend hob er ab – und dann holte ihn die Stimme am anderen Ende ruckartig in die Realität zurück.
»Hey, Charles«, sagte Joseph Sani, einst sein bester Freund auf der ganzen Welt. »Ich habe heute an dich gedacht. An dich und deine neue Braut.«
»Nicht mehr ganz so neu«, antwortete Charles, ohne sich gegen das Glücksgefühl zu wehren, das in ihm aufstieg. Joseph löste in jedem diese Gefühle aus. »Es sind inzwischen schon drei Jahre – sogar ein paar Monate mehr. Wie geht es dir?«
»Drei Jahre, und ich habe sie noch nicht getroffen«, meinte Joseph, und sein Tonfall fragte: Warum nicht?
Die Jahre vergingen fast unbemerkt, dachte Charles. Und als ich dich das letzte Mal gesehen habe, warst du ein alter Mann. Ich will nicht, dass du alt bist. Bei dem Gedanken schmerzt mein Herz.
»Ich konnte nicht zu deiner Hochzeit kommen«, erklärte Joseph gerade, »aber du warst auch nicht bei meiner. Also sind wir quitt.«
»Ich wusste gar nichts von deiner Hochzeit«, hielt Charles trocken dagegen.
»Ich hatte weder eine Adresse noch eine Telefonnummer von dir«, erwiderte Joseph. »Du warst schwer zu finden. Ich gebe allerdings zu, dass du mich zu deiner Hochzeit eingeladen hattest. Aber über Maggie – und somit habe ich erst am Tag vorher davon erfahren.«
Ja, er hatte sich schon gedacht, dass Maggie die Einladung nicht weitergeben würde. »Es überrascht mich, dass du überhaupt vor der Hochzeit davon erfahren hast«, antwortete Charles und gestand damit seinen eigenen Fehler ein. »Aber wir haben keine offiziellen Einladungen verschickt, sondern die Leute nur angerufen. Ich habe es dreimal versucht, und zweimal davon konnte ich nur mit Maggie sprechen. Beim zweiten Mal habe ich einfach nur eine Nachricht hinterlassen.«
Joseph lachte, dann hustete er.
»Das ist ein übler Husten«, sagte Charles besorgt.
»Es geht mir gut«, sagte Joseph leichthin. »Ich will deine Frau treffen, damit ich mir anschauen kann, ob sie gut genug für dich ist. Warum kommst du nicht mal mit ihr vorbei?«
Charles überschlug die Daten im Kopf. Er hatte Joseph kennengelernt, als dieser ungefähr zwölf war, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Joseph musste jetzt über achtzig sein. Als Charles ihm das letzte Mal von Angesicht zu Angesicht gegenübergestanden hatte, war er noch Mitte sechzig gewesen. Zwanzig Jahre, realisierte er entsetzt. War er wirklich so ein Feigling?
»Charles?«
»Okay«, antwortete Charles bestimmt. »Wir kommen vorbei.« Wieder fiel sein Blick auf den gelben Klebezettel, und da kam ihm eine Idee. »Züchtet Hosteen und du immer noch Pferde?«
Drei Tage später
Chelsea Sani parkte ihr Auto, nahm die Sonnenbrille ab und stieg aus dem Wagen. Im Vorbeigehen tätschelte sie das riesige Schild, das verkündete, dass die Sunshine-Kindertagesstätte ein Ort war, der Kinder glücklich machte. Die eingezäunten Spielbereiche rechts und links neben dem Eingang waren leer, doch sobald sie die schwere Tür der Krippe aufzog, zauberte das fröhliche Schreien von Kindern ein Lächeln auf ihr Gesicht.
Es gab Kitas, die näher an ihrem Haus lagen. Doch diese Einrichtung war sauber und gut organisiert und beschäftigte die Kinder ordentlich. Und vor allem bei ihren Kindern war es immer gut, wenn sie beschäftigt waren.
Michael entdeckte Chelsea sofort, als sie in die Gruppe der Vierjährigen spähte. Er ließ johlend das Spielzeug fallen, mit dem er gerade gespielt hatte, und rannte zu ihr. Sie hob ihn auf den Arm, in dem Wissen, dass schon bald der Moment kommen würde, in dem sie das nicht mehr tun konnte. Dann pustete sie an seinen Hals, und er kicherte. Schließlich zappelte er in ihren Armen, bis sie ihn auf den Boden setzte, damit er zu dem Wandhaken laufen konnte, an dem sein Rucksack hing.
Die verantwortliche Betreuerin winkte ihr schnell zu, nahm sich aber dieses Mal nicht die Zeit für ein kurzes Gespräch, wie sie es sonst manchmal tat. Ihre Assistentin half Michael mit seinem Rucksack, grinste ihn einmal an und wurde dann von einem kleinen Mädchen in einem pinken Kleid abgelenkt.
Michael ergriff Chelseas Hand und tanzte zu Musik, die er nur in seinem Kopf hörte. »Erst holen wir Mackie ab, und dann gehen wir heim«, erklärte er ihr.
»Richtig«, stimmte sie zu, als sie den Flur entlanggingen. Sie öffnete die Tür zu Mackies Klassenzimmer und entdeckte ihre Tochter auf dem stillen Stuhl, die Arme verschränkt und mit einem sehr vertrauten, eigensinnigen Ausdruck auf dem Gesicht – ein Ausdruck, den Chelsea mehr als einmal auch auf dem Gesicht ihres Ehemannes gesehen hatte.
»Hey, Mäuschen.« Sie streckte ihrer Tochter die freie Hand entgegen. »Schlechter Tag?«
Mackie dachte über ihre Worte nach, ohne sich vom Stuhl zu erheben, dann nickte sie ernst. Die neue Betreuerin, die kaum zwanzig sein konnte, eilte herüber und ließ die restlichen Kinder unter der Aufsicht ihrer Kollegin zurück.
»Das gemeinsame Spielen lief heute nicht besonders gut«, erläuterte sie fast grimmig. »Wir mussten mit Mackie ein ernsthaftes Gespräch darüber führen, dass man nett zueinander ist. Ich bin mir nicht sicher, ob der Vortrag Wirkung gezeigt hat.«
»Ich habe es Ihnen aber erklärt. Sie ist nicht hozho«, erklärte Mackie stur. »Es ist nicht sicher, in der Nähe von jemandem zu sein, der nicht hozho ist.«
»Und sie ist eigentlich alt genug, um deutlich zu sprechen«, fuhr die Betreuerin fort, an deren Namen sich Chelsea gerade nicht erinnern konnte.
»Sie spricht deutlich«, schaltete Michael sich ein, immer bereit, seine Schwester zu verteidigen.
»Hozho ist ein Navajo-Wort«, erklärte Chelsea, als Mackie endlich vom Stuhl glitt und die Hand ihrer Mutter packte. Diese entschlossene Art, ihre Hand zu greifen, hieß Verbündete unter Feinden, was bedeutete, dass Mackie nicht der Meinung war, etwas falsch gemacht zu haben. Wenn sie wirklich etwas falsch gemacht hatte, suchte sie niemals die Unterstützung ihrer Mutter. »Ihr Vater oder Großvater bringen ihnen hin und wieder ein wenig Navajo dabei. Hozho ist« – es war kompliziert und einfach zugleich, aber in jedem Fall schwer zu erklären –, »was das Leben sein soll.«
»Glücklich«, sagte Michael, in dem Versuch, hilfreich zu sein. »Hozho ist wie Picknicks und Schaukeln. Fröhliche kleine Bäume.« Er drehte sich um Chelseas Hand, ohne sie loszulassen, und vollführte ein paar Tanzschritte, als er sang: »Glücklicher Wind.«
»Navajo?«, fragte die Betreuerin. Sie klang überrascht.
»Ja.« Chelsea schenkte ihr ein gefährliches Lächeln. Niemand hätte Chelsea angesehen – deren Vorfahren Schiffe mit Drachenköpfen gesteuert hatten – und aufgrund ihres Aussehens dann angenommen, dass ihre Gene für die bronzefarbene Haut und die dunklen Augen ihrer Kinder, die an eine stürmische Nacht denken ließen, verantwortlich wären. Wenn du dafür sorgst, dass meine Kinder – oder irgendwelche Kinder– sich für das schämen, was sie sind, werde ich dir beibringen, warum Leute Grizzly-Mütter mehr fürchten als Grizzly-Väter. Ich werde dir beibringen, dass sich selbst ein Kind, dessen Eltern Marsmenschen sind, sich hier sicher fühlen sollte.
»Das ist so cool«, sagte die Betreuerin, ohne sich der Gefahr bewusst zu sein, in der sie gerade geschwebt hatte. »Wir hatten vor, uns in ein paar Wochen mit den amerikanischen Ureinwohnern zu beschäftigen. Glauben Sie, ihr Vater oder ihr Großvater würden sich bereit erklären herzukommen und mit den Kindern zu reden?«
Der Enthusiasmus der jungen Frau nahm Chelsea den Wind aus den »Ich werde meine Kinder bis zum Tod verteidigen«-Segeln. Sie beruhigte ihren inneren Wikinger und sagte: »Vielleicht besser am Ende des Monats. Seine Familie züchtet Pferde, und bald ist die große Pferdeschau. Bis dahin steht die ganze Familie unter Hochspannung.«
Ein kleines Mädchen erregte plötzlich Chelseas Aufmerksamkeit. Das Kind stand in der Mitte des Raums, seltsam allein inmitten in der ganzen Aufregung, die durch die ankommenden Eltern entstand.
Da Chelsea die Kinder jeden Tag abholte, kannte sie die meisten Kinder in der Klasse vom Sehen. Auch dieses Mädchen war ihr schon einmal aufgefallen. Das Mädchen und Mackie hatten vor ein paar Monaten zusammen Blumen aus Ton geknetet, um sie Chelsea und der Mutter der Kleinen zu Weihnachten zu schenken. Beide Mädchen hatten wie triumphierende Hyänen gekichert, als sie versucht hatten zu erklären, wie sie die Blumen gemacht hatten. Das andere Mädchen war nach irgendeinem Edelstein benannt. Nicht Ruby oder Diamond … sondern Amethyst. So hieß sie.
Heute allerdings beobachtete Amethyst Mackie angespannt und wirkte überhaupt nicht mehr wie das kichernde kleine Mädchen, das Chelsea damals kennengelernt hatte. Während die Betreuerin ihr begeistert von dem Pony erzählte, das sie in ihrer Kindheit besessen hatte, richtete das kleine Mädchen ihren Blick von Mackie auf Chelsea. Graugrüne Augen hielten kurz Chelseas Blick, dann drehte sich das Mädchen weg.
»Ich reite nur hin und wieder«, sagte Chelsea abgelenkt. »Und ich habe auch sonst kaum etwas mit den Pferden zu tun. Das macht mein Mann, und er hat zudem Assistenten.«
»Cool«, meinte die Betreuerin. »Ich werde Ihren Mann nach der Show darum bitten, mal bei uns vorbeizuschauen.« Sie sah Mackie an. »Tschüss, Süße. Morgen bauen wir Windräder. Ich denke, das wird dir gefallen.«
Mackie musterte sie ernsthaft, dann nickte sie huldvoll. »In Ordnung, Miss Baird. Wir sehen uns dann morgen.« Es schien, als hätte sie der Betreuerin für den Moment vergeben.
Mackie hatte klare Vorlieben und Abneigungen. Sie mochte Miss Newman, die letztes Jahr ihre Betreuerin gewesen war und dieses Jahr die Verantwortung für Michaels Gruppe trug. Die Leiterin der Kindertagesstätte, den Hausmeister und Eric, einen der Freunde ihres viel älteren Bruders Max, mochte sie nicht. Eric hatte sogar aufgehört, Max zu besuchen, weil Mackie dafür sorgte, dass ihm unbehaglich zumute wurde. Chelsea hielt Eric für einen netten Jungen, hatte aber durchaus ebenso Bedenken in Bezug auf Miss Newman.
Mackie zog an der Hand ihrer Mutter und führte sie aus der Krippe. Während Chelsea Michael in seinen Kindersitz schnallte, legte sich Mackie selbst den Gurt an. Mackie schnallte sich schon selbst an, seitdem sie fähig war, den Gurt zu bedienen.
Sie als »unabhängig« zu bezeichnen war noch eine Untertreibung, dachte Chelsea reumütig. Das hatte Mackie von ihrer Mutter geerbt, und dasselbe galt für ihren bestimmenden Charakter. Beides kam Chelsea im Geschäftsleben sehr zugute, würde aber wahrscheinlich auch dafür sorgen, dass die neue Betreuerin nicht zum letzten Mal ihre Schwierigkeiten mit Mackie gehabt hatte.
Und wenn sie gerade darüber nachdachte … »Was ist eigentlich passiert?«, fragte Chelsea ihre Tochter. Dann rieb sie sich die Schläfen, weil sie plötzlich Kopfschmerzen bekam. »Warum hat Miss Baird dich auf den stillen Stuhl geschickt?«
Mackie musterte ihre Mutter nachdenklich.
Ihrem Dad würde Mackie die absolute, ungeschminkte Wahrheit erzählen, wenn er fragen sollte. Doch das tat er selten, weil er sich mehr dafür interessierte, wie sie mit der Situation umgegangen war als für die Einzelheiten des eigentlichen Vorfalls. Hatte sie das Richtige getan? Hätte sie einen anderen Weg wählen können, um ein besseres Resultat zu erzielen? Das waren die Fragen, die Kage wichtig waren.
Chelsea dagegen würde nur das hören, wovon Mackie glaubte, dass sie es wissen musste. Nicht weil Mackie Angst davor hatte, Ärger zu bekommen, sondern – davon war Chelsea fest überzeugt – weil Mackie sich sehr darum bemühte, ihrer Mutter jeglichen Schmerz und Kummer zu ersparen.
Mackie machte ihrer Mutter trotzdem Sorgen. Ihre beiden Söhne, Max und Michael, hatten fröhliche, unbelastete Gemüter. Mackie dagegen war schon ernst und wachsam auf die Welt gekommen, jetzt war sie eine hundertjährige Seele in einem kaum fünf Jahre alten Körper. Manchmal gab es unbeschwerte Momente, doch ihr normales Verhalten war von Wachsamkeit geprägt. Kage erklärte immer, seine Tochter hätte die Seele eines Kriegers.
»Das Mädchen, mit dem ich mir die Wachsmalkreiden teilen sollte, war irgendwie wie Chindi«, erklärte Mackie schließlich, was überhaupt keinen Sinn ergab. Trotz der Tatsache, dass Chelsea nur einzelne Navajo-Worte verstand, war sie sich ziemlich sicher, dass Chindi die bösen Geister der Toten bezeichnete. »Aber irgendwie auch nicht wie Chindi«, fügte Mackie rätselhaft hinzu.
»Man soll nicht Chindi sagen«, erklärte Michael finster. »Ánáli Hastiin sagt, dass dann schlimme Dinge passieren.«
»Okay«, sagte Chelsea, plötzlich genervt davon, verstehen zu müssen, was in der Kita geschehen war. Kage konnte sich mit Mackie unterhalten, sobald sie zu Hause waren.
Es war Februar, und gewöhnlich gab es um diese Jahreszeit einige Regenfälle, doch heute war der Himmel strahlend blau. Die Sonne brannte und sorgte dafür, dass Chelseas Augen bald genauso schmerzten wie ihr Kopf. Chelsea hatte keine Aspirin im Auto, also musste sie erst nach Hause, um Erleichterung zu finden. Erleichterung von allem.
»Ich glaube, ich muss mal mit eurem Großvater darüber reden, was er euch so beibringt«, sagte sie.
»Nicht Großvater«, erklärte Mackie. »Ánáli Hastiin.«
Ánáli Hastiin bedeutete Großvater. Doch sie benutzten das Navajo-Wort nur für Mackies Urgroßvater Hosteen.
»Schön«, meinte Chelsea. »Ich werde mit Ánáli Hastiin darüber reden, was man mit Fünfjährigen diskutieren darf und was nicht.« Dann schlug sie die Hintertür des Wagens ein wenig fester zu als nötig und fuhr los.
»Bis jetzt haben wir auf dieser Reise«, sagte Anna mit einem Unterton trockener Erheiterung in der Stimme, die Charles über die Kopfhörer deutlich mitbekam, »über die aktuellen Börsenentwicklungen geredet und darüber, wieso sie gut für uns und schlecht für viele andere Leute sind. Wir haben darüber gesprochen, welche Probleme entstehen, wenn man Militärtaktiken bei Polizeieinsätzen einsetzt. Wir haben über die künstlerische Freiheit bei der Verfilmung von klassischen Fantasy-Romanen geredet und darüber, ob die Ergebnisse gut oder schrecklich waren. Und wir haben anerkannt, dass wir verschiedener Meinung sind, auch wenn ich trotzdem recht habe.«
Wir haben nicht über das Thema geredet, über das wir dringend sprechen müssen, mein Geliebter. Meine Mutter hat immer gesagt, niemand wäre so stur wie eine Latham, und das werde ich dir beweisen. Wir haben Zeit.
Also sprach sie ein anderes Thema an, dem er bis jetzt ausgewichen war. »Bist du inzwischen so weit, mir zu verraten, wo wir hinfliegen?«
Charles lächelte, ganz leicht nur.
Sie schnaubte amüsiert. »Ich versuche nur zu entscheiden, ob es um mein Geburtstagsgeschenk geht oder um Arbeit.« Es ging um ihr Geschenk, dessen war sie sich sicher. Ihr Geburtstag war erst in zwei Wochen, doch Charles war nie so gut gelaunt und sorglos (wie jetzt), wenn es um einen Auftrag seines Vaters ging.
»Okay«, meinte Charles gutgelaunt, und sie schlug ihm leicht gegen die Schulter.
»Ganz vorsichtig.« Er ließ das Flugzeug leicht schwanken. »Wenn du weiterhin den Piloten schlägst, könnten wir abstürzen.«
»Hmmm.« Sie machte sich keine Sorgen. Wenn Charles etwas tat, dann richtig. »Wo fliegen wir hin? Also, mal abgesehen von Arizona.« So viel hatte er ihr bereits verraten, irgendwann zwischen dem Gespräch über Polizeiarbeit und dem über Filme. »Arizona ist ein großer Staat.«
»Scottsdale«, ließ er sie wissen.
Sie sah ihn stirnrunzelnd an. Über Scottsdale wusste sie nur eines: »Gehen wir golfen?« Ihr Vater golfte in seinen gelegentlichen Urlauben gerne.
»Nein, wir machen das andere, wofür Scottsdale berühmt ist.«
»Wir checken in einem Resort ein und hängen mit Promis ab?«, fragte sie zweifelnd.
»Wir finden ein Pferd für dich.«
»Jinx ist doch mein Pferd«, antwortete sie sofort.
Jinx war ein Mischling, dessen Vorfahren – so hatte Charles es ihr erklärt – wahrscheinlich hauptsächlich Quarter Horses waren. Er hatte den alten Wallach auf einer Auktion erstanden, indem er den Abdecker überboten hatte.
Auf Jinx hatte Anna das Reiten gelernt.
»Nein«, erwiderte Charles. »Jinx ist zwar ein toller Babysitter, aber er ist faul. Er mag keine langen Ausritte, und er galoppiert auch nicht gern. Du brauchst ein anderes Pferd. Ich habe ein gutes Zuhause für ihn im Blick. Dort wird er langsam Kinder im Kreis herumtragen: Das wird ihm gefallen.«
»Und in Montana gibt es keine Pferde, die sich für mich eignen würden?«
Er lächelte. »Ich habe einen alten Freund, der Araber züchtet. Neulich habe ich mit ihm telefoniert, und dann habe ich an deinen Geburtstag gedacht und daran, dass es Zeit ist, dass du ein neues Pferd bekommst.«
Anna lehnte sich zurück. Ein Araber. Bilder aus dem Film Der schwarze Hengst stiegen vor ihrem inneren Auge auf, und sie konnte ein glückliches kleines Seufzen nicht unterdrücken.
»Ich mag Jinx«, erklärte sie trotzdem.
»Das weiß ich«, antwortete Charles. »Und er mag dich.«
»Er ist wunderschön.«
»Das ist er«, stimmte Charles zu. »Aber er wird auch mit einem erleichterten Seufzen dabei zusehen, wie du ein anderes Pferd sattelst, um dann wieder einzuschlafen.«
»Araber sehen aus wie Karussellpferde«, meinte Anna, die immer noch das Gefühl hatte, sie würde den freundlichen Wallach verraten, der ihr so viel beigebracht hatte.
Charles lachte. »Das ist wahr. Vielleicht passen die Araber gar nicht zu dir. Sie passen nicht zu jedem. Denn sie sind wie Katzen: eitel, schön und intelligent. Aber du kommst ganz gut mit Asil zurecht, der ebenfalls eitel, schön und intelligent ist. Und wenn du in Scottsdale kein gutes Pferd für dich findest, können wir sicher näher an zu Hause eines aufspüren.«
»Okay«, erwiderte Anna, doch in ihrer Vorstellung ritt sie bereits auf einem ungesattelten schwarzen Hengst ohne Zaumzeug über den Strand einer einsamen Insel, und das in gestrecktem Galopp.
Charles musste es an ihrer Stimme gehört haben, denn er lächelte.
Dann drängte eine andere Frage in den Vordergrund – die sie bis jetzt nur deswegen nicht gestellt hatte, weil der Pferdeteil der Unterhaltung sie zu sehr beschäftigt hatte. »Ein alter Freund«, hatte er gesagt. Charles hatte nicht viele Freunde. Bekannte, ja, aber keine Freunde – und Charles wählte seine Worte immer sehr sorgfältig. Sie konnte die Leute, denen er nahestand, an den Fingern einer Hand abzählen – sie selbst, sein Bruder Samuel und sein Dad. Wahrscheinlich konnte man noch Mercy, die Kojoten-Gestaltwandlerin, die in seinem Rudel aufgewachsen war, dazuzählen. Aber das war es dann auch schon. Charles war fast zweihundert Jahre alt, und bis jetzt hatte er sehr wenige Leute gefunden, die er liebte.
»Erzähl mir von deinem alten Freund«, sagte sie.
»Joseph Sani ist der beste Reiter, den ich je gesehen oder von dem ich je gehört habe«, sagte Charles langsam. »Er ist ein Draufgänger ohne jeden Selbsterhaltungstrieb.« Die meisten Leute hätten die halb verzweifelte, liebevolle Bewunderung in Charles’ Stimme nicht wahrgenommen. »Je gefährlicher eine Situation ist, desto wahrscheinlicher stürzt er sich hinein. Er versteht Leute – durchschaut sie vollkommen – und mag sie trotzdem.« Er mag mich. Das sprach Charles nicht aus, doch Anna hörte es trotzdem. Dieser Joseph war ein Mann, der ihren Ehemann kannte und liebte.
Du liebst ihn auch, dachte Anna. Und trotzdem hast du in drei Jahren nicht einmal seinen Namen erwähnt.
Sie sprach es nicht aus, doch seine Augen huschten zu ihr und dann wieder zur Seite, also nahm sie an, dass er ihren Gedanken durch die Gefährtenbindung, deren Nützlichkeit sie immer wieder überraschte, aufgefangen hatte. Dadurch war es schwer, Geheimnisse vor seinem Gefährten zu bewahren, und es fiel schwerer, lange Zeit auf jemanden wütend zu sein, dessen Schmerz – und Liebe – man fühlte. Ihre Verbindung schien besser Gefühle als Worte zu transportieren. Doch manchmal kamen auch ganze Sätze an.
»In der Tat«, sagte er. »Bevor ich dich getroffen habe, war er mein bester Freund. Ich habe ihn seit zwanzig Jahren nicht gesehen, denn als ich ihn das letzte Mal besucht habe, ist mir aufgefallen, dass er alt wird. Er ist ein Mensch, kein Werwolf.« Charles starrte in den blauen Himmel hinaus. »Ich habe mich nicht bewusst von ihm ferngehalten, Anna. Nicht absichtlich. Aber ihn zu besuchen war … nicht mehr gut. Früher habe ich mich darauf verlassen, dass er für meinen … Ausgleich sorgt. Das, was du jetzt für mich tust, wenn Dads Aufträge besonders schlimm sind.« Er atmete zitternd ein. »Es fällt mir schwer mich zu verabschieden, Anna. Abschiede sind weder würdevoll noch souverän, sie reißen einem das Herz heraus und lassen es für jeden Aasfresser liegen, der des Weges kommt.«
Sie legte eine Hand auf seinen Schenkel und ließ sie dort, bis er das Flugzeug landete.
Chelseas Kopfschmerzen wurden während der Heimfahrt immer schlimmer, und nach ein paar scharfen Antworten hielten die Kinder den Mund. Sie sehnte sich so sehr nach ihrem Zuhause, wie sie es nicht mehr getan hatte, seitdem sie mit zehn Jahren aus einem sehr langen, sehr unangenehmen Sommercamp zurückgekommen war.
Ihr Kopfschmerz ließ allerdings auf keine wundersame Weise nach, als sie den Wagen in die Einfahrt lenkte. Chelsea holte die Kinder aus dem Auto und brachte sie ins Haus. Sie hätte etwas … mit ihnen unternehmen sollen, doch sie machte sich Sorgen, dass sie in diesem Zustand ihre Gefühle verletzen könnte … oder Schlimmeres.
Also überließ Chelsea die Kinder sich selbst und stolperte durch ihr Schlafzimmer zum Bad dahinter. Wenn sie nur diese Kopfschmerzen loswürde, könnte sie ihr inneres Gleichgewicht wiederfinden.
Sie nahm drei Schmerztabletten, obwohl der Beipackzettel zwei als Höchstmenge anführte. Die Pillen waren trocken und blieben ihr fast in der Kehle stecken; sie schluckte noch zwei weitere, dann hielt sie ihren Mund an den Wasserhahn und trank, um sie runterzuspülen.
Zu viele, dachte Chelsea, doch ihr Kopf tat so schrecklich weh. Sie wollte noch mehr schlucken. Ihre Hand hob sich zum Medizinschrank, in dem sie noch ein paar übrig gebliebene Schmerztabletten von ihrer Wurzelbehandlung vor ein paar Monaten aufbewahrte. Dabei stieß sie gegen das Glas mit den Zahnbürsten, das in die Spüle fiel und zerbrach.
Sie wollte die Scherben wegräumen, doch ihr Kopfweh machte sie ungeschickt. Beim Wegwerfen schnitt sie sich an einer Scherbe. Es war allerdings keine schlimme Wunde. Schnell steckte sie sich den Finger in den Mund, dann starrte sie sich im Spiegel über dem Waschbecken an. Sie sah … falsch aus. Chelsea hob die Hände ans Gesicht und zog ihre Wangen nach hinten, bis ihre Nase ein wenig flacher wurde, doch das änderte nichts daran, dass sie an der Stelle, an der ihr eigenes Spiegelbild hätte sein sollen, eine Fremde sah.
Sie wusch sich das Gesicht mit kaltem Wasser, und das schien die Kopfschmerzen ein wenig zu dämpfen. Ihr Finger hatte aufgehört zu bluten.
Ein Blick auf die Uhr verriet ihr, dass Max schon bald nach Hause kommen würde. Er war mehr als zehn Jahre älter als seine Halbgeschwister, und kam vom … Was für ein Sport war es gleich noch mal? Basketball. Er hatte nach der Schule Basketballtraining.
Und wenn er bald nach Hause kam, dann war sie bereits seit einer Stunde im Bad und hatte einen Vierjährigen und eine Fünfjährige eine Stunde lang ohne Aufsicht allein gelassen. Sie eilte aus dem Bad und die Treppe nach unten. Das Lärmen des Fernsehers führte sie ins Wohnzimmer, wo die Kinder eine Zeichentrickserie schauten. Michael sah nicht einmal auf, aber Mackie warf ihr einen argwöhnischen Blick zu.
ENDE DER LESEPROBE