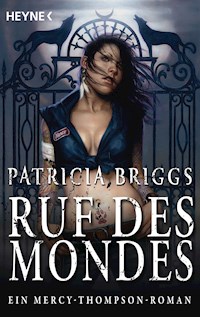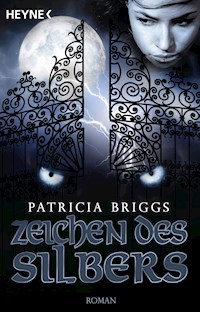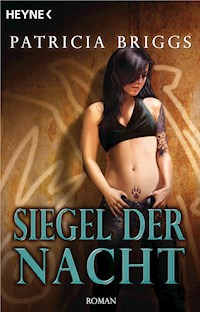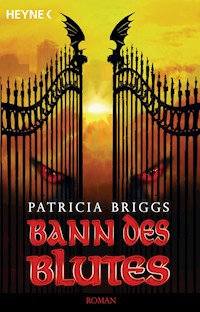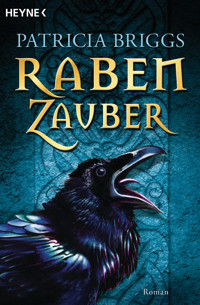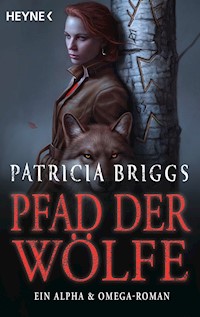9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Mercy-Thompson-Reihe
- Sprache: Deutsch
Mercy Thompsons neuester Auftrag beginnt harmlos: Sie und ihr Gefährte Adam sollen einen randalierenden Troll zur Vernunft bringen. Doch dann finden sie dabei einen seit Langem vermissten Jungen – einen Jungen, der einst von den Fae entführt wurde. Plötzlich droht die ohnehin schon angespannte Situation zwischen den Menschen und den Fae völlig zu eskalieren, und die Tri-Cities stehen vor einem Bürgerkrieg. Um das Schlimmste zu verhindern, nehmen Mercy und Adam den Jungen in ihrem Rudel auf – nicht ahnend, dass ihr Schützling eine dunkle Gabe hat ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 540
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Das Buch
Eigentlich beginnt Mercy Thompsons neuester Auftrag ganz harmlos: Gemeinsam mit ihrem Gefährten Adam, dem mächtigen Alpha ihres Werwolfsrudels, soll sie einen randalierenden Troll zur Vernunft bringen. Doch dann nehmen die Ereignisse eine unerwartete Wendung: Die beiden finden auf ihrer Mission einen seit Langem vermissten Jungen – einen Jungen, der einst von den Fae entführt wurde. Plötzlich droht die ohnehin schon angespannte Situation in der Stadt völlig zu eskalieren, und die Tri-Cities stehen vor einem Bürgerkrieg zwischen Menschen und magischen Völkern. Um das Schlimmste zu verhindern, nehmen Mercy und Adam den Jungen in ihrem Rudel auf – nicht ahnend, dass ihr Schützling eine dunkle Gabe hat ...
Die MERCYTHOMPSON-Serie
Erster Roman:
Ruf des Mondes
Zweiter Roman:
Bann des Blutes
Dritter Roman:
Spur der Nacht
Vierter Roman:
Zeit der Jäger
Fünfter Roman:
Zeichen des Silbers
Sechster Roman:
Siegel der Nacht
Siebter Roman:
Tanz der Wölfe
Achter Roman:
Gefährtin der Dunkelheit
Neunter Roman:
Spur des Feuers
Die ALPHA & OMEGA-Serie
Erster Roman:
Schatten des Wolfes
Zweiter Roman:
Spiel der Wölfe
Dritter Roman:
Fluch des Wolfes
Vierter Roman:
Im Bann der Wölfe
Die Autorin
Patricia Briggs, Jahrgang 1965, wuchs in Montana auf und interessiert sich seit ihrer Kindheit für Phantastisches. So studierte sie neben Geschichte auch Deutsch, denn ihre große Liebe gilt Burgen und Märchen. Neben erfolgreichen und preisgekrönten Fantasy-Romanen wie Drachenzauber widmet sie sich ihrer Mystery-Saga um Mercy Thompson. Nach mehreren Umzügen lebt die Bestsellerautorin heute gemeinsam mit ihrer Familie in Washington State.
Patricia Briggs
Ein MERCY-THOMPSON-Roman
Deutsche Erstausgabe
WILHELMHEYNEVERLAG
MÜNCHEN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Titel der amerikanischen Originalausgabe:FIRE TOUCHEDDeutsche Übersetzung von Vanessa Lamatsch
Redaktion: Diana MantelCopyright © 2016 by Hurog, Inc.Copyright © 2017 der deutschsprachigen Ausgabe byWilhelm Heyne Verlag, München,in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: Animagic, Bielefeld, unter Verwendung der Motive von Daniel Dos Santos Karte: Andreas HancockSatz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad AiblingISBN 978-3-641-20079-4V003
www.heyne.dewww.penguinrandomhouse.de
Für Nanette
1
Ich setzte mich mit einem Ruck im Bett auf, aufgeschreckt von einem Gefühl der Dringlichkeit, das gerade seine Klauen in meinen Unterleib zu schlagen schien. Vollkommen verkrampft lauschte ich auf das, was mich geweckt hatte, konnte jedoch in der Frühsommernacht keine ungewöhnlichen Geräusche wahrnehmen.
Ein warmer Arm schlang sich um meine Taille.
»Mercy?« Adams Stimme klang rau und verschlafen. Was auch immer mich geweckt hatte, meinen Ehemann hatte es nicht gestört. Hätte irgendetwas nicht gestimmt, wären seine Stimme entschlossen und seine Muskeln angespannt gewesen.
»Ich habe etwas gehört«, erklärte ich Adam, obwohl ich mir inzwischen nicht mal sicher war, ob das stimmte. Es hatte sich zumindest angefühlt, als ob ich etwas gehört hätte. Aber ich hatte geschlafen und konnte mich jetzt nicht mehr daran erinnern, was mich eigentlich gestört hatte.
Adam ließ mich los, um sich vom Bett und auf die Beine zu rollen. Wie ich lauschte er in die Nacht. Ich fühlte, wie er sein Bewusstsein in Richtung des Rudels ausstreckte, auch wenn ich nicht mitbekam, was er von dort empfing. Meine Verbindung mit dem Columbia-Basin-Rudel bestand in einer einfachen Mitgliedschaft, aber Adam war der Alpha dieses Rudels.
»Niemand sonst im Haus wurde gestört«, sagte er und drehte den Kopf, um mich anzusehen. »Ich habe nichts gespürt. Was hast du genau gehört?«
Ich schüttelte den Kopf. »Ich weiß es nicht. Etwas Schlimmes.« Dann schloss ich meine Faust um den Wanderstab, der neben meinem Körper lag. Diese Bewegung lenkte Adams Blick auf meine Hände. Er runzelte die Stirn, dann ging er neben dem Bett in die Hocke und entzog mir sanft den Stab.
»Hast du ihn gestern Abend mit ins Bett genommen?«, fragte er.
Ich bewegte meine Finger und starrte genervt auf den Wanderstab hinunter. Bis Adam mich darauf aufmerksam gemacht hatte, war mir nicht einmal bewusst gewesen, dass der Stab wieder einmal dort aufgetaucht war, wo er nicht hingehörte. Er war ein Fae-Artefakt – ein Artefakt von eigentlich geringer Bedeutung, wie mir erklärt worden war.
Der Wanderstab war hübsch, aber nicht großartig verziert – ein einfacher Holzstab mit gravierten Beschlägen aus Silber. Das Holz war grau durch Alter, Politur oder beides. Als mir der Stab zum ersten Mal nach Hause gefolgt war wie ein verwirrter Welpe, war er mir noch harmlos erschienen. Doch Gegenstände des Feenvolkes waren selten das, als was sie erschienen. Und selbst geringfügige Artefakte konnten mit der Zeit an Macht gewinnen.
Der Stab war voller alter Magie und sehr stur. Wann immer ich versucht hatte, ihn dem Feenvolk zurückzuerstatten, blieb er einfach nicht bei den Fae. Dann hatte ich mit dem Stab getötet – oder er hatte mich benutzt, um etwas damit zu töten. Jemanden. Und das hatte den Wanderstab verändert. Ich hatte im Anschluss nicht gewusst, was ich mit dem Stab tun sollte, also hatte ich ihn an Kojote verschenkt.
Mein Leben war ein ständiger Lernprozess. Eine Sache, die ich inzwischen kapiert hatte, war: Verschenk keine magischen Gegenstände an Kojote. Er hatte mir den Stab etwas später wieder zurückgegeben, und seitdem war das Artefakt … nicht mehr dasselbe.
Ich öffnete und schloss meine Finger mehrmals, aber das brennende Bewusstsein, dass irgendetwas nicht stimmte, war inzwischen verklungen. Probeweise hob ich die Hand und berührte erneut den Wanderstab, doch meine Furcht kehrte nicht zurück.
»Vielleicht hatte ich einfach einen Albtraum«, erklärte ich Adam. Unter Umständen hatte der Stab gar keine Schuld daran.
Adam nickte und legte den Wanderstab auf meine Kommode, wo er inzwischen meistens ruhte. Ihn in einen Schrank zu sperren erschien mir irgendwie unhöflich.
Dann kam Adam zurück zum Bett und küsste mich, ein schneller, besitzergreifender Kuss. Als er sich wieder von mir löste, musterte er mich genau, um sicherzugehen, dass es mir wirklich gut ging.
»Ich will mich nur kurz im Haus umsehen, um auf Nummer sicher zu gehen.« Er wartete auf ein Nicken von mir, bevor er mich allein ließ.
Ich wartete im Dunkeln auf meinen Ehemann. Vielleicht war das Ganze nur ein Albtraum gewesen, aber vielleicht stimmte irgendetwas wirklich nicht. Währenddessen dachte ich über die Dinge nach, die meine Instinkte ansprechen könnten – und die Dinge, um die ich mir Sorgen machte.
Möglicherweise war irgendetwas mit Tad und Zee passiert – das hätte die Gegenwart des Wanderstabes in meinem Bett erklärt. Der Wanderstab könnte sich also Sorgen um sie machen – die beiden gehörten schließlich zum Feenvolk. Oder zumindest war Zee ein Fae.
Die Fae hatten sich vor einiger Zeit in ihre Reservate zurückgezogen, nachdem einer der Grauen Lords, die das Feenvolk regierten, die Unabhängigkeit der Fae von der menschlichen Regierung erklärt hatte. Zee, mein alter Freund und – zumindest in allen Belangen der Mechanik – mein Mentor, war ebenfalls gezwungen gewesen, sich in das Reservat in Walla Walla zurückzuziehen, das vielleicht eine Stunde entfernt lag.
Das Feenvolk hatte sich hinter den Mauern verbarrikadiert, die die Regierung für sie gebaut hatte. Sie hatten den Menschen ungefähr einen Monat Zeit gegeben, um selbst herauszufinden, dass die Mauern bei Weitem nicht das Einzige waren, was die Reservate schützte. Das Reservat von Walla Walla war schließlich quasi verschwunden, verborgen hinter Illusionen und Magie. Die Straße, die einmal dort hingeführt hatte, tat das nun nicht mehr. Gerüchten zufolge vergaßen Piloten ihren Kurs, wenn sie versuchten, das Reservat aus der Luft anzusteuern. Auf Satellitenfotos erschien nur eine graue Fläche, die viel größer war als das eigentliche Reservat.
Dann hatte das Feenvolk ein paar ihrer Monster auf die Menschheit losgelassen. Fae, die bisher von ihren Herrschern unter Kontrolle gehalten worden waren, wurden freigelassen. Leute starben. Die Regierung versuchte die Geschichten zu vertuschen, um Panik zu vermeiden, doch langsam bekamen die Medien Wind von der Sache.
Erneut schlossen sich meine Finger um das graue Holz des Wanderstabes, der inzwischen quer über meinem Schoß lag. Um den Wanderstab, den Adam gerade erst auf die Kommode gelegt hatte. Der Stab bewegte sich selbsttätig, doch es war mir noch nie gelungen, ihn dabei zu ertappen.
Zuerst hatte ich mir keine großen Sorgen um Zee gemacht – er konnte gut auf sich selbst aufpassen. Tad und ich hatten ihn hin und wieder sogar kontaktieren können.
Tad war Zees Sohn. Ein Halb-Fae – das Produkt eines überwiegend gescheiterten Experiments der Grauen Lords, mit dem sie hatten herausfinden wollen, ob Fae sich mit Menschen reproduzieren und dennoch Fae bleiben konnten – war Tad nicht verpflichtet gewesen, sich in ein Reservat zurückzuziehen (und man hatte ihn auch nicht dazu aufgefordert). Das Feenvolk hatte keine Verwendung für ihre Halbblut-Abkömmlinge, zumindest nicht, bis Tad offenbart hatte, dass seine Magie mächtig und selten war. Dann hatten sie ihn natürlich doch gewollt.
Sieben Wochen waren seitdem vergangen. Ohne Tad war ich nicht fähig gewesen, den Spiegel zu aktivieren, mit dem wir früher Kontakt zu Zee aufgenommen hatten. Sieben Wochen und kein Wort von den beiden.
»Geht es um Tad?«, fragte ich den Wanderstab. Doch er lag unbeweglich unter meinen Händen. Als ich Adam auf der Treppe hörte, stand ich auf und legte den Stab wieder auf die Kommode.
Am nächsten Morgen saß ich am Küchentisch, blätterte durch einen weiteren Katalog mit Mechanikerbedarf und notierte mürrisch Seitennummern und Preise auf einem Block.
Ich hatte die letzte Nacht nicht vergessen. Trotzdem, ich konnte nicht einfach herumsitzen und nichts tun, während ich darauf wartete, dass irgendetwas Schlimmes geschah. Aber ich besaß keine Möglichkeit, Zee oder Tad zu kontaktieren. Außerdem gab es keine Chance herauszufinden, ob der Wanderstab mir wegen etwas Realem Panik eingeflößt hatte oder ob ein Albtraum den Stab zu mir gerufen hatte.
Falls etwas Schreckliches geschehen sollte, würde es meiner Erfahrung nach passieren, egal was ich gerade tat – und abwartend herumzusitzen war einfach sinnlos. Also arbeitete ich.
Der sanfte Wind brachte die Seiten zum Rascheln. Noch hatten wir Frühsommer, und es war kühl genug, um die Fenster offen zu lassen. Schon in ein paar Wochen würde die Hitze vom Land Besitz ergreifen, doch im Moment gaben nur vereinzelte Stürme Anlass zu Beschwerden. Ich drückte die Seiten des Katalogs flach und verglich die Daten der billigsten Hebebühne mit denen der zweitbilligsten.
Es war uns gelungen, ein paar Werkzeuge aus meiner Werkstatt zu retten, nachdem ein Vulkangott dort kürzlich alles geröstet hatte. Aber die meisten Dinge waren von der Hitze verzogen – und andere Dinge waren zerstört worden, als der Rest des Gebäudes eingestürzt war. Es würde Monate dauern, um die Werkstatt wieder aufzubauen – aber bei manchen Sachen würde es wohl sogar Monate dauern, um sie zu bestellen.
In der Zwischenzeit schickte ich viele Kunden zur ansässigen VW-Niederlassung. Ein paar meiner ältesten Kunden – und diejenigen mit den größten Geldproblemen – ließ ich ihre Autos zu der großen Scheune vor meinem alten Zuhause bringen. Es gab in der Scheune zwar nicht alle Werkzeuge, aber zumindest um einfachere Reparaturen konnte ich mich dort kümmern.
Von oben drang Musik aus Jesses Kopfhörern an mein Ohr. Ihre Tür musste offen stehen, oder ich hätte nichts gehört. Die Kopfhörer waren ein Kompromiss, der schon vor meinem Einzug geschlossen worden war. Jesse hatte mir einmal erklärt – bevor ihr Vater und ich geheiratet hatten –, dass ihr Vater ihrer Vermutung nach nichts dagegengehabt hätte, wenn sie Big-Band-Musik oder Elvis über die Stereoanlage abgespielt hätte. Er mochte Musik. Nur eben nicht die Musik, die sie hörte.
Jesse hatte mir außerdem erklärt, dass er wahrscheinlich den Kompromiss mit den Kopfhörern nie geschlossen hätte, wenn sie ihm nicht erklärt hätte, dass ihre Mutter sie spielen ließ, was auch immer sie wollte (das war die Wahrheit – man log Werwölfe nicht an, denn sie erkannten das). Werwölfe konnten sogar Musik hören, die über Kopfhörer abgespielt wurde – und das nervte sie bei Weitem nicht so wie Musik aus Lautsprechern.
Mir gefiel Jesses Musik allerdings, und ich summte mit, während ich aus dem Katalog auswählte, was ich nicht wollte, was ich sehr wohl wollte, aber nicht brauchte, und was ich dagegen wirklich brauchte. Sobald die Liste fertig war, würde ich sie mit meinem Budget abgleichen. Ich rechnete fest damit, dass ich dann noch einmal sortieren würde – danach, was ich brauchte und was ich unbedingt brauchte.
Über Jesses Musik hinweg hörte ich männliche Stimmen, die die Rudelfinanzen und unsere Pläne für die nächsten sechs Monate diskutierten. Heute war offensichtlich ein Tag der Finanzplanung. Unser Rudel besaß genügend Geld, um es zu investieren und damit den Wölfen zur Seite zu stehen, die Hilfe brauchten. Unser Rudel, weil ich zwar kein Werwolf war, aber trotzdem ein Mitglied des Rudels – was ungewöhnlich war, aber nicht einzigartig.
Nicht alle Rudel besaßen die Ressourcen, die uns zur Verfügung standen. Es war allerdings gut, wenn ein Werwolfrudel Geld besaß. Werwölfe mussten sich anstrengen, um ihre Wölfe zu kontrollieren, und Stress machte den Kampf noch schwieriger. Geldmangel war ein häufiger Auslöser von Stress.
Es war eine Gratwanderung, den Leuten zu helfen, die Hilfe brauchten, ohne deswegen Müßiggänger zu begünstigen. Adam und sein Zweiter, Darryl, sowie Zack, unser einziger unterwürfiger Wolf – der es am ehesten hören würde, falls jemand im Rudel in Schwierigkeiten steckte (mit allem, was dieses Wort beinhalten konnte) –, waren oben im Versammlungsraum des Rudels. Adams Büro war einfach zu klein, um zwei dominante Werwölfe gleichzeitig aufzunehmen.
Wen ich nicht hörte, war Lucia …, den einzigen Menschen im Raum. Sie befand sich ebenfalls dort, weil sie inzwischen einen Großteil der Buchführung des Rudels von Adams Geschäftsbuchhalter übernommen hatte. Allerdings blieb sie meistens sehr still, weil sie sich im Moment in Gegenwart der Wölfe noch nicht sicher genug fühlte, um mit ihnen zu diskutieren. Zack war dagegen ziemlich gut darin zu deuten, was sie alles nicht aussprach, und ihre Einwände an die anderen weiterzugeben. Also funktionierte die Sache trotzdem.
Lucias Ehemann, Joel (wie im Spanischen Cho-el ausgesprochen), seufzte schwer und rollte sich herum, bis all seine vier Pfoten in die Luft ragten und er mit der Seite an dem Küchenschrank lehnte, nur ein paar Schritte von meinem Tisch entfernt. Joel war der andere Nicht-Werwolf, der zu unserem Rudel gehörte.
Sein Fell war schwarz, doch im gleißenden Sonnenlicht konnte ich darunter ein Streifenmuster erkennen. Seine Aufnahme ins Rudel hatte in meiner Verantwortung gelegen, selbst wenn ich damit mein und wahrscheinlich gleichzeitig sein Leben gerettet hatte. Statt sich in einen Werwolf zu verwandeln – oder wie ich in einen Kojoten – erschien Joel manchmal in menschlicher Form. Allerdings nahm er auch oft die Gestalt einer Tibicena an, eines riesigen, sehr Furcht einflößenden Monsters, das nach Schwefel roch und dessen Augen im Dunkeln glühten. Überwiegend allerdings sah er aus wie ein großer Presa Canario: ein Hund, der die meisten Leute fast genauso verängstigte wie ein Werwolf. Besonders, wenn diese Leute nicht mit Werwölfen vertraut waren. Wir hofften, dass Joel eines Tages die Fähigkeit erwerben würde, seine Verwandlungen zu kontrollieren und überwiegend in menschlicher Form zu leben statt in der eines Hundes. Allerdings waren wir alle dankbar, dass er nicht in der Gestalt der Tibicena festhing.
Neben ihm zusammengerollt und fast genauso groß wie Joel lag Cookie, ein weiblicher Schäferhundmischling. Sie schenkte mir einen wachsamen Blick. Inzwischen ging es ihr um einiges besser als bei unserer ersten Begegnung. Cookie war ein Opfer schwerer Misshandlungen gewesen, das von Joel und seiner Frau gerettet worden war. Trotzdem ging Cookie Fremden immer noch aus dem Weg und betrachtete jede abrupte Bewegung als Grund zur Besorgnis.
Das Geräusch eines fremden Autos vor dem Haus sorgte dafür, dass ich nicht länger die Vorteile einer zweisäuligen Hebebühne gegen die einer viersäuligen abwog. Joel rollte sich sofort herum und spitzte die Ohren. Oben verklangen die Stimmen der Männer. Es bestand kein Zweifel, dass dieses Auto zu uns wollte, denn unser Haus war das letzte in einer Sackgasse, die wiederum in einer sehr ländlichen Gegend lag.
Es war allerdings weder der Postbote noch die UPS-Lieferantin – diese Autos kannte ich genauso wie alle Wagen, die vom Rudel gefahren wurden.
»Ich schaue nach«, erklärte ich Joel in dem Wissen, dass auch Adam mich hören würde. Als ich schon halb auf dem Weg zur Tür war, Cookie auf den Fersen, klopfte jemand an.
Ich öffnete die Tür und entdeckte Izzy, eine von Jesses Freundinnen. Sie wurde begleitet von ihrer Mom, die eine große Stofftasche in den Händen trug. Izzy fuhr gewöhnlich selbst zu uns, deshalb fragte ich mich, ob irgendetwas mit ihrem Auto nicht in Ordnung war … und ob ich anbieten sollte, ihr ein wenig Reparaturnachhilfe zu geben.
»Hey, Mrs. H«, sagte Izzy, ohne mir in die Augen zu sehen. »Jesse erwartet mich.«
Sobald sie den Mund geöffnet hatte, machten sich Adam und seine Finanzbrigade (wie Darryl sie nannte) wieder an die Arbeit – auch sie kannten Izzy. Izzy glitt um mich herum und »entkam« – das war das Wort, das zu passen schien – über die Treppe nach oben. Cookie folgte ihr eilig – die Hündin mochte das Mädchen sehr.
»Mercy«, sagte Izzys Mom. Ich konnte mich ums Verrecken nicht mehr an ihren Namen erinnern. Während ich noch in meiner Erinnerung herumgrub, sprach sie schon weiter: »Hättest du vielleicht ein paar Minuten Zeit für mich übrig? Ich würde mich gerne mit dir unterhalten.«
Das klang unheilvoll – aber Izzy war gerade nach oben verschwunden, also konnte es nicht um eines dieser »Es tut mir leid, aber ich fühle mich einfach nicht gut damit, dass meine Tochter ein Haus besucht, in dem sich Werwölfe aufhalten«-Gespräche werden. Die fanden sowieso meistens am Telefon statt.
»Sicher«, meinte ich und trat einen Schritt zurück, um sie ins Haus einzuladen.
»Wir werden einen Tisch brauchen«, erklärte sie.
Also führte ich sie in die Küche, wo Joel sich groß und beängstigend auf dem Boden ausgestreckt hatte, sodass er quasi den einzigen Weg zum Tisch blockierte. Ich hatte bereits den Mund geöffnet, um ihn zur Seite zu bitten, doch Izzys Mom stieg einfach über ihn hinweg, wie man es auch mit einem Labrador oder einem Golden Retriever tun würde.
Joel sah mich an, ein wenig beleidigt ob dieser Missachtung seiner Schrecklichkeit. Ich zuckte nur mit den Achseln und schenkte ihm ein entschuldigendes Lächeln, dann stieg auch ich über ihn hinweg. Izzys Mom hatte sich bereits an den Tisch gesetzt, also nahm ich neben ihr Platz.
Sie schob meine Kataloge ohne zu fragen zur Seite, um mehr Platz auf dem Tisch zu schaffen, dann zog sie ein glattes, seegrünes Buch von der Größe eines A4-Blockes heraus, auf dessen Vorderseite in goldenen Buchstaben die Worte Intrasity Living prangten.
Sie legte das Buch sanft ab, als wäre es ein kostbarer Schatz, dann sagte sie ernsthaft: »Das Leben ist kurz. Und die Zeit geht nicht spurlos an uns vorüber. Was würdest du dafür geben, zehn Jahre jünger auszusehen und gleichzeitig deine Energien zu verbessern? Das können unsere Vitamine für dich erreichen.«
Heiliger Avon-Batman, dachte ich, als ich mich halb amüsiert, halb genervt entspannte, ich werde gerade von einer Multilevel-Marketing-Anhängerin überfallen.
»Ich schlucke keine Vitamine«, erklärte ich ihr.
»Dann hast du unsere Vitamine noch nicht probiert«, fuhr sie vollkommen unbeeindruckt fort. »Es wurde in klinischen Studien bewiesen, dass …«
»Mir fallen davon die Haare aus«, log ich, aber sie beachtete mich gar nicht.
Während sie so enthusiastisch vor sich hinflötete, hörte ich im Hintergrund Izzys genervte Stimme aus Jesses Zimmer: »Mercy wird mich ewig dafür hassen. Mom hat schon all ihre Freunde durch, alle Bekannten und auch alle Leute im Fitnessstudio, also stürzt sie sich jetzt auf die Eltern meiner Freunde.«
»Mach dir um Mercy keine Sorgen«, meinte Jesse beruhigend. »Sie kann auf sich selbst aufpassen.« Damit fiel Jesses Tür ins Schloss. Ich wusste, dass die Mädchen zu menschlich waren, um mit geschlossener Tür noch zu hören, was in der Küche geschah – außer es würde sich um Schreie oder Schüsse handeln. Und bisher war ich nicht verzweifelt genug, als dass diese Geräusche – und die damit verbundenen Aktionen – eine Option darstellten.
»Ich weiß, dass es dort draußen noch andere Vitamine gibt«, fuhr Izzys Mutter fort, »aber von den zwölf weitverbreiteten Marken sind ausschließlich unsere Produkte von zwei unabhängigen Laboren als toxin- und allergenfrei zertifiziert worden.«
Wäre sie nicht die Mutter von Jesses bester Freundin gewesen, hätte ich sie sanft, aber freundlich (oder zumindest bestimmt) ihrer Wege geschickt. Doch Jesse hatte nicht viele Freundinnen – die Werwolf-Sache vertrieb nun mal einige Leute. Und diejenigen, die blieben, waren nicht immer die Art von Mensch, mit der man befreundet sein wollte.
Also blieb ich sitzen und hörte zu und gab ab und zu in scheinbar passenden Momenten zustimmend brummende Geräusche von mir. Irgendwann wechselten wir von Vitaminen zu Make-up. Trotz aller Gerüchte trug ich durchaus manchmal Make-up. Meistens allerdings dann, wenn sich die Ex-Ehefrau meines Mannes in der Gegend herumtrieb.
»Außerdem haben wir ein Produkt, das sehr gut darin ist, Narben abzudecken«, erklärte sie mir mit einem vielsagenden Blick auf den weißen Strich, der sich quer über meine Wange zog.
Fast hätte ich gefragt: »Narbe? Welche Narbe?« Aber ich hielt mich zurück. Izzys Mom hätte die Anspielung auf den Film Frankenstein Junior wahrscheinlich sowieso nicht erkannt.
»Ich trage gewöhnlich kein Make-up«, erklärte ich ihr stattdessen. Außerdem verspürte ich den fast unüberwindlichen Drang, hinzuzufügen: »Mein Ehemann will nicht, dass ich andere Männer auf mich aufmerksam mache« oder »Mein Ehemann hält Make-up für Teufelswerk«, nur um dann zu entscheiden, dass jede Frau, an deren Namen ich mich nicht erinnern konnte, mich wahrscheinlich nicht gut genug kannte, um zu erkennen, dass ich nur Spaß machte.
»Aber, Liebes«, sagte sie, »mit deinem Teint und dem richtigen Make-up wärst du einfach atemberaubend.« Und mit diesem zweideutigen Kompliment nahm sie wieder volle Fahrt im Verkaufsgespräch auf.
Izzys Mom verwendete die Worte »natürlich« und »pflanzlich« im Sinne von »gut«. »Toxin« dagegen war böse. Es wurde nie wirklich ein bestimmtes Toxin genannt, aber mein Haus, mein Essen und anscheinend auch mein Make-up waren voller Toxine.
Die Welt war doch gar nicht so eindeutig aufgeteilt, grübelte ich, während sie weitersprach. Es gab eine Menge natürlicher und pflanzlicher Stoffe, die tödlich waren. Uran zum Beispiel kam als natürlicher Stoff in der Natur vor. Weiße Natternwurz war so giftig, dass sogar Leute gestorben waren, die nur die Milch von Kühen getrunken hatten, die das Kraut gefressen hatten. Mein Abschluss in Geschichte hatte also doch einen Nutzen, wenn auch nur als Quelle für Infos, mit denen ich mich zumindest selbst amüsieren konnte, während mir jemand einen Verkaufsvortrag hielt.
Izzys Mutter war vollkommen ernsthaft bei der Sache und glaubte alles, was sie sagte, daher diskutierte ich nicht mit ihr. Wieso sollte ich ihre Weltsicht erschüttern und ihr erklären, dass Natrium und Chlor einzeln giftig waren, aber sehr nützlich, wenn sie sich zu Salz verbanden? Ich war mir sowieso ziemlich sicher, dass sie mich dann nur auf die Schädlichkeit von Salz hingewiesen hätte.
Sie blätterte ein weiteres Mal um, während ich mich damit beschäftigte, über weitere Toxine nachzudenken, die eigentlich nützlich waren – nur um dann von dem Bild auf der betreffenden Seite abgelenkt zu werden. Ein Minzblatt lag auf einem unnatürlich glänzenden, schwarzen Stein in der Mitte eines sauberen, plätschernden Baches mit massenweise Tropfen an künstlerisch ausgewählten Orten. Der Anblick machte mich ein wenig durstig – und mein Durst ließ mich an Drinks denken. Obwohl ich seit einem Vorfall im College keinen Alkohol mehr trank, hätte ich in diesem Moment einen Drink gut gebrauchen können.
Jetzt, wo ich so darüber nachdachte … auch Alkohol war ein Toxin – und trotzdem oft nützlich.
»Oh, das ist mein Lieblingsthema«, sagte sie und strich sanft mit den Fingerspitzen über das Foto. »Ätherische Öle.« Die letzten zwei Worte sagte sie ungefähr in dem Tonfall, in dem ein Drache die Worte »Spanische Dublonen« ausgesprochen hätte.
Sie griff schnell in ihre Tasche und zog eine aquamarinfarbene Kiste von der Größe eines Brotlaibes heraus. Auf der Oberfläche glänzten die Worte »Intrasity« und »Ätherische Öle« in attraktiv geschwungener Kalligrafie-Schrift.
Dann öffnete sie die Kiste und ließ damit einen Hauch verschiedenster Düfte frei. Ich nieste. Joel nieste. Izzys Mutter sagte nur »Gott behüte«.
Ich lächelte. »Das tut Er. Vielen Dank.«
»Ich weiß nicht, was ich ohne meine ätherischen Öle tun würde«, erklärte sie mir mit Nachdruck. »Ich hatte früher schreckliche Migräne. Jetzt trage ich einfach ein wenig von unserem Gaias-Segen-Öl auf meine Handgelenke und Schläfen und Tada! keine Schmerzen mehr.« Sie zog ein schön geformtes, durchsichtiges Fläschchen mit einer bernsteinfarbenen Flüssigkeit heraus und hielt es mir direkt vor meine Nase.
Es war nicht allzu schlimm. Ich gebe allerdings zu, dass meine Augen von dem Pfefferminzöl ein wenig tränten. Joel nieste wieder und warf Izzys Mutter einen bösen Blick zu. Von oben hörte ich würgende Geräusche und lautes Husten. Ben war nicht da, und ich ging nicht davon aus, dass Zack sich zu so lächerlichen Aktionen herabließ. Adam und Darryl hätte ich allerdings für reifer gehalten. Zweifellos wollten sie mich damit auf die Schippe nehmen, worauf auch die Tatsache hinwies, dass die Geräusche gerade leise genug waren, dass Izzys Mutter sie nicht hören konnte.
Joel sah mich an und ließ amüsiert die Zunge aus dem Maul hängen. Er streckte sich, stand auf und lief die Treppe hinauf, zweifellos um sich der lustigen Runde dort oben anzuschließen. Deserteur. Damit blieb ich allein mit dem Feind zurück.
»Gaias Segen enthält Pfefferminzöl«, verkündete Izzys Mutter unnötigerweise, denn genau dieser Bestandteil war es, der meine Augen zum Tränen brachte, »Lavendel, Rosmarin und Eukalyptus. Alles natürliche Öle.« Sie schraubte den Deckel wieder darauf. »Wir haben Mittel gegen verschiedenste Erkrankungen. Mein Ehemann war im College Leistungssportler und kämpft seit zwanzig Jahren mit einer Pilzerkrankung im Leistenbereich.«
Ich blinzelte.
Mit aller Kraft bemühte ich mich, meine Miene ausdruckslos zu halten trotz des Lachens von oben. Izzys Mutter fuhr fort, scheinbar ohne sich der Tatsache bewusst zu sein, dass man manche Sachen gar nicht so genau wissen wollte. »Wir haben in den letzten Jahren wirklich alles versucht.« Sie grub in ihrem Kasten herum und stellte ein paar Fläschchen zur Seite, bevor sie endlich fand, wonach sie suchte. »Hier ist es. Eine abendliche Behandlung damit an drei aufeinanderfolgenden Tagen, und der Pilz war auf einmal verschwunden. Es hilft auch gegen Grindflechte, Schuppenflechte und Akne.«
Ich starrte auf das Fläschchen, als könnte ich damit die unappetitlichen Bilder in meinem Kopf zum Verschwinden bringen. Es half, dass ich Izzys Vater noch nie getroffen hatte. Doch jetzt hoffte ich inständig, dass ich ihm auch niemals begegnen würde.
Auf dem Etikett stand »Heilende Berührung«. Ich fragte mich, ob der Ehemann von Izzys Mutter wusste, dass seine Ehefrau seine Pilzerkrankung bei Verkaufsgesprächen mit quasi Fremden erwähnte. Vielleicht war es ihm egal.
Sie öffnete auch dieses Fläschchen. Es war nicht so schlimm wie das erste.
»Vitamin E«, sagte sie. »Teebaumöl.«
»Lavendel«, sagte ich, und ihr Lächeln wurde strahlender.
Ich würde wetten, sie verdiente mit ihrem Job ziemlich gut. Sie war freundlich, aufgeweckt und voller Ernst bei der Sache.
Dann zog sie ein weiteres Fläschchen heraus. »Die meisten unserer ätherischen Öle sind rein aus einer Pflanze gewonnen – Lavendel, Jasmin, Zitrone, Orange. Doch ich halte die kombinierten Öle für nützlicher. Man kann sie natürlich auch selbst mischen, doch unsere Mischungen sind in Hinsicht auf die bestmöglichen kreiert worden. Das hier verwende ich am Morgen immer als Erstes. Damit fühlt man sich einfach besser. Der Duft löst einen Endorphinschub aus und vertreibt jede schlechte Laune.«
»Good Vibrations«, kommentierte ich neutral. Ich war nicht in die Sechzigerjahre zurückkatapultiert worden oder irgendwas – das stand einfach auf dem Etikett.
Izzys Mutter nickte. »Wir werben zwar nicht damit, aber meine Vorgesetzte sagt, dass das Öl ihrer Meinung nach für mehr sorgt als nur dafür, die Laune zu heben. Sie hat mir anvertraut, dass es ihres Erachtens tatsächlich das Leben verbessert. Dafür sorgt, dass einem Gutes widerfährt.« Sie lächelte wieder – oder eigentlich lächelte sie einfach noch mehr, denn ich konnte mich an kaum einen Moment erinnern, in dem sie nicht gelächelt hatte. »Meine Vorgesetzte trug es zum Beispiel, als sie tausend Dollar in der Lotterie gewonnen hat.«
Izzys Mutter stellte das Gefäß ab und lehnte sich mit ernster Miene vor. »Ich habe gehört – doch es wurde nicht bestätigt –, dass die Frau, die Intrasity gegründet hat« – sie betonte es In-Tray-sity –, »Tracy LaBella, eine Hexe ist. Eine weiße Hexe natürlich, die ihre Kräfte zum Guten einsetzt. Zu unserem Guten.« Sie kicherte, was bei einer Frau ihres Alters hätte seltsam wirken müssen, stattdessen aber wirklich charmant war.
Ihr Kommentar allerdings beunruhigte mich und sorgte dafür, dass ich doch nach dem Fläschchen mit Good Vibrations griff. Misstrauisch öffnete ich es und schnüffelte vorsichtig daran: Rose, Lavendel, Zitrone und Minze. Ich spürte keine Magie, und in den meisten Fällen konnte ich es unzweifelhaft erkennen, wenn Magie im Spiel war.
Soweit ich wusste, war LaBella kein typischer Familienname von Hexen, aber wenn »Tracy die Schöne« ihr wahrer Name wäre, hätte mich das auch ziemlich überrascht.
»Und dieses kleine Prachtstück« –, Izzys Mutter zog einen weiteren Glasbehälter heraus, »ist einer meiner Lieblinge. Verbessert garantiert das Liebesleben, oder es gibt das Geld zurück. Hat dein Ehemann je Probleme mit der Ausdauer?« Sie hob einen Finger, dann ließ sie ihn schlaff nach unten sinken, während ihre Augenbrauen sich gleichzeitig hoben.
Das Schweigen von oben war plötzlich fast ohrenbetäubend.
»Ähm. Nein«, antwortete ich. Ich bemühte mich, brav zu sein. Ja, ich gab mir wirklich Mühe. Hätte Darryl nicht gesagt: »Glück gehabt, Mann – für einen Moment habe ich mir schon Sorgen um dich gemacht«, hätte ich wahrscheinlich durchgehalten. Aber er sagte es. Und Adam lachte, was die Sache entschied.
Also seufzte ich und spielte an einem eingebildeten Faden meiner Hose herum. »Nicht auf diese Art. Mein Ehemann ist ein Werwolf, weißt du. Also wirklich nicht, wenn du verstehst, was ich sagen will.«
Sie blinzelte interessiert. »Nein. Was willst du damit sagen?«
»Naja«, sagte ich, wandte den Blick ab, als wäre es mir peinlich und murmelte: »Du weißt doch, was man über Werwölfe sagt.«
Izzys Mutter lehnte sich näher zu mir. »Nein«, flüsterte sie. »Erzähl es mir.«
Ich hatte gehört, wie die Tür zum Versammlungsraum schon vorher geöffnet worden war, darum konnten die Werwölfe jedes unserer geflüsterten Worte verstehen.
Also stieß ich die Luft aus und wandte mich ihr wieder zu. »Weißt du, jeden Abend ist in Ordnung. Ich komme ja auch mit jedem Morgen klar. Drei- oder viermal die Nacht? Naja …« Ich lachte heiser. »Du hast meinen Ehemann gesehen, oder?« Adam war atemberaubend. »Aber in manchen Nächten … Ich habe die Dreißig schon hinter mir, verstehst du? Manchmal bin ich müde. Ich bin gerade eingeschlafen, und schon stupst er mich wieder an.« Ich schenkte ihr etwas, wovon ich glaubte, dass es ein hoffnungsfrohes Lächeln war. »Hast du etwas, was mir dabei helfen könnte?«
Ich wusste nicht, womit ich gerechnet hatte. Aber auf jeden Fall geschah etwas ganz anderes.
Sie nickte nämlich entschlossen und zog eine größere Flasche mit der Aufschrift »Schlaf gut« heraus. »Der Vater meiner Vorgesetzten, Gott möge seiner Seele gnädig sein, hat letztes Jahr die ›kleine blaue Pille‹ für sich entdeckt. Ihre Mutter hätte sich nach vierzig Jahren Ehe fast von ihm scheiden lassen, bis sie auf das hier gekommen ist.«
»Gott möge seiner Seele gnädig sein« bedeutete, dass der Mann tot war, richtig? Wachsam griff ich nach der Flasche. Wie die anderen fühlte sich auch diese Mixtur nicht magisch an. Ich öffnete sie und schnüffelte daran. Wieder Lavendel, aber die Gesamtmischung war wesentlich komplexer. Orange, vermutete ich, und noch etwas anderes. »Was ist da drin?«, fragte ich.
»Johanniskraut, Lavendel, Orange«, erklärte Izzys Mutter entschieden. »Es ist nicht ganz wie eine chemische Kastration, aber es wird dein Leben ins Gleichgewicht bringen.« Und damit ging der Verkaufsvortrag weiter, als wäre »chemische Kastration« ein normales Konzept – und etwas, das man schon mal mit seinem Ehemann machen konnte.
Und dabei wirkte Izzys Mutter wie eine nette, normale Person.
Ich schnüffelte erneut an der Phiole. Johanniskraut kannte ich hauptsächlich aus einem Buch, das ich mir einmal vom Feenvolk geliehen hatte. Das Kraut konnte eingesetzt werden, um sich selbst und sein Heim gegen gewisse Arten von Fae zu schützen, wenn man es um Fenster, Türen und Kamine verteilte. Wenn das Kraut wirklich Schutz gegen das Feenvolk garantierte, sollten wir es vielleicht irgendwo in großen Chargen kaufen und einlagern. Vielleicht konnten wir die Pflanze selbst anbauen. Dank Lucia sahen unsere Blumenbeete besser aus als seit Jahren, und inzwischen redete sie sogar davon, irgendwo auch noch einen Kräutergarten anzulegen. Und Johanniskraut war ja ein Kraut.
Irgendwann beendete Izzys Mutter ihre Präsentation dann doch und machte sich daran, mir wirklich etwas anzudrehen.
Ich bin ziemlich willensstark. Also erklärte ich mich nicht bereit, all meinen Freunden Intrasity-Produkte zu verkaufen. Sie konnte noch so oft behaupten, das Konzept beruhe »nicht auf dem Schneeballsystem« – genau das war es. Als sie mir einen zehnprozentigen Nachlass für Namen und Telefonnummern von Freunden anbot, dachte ich darüber nach, ihr Elizavetas Nummer zu geben. Doch ich war nicht besonders scharf darauf, diese nette Frau zur bösen Hexe zu schicken. Außerdem war ich mir nicht sicher, ob die Hexe wirklich als Freundin zählte.
Ich würde Elizaveta allerdings wissen lassen, dass Tracy LaBelle sich als Hexe ausgab, um ihre Produkte zu verkaufen … und dann durfte sich die alte Russin selbst darum kümmern.
Also zahlte ich nur für eine normal große und eine extragroße Flasche »Schlaf gut«, was den gesamten Vorrat von Izzys Mutter ausmachte. Überwiegend kaufte ich das Öl, weil ich es witzig fand, aber auch, weil ich herausfinden wollte, welche Auswirkungen Johanniskraut auf die Fae haben konnte.
Solange Zee und Tad im Reservat festhingen, brauchte ich vielleicht tatsächlich etwas, das ich gegen die Fae einsetzen konnte.
Außerdem kaufte ich ein kleines Fläschchen »Good Vibrations«. Ich hatte das eigentlich nicht vorgehabt, aber Izzys Mutter gab mir fünf Prozent Nachlass, weil sie es als Vorführ-Duft verwendet hatte. Ich konnte die Mischung an Elizaveta weitergeben, um sicherzustellen, dass wirklich nichts Magisches daran war. Und es konnte sicher nicht schaden, wenn ich den Duft vorher mal ausprobiert hatte.
Als ich dann auch noch Orangenöl kaufte, musste ich mir selbst eingestehen, dass Izzys Mutter mich geschlagen hatte. Doch das Orangenöl roch wirklich gut. Izzys Mutter erklärte mir, es solle innere Ruhe begünstigen – und man konnte es zum Beispiel für Cookies verwenden. Ich hatte schon Orangenextrakt für Brownies verwendet, aber Izzys Mutter erklärte mir, Orangenöl sei wesentlich besser.
Schließlich brachte ich sie hinaus und lehnte mich danach erschöpft mit dem Rücken gegen die geschlossene Tür. Adam räusperte sich. Ich schaute auf und entdeckte ihn auf halber Höhe auf der Treppe. Er lehnte mit verschränkten Armen an der Wand und tat sein Bestes, um schlecht gelaunt zu wirken. Doch ich entdeckte winzige Lachfalten in seinen Augenwinkeln.
»Also«, sagte er mit einem Kopfschütteln. »Ich bin zu viel für dich. Du hättest etwas sagen können. Wir mögen ja verheiratet sein, Mercy, aber Nein bedeutet trotzdem Nein.«
Ich riss die Augen weit auf. »Aber ich wollte doch deine Gefühle nicht verletzen.«
»Wenn ich dir diesen kleinen Stups verpasse, hm?« Seine Stimme wurde nachdenklich. »Wenn ich so in mich gehe, fühle ich gerade jetzt im Moment einen kleinen Stups in mir aufsteigen.«
»Jetzt?«, flüsterte ich scheinbar entsetzt. Ich sah nach oben in Richtung Jesses Zimmer. »Denk an die Kinder.«
Er legte den Kopf schräg, um zu lauschen, dann schüttelte er sein Haupt. »Sie können hier unten nichts hören.« Langsam kam er die Treppe herunter.
»Denk an Darryl, Zack, Lucia und Joel«, meinte ich ernsthaft. »Das könnte sie ein Leben lang traumatisieren.«
»Du weißt doch, was man über Werwölfe sagt«, erklärte er vollkommen ernst, als er das Erdgeschoss erreichte.
Ich rannte davon – und er war mir direkt auf den Fersen.
Schnell lief ich um den großen Esstisch herum, doch er stemmte einfach eine Hand auf die Tischplatte und sprang darüber, sogar noch über Medea hinweg, die an diesem ihr eigentlich verbotenen Ort ein Nickerchen machte. Die Katze fauchte ihn an, doch Adam ignorierte sie und verfolgte mich weiter. Ich tauchte unter dem Tisch hindurch, rannte durch die Küche und lief die Treppe hinauf, wobei ich so heftig lachte, dass ich kaum atmen konnte.
Im großen Gemeinschaftsraum fing er mich ein, brachte mich zum Stolpern und warf sich auf mich. Er küsste mein Kinn, meinen Hals, meine Wange und meinen Nasenrücken, bevor er sich meinen Lippen widmete. Ich vergaß unser Spiel (und verlor die Fähigkeit, überhaupt klar zu denken), daher brauchte ich, als er »Stups« sagte, ein oder zwei Sekunden um zu verstehen, was er mir damit sagen wollte.
Langsam löste ich meine Gedanken von meinem zitternden, erregten Körper und dachte darüber nach, wie viele Leute im Haus wissen würden, was wir hier gerade taten. »Nein?«, sagte ich zögerlich.
»Was ist mit dem Vorsatz geschehen, meine Gefühle nicht zu verletzen?«, fragte er. Obwohl er genauso erregt war wie ich und sein Atem schwerer ging, als es unserer kleinen Verfolgungsjagd angemessen war, sah ich Erheiterung in seinem Blick.
»Izzy, Jesse, Darryl, Zack, Lucia und Joel sind geschehen«, antwortete ich. Falls meine Stimme heiser war, nun … ich denke jede Frau in meiner Situation hätte Schwierigkeiten gehabt, normal zu sprechen.
Adam rollte sich von mir herunter, griff jedoch gleichzeitig nach meiner Hand, sodass wir händchenhaltend nebeneinander auf dem Rücken lagen. Er fing zuerst an zu lachen.
»Zumindest«, sagte er schließlich, »muss ich mir als Werwolf niemals Sorgen wegen irgendwelcher Pilzerkrankungen machen.«
»Es gibt immer einen Silberstreif am Horizont«, stimmte ich zu. »Selbst die Existenz als Werwolf hat also ihre Vorteile.«
Ich rechnete damit, dass er wieder lachen würde. Stattdessen packte er meine Hand fester, setzte sich auf und sah mich an. Er zog meine Finger an seine Lippen und sagte: »Ja.«
Da musste ich ihn natürlich noch mal küssen.
Nach diesem Kuss gingen wir nach unten, also war es nicht allzu peinlich. Sicher, es gab anzügliches Grinsen auf den billigen Plätzen, doch nachdem nichts passiert war, wurde ich nicht rot, als Darryl und Zack sich zum Aufbruch bereit machten. Adam und die anderen hatten ihre Besprechung während meines Gespräches mit Izzys Mutter offensichtlich beendet.
Darryl küsste mir förmlich die Hand und sagte: »Du bist ein ständiger Quell der Unterhaltung.«
Ich zog eine Augenbraue hoch und schenkte ihm einen »Wer? Ich?«-Blick. Natürlich brachte ihn das wieder zum Lachen, sodass seine Zähne weiß in seinem Gesicht aufblitzten. Darryl stellte eine gelungene Mischung aus afrikanischem Vater und chinesischer Mutter dar. Dabei vereinte er die besten Eigenschaften beider Eltern und verband sie zu etwas ganz Eigenem. Er war ein extrem großer Mann, der von allen Mitgliedern des Rudels am Angst einflößendsten wirken konnte, doch wenn er grinste, konnte er mit seinem Gesicht kleine Kätzchen aus Bäumen locken.
Zack umarmte mich zum Abschied. Unser einziger unterwürfiger Wolf war wirklich … scheu und erschöpft gewesen, als er sich vor ein paar Monaten unserem Rudel angeschlossen hatte. Doch seitdem er sich an uns gewöhnt hatte, berührte er uns oft. Manche der Männer waren ziemlich überrascht gewesen, als er damit angefangen hatte, auch wenn die Berührungen nichts mit Sex zu tun hatten. Doch niemand wollte, dass Zack traurig war: Ein glücklicher, unterwürfiger Wolf half den dominanten Wölfen und beruhigte generell die Gemüter. Also hatten sie gelernt, Zacks Eigenart zu akzeptieren.
Ich erwiderte Zacks Umarmung. Dabei schob er mir etwas in die Hosentasche, das sich anfühlte wie eines der Fläschchen, die ich gerade gekauft hatte. Er trat zurück, sah mir ernsthaft und tief in die Augen und sagte: »Um dich vor dem Stups zu beschützen.«
Darryl klatschte ihn ab, als sie zusammen auf die Veranda traten. Adam lachte.
Nachdem ich die Tür hinter den Fieslingen geschlossen hatte, die nicht hier lebten, drehte ich mich um und entdeckte Lucia mit verschränkten Armen und einem breiten Grinsen im Gesicht im Türrahmen zur Küche, Joel an ihrer Seite.
Ich sah sie stirnrunzelnd an.
»Keine Sorge«, erklärte sie ernsthaft. »Ich habe nicht alles gehört. Aber Zack hat mich auf dem Laufenden gehalten, damit ich mich nicht ausgeschlossen fühle. Wieso hast du sie eigentlich nicht weggeschickt, bevor sie überhaupt angefangen hat?«
»Weil sie Izzys Mutter ist – und solche Sachen Auswirkungen auf Jesse haben können«, erklärte ich ihr.
»Und weil du ihre Gefühle nicht verletzen wolltest«, erklärte Adam. »Deswegen funktioniert diese Art des Marketings so gut. Und du hast das Öl gekauft, weil du wissen willst, ob echte Magie im Spiel ist, da du dir ihretwegen Sorgen machst.«
Ich suchte seinen Blick. »Nein.« Vorsichtig berührte ich meine Hosentasche. »Das Orangenöl habe ich für das Backen von Brownies gekauft, und das andere als Verteidigung gegen mögliche Stups-Attacken.«
Er zog die Augenbrauen hoch. »Musst du den Duft auflegen oder ich?«
Ich runzelte die Stirn. »Aus ihrer Geschichte konnte ich das nicht so richtig ablesen, aber ich fürchte, für dich könnte es tödlich ausgehen.« Der Vater ihrer Vorgesetzten hatte schließlich ein »Gott möge seiner Seele gnädig sein« bekommen, als Izzys Mutter über ihn gesprochen hatte. »Ich nehme an, es funktioniert, indem ich den Duft auflege. Dann stinke ich nämlich so sehr, dass du dich von mir fernhältst, bis du vor Verzweiflung nicht mehr an dich halten kannst.«
Er warf den Kopf in den Nacken und lachte. Adam … Adam versuchte es gerne herunterzuspielen, mit seinem militärischen Kurzhaarschnitt und Kleidung, die immer ein wenig die falsche Farbe hatte – das hatte ich gerade erst kapiert –, aber er war einfach schön. So schön wie ein Model. Ich sah es oft nicht mehr, weil ich sein Innenleben interessanter fand als die Verpackung, aber wenn seine Augen so leuchteten und seine Grübchen aufblitzten …
Ich räusperte mich. »Stups?«, sagte ich.
Lucia lachte und drehte sich zur Küche um. »Besorgt euch ein Zimmer«, sagte sie über die Schulter.
Adam dagegen? Er machte einen Schritt auf mich zu … und in diesem Moment klingelte sein Handy.
Genauso wie meines.
Ich kontrollierte die Nummer auf meinem Handy, weil ich eigentlich vorhatte, den Anruf auf die Mailbox gehen zu lassen. Doch als ich sah, wer gerade anrief, hob ich sofort ab.
»Tony?«, fragte ich und entfernte mich ein wenig von Adam, um sicherzustellen, dass wir beide ungestört sprechen konnten. Adam sprach gerade mit Darryl, dessen Stimme so klang, als ob es um etwas sehr Dringendes gehen würde.
»Ich weiß nicht, ob du und Adam uns helfen könnt«, sagte Tony gehetzt. Im Hintergrund taten Sirenen ihr Bestes, seine Stimme zu übertönen. »Aber wir haben hier ein Problem. Da ist etwas, ein verdammt großes Etwas, auf der Kabelbrücke. Und es frisst Autos.«
»Du und Adam« war die Kurzform für »Bitte bring ein Rudel Werwölfe, damit es sich um das autofressende Monster kümmert.« Wenn sie nach dem Rudel riefen, mussten sie wirklich verzweifelt sein.
»Mercy«, meinte Adam, der anders als ich scheinbar keinerlei Probleme damit hatte, zwei Gesprächen gleichzeitig zu folgen. »Sag ihm, dass wir unterwegs sind. Darryl und Zack befinden sich quasi schon vor Ort.«
Ich wiederholte Adams Worte für Tony, dann sagte ich: »Wir sind gleich da.«
Sofort legte ich auf und öffnete die Tür. Die Kabelbrücke – die noch einen anderen Namen trug, an den niemand sich erinnerte – befand sich ungefähr zehn Minuten Fahrt von unserem Haus entfernt.
»Mercy«, sagte Adam angespannt. Als ich mich das letzte Mal einem Monster gestellt hatte, war ich dabei fast gestorben. Es hatte mich sechs Wochen gekostet, wieder richtig auf die Beine zu kommen. Und das war nicht das erste Mal gewesen, dass ich verletzt worden war. Die Werwölfe bestanden aus hundert Kilo Zähnen und Klauen und heilten fast so schnell, wie sie verletzt werden konnten. Ich dagegen war so verletzlich wie jeder Mensch. Meine Superkräfte bestanden hauptsächlich darin, mich in einen fünfzehn Kilo schweren Kojoten zu verwandeln.
Adam wurde seit meiner Verletzung von Albträumen geplagt.
Ich sah ihn an. »Du wirst dich in einen Werwolf verwandeln. Darryl wird sich in einen Werwolf verwandeln, und ich gehe davon aus, dass Joel als monströse Tibicena auftreten wird, die Lava spuckt und unglaublich beängstigend aussieht. Ich denke, ihr braucht jemanden mit der Fähigkeit, Dinge zu rufen wie ›Hört auf zu schießen, das sind die Guten‹.« Dann holte ich tief Luft. »Hör zu: Ich werde dir nicht versprechen, nicht verletzt zu werden. Ich werde dich nicht anlügen. Aber ich verspreche dir, nichts Dummes zu tun.«
Adams Wangen wurden bleich, weil er die Zähne zusammenbiss. Sein Blick wirkte gehetzt, doch er nickte. So lautete unsere Abmachung, und das war es, was es mir möglich gemacht hatte, meine Unabhängigkeit aufzugeben und ihm zu vertrauen. Er musste mich sein lassen, wer ich war – und mich nicht wie eine Prinzessin in Watte packen und irgendwo in einem sicheren Schrank aufbewahren.
»Okay«, sagte er. »Okay.« Unbefangen begann er, seine Kleidung auszuziehen, weil das hier einfacher war als im Auto. »Joel? Kommst du mit?«
Der große schwarze Hund, der bereits ein wenig größer wirkte, tapste aus der Küche. Ich war mir nicht sicher, wie viel Kontrolle Joel über seine Form besaß – ich wusste nur, dass es nicht viel war. Wir mussten die Brücke erreichen, bevor er anfing, im Auto Dinge zum Schmelzen zu bringen – die Tibicena war schließlich eine Kreatur, die dem Herzen eines Vulkans entsprungen war.
Ich öffnete die Tür, stoppte und rannte noch einmal die Treppe nach oben. Ohne anzuklopfen öffnete ich Jesses Zimmertür.
»Monster auf der Kabelbrücke«, sagte ich. »Polizei bittet um Verstärkung. Bleib zu Hause. Pass auf dich auf. Wir lieben dich.«
Ich ließ ihr keine Zeit zu antworten, sondern rannte einfach wieder nach unten und zu Adams SUV, wo die anderen bereits auf mich warteten.
Wir würden also ein Monster bekämpfen.
2
Adam hatte sich noch nicht ganz verwandelt, als der Verkehr auf dem Highway in die Stadt bereits ins Stocken geriet. Ein Stau auf dieser Straße war ungewöhnlich – aber dasselbe galt wohl auch für ein Monster, das Autos zerstörte. Ich vermutete da eine Verbindung. Manchmal bin ich eben echt clever.
Der Verkehr wurde immer langsamer, bis die Autos sich schließlich gar nicht mehr bewegten. Dann schaltete ich auf Allrad um und fuhr von der Straße auf den Gehweg, um so noch dem riesigen Parkplatz zu entkommen, in den der Highway sich inzwischen verwandelt hatte.
Beim Altmetall-Recyclinghof fuhr ich auf einen der leeren Stellplätze und hielt an. Von hier aus wären wir zu Fuß schneller. Sobald ich die Tür öffnete, hörte ich auch schon die Sirenen.
Joel sprang vom Rücksitz hinter dem Fahrer aus dem Wagen, der dabei schwankte, weil Joel in seiner Tibicena-Form kompakter gebaut war als jedes natürliche Tier. Er wartete, bis alle vier Pfoten auf dem Boden standen, bevor er das Feuer in sich entzündete. Seine Haut brach auf und bildete Risse, die den Blick auf ein heftiges Glühen freigaben, das sogar im Tageslicht zu bemerken war. Adam, inzwischen ganz verwandelt, sprang hinter Joel heraus. Er schüttelte sich einmal, dann rannte er Richtung Brücke. Joel und ich folgten ihm.
Selbst auf zwei Beinen war ich schnell, auch wenn der Kojote noch schneller gewesen wäre. Doch ich sollte Kleidung tragen, wenn ich mit der Polizei sprach – aus irgendeinem Grund ging ich davon aus, dass die Polizisten mich nackt nicht besonders ernst nehmen würden. Also blieb ich in menschlicher Form und rannte … mit dem silberschwarzen Wolf, der Adam war, auf einer Seite und Joel, den man nicht länger mit einem Hund verwechseln konnte, auf meiner anderen.
Wir erregten so natürlich Aufmerksamkeit. Die Rudelmagie übt einen passiven Einfluss aus, der es normalen Menschen schwer macht, Werwölfe zu erkennen. Adam hätte mitten am Tag über die Interstate laufen können, und nur ein oder zwei Leute hätten etwas anderes gesehen als einen streunenden Hund. Wir hatten allerdings entdeckt, dass für Joel nicht dasselbe galt, auch wenn er zum Rudel gehörte. Es war, als drängte etwas in seiner Magie darauf, bemerkt zu werden.
Joels Augen glühten wie die eines Höllendämons in einem Comic. Er war größer als Adam und hinterließ bei jedem Kontakt seiner Pfoten ölige Spuren auf dem Boden. Die Leute bemerkten ihn so natürlich sofort. Und sobald sie ihn bemerkt hatten, bemerkten sie auch Adam.
Adam war eine Person des öffentlichen Lebens. Selbst wenn er nicht oft in Wolfsform in den überregionalen Nachrichten erschien, war er im örtlichen Fernsehen selbst in seiner Wolfsgestalt eine echte Celebrity. Ein Kleinstadtheld, und sei es nur, weil er irgendwie berühmt war.
»Hey, Mercy«, hörte ich einen Ruf aus der Reihe der stehenden Autos. »Was ist los? Wann öffnet deine Werkstatt wieder? Sheba hat ein Elektronikproblem, das ich einfach nicht in den Griff kriege.«
»Du erreichst mich immer noch über das Werkstatttelefon, Nick«, rief ich und winkte unbestimmt, ohne mich umzudrehen. Ich musste den Sprecher nicht sehen, um ihn zu identifizieren. Nicks Sheba war ein VW-Käfer, der mit fast übernatürlicher Regelmäßigkeit zusammenbrach. »Im Moment muss ich der Polizei mit einem autofressenden Monster auf der Brücke helfen.«
»Was ist auf der Brücke?«, rief er, aber ich winkte nur noch mal, weil ich bereits zu weit entfernt war, als dass er mich selbst schreiend noch hätte hören können.
Doch eine Frau steckte den Kopf aus dem Fenster, als ich vorbeikam, und rief: »Gibt es Werwolf-Ärger, Mercy?«
Ich erkannte die Stimme nicht, aber Adams Bekanntheit brachte es zwangsläufig mit sich, dass auch ich nicht mehr anonym war.
»Nein«, erklärte ich ihr. »Fae-Monster, denke ich.«
Ich war mir nicht sicher, ob Tony mit meinem Verhalten einverstanden wäre: Schließlich informierte ich gerade die Öffentlichkeit, ohne mich vorher mit ihm abgestimmt zu haben. Aber ich ging davon aus, dass in einer Ära der Handykameras das Wesen auf der Brücke wahrscheinlich sowieso schnell zum YouTube-Star werden würde.
Die Brücke war auf beiden Seiten vom Fluss aus gut einzusehen. Etwas, das groß genug war, um »Autos zu fressen« würde sicherlich Leute mit Kameras und Handys anziehen. Das hier ließ sich nicht vertuschen.
Vor uns kam das Lampson-Gebäude in Sicht, genauso wie die rot-blau leuchtenden Lichter Dutzender Polizeiwagen. Lampson International baute die größten Kräne der Welt, und ihr Hauptquartier lag am Fuß der Kabelbrücke. Das vierstöckige Gebäude aus Glas und Stahl sah sehr seltsam aus. Es wirkte irgendwie, als hätte ein Riese eine Pyramide hochgehoben, auf den Kopf gestellt und wieder in den Boden gerammt.
Die Polizei hatte inzwischen zwei Barrikaden errichtet. Die erste lag an der letzten Kreuzung vor der Brücke, um die Autos zurückzuhalten. Die zweite Barrikade befand sich näher an der Brücke, direkt hinter dem Eingang zum Vietnam-Memorial, das am Rand der Straße und auf einem Hügel neben dem Lampson-Gebäude lag.
Wir passierten die erste Barrikade, ohne dass ein Polizist versuchte, uns aufzuhalten, auch wenn wir einige kritische Blicke auf uns zogen. Wahrscheinlich waren sie zu sehr mit dem Verkehr beschäftigt. Aber zusätzlich brauchte es wirklich Mumm, um jemanden anzuhalten, der mit einem Werwolf und einer Tibicena vorbeilief. Vielleicht erkannten sie allerdings auch Adam.
Kurz vor der Hängebrücke stieg das Gelände langsam an. Ich wandte den Blick von der Polizei und dem Stau ab, um zur Brücke zu spähen.
Sie spannte sich in einem eleganten Bogen über den Fluss, ungefähr eineinhalb Kilometer lang, die schönste der drei Brücken über den Columbia in den Tri-Cities und die einzige, die keine Highway- oder Interstate-Brücke war. Weiße Stahlseile erstreckten sich von den zwei Pfeilern der Brücke in eleganten Linien nach unten.
Vom Kennewick-Ufer aus konnte ich nur den höchsten Punkt der Brücke sehen – die Mitte, vielleicht siebenhundert Meter entfernt. Ein paar Autos, deren Motorhauben (überwiegend) in unsere Richtung zeigten, standen auf der Fahrspur Richtung Kennewick, unbeweglich und scheinbar leer. Das nächststehende Auto, ein roter Buick, lag auf dem Dach. Eines seiner Hinterräder fehlte. Für mein erfahrenes Auge sah es aus, als hätte jemand das Rad gepackt und einfach abgerissen.
Die nach Pasco führende Spur auf der rechten Seite der Brücke war bis ungefähr zur Mitte des Bauwerks leer. Der Rest sah aus, als hätte ein Fünfjähriger seine Wut an Spielzeugautos ausgelassen. Dieser Eindruck wurde noch dadurch verstärkt, dass die Autos aus der Entfernung viel kleiner aussahen, ganz winzig und leer. Doch das scheinbar harmlose Bild täuschte: In diesen Autos hatten einmal Leute gesessen. Ich hatte genug Unfälle gesehen, um zu wissen, dass in einigen dieser Wagen wahrscheinlich Leichen in endloser Geduld darauf warteten, dass wir uns um das Wesen kümmerten, das dieses Chaos angerichtet hatte. Erst dann konnten wir uns um die Toten kümmern.
Ich prallte gegen Adam, der sich gerade vor mir quer gestellt hatte. In seiner Wolfsform war er groß genug, dass ich nicht über ihn fiel, als ich ihn rammte, er aber von meinem Gewicht auch nicht umgeworfen wurde. Er wartete, bis ich mich erholt hatte, dann sah er nach links, Richtung Polizei. Die Beamten hatten uns schon gesehen. Doch bis auf Tony, der bereits in unsere Richtung lief, kam niemand näher. Ein paar der Beamten wirkten ziemlich angeschlagen, und ich konnte sogar von meiner Position aus Blut riechen. Ob es ihres oder das der Opfer war, konnte ich nicht identifizieren. Aber es roch frisch.
»Okay«, erklärte ich Tony. »Zwei andere Werwölfe sollten bereits hier sein. Adam hat den Rest des Rudels gerufen, aber es könnte eine halbe Stunde oder mehr dauern, bis die Verstärkung ankommt. Was brauchst du?«
»Könnt ihr dieses Ding einfach umbringen? Wenn ihr das nicht schafft, sollten wir es auf der Brücke halten, bis die Nationalgarde auftaucht – laut der letzten Meldung ist das in ungefähr zwei Stunden«, meinte Tony grimmig.
Tony warf einen Blick zu Joel hinüber. Das war Joels erster öffentlicher Auftritt als Mitglied des Rudels. Zu Tonys Ehre muss ich gestehen, dass ein schwarzer Hund, der aussah, als bestände er zum Teil aus glühender Kohle, seine Aufmerksamkeit nicht sehr lange fesselte. Er zögerte nur kurz, bevor er weitersprach.
»Das Ding scheint glücklicherweise kein besonderes Interesse daran zu haben, die Brücke zu verlassen. Hier ist das Risiko zumindest eingeschränkt. Aber es hat uns ganz deutlich gezeigt, dass es nur deswegen auf der Brücke bleibt, weil es das will. Bisher haben wir nicht viel mehr geschafft, als es zu nerven.«
Adam warf mir einen scharfen Blick zu.
»Ich komme hier schon klar«, stimmte ich zu. »Du und Joel könnt losziehen und herausfinden, wer da auf der Brücke mit Matchbox-Autos spielt.«
Adam setzte sich in Bewegung, zögerte und drehte sich wieder um, Joel immer an seiner Seite. Mein Gefährte suchte meinen Blick. Seine Augen leuchteten golden und klar.
»Ich weiß«, sagte ich, weil ich seine Gefühle durch unsere Gefährtenverbindung in mir vibrieren spürte. Er sollte meine ebenfalls spüren, doch manchmal war es wichtig, gewisse Dinge laut auszusprechen. »Ich liebe dich auch.«
Er drehte sich um und lief davon, eher in den weiten Sprüngen einer beginnenden Jagd als im Sprint. Joel hielt mit ihm Schritt.
Tony schob eine Hand unter meinen Ellbogen und zog mich zu den versammelten Polizeibeamten, manche in Uniform, manche im Geschäftsanzug und manche auch in der Kleidung, die sie eben gerade getragen hatten, als sie den Anruf bekamen. Ich erkannte ein paar Gesichter, ein paar mehr Witterungen und dann noch Detective Willis, der mich mit einem Ausdruck musterte, den ich nicht deuten konnte.
»Erschießen Sie auf keinen Fall die Werwölfe und die Tibicena«, sagte ich sofort – weil das der Hauptgrund war, wieso ich Adam begleitet hatte. »Sie sind die Guten.«
»Tibicena?« Detective Willis schien das unvertraute Wort zu testen, doch dann wandte er sich wieder anderen Dingen zu. Er drehte sich zur Brücke um, aber nicht in Richtung von Adam und Joel, die ihre Schritte verlangsamt hatten, um die herumstehenden Autos als Deckung zu nutzen. »Was können Sie uns über dieses Ding auf der Brücke sagen? Wieso können wir es nicht erschießen? Kugeln scheinen ihm nichts anhaben zu können.«
»Ich weiß nicht, was für ein Monster Sie da haben«, antwortete ich. »Bis jetzt hatte ich noch keine Chance, es mir anzuschauen. Die Tibicena ist die unheimliche, hundeähnliche Kreatur, die neben Adam läuft. Adam ist der Werwolf, und die Tibicena ist ein Freund. Bitte weisen Sie alle an, die beiden nicht zu erschießen, okay?«
Willis warf einen schnellen Blick zu Adam und Joel hinüber, dann runzelte er die Stirn und kniff die Augen zusammen, als wäre ihm jetzt doch aufgefallen, dass Joel nicht einfach nur ein seltsamer Werwolf war. »Dieses Ding ist eine Tibicena? Was zur Hölle ist eine Tibicena?«
»Mein Freund«, antwortete ich kühl. »Der sein Leben riskiert, um zu helfen.«
Willis zog eine Grimasse. »Fühlen Sie sich nicht von Aussagen angegriffen, die nicht so gemeint sind, Mercy Hauptman.« Er hob eine Hand ans Gesicht und drückte dann einen Knopf, den ich nicht sehen konnte, denn er sagte plötzlich: »Schießt nicht, ich wiederhole, schießt nicht auf den unheimlichen schwarzen Hund … ähm, die hundeähnliche Kreatur. Und erschießt mir keinen der Werwölfe. Sie sind auf unserer Seite, Leute.«
Tony, der mir zu Willis gefolgt war, sagte anscheinend zu mir: »Wir haben ein paar SWAT-Scharfschützen auf dem Lampson-Gebäude und noch ein paar mehr im Krähennest auf Clover Island – nicht, dass das bisher viel geholfen hätte.«
Clover Island war ein Touristen- und Segelparadies ein kurzes Stück westlich der Brücke mit vielen Booten, Stegen und – auf der winzigen Insel selbst – einem Hotel, einem Büro der Küstenwache und ein paar Restaurants. Das Krähennest war das Restaurant im obersten Stockwerk des Hotels. »Sie können nicht schießen, weil der Wind zu stark ist.« Seine Stimme klang kühl und beherrscht. »Pasco hat ebenfalls ein paar Schützen auf der anderen Seite des Flusses postiert. Wenn das so weitergeht, erschießen wie eher uns gegenseitig als dieses Ding, was auch immer es sein mag. Und wenn man bedenkt, wie ineffektiv unsere Kugeln bisher waren, spielt es wahrscheinlich sowieso keine Rolle.«
»Das Monster befindet sich jenseits des Scheitelpunktes der Brücke, und ich habe es noch gar nicht gesehen«, meinte ich. »Wie sieht es aus?«
»Wie King Kong«, sagte einer der Beamten, die ich nicht kannte. »Wenn King Kong grün wäre und moosbewachsen mit einer Nase, die über den Augen sitzt. Und es ist auf jeden Fall ein Er, denn dieses gewisse Teil ist nicht grün.«
»Wie die Farben von Weihnachtsdeko«, stimmte eine Frau zu, die ich schon mal gesehen hatte, die mir aber nie vorgestellt worden war. »Rot und Grün.«
»Das ist mehr, als ich gesehen habe«, warf ein Kerl in einem Sweatshirt ein, auf dessen Ärmel eine Blutspur prangte. »Ich war zu sehr damit beschäftigt, die übel zugerichteten Zivilisten von der Brücke zu schaffen.«
»Was macht das Monster da?«, fragte ich. »Ich meine, wieso ist es immer noch auf der Brücke und nicht woanders? Haben die Werwölfe es dort festgehalten?«
»Wenn es von der Brücke runter wollte«, erklärte ein Beamter grimmig, »dann wäre es nicht mehr drauf.«
»Adams Leute halten das Vieh sehr geschickt beschäftigt«, sagte Tony. »Laut der Polizei von Pasco haben sie das Vieh abgelenkt, wann immer es erwogen hat, sich in Bewegung zu setzen. Aber überwiegend wirkt es, als wollte es einfach bleiben, wo es ist.«
Der Kerl im blutigen Sweatshirt meldete sich wieder zu Wort. »Eines der Opfer, das ich in Sicherheit gebracht habe, hat erzählt, das Ding hätte einfach angehalten und wäre wieder in die Mitte der Brücke gelaufen. Es war ein paar Mal auf unserer Seite, und hat auch ein paar Ausflüge Richtung Pasco gestartet – aber überwiegend scheint es sich in der Mitte zwischen den Pfeilern aufzuhalten.« Er sah mich an. »Dieses Ding kam direkt auf mich zu … und da ist dieser große, schwarze Kerl an mir vorbeigelaufen und hat es mit einem Baseballschläger erwischt. Ich spiele schon seit meiner Kindheit Baseball, und ich habe noch nie gesehen, dass ein Mensch einen Schläger so geschwungen hätte. Der Schläger ist zerbrochen, was ich durchaus schon mal gesehen habe … aber nicht so. Er hat mir das Leben gerettet, genauso wie den vier Leuten, denen ich gerade von der Brücke geholfen habe. Gehört er zu Ihnen?«
Darryl. Darryl hatte immer einen Baseballschläger im Auto zusammen mit einem Ball. In Washington verstieß es nämlich gegen das Gesetz, einen Baseballschläger allein im Auto zu transportieren. Darryl war bisher noch nicht als Werwolf geoutet gewesen. Aber diese Katze war jetzt wahrscheinlich aus dem Sack.
»Wahrscheinlich«, meinte ich.
»Wieso sind ihm dann nicht Reißzähne und Pelz gewachsen?«, knurrte eine andere Person.
Ich öffnete den Mund, um zurückzublaffen, doch dann entdeckte ich die Sprecherin. Sie trug einen Druckverband am Arm, der in einer Schlinge ruhte, und die Schwellung in ihrem Gesicht würde morgen definitiv schon schwarz und blau sein.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: