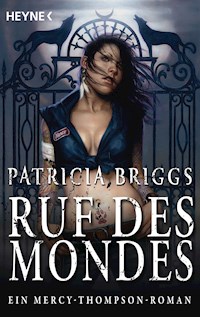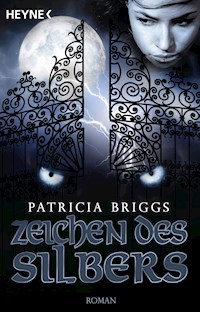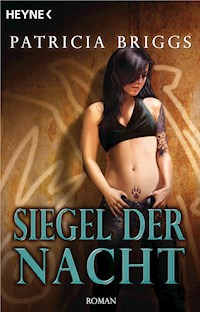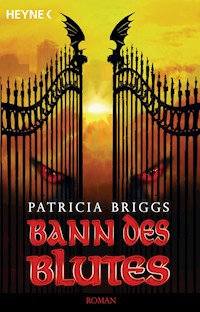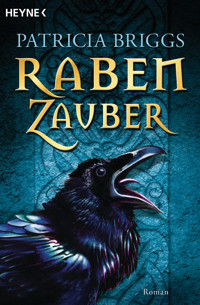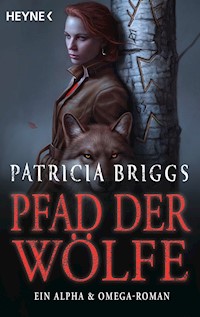9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Mercy-Thompson-Reihe
- Sprache: Deutsch
Als Christy, die Exfrau ihres Gefährten Adam, plötzlich in ihrem Leben auftaucht, schrillen bei Mercy sämtliche Alarmglocken – und das zu Recht, denn Christy führt nichts Gutes im Schilde: Sie will Adam zurück und ist sogar bereit, Mercys eigenes Rudel gegen sie aufzustacheln. Doch eine Mercy Thompson gibt niemals kampflos auf – schon gar nicht in der Liebe! Noch ahnt Mercy nicht, dass Christy ihr geringstes Problem ist: Ihr droht weitaus größere Gefahr von einem Gegner, der die ganze Welt zerstören kann …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 554
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Das Buch
Gerade als Automechanikerin und Walkerin Mercy Thompson glaubt, dass endlich Ruhe in ihr sonst so turbulentes Leben eingekehrt sei, wird sie mit einer neuen Herausforderung konfrontiert: Christy, die verführerische Ex-Frau von Mercys Gefährten Adam steht plötzlich vor der Tür, und sie führt nichts Gutes im Schilde. Sie will Adam zurück und ist sogar bereit, Mercys eigenes Rudel gegen sie aufzustacheln. Doch eine Mercy Thompson gibt nicht kampflos auf – schon gar nicht in der Liebe! Sie ahnt allerdings nicht, dass der Streit mit Christy noch ihr geringstes Problem sein wird: Ihr droht weitaus größere Gefahr von einem Gegner, der im Dunkeln lauert. Einem Gegner, der Mercys ganze Welt zerstören könnte …
Die MERCYTHOMPSON-Serie
Erster Roman:
Ruf des Mondes
Zweiter Roman:
Bann des Blutes
Dritter Roman:
Spur der Nacht
Vierter Roman:
Zeit der Jäger
Fünfter Roman:
Zeichen des Silbers
Sechster Roman:
Siegel der Nacht
Siebter Roman:
Tanz der Wölfe
Achter Roman:
Gefährtin der Dunkelheit
Die ALPHA & OMEGA-Serie
Erster Roman:
Schatten des Wolfes
Zweiter Roman:
Spiel der Wölfe
Dritter Roman:
Fluch des Wolfes
Vierter Roman:
Im Bann der Wölfe
Die Autorin
Patricia Briggs, Jahrgang 1965, wuchs in Montana auf und interessiert sich seit ihrer Kindheit für Phantastisches. So studierte sie neben Geschichte auch Deutsch, denn ihre große Liebe gilt Burgen und Märchen. Neben erfolgreichen und preisgekrönten Fantasy-Romanen wie Drachenzauber widmet sie sich ihrer Mystery-Saga um Mercy Thompson. Nach mehreren Umzügen lebt die Bestsellerautorin heute gemeinsam mit ihrer Familie in Washington State.
Ein MERCY-THOMPSON-Roman
Deutsche Erstausgabe
WILHELMHEYNEVERLAG
MÜNCHEN
Für unsere guten Freunde – ihr wisst, wer damit gemeint ist. Ich habe keine Ahnung, wie es dazu gekommen ist, dass wir von so vielen Leuten umgeben sind, mit denen man – wie mein Vater zu sagen pflegte – »durch dick und dünn gehen kann«. Besonders möchte ich dieses Buch zwei Leuten widmen, die weit über bloße Pflichterfüllung hinausgegangen sind, als wir dieses Jahr versucht haben, einen ohnehin ungünstigen Reiseplan mit bestimmten Pferden zu kombinieren, die natürlich genau meine Abfahrt abwarten mussten, bevor sie etwas Dummes getan haben.
Dr. Dick Root, ein wunderbarer Tierarzt, hat meiner Tochter die Hand gehalten, als Tilly ihr Fohlen gerade dann bekam, als Mike und ich auf Lesereise waren. Es gibt da draußen nicht viele Leute, die ein Dutzend Telefonanrufe um vier Uhr morgens ertragen, ohne die Fassung zu verlieren. Danke, Dick. Mögen du und dein Pferd Ally noch viele glückliche Kilometer miteinander reisen.
Auch Deken Schoenberg eilt immer wieder zu meiner Rettung, ob es nun darum geht, in glühender Hitze Pferde abzureiben, mit anzupacken, wenn ich mir zu viel aufgeladen habe oder – und das ist wirklich kein untypisches Beispiel – sogar dann zu helfen, wenn ich achthundert Kilometer entfernt in einem anderen Land festhänge und ein dummes Fohlen beschließt, dass ausgerechnet das der richtige Tag sei, um sich zu verletzen. Magic tut es übrigens sehr leid, dass er dich getreten hat, besonders, nachdem du achtzig Kilometer gefahren bist, um ihm zu helfen. Er hat mir versprochen, dass er unsere Freunde in Zukunft besser behandeln wird.
Und wenn wir das nächste Mal die Stadt verlassen, erzählen wir den Pferden einfach nichts davon.
1
Das Telefon begann in dem Moment zu klingeln, als ich gerade bis zu den Ellbogen in seifigem Abwaschwasser steckte.
»Ich gehe schon«, meinte meine Stieftochter Jesse und ließ noch schnell zwei Gläser und eine Gabel in das Spülbecken gleiten.
Ein Werwolf-Rudel, das zusammen isst, bleibt immer zusammen, dachte ich, während ich widerspenstige Eierreste von einem Teller kratzte. Am Sonntagsfrühstück nahm nicht das ganze Rudel teil – manche Mitglieder hatten Familien oder auch Jobs, die Wochenendarbeit verlangten, wie bei ganz normalen Menschen auch. Das Frühstück war nicht verpflichtend, weil das die Absicht dahinter ad absurdum geführt hätte. Darryl, Adams Zweiter, der das Frühstück gewöhnlich vorbereitete, war allerdings ein verdammt guter Koch, und sein Essen sorgte einfach dafür, dass jeder kam, der es irgendwie einrichten konnte.
Die Spülmaschine lief schon, voll bis zum Rand. Ich hätte den Rest der Teller einfach stehen gelassen, bis das Gerät fertig war, aber Auriele, Darryls Gefährtin, hatte nichts davon hören wollen.
Gewöhnlich stritt ich mich nicht mit ihr, weil ich eine der drei Personen im Rudel war, die im Rang über ihr standen, und sie schon allein deswegen hätte nachgeben müssen. Das wirkte in meinen Augen wie Betrug – und ich betrog nie.
Außer, wenn es gegen meine Feinde geht, flüsterte eine kleine Stimme in meinem Kopf, die vielleicht sogar zu mir gehörte, sich aber trotzdem anhörte wie die von Kojote.
Der zweite Grund für meine Nachgiebigkeit war eher eigennützig. Auriele und ich kamen halbwegs miteinander aus, was sie zum einzigen weiblichen Werwolf im Rudel machte, der im Moment freundlich zu mir war.
Natürlich war auch Auriele nicht glücklich darüber gewesen, mich als die Gefährtin ihres Alphas anzuerkennen – ich blieb eben eine Kojote-Gestaltwandlerin unter Wölfen. Sie war davon überzeugt, dass das nichts Gutes für die Moral des Rudels bedeuten konnte. Außerdem war sie – und da lag sie völlig richtig – der Überzeugung, dass ich Ärger für das Rudel bedeutete. Sie mochte mich quasi gegen ihren Willen. Ich war es gewöhnt, mich unter Männern zu bewegen, aber trotzdem war es nett, zusätzlich zu meiner Teenager-Stieftochter Jesse noch eine weitere Frau um mich zu haben, die tatsächlich mit mir sprach.
Also wusch ich Teller ab, um Auriele zufriedenzustellen, obwohl sich auch die Spülmaschine darum hätte kümmern können. Dabei ignorierte ich den Schmerz, den das heiße Seifenwasser in den Wunden erzeugte, die mein Beruf mit sich brachte – aufgeschürfte Knöchel sind stete Begleiter von Mechanikern. Auriele trocknete ab, und Jesse hatte sich freiwillig gemeldet, um allgemein ein wenig die Küche aufzuräumen. Drei Frauen, die sich gesellig um die Hausarbeit kümmerten – was würde sich meine Mutter freuen, wenn sie uns gerade sehen könnte. Dieser Gedanke verstärkte meinen Entschluss, nächste Woche das Aufräumen an ein paar der Männer zu delegieren. Es wäre wirklich gut für sie, ihre Zuständigkeiten ein wenig zu erweitern.
»Da ist dieser Junge in der zweiten Jahrgangsstufe.« Auriele ignorierte das klingelnde Telefon und hob, begleitet von einem kleinen Stöhnen, einen Stapel Teller in den Schrank. Sie stöhnte nicht wegen des Gewichts der Teller – Auriele war immerhin eine Werwölfin, sie hätte auch einen zweihundert Kilo schweren Amboss ins Regal heben können. Es hatte eher damit zu tun, dass sie recht klein war und sich auf die Zehenspitzen stellen musste, um das Regalbrett zu erreichen. Jesse musste um sie herumgehen, um zum immer noch klingelnden Telefon zu kommen.
»Alle Lehrer lieben Clark«, fuhr Auriele fort. »Dasselbe gilt für alle Mädchen und die meisten Jungen. Aber jedes Wort, das über seine Lippen dringt, ist eine Lüge. ›Enrique hat bei mir abgeschrieben‹, hat er mir erklärt, als ich ihn gefragt habe, wieso er und der andere Junge quasi dieselben Fehler haben. Enrique hat dann nur resigniert dreingeschaut, ich gehe davon aus, dass Clark diese Tour schon öfter bei ihm durchgezogen hat.«
»Hier bei Hauptmans«, sagte Jesse währenddessen fröhlich am Telefon. »Wie kann ich Ihnen helfen?«
»Ist Adam da?«
»Also habe ich ihm gesagt …« Auriele brach abrupt ab, weil ihre empfindlichen Ohren die Stimme am anderen Ende der Leitung identifiziert hatten.
»Ich brauche Adam.« Die Stimme der Exfrau meines Ehemannes wurde eindeutig durch lautes Schluchzen unterbrochen. Christy Hauptman klang verzweifelt, ja fast hysterisch.
»Mom?« Jesses Stimme zitterte. »Mom, was ist los?«
»Hol Adam!«
»Mom?« Jesse warf mir einen verzweifelten Blick zu.
»Adam«, rief ich. »Christy ist am Telefon und muss mit dir sprechen.«
Mein Ehemann saß im Wohnzimmer und unterhielt sich mit Darryl und ein paar anderen, die nach dem Frühstück noch geblieben waren, also musste ich meine Stimme kaum heben. Es war nicht das erste Mal, dass Christy anrief, weil sie etwas brauchte.
Kontakt mit Christy verursachte mir immer Magenschmerzen. Nicht, weil sie mir oder Adam irgendetwas hätte antun können. Jesse allerdings – die ihre Mutter sehr liebte, aber der es momentan schwerfiel, sie gleichzeitig auch zu mögen – litt jedes Mal, wenn die Frau anrief. Und es gab nichts, was ich dagegen tun konnte.
»Er kommt gleich, Mom«, sagte Jesse.
»Bitte«, sagte Christy. »Sag ihm, er soll sich beeilen!«
Verzweifelte, hysterische Tränen – das war nichts Ungewöhnliches bei Christy. Aber sie klang außerdem richtig verängstigt. Und das hatte ich bei ihr bisher noch nicht erlebt.
Adam kam in den Raum, und ich konnte an seiner grimmigen Miene ablesen, dass er Christys letzte Worte gehört hatte. Er nahm Jesse den Hörer ab, um seine Tochter gleichzeitig mit dem anderen Arm an sich zu drücken. Bei dieser beruhigenden Umarmung traten Tränen in Jesses Augen. Sie warf mir noch einen panischen Blick zu, bevor sie davonrannte, aus der Küche und die Treppe nach oben – wahrscheinlich in ihr Zimmer, wo sie sich wieder fangen konnte.
»Was brauchst du?«, fragte Adam währenddessen, wobei der Großteil seiner Aufmerksamkeit seiner Tochter galt.
»Kann ich nach Hause kommen?«
Auriele warf mir sofort einen neugierigen Blick zu, doch ich hatte bereits eine ausdruckslose Miene aufgesetzt. Aus meinem Gesicht würde sie nicht ablesen können, was ich dachte.
»Das ist nicht dein Zuhause«, erklärte Adam. »Nicht mehr.«
»Adam«, sagte Christy. »Oh, Adam.« Sie schluchzte, ein kleines, hoffnungsloses Geräusch. »Dieses Mal stecke ich in echten Schwierigkeiten. Deshalb muss ich nach Hause kommen! Ich war so dumm. Er lässt mich einfach nicht in Ruhe. Und er hat mich verletzt, er hat einen Freund von mir umgebracht und er folgt mir, wo immer ich auch hingehe. Kann ich bitte nach Hause kommen?«
Damit hatte ich nicht gerechnet. Auriele gab auf, so zu tun, als würde sie nicht jedes Wort belauschen und drehte ihren Kopf Richtung Telefon.
»Ruf die Polizei«, sagte Adam. »Dafür ist sie da.«
»Er wird mich umbringen«, flüsterte Christy. »Adam, er wird mich umbringen. Ich weiß nicht, wo ich sonst hinsoll. Bitte.«
Werwölfe können erkennen, wenn Leute lügen. Genauso wie einige der anderen übernatürlichen Kreaturen, die dort draußen so herumlaufen, Lügen identifizieren können – ich zum Beispiel. Am Telefon fällt es um einiges schwerer, weil viele der verräterischen Zeichen mit Herzschlag und Geruch zusammenhängen – was man am anderen Ende einer Leitung nicht wahrnehmen kann. Doch trotzdem hörte ich die Wahrheit in ihrer Stimme.
Adam sah zu mir.
»Sag ihr, sie soll kommen«, meinte ich. Was sollte ich sonst sagen? Wenn ihr etwas geschah, obwohl wir ihr hätten helfen können … ich war mir nicht sicher, ob ich damit hätte leben können. Aber ich wusste in jedem Fall, dass Adam es nicht konnte.
Auriele sah mich weiter unverwandt an. Dann runzelte sie die Stirn, wandte sich ab und fuhr damit fort, Geschirr abzutrocknen.
»Adam, bitte?«, flehte Christy.
Adam verengte die Augen zu Schlitzen, schaute mich weiter an und sagte nichts.
»Adam«, meldete sich Mary Jo aus dem Türrahmen. Mary Jo ist eine Feuerwehrfrau, taff und klug. »Das Rudel steht in ihrer Schuld für die Jahre, die sie die Deine war. Lass sie nach Hause kommen, und das Rudel wird sie beschützen.«
Adam warf einen Blick in Mary Jos Richtung, und sie senkte den Blick.
»Es ist okay«, erklärte ich Adam und bemühte mich, Wahrheit in meine Worte zu legen. »Wirklich.«
Ich backe normalerweise, wenn ich gestresst bin. Wenn ich also, während Christy hier sein würde, genügend Schokoladenkekse backen musste, um ganz Richland zu ernähren, wäre das okay – weil Adam darauf angewiesen war, dass es für mich okay war.
Und wenn Christy irgendwas versuchen würde, würde sie es bereuen. Adam gehörte mir. Sie hatte ihn weggeworfen, hatte Jesse weggeworfen – und ich hatte sie mir geschnappt. Wer’s findet, darf’s behalten.
Vielleicht wollte sie aber gar nicht zurück zu Adam. Vielleicht suchte sie wirklich nur Sicherheit. Mein Bauch war nicht überzeugt davon, aber Eifersucht ist kein logisches Gefühl, und ich hatte eigentlich keinen Grund, eifersüchtig auf Christy zu sein.
»In Ordnung«, meinte Adam. »In Ordnung. Du kannst kommen.« Dann fragte er sanft: »Brauchst du Geld für das Flugticket?«
Ich wandte mich wieder dem Geschirr zu und bemühte mich, den Rest des Gespräches nicht zu belauschen. Bemühte mich, nicht die Sorge in Adams Stimme zu hören, diese Sanftheit – und die Befriedigung, die er daraus zog, sich um sie zu kümmern. Gute Alpha-Werwölfe kümmerten sich um jeden in ihrer Umgebung; das gehörte eben zu dem, was sie zu Alphas machte.
Es wäre mir vielleicht leichter gefallen, das Telefonat zu ignorieren, wenn nicht inzwischen alle Wölfe, die sich noch im Haus aufhielten, in die Küche gekommen wären. Sie lauschten, wie Adam die letzten Details klärte, die Christy hierher bringen würden, und warfen kurze, heimliche Blicke in meine Richtung, wann immer sie glaubten, ich würde es nicht bemerken.
Auriele nahm mir die letzte Tasse aus der Hand. Ich leerte die Spüle und schüttelte mir das Wasser von den Händen, bevor ich meine Finger an meinen Jeans abtrocknete. Meine Hände sind nicht gerade der attraktivste Teil von mir. Das heiße Wasser hatte die Haut runzelig werden lassen, und meine Knöchel waren rot und geschwollen. Selbst nach dem Spülen klebte immer noch schwarzer Dreck an meiner Haut und unter den Nägeln. Christys Hände waren dagegen stets gepflegt, mit perfekt manikürten Nägeln.
Adam legte auf und rief das Reisebüro an, über das er seine durchaus häufigen Geschäftsreisen organisierte: sowohl die wirklich geschäftlichen Geschäftsreisen als auch die besonderen Werwolf-Geschäftsreisen.
»Sie kann bei Honey und mir wohnen«, sagte Mary Jo zu mir, ihre Stimme so neutral wie möglich.
Sie und Honey waren die beiden anderen weiblichen Werwölfe im Rudel. Mary Jo war bei Honey eingezogen, als Honeys Gefährte vor ein paar Monaten getötet worden war. Keine der beiden mochte mich besonders.
Bis Mary Jo ihr gastfreundliches Angebot gemacht hatte, hatte auch ich halb geplant, Christy bei einem der Rudelmitglieder unterzubringen. Allerdings nur, weil ich die Sache noch nicht durchdacht hatte. Aber ich wusste sofort, dass es ein Fehler wäre, Christy bei Mary Jo und Honey einzuquartieren.
Adam und ich arbeiteten hart daran, den Zusammenhalt des Rudels zu verbessern. Das bedeutete, dass ich mich sehr bemühte, weder Honey noch Mary Jo weiter zu entfremden. Ich schaffte es recht gut, unsere Begegnungen neutral-freundlich zu halten. Aber wenn Christy bei ihnen einzog, würde sie die Abneigung der zwei Frauen gegen mich zu einem Tornado anfachen, bis das Ergebnis in einem Gewittersturm aus Drama, Drama und noch mal Drama über dem Rudel herniederging.
Als ich weiter darüber nachdachte, welch spaltende Kraft Christy entwickeln konnte, wurde mir klar, dass sie nicht nur ein Problem für mein Verhältnis mit dem Rudel darstellen würde, sondern auch für Adams. Adams Exfrau im selben Haus einzuquartieren wie Honey und Mary Jo wäre dämlich, weil es Mary Jo dazu zwingen würde, sich bei jeglichen Spannungen zwischen Christy oder Adam – oder Christy und dem Rudel – auf Christys Seite zu schlagen. Und dasselbe galt für jeden, bei dem Christy eventuell einzog.
Christy würde also hier wohnen müssen, bei Adam und mir.
»Christy muss hier wohnen, weil sie sich hier sicher fühlt«, erklärte Auriele, bevor ich Mary Jo antworten konnte.
»Ähm«, sagte ich, weil ich immer noch unter dem Gewicht der Erkenntnis schwankte, wie sehr es zum Himmel stinken würde, Christy nicht nur hier in den Tri-Cities zu haben, sondern sogar in meinem Zuhause.
»Du willst nicht, dass sie hier wohnt?«, fragte Auriele, und zum ersten Mal wurde mir bewusst, dass auch Auriele, wie Mary Jo, Christy mehr gemocht hatte als sie mich mochte. »Sie hat Angst und ist allein. Sei nicht kaltherzig, Mercy.«
»Würdest du wollen, dass Darryls Ex in deinem Haus wohnt?«, wandte Jesse kampfeslustig ein. Mir war nicht mal aufgefallen, dass meine Stieftochter wieder ins Erdgeschoss gekommen war. Sie hielt den Kopf hoch erhoben, als sie meine Seite ergriff. Dabei wollte ich das gar nicht. Christy war ihre Mutter – Jesse sollte nicht das Gefühl haben, sich zwischen uns entscheiden zu müssen.
»Wenn sie Hilfe bräuchte, würde ich es wollen«, blaffte Auriele. Doch das konnte sie leicht behaupten, denn so weit ich wusste, hatte Darryl keine Exfrau. »Wenn du Christy nicht hier haben willst, Mercy, ist sie auch in meinem Haus willkommen.«
Auf Aurieles Angebot folgten mehrere weitere, begleitet von bösen Blicken in meine Richtung. Viele Rudelmitglieder hatten Christy gemocht. Sie war genau die Art von hilfloser, nicht berufstätiger Frau, die ein Rudel voller Werwölfe mit zu viel Testosteron ansprach.
»Christy wird natürlich hier wohnen«, erklärte ich bestimmt.
Aber Mary Jo und Auriele diskutierten bereits hitzig darüber, wo sich Christy am wohlsten fühlen würde, die Männer hörten ihrem Streitgespräch zu und niemand beachtete mich.
»Ich habe gesagt …« – ich trat zwischen die zwei Frauen und lieh mir ein wenig Macht von Adam, um meinen Worten Gewicht zu verleihen – »Christy wird hier bei Adam und mir wohnen.« Beide Frauen senkten den Blick und traten zurück, aber die Feinseligkeit in Aurieles Miene verriet mir, dass sie nur wegen der Autorität des Alphas in meiner Stimme klein beigab. Mary Jo dagegen wirkte zufrieden – ich war mir ziemlich sicher, dass sie glaubte, dass der Aufenthalt in unserem Haus Christy die Chance eröffnen könnte, die Stellung als seine Frau zurückzugewinnen.
Auch wenn Adam immer noch telefonierte, sorgte mein Zugriff auf seine Autorität dafür, dass er sich umdrehte, um festzustellen, was in der Küche geschah. Doch er unterbrach keinen Moment seine schnellen Anweisungen.
»Es ist keine gute Idee, wenn sie hier wohnt. Sie kommt schon klar bei Honey und Mary Jo.« Jesse klang fast verzweifelt.
»Christy wird hier wohnen«, wiederholte ich, auch wenn ich mir dieses Mal nicht Adams Magie lieh, um meine Aussage zu unterstreichen.
»Mercy, ich liebe meine Mutter.« Jesse verzog unglücklich den Mund. »Aber sie ist selbstsüchtig, und sie nimmt es dir schrecklich übel, dass du ihren Platz eingenommen hast. Sie wird Ärger machen.«
»Jesse Hauptman«, blaffte Auriele. »Es ist deine Mutter, von der du gerade redest. Du solltest ihr mehr Respekt entgegenbringen.«
»Auriele«, knurrte ich. Dieser Morgen brauchte einen Dominanzkampf zwischen uns beiden genauso nötig wie die Welt einen Atomkrieg brauchte. Aber ich konnte nicht zulassen, dass sie Jesse Vorschriften machte: »Sei einfach ruhig.«
Die Zähne zu einem feindseligen Lächeln gefletscht richtete Auriele ihren vor Wut brennenden Blick auf mich, und in den kaffeebraunen Tiefen ihrer Augen wirbelte bereits ein wenig Gelb.
»Lass Jesse in Ruhe«, wies ich sie an. »Du überschreitest deine Befugnisse. Jesse gehört nicht zum Rudel.«
Aurieles Lippen wurden bleich, aber sie gab klein bei. Ich hatte recht, und das wusste sie genau.
»Deine Mom wird sich in diesem Haus sicherer fühlen«, erklärte ich Jesse, ohne den Blick von Auriele abzuwenden. »Und Auriele hat auch recht, wenn sie darauf hinweist, dass wir Christy hier besser beschützen können.«
Jesse warf mir einen verzweifelten Blick zu. »Sie will Dad nicht mehr. Aber das bedeutet noch lange nicht, dass sie will, dass eine andere ihn hat. Und sie wird versuchen, sich zwischen euch zu drängen. Sie ist wie eine Form der Wasserfolter – ein stetes tropf, tropf, tropf. Du solltest hören, was sie so über dich sagt.«
Nein. Nein, das sollte ich nicht. Und Jesse genauso wenig. Aber es gab nichts, was ich dagegen tun konnte.
»Es ist in Ordnung«, erklärte ich. »Wir sind alle erwachsen. Also können wir uns durchaus mal eine Weile benehmen.« Wie viel konnte es einen Werwolf schon kosten, einen Stalker zu finden und zu verscheuchen? Ein Stalker sollte doch per definitionem leicht zu finden sein, oder? Immerhin müsste er ihr dann folgen und damit schnell zu orten sein.
»Die gute Samariterin Mercy«, murmelte Mary Jo. »Sollten wir nicht alle dankbar sein für ihre Barmherzigkeit?« Sie sah sich um, stellte fest, dass sie im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stand, und wurde rot. »Was? Stimmt doch.«
Adam, der immer noch telefonierte, sah zu Mary Jo und hielt sie – und alle anderen im Raum – allein durch seinen Blick ruhig. Er beendete das Telefonat mit dem Reisebüro, dann legte er auf.
»Das reicht«, sagte er sehr leise, und Mary Jo zuckte zusammen. Adam sprach nur dann leise, wenn er wirklich wütend war – oft kurz bevor Leute starben. »Das steht nicht zur Debatte. Es wird Zeit, dass alle gehen. Christy gehört nicht zum Rudel, und sie hat auch nie zum Rudel gehört. Sie war niemals meine Gefährtin, sondern nur meine Frau. Das bedeutet, dass das keine Rudelangelegenheit ist und euch damit nichts angeht.«
»Christy ist meine Freundin«, erklärte Auriele hitzig. »Sie braucht Hilfe. Damit geht es mich etwas an!«
»Wirklich?«, fragte Adam, offensichtlich am Ende seiner Geduld. »Wenn es dich etwas angeht, wieso hat Christy dann mich angerufen und nicht dich?«
Auriele öffnete den Mund, doch Darryl legte ihr eine Hand auf die Schulter und führte sie aus dem Raum. »Das lässt du mal besser«, hörte ich ihn sagen, bevor sie das Haus verließen.
Die Wölfe – inklusive Mary Jo – schlichen sich aus dem Raum, ohne abzuwarten, ob Adam noch etwas zu sagen hatte. Wir – Adam, Jesse und ich – standen in der Küche und warteten, bis die Geräusche der startenden und anfahrenden Autos verklungen waren. Der gesamte harmonisierende Effekt des Sonntagsfrühstücks war genauso schnell verschwunden wie die Waffeln beim Essen kurz zuvor.
»Jesse«, sagte ich, »deine Mutter ist hier willkommen.«
»Du weißt, wie sie ist«, hielt Jesse leidenschaftlich dagegen. »Sie wird alles ruinieren! Sie kann Leute, kann Dad, dazu bringen, Dinge zu tun, die sie eigentlich niemals tun wollten.«
»Aber das ist nicht dein Problem«, erklärte ich Jesse, während Adams Miene hart wurde, weil er in diesem Punkt Jesses Meinung teilte.
»Sie kann auch mich dazu bringen, Dinge zu tun.« Jesse wirkte verzweifelt. »Ich will nicht, dass du verletzt wirst.«
Adams Hand landete auf meiner Schulter.
»Du bist für deine eigenen Handlungen verantwortlich«, erklärte ich ihr. Erklärte ich beiden. »Nicht für ihre. Sie ist kein Werwolf, keine Alpha. Sie kann dich nicht dazu zwingen, etwas zu tun, wenn du es nicht zulässt.«
Ich warf einen Blick auf die Uhr, obwohl ich genau wusste, wie spät es war. »Und wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet, ich muss mich umziehen und zur Kirche fahren, sonst komme ich zu spät.« Ich verließ die Küche, dann drehte ich mich im Türrahmen noch einmal um. »Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich für eine Extraportion Geduld und Barmherzigkeit beten sollte – die kann ich demnächst sicher gebrauchen.« Ich schenkte ihnen ein schiefes Grinsen, das allerdings kaum Humor enthielt, und verließ endgültig den Raum.
Der Kirchenbesuch half nicht viel. Als ich einige Zeit später heimkam und gleich danach mit dem Rücken auf die Matte in der Garage knallte, war ich immer noch verunsichert und in Gedanken bei den Geschehnissen des Morgens. Der unsanfte Aufprall vertrieb meine Sorgen allerdings und sorgte dafür, dass die Luft mit einem Stöhnen aus meiner Lunge entwich. Ich knurrte meinen Angreifer an – der um einiges tiefer zurückknurrte.
Das Knurren ließ Adams gut aussehendes Gesicht keinesfalls weniger attraktiv wirken, wobei jemand anderes vielleicht Angst bekommen hätte. Aber ich? Ich muss wohl irgendeinen unterdrückten Todeswunsch in mir tragen, denn ein wütender Adam sorgte grundsätzlich nur dafür, dass meine Knie ganz weich wurden, und zwar nicht auf verängstigte Art und Weise.
»Was hast du da versucht? Wolltest du Mücken erschlagen?« Adam war zu sauer, um meine Reaktion auf seinen Zorn zu bemerken. »Ich bin ein Werwolf. Und gerade versuche ich, dich umzubringen – und du schlägst mich dann einfach so mit der flachen Hand auf den Hintern?«
Selbst während ich auf dem Boden lag, blieb er in der Sanchin-Dachi-Position, einer neutral-bereiten Position, die es ihm jederzeit erlaubte, entweder anzugreifen oder eine Attacke abzuwehren. Außerdem drehte er dabei seine Füße einwärts. Das war wenig attraktiv, selbst bei Adam, aber sein dünnes, schweißnasses T-Shirt gab wirklich sein Bestes, diesen Makel auszugleichen.
»Es ist eben ein süßer Hintern«, erklärte ich.
Er verdrehte die Augen, verließ seine seltsame Stellung und kam einen Schritt auf mich zu.
»Und was meine Hand auf deinem süßen Hintern angeht«, fuhr ich fort, wobei ich meinen Schultern erlaubte, auf die Matte zu sinken, »habe ich nur sehr geschickt versucht, dich abzulenken.«
Er sah stirnrunzelnd auf mich herab. »Mich von was abzulenken? Von deinem fantastischen Angriff aus dem Hinterhalt, der dafür gesorgt hast, dass du jetzt auf dem Boden liegst?«
In diesem Moment drehte ich mich schnell herum und erwischte ihn mit einem Fuß am Knöchel, verlagerte aber mein gesamtes Gewicht auf das Schienbein, mit dem ich ihn in der Kniekehle traf. Er geriet ein wenig aus dem Gleichgewicht, und ich rollte mich auf die Beine, begleitet von einem Ellbogenschlag, der mit der Gewalt eines Pferdetrittes den großen Muskel hinten an Adams Oberschenkel traf. Als er auf Hände und Knie fiel, schwang ich den Schraubenschlüssel, den ich mir vor meinem Fall noch geschnappt hatte, und berührte damit leicht seinen Hinterkopf.
»Genau«, antwortete ich, erfreut über die Tatsache, dass ich es geschafft hatte, gut genug mit meiner Körpersprache zu lügen, um ihn zu überrumpeln. Er kämpfte schon um einiges länger als ich, und er war größer und stärker. Es gelang mir nur selten, ihn zu besiegen, wenn wir miteinander trainierten.
Adam rollte sich herum und rieb sich den Oberschenkel, weil mein Schlag ihm einen Krampf beschert hatte. Er sah den Schraubenschlüssel und kniff die Augen zusammen – dann grinste er und ließ sich auf die Matte sinken, die ungefähr den halben Garagenboden bedeckte. »Ich stand schon immer auf gemeine, hinterhältige Frauen.«
Ich rümpfte die Nase. »Hinterhältig wusste ich, aber mir war nicht bewusst, dass du auch auf gemein stehst. Okay. Dann gibt es ab jetzt keine Schokoladenkekse mehr für dich. Ich werde sie stattdessen an den Rest des Rudels verfüttern.«
Adam setzte sich auf, ohne die Hände zu Hilfe zu nehmen. Er wollte damit nicht angeben – er war einfach so stark. Und er war nicht einmal eitel genug, um sich bewusst zu sein, wie diese Bewegung die Bauchmuskeln unter seinem dünnen Shirt zur Geltung brachte. Aber ich würde ihm auch das nicht verraten.
Nicht, dass ich das hätte tun müssen. Seine Mundwinkel hoben sich nämlich schon, und seine schokoladenbraunen Augen wurden ein wenig dunkler, als er seine Nasenflügel blähte, um die plötzliche Veränderung wahrzunehmen, die meine Erregung in meiner Witterung bewirkte. Er zog sein Hemd aus und wischte sich damit über das Gesicht, bevor er es zur Seite warf.
»Ich mag meine Frauen aber nur ein klein wenig gemein«, gestand mir Adam mit rauchiger Stimme, die dafür sorgte, dass mein Herzschlag sich beschleunigte. »Keksentzug ist supergemein.«
Wir hatten jeden Tag miteinander trainiert, seitdem ich vor einiger Zeit in einen Kampf mit einem fiesen Vampir namens Frost geraten war. Danach hatte Adam beschlossen, dass – wenn ich schon immer wieder in Schwierigkeiten geriet – er wenigstens dafür sorgen konnte, dass ich mich auch selbst daraus befreien konnte. Ich ging immer noch dreimal die Woche zu meinem Sensei, um Karate zu lernen, und bemerkte bereits, wie sich dieses zusätzliche Training auf meine Kampffähigkeiten auswirkte. Aber mit Adam zu trainieren bedeutete, dass ich mich vollkommen auf den Kampf konzentrieren konnte, ohne mir Gedanken darum zu machen, jemanden zu verletzen (Werwölfe sind schließlich zäh). Außerdem bedeutete es, dass ich mein wahres Selbst nicht hinter menschlich-langsamen Bewegungen verstecken musste. Und heute bedeutete es außerdem, dass ich den morgendlichen Anruf mal für eine Weile vergessen konnte.
Ich beugte mich vor und lehnte meine Stirn an Adams verschwitzte Schulter. Er roch gut: es war eine Duftkombination aus dem Moschusgeruch des Werwolfes und sauberem Schweiß und ergab eine einzigartige Mischung, die einzig und allein Adam gehörte. »Nein. Wäre ich supergemein, hätte ich Christy mitgeteilt, dass sie jemand anderen finden soll, der sie rettet.«
Er schlang einen Arm um mich. »Ich liebe sie nicht. Und ich habe sie niemals auf die Weise geliebt, wie ich dich liebe. Sie hat jemanden gebraucht, der sich um sie kümmert … und ich kümmere mich eben gerne um Leute. Das war alles, was uns verbunden hat.«
Er war von seinen Worten überzeugt, doch ich wusste es besser. Ich hatte Adam und Christy in guten Zeiten zusammen gesehen. Und ich hatte auch den Schaden gesehen, den ihr Abgang bei diesem Mann angerichtet hatte, der sich um die Leute kümmerte, die zu ihm gehörten, und der sie nicht leichtfertig gehen ließ. Aber ich würde nicht mit ihm diskutieren.
»Ich mache mir keine Sorgen darum, dass sie sich zwischen uns drängen könnte«, erklärte ich ihm ehrlich. »Ich mache mir vielmehr Sorgen, dass sie dich und Jesse verletzen könnte. Das Rudel verletzen könnte. Aber das ist immer noch besser, als zuzulassen, dass sie sich ihren Schwierigkeiten – wie auch immer diese aussehen mögen – alleine stellt.«
Er beugte sich vor und drückte seine Wange auf meinen Scheitel. »Du hast gelogen«, meinte er. »Du bist überhaupt nicht gemein.«
»Pst. Das ist doch ein Geheimnis.«
Er ließ sich auf die Matte zurücksinken und zog mich mit sich nach unten. »Ich glaube allerdings, du musst mich bestechen, damit ich dein Geheimnis wahre«, sagte er nachdenklich.
»Ich habe so ein vages Gefühl, dass ich in nächster Zukunft eine Menge Kekse backen werde«, erklärte ich reumütig. »Ich könnte meine Entscheidung zurücknehmen und dich doch ein oder zwei davon essen lassen.«
Adam brummte nachdenklich, dann schüttelte er langsam den Kopf und rollte sich ein wenig herum, bis ich auf ihm lag statt neben ihm. »Das würde den Zweck verfehlen, nicht wahr? Wenn die Leute sehen, dass du mir Kekse gibst, halten sie dich auch nicht mehr für gemein.«
Jesse war inzwischen mit Freundinnen unterwegs, und keiner der Werwölfe war zurückgekommen, nachdem Adam sie weggeschickt hatte.
Ich setzte mich auf und spürte unter mir, wie er tief einatmete. Fühlte seine harten Bauchmuskeln. Langsam schob ich mich ein wenig nach unten, und er schnappte nach Luft.
»Ich weiß nicht, ob mir noch etwas anderes einfällt, womit ich dich bestechen könnte«, erklärte ich übertrieben ernsthaft.
Er knurrte mich an – ein echtes Knurren. Dann sagte er: »Siehst du? Supergemein.«
Manchmal war das Liebesspiel mit Adam langsam, sodass sich die Intensität immer weiter aufbaute, bis ich davon überzeugt war, in Funken explodieren zu müssen und nie wieder etwas empfinden zu können, wenn die Gefühle noch intensiver würden. Nach solchen Erlebnissen blieb ich ganz erschöpft zurück … und ein wenig verloren, im besten Sinne. Liebe bedeutet ja, dass man sich verletzlich macht, weil man weiß, dass es da jemanden gibt, der einen auffängt, wenn man fällt. Aber zu Zeiten, in denen ich mich sowieso bereits verletzlich fühlte, konnte ich mich nicht auf diese Weise gehen lassen.
Adam entschied sich heute allerdings für ein neckendes Liebesspiel, als wüsste er genau, was ich empfand. Er war leidenschaftlich und verspielt dabei, und ich gab ihm dasselbe zurück. Ich war also nicht die Einzige, die sich Sorgen darum machte, was Christys Anwesenheit uns antun konnte; ich war nicht die Einzige, die Bestätigung brauchte.
Leise schrie ich auf, als seine Zähne meine Schulter fanden, der kleine Schmerz über meine Wirbelsäule nach unten schoss und mich in einen Höhepunkt katapultierte, der meinen Körper schwach und meinen Geist stark zurückließ. Adam wartete, bis ich wieder zu mir selbst gefunden hatte, bevor er seine Liebkosungen aufs Neue begann. Ich beobachtete sein Gesicht, beobachtete, wie er sich gerade noch unter Kontrolle halten konnte – und vermasselte ihm schließlich die Tour. Zuerst knabberte ich zart an seinem Hals, dann schlang ich die Beine um ihn und vergrub meine Fersen leicht in seinem Kreuz. Er verlor sich schließlich ganz und gar in mir, und das reichte aus, um auch mich noch einmal in einen Taumel der Lust zu treiben.
Und als wir danach nackt auf den Matten lagen, umgeben vom Geruch von Sex und Schweiß, unsere Hände fest verschlungen, fühlte ich, wie das Problem Christy auf kontrollierbare Größe schrumpfte.
Ich war mir sicher: solange Adam mich liebte, konnte ich auch mit dem Schlimmsten umgehen, was Christy uns antun konnte. Die leise mahnende Stimme, dass Adams Liebesspiel mich manchmal mit der Illusion von Unverwundbarkeit zurückließ, verdrängte ich schnell.
Später an diesem Abend, lange, nachdem wir ins Bett gegangen waren, klopfte jemand an die Eingangstür.
Adams Arm lag schwer auf meinem Oberschenkel. Irgendwie hatte ich mich so herumgerollt, bis ich quasi quer im Bett lag. Medea, unsere Katze, lag hinter meinem Kopf, was wiederum die Frage beantwortete, wieso ich mich in dieser seltsamen Position befand. Sie hatte die Angewohnheit, mich, wenn ich schlief, von meinem Kissen zu verdrängen, damit sie so hoch wie möglich ruhen konnte.
Wieder klopfte jemand, ein höfliches Poch-poch.
Stöhnend schob ich Medea von meinem Kissen, um es mir dann über den Kopf zu ziehen. Adam blieb völlig entspannt und locker, als ich mich bewegte. Genauso wie die Katze. Sie protestierte nicht einmal, und sie stand schon gar nicht auf, um beleidigt von dannen zu stiefeln. Sondern schlief einfach dort weiter, wo ich sie hingeschoben hatte.
Klopf. Klopf.
Ich erstarrte, stemmte mich halb vom Bett hoch und sah Adam an. Starrte die Katze an. Dann schüttelte ich Adam, doch auch das hatte keinen Effekt: etwas hielt ihn im Schlaf fest. Nachdem dasselbe auch für die Katze galt, ging ich von Magie aus.
Ich bin immun gegen manche Arten von Magie. Vielleicht beeinflusste mich der Zauber deswegen nicht. Aber dieses hartnäckige Klopfen …
Klopf. Klopf.
… genau das … ließ mich vermuten, dass ich absichtlich nicht unter dem Einfluss des Zaubers stand. Jemand wollte allein mit mir sprechen. Oder mir etwas antun, ohne Adam in meinem Rücken.
Ich rollte mich vom Bett, griff mir meine Sig Sauer aus der Nachttischschublade, löste das Magazin mit den Silberkugeln und ersetzte es durch eines, das mit kupferummantelten Hohlspitzgeschossen gefüllt war. Kein Werwolf, den ich kannte, besaß die Macht, einen Alpha von Adams Kaliber so tief im Reich der Träume versinken zu lassen. Das bedeutete Magie der Fae – Feenvolk – oder der Hexen, und beide Arten konnten durch normale Kugeln getötet werden. Zumindest war ich mir in dieser Sache ziemlich sicher. Bei Hexen würde das in jedem Fall funktionieren – solange es sich nicht um Elizaveta handelte –, aber was das Feenvolk betraf, war alles etwas komplizierter.
Die Hohlspitzgeschosse würden auf jeden Fall mehr Schaden anrichten als die Silberkugeln. Silber war zu hart, um gute Munition abzugeben. Und bewaffnet zu sein war immer besser als unbewaffnet, wenn man sich einem unbekannten Feind stellen musste.
Ich schaute auf meinem Weg zur Eingangstür in Jesses Zimmer vorbei. Sie schlief leise schnarchend auf dem Rücken, die Arme über den Kopf geworfen. Für den Moment war sie sicher genug.
Klopf. Klopf.
Die Waffe verlieh mir den Mut, mich die Treppe nach unten zu schleichen. Die Pistole lag schwer in meinen Händen. Wie meine täglichen Trainingssessions mit Adam war auch das Tragen der Waffe zur Routine geworden. Ich war kein Mensch, nicht wirklich, aber ich war fast genauso hilflos. Das hatte keine große Rolle gespielt, bis ich Adam zu meinem Gefährten erwählt hatte. In mancher Hinsicht hatte die Tatsache, dass ich jetzt zum Rudel gehörte, dafür gesorgt, dass ich um einiges sicherer war – aber gleichzeitig wurde ich damit zum schwächsten Glied im Rudel. Die Waffe half dabei, den Unterschied zwischen mir und den Werwölfen auszugleichen.
Draußen war es dunkel, und die schmale Fensterscheibe neben der Tür bestand sowieso nur aus Milchglas. Es gab also keine Möglichkeit, von hier aus zu erfahren, wer vor der Tür stand.
Klopf.
»Wer sind Sie?«, fragte ich, wobei ich meine Stimme hob, ohne wirklich zu schreien.
Das Klopfen hörte auf.
»Wir verraten unsere Namen nicht leichtfertig«, erklang eine angenehme Männerstimme. Dass er seine Stimme nicht hob, verriet mir, dass er genug über mich wusste, um zu verstehen, dass ich besser hörte als ein normaler Mensch. Und seine Antwort verriet mir, was er war, wenn auch nicht wer.
Die Fae hüteten ihre Namen nämlich sorgfältig, wechselten sie regelmäßig und versteckten ihre wahren Namen, damit man diese nicht gegen sie einsetzen konnte. Die Magie des Feenvolkes funktionierte am besten, wenn deutlich gemacht wurde, auf wen sie wirken sollte. Doch einem Feind den eigenen Namen zu verraten, konnte sogar ein Zeichen von Stärke sein – Siehst du, wie wenig Sorgen ich mir deinetwegen mache? Ich nenne dir meinen Namen, und selbst dann kannst du mich nicht verletzen.
Dank meines Freundes und früheren Arbeitgebers Zee – ein eisengeküsster, selbst ernannter Gremlin und Meistermechaniker – kannte ich eine Menge Fae in der Gegend der Tri-Cities. Doch die Stimme der Person auf meiner Türschwelle erkannte ich nicht. Das Feenvolk konnte sehr effektive Tarnzauber wirken: die Fae konnten ihr Antlitz verändern, ihre Stimmen, sogar ihre Größe und Form. Aber alle Fae sollten sich eigentlich in den Reservaten aufhalten, nachdem sie vor einiger Zeit den USA den Krieg erklärt hatten.
»Ich öffne niemandem die Tür, dessen Namen ich nicht kenne«, erklärte ich dem Fremden vor meinem Haus.
»In letzter Zeit war ich als Alistair Beauclaire bekannt«, erklärte er mir.
Beauclaire. Ich schnappte nach Luft. Natürlich wusste ich, wer er war. Und dasselbe galt für jeden, der das virale YouTube-Video gesehen hatte. Beauclaire hatte den Mann getötet, der davor seine Tochter entführt hatte, um sie dann umzubringen wie so viele andere Halbblut-Fae zuvor auch (genauso wie ein paar Werwölfe). Beauclaire war außerdem der Mann, der erklärt hatte, dass sich das Feenvolk von nun an als unabhängig von den USA und jeglichen menschlichen Einflusses betrachtete. Er war ein Grauer Lord – einer der Mächtigen, die das Feenvolk regierten.
Aber er war noch mehr, viel mehr als das, denn an diesem schicksalshaften Tag hatte er auch einen anderen seiner vielen Namen verraten.
»Gwyn ap Lugh«, sagte ich.
Ich hatte zu Lugh recherchiert, nachdem ich vor ein paar Jahren einem Eichendryad begegnet war, der ständig von Lugh gesprochen hatte. Die Ergebnisse waren verwirrend gewesen, um es milde auszudrücken. Sicher war nur, dass Lugh in den Überlieferungen der legendären Fae leuchtete wie eine Laterne in dunkler Nacht. »Ap Lugh« bedeutete Sohn des Lugh, also hatte ich es zumindest nicht mit Lugh selbst zu tun.
Der Fae auf der anderen Seite der Tür zögerte, bevor er langsam antwortete: »Auch diesen Namen habe ich getragen.«
»Sie sind ein Grauer Lord.« Ich bemühte mich, meine Stimme ruhig zu halten. Als Alistair Beauclaire hatte er lange Zeit in menschlicher Gestalt gelebt, und war – das schloss ich aus Interviews mit seinen Freunden, seiner Exfrau und seinen Mitarbeitern – recht beliebt gewesen. Es machte keinen Sinn, ihn zu beleidigen, wenn es nicht nötig war. Und ihn auf der Türschwelle stehen zu lassen, konnte als Beleidigung ausgelegt werden.
»Ja«, antwortete er.
»Würden Sie mir Ihr Wort geben, dass Sie nicht beabsichtigen, mir zu schaden?« Es war wichtig, ihn nicht vor den Kopf zu stoßen. Aber genauso wichtig war es, nicht dumm zu sein. Obwohl ich mir ziemlich sicher war, dass die Tür ihn nicht aufhalten könnte, wenn er wirklich ins Haus wollte.
»Ich werde Sie heute Nacht nicht verletzen«, erklärte er bereitwillig. Die für einen Fae so untypisch direkte Antwort machte mich nur noch misstrauischer.
»Sind Sie allein da draußen?«, fragte ich wachsam, nachdem ich darüber nachgedacht hatte, was er mir antun könnte, ohne sein Wort zu brechen. »Und würden Sie mir versprechen, heute Nacht auch niemandem in diesem Haus Schaden zuzufügen?«
»Ich bin der Einzige hier draußen, und für diese Nacht werde ich sicherstellen, dass keinem, der mit Ihnen in diesem Haus ist, Schaden droht.«
Ich sicherte die Waffe, wich bis in die Küche zurück und versteckte dann die Waffe unter einem Stapel Küchentücher, die darauf warteten, weggeräumt zu werden. Dann ging ich wieder zurück zur Tür und öffnete sie.
Die kalte Nachtluft, deren Temperatur sich in dieser frühen Frühlingsnacht noch um den Gefrierpunkt einpendelte, sorgte dafür, dass das T-Shirt, das ich trug – ein langes, schwarzes Hauptman-Security-Shirt, so oft gewaschen, dass es schon grau wirkte – nicht ausreichte, um mich warm zu halten. Ich schlafe niemals nackt: das Leben als Ehefrau des Alphas beinhaltete regelmäßig unerwartete Besuche mitten in der Nacht.
Zwar bin ich weder scheu noch besonders anfällig für Schamgefühle, aber Adam mag es nicht, wenn andere Männer mich nackt sehen. Er wird dann noch reizbarer als gewöhnlich. Adams T-Shirts haben genau die richtige Größe, um bequem zu sein, und mich in seinen Hemden zu sehen half ihm außerdem dabei, in der Umgebung anderer Männer die Ruhe zu bewahren.
Beauclaire senkte seinen Blick nicht tiefer als mein Kinn. Ob das nun aus Höflichkeit oder Desinteresse geschah – für mich war es in jedem Fall okay.
Seine Witterung erinnerte an einen See, voller Leben und Pflanzen, mit einem leichten Anflug von Sommersonne, obwohl er im Licht des Mondes und der Sterne vor mir stand, mit kahlen Bäumen hinter sich, an denen sich gerade erst die ersten Knospen bildeten. Rötlichbraunes Haar, an den Schläfen bereits ein wenig ergraut, ließ ihn unglaublich normal wirken – ein Eindruck, der eine klare Lüge war, dafür musste ich nur an den so ungewöhnlich tief schlafenden Werwolf in meinem Bett denken.
Beauclaire war mittelgroß, mit einem schlanken Körperbau, dem es trotzdem nicht ganz gelang, die sehnigen Muskeln darunter zu verstecken. Warren, Adams Dritter, war ähnlich gebaut.
Er sah nicht aus wie ein Sonnen- oder Sturmgott und auch nicht wie ein Schelmengott und Trickster. Alles Dinge, die Lugh angeblich einmal gewesen war. Beauclaire hatte vor seinem dramatischen YouTube-Moment als Rechtsanwalt gearbeitet, und so wirkte er selbst jetzt noch.
Natürlich konnten die Fae aber aussehen, wie auch immer sie wollten.
Als ich zurücktrat und ihn ins Wohnzimmer führte, bewegte Beauclaire sich wie ein Mann, der weiß, wie man kämpft – immer gut ausbalanciert und wachsam. Diese Bewegungen verrieten mir mehr als die Fassade des Anwalts, die er mir präsentieren wollte.
Er ging ins Wohnzimmer, doch dort blieb er nicht. Das Erdgeschoss unseres Hauses hatte einen offenen Grundriss, also ging er durch das Esszimmer und noch weiter, bis um eine Ecke herum. Dort gelangte er schließlich in die Küche, wo er sich einen Stuhl nahm, der mit der Lehne zur Wand stand, und sich darauf setzte.
Ich war mir ziemlich sicher, dass seine Wahl wichtig war – das Feenvolk legt sehr viel Wert auf Symbolik. Vielleicht hatte er die Küche gewählt, weil sonst Gäste, die neu ins Haus kamen, sich eher im Wohnzimmer niederließen. Familie und Freunde dagegen versammelten sich in der Küche. Falls das stimmte, versuchte er vielleicht, sich als Freund darzustellen – oder er wollte betonen, dass ich nicht die Macht besaß, ihn aus dem Herz meines eigenen Hauses fernzuhalten. Die Symbolik war zu subtil, als das ich mir in ihrer Bedeutung sicher sein konnte – also ignorierte ich sie einfach. Wenn ich mich zu sehr bemühte, die tiefere Bedeutung seiner Handlungen oder Worte zu ergründen, würde ich bald schon im Land der Zwangsjacken leben.
»Mrs. Hauptman«, sagte er, kaum dass ich mich ihm gegenüber niedergelassen hatte. »Meinem Verständnis nach besitzen Sie eines der Artefakte meines Vaters. Ich bin hier, um den Wanderstab zu holen.«
2
Ich habe den Wanderstab nicht mehr.«
Beauclaire sollte das eigentlich wissen. Ich hatte es schließlich Zee erzählt, und der hatte es, laut seines Sohnes, einigen anderen Fae weitererzählt, um mich genau vor einer solchen Szene zu schützen.
Falls Beauclaire wirklich nichts wusste, lag das möglicherweise daran, dass er nicht aus dem naheliegenden Walla-Walla-Reservat stammte? Oder bedeutete es, dass Zee ihm nicht vertraute?
»Wo ist der Stab?« Die Stimme des Fae erfüllte den Raum, verlockend und gleichzeitig doch gefährlich.
Wenn er es nicht wusste, wollte ich es ihm nicht sagen müssen. Die Wahrheit würde ihm nicht gefallen, und ich wollte keinen Grauen Lord wütend machen, solange er an meinem Küchentisch saß.
»Ich habe versucht, ihn dem Feenvolk zurückzugeben«, erklärte ich, um Zeit zu schinden. »Also habe ich ihn Onkel Mike gegeben, aber der Stab ist einfach wieder zu mir zurückgekehrt.«
»Der Stab ist sehr alt«, meinte Beauclaire, halb entschuldigend. »Die Fae haben ihn jedenfalls nicht, zumindest keiner der Fae, die im nahe gelegenen Reservat leben. Wissen Sie, wo er sich im Moment befindet?«
Er ging wohl davon aus, dass ich den Wanderstab erneut ans Feenvolk übergeben hatte. Hätte es den entschuldigenden Tonfall in seiner Stimme nicht gegeben, hätte ich ihn wahrscheinlich … naja, nicht angelogen, nicht direkt. Denn ich wusste eigentlich gar nicht, wo sich der Wanderstab befand. Ich wusste nur, bei wem.
»Nicht genau«, erklärte ich, um dann zu schweigen. Zee hatte mir sehr deutlich gemacht, dass das Feenvolk nicht begeistert sein würde zu hören, wo der Wanderstab gelandet war.
»Was ›genau‹ wissen Sie dann? Wem haben Sie ihn gegeben?«
Wir hörten einen dumpfen Schlag aus Richtung der Treppe und zuckten beide zusammen. Beauclaire konzentrierte sich, und ich fühlte, wie seine Magie in eisigen Wellen über meine Haut glitt.
»Warten Sie«, meinte ich. »Ich werde nachsehen.« Noch bevor ich das erste Wort gesprochen hatte, war ich schon aufgesprungen und zur Treppe gegangen. Wer auch immer das Geräusch erzeugt hatte, es war auf jeden Fall jemand, der mir etwas bedeutete – und ich wollte nicht, dass derjenige von einem Grauen Lord mit Magie attackiert wurde.
Ich bog um die Ecke, und Medea starrte von der vierten Stufe von unten zu mir auf. »Es ist alles okay«, sagte ich in Beauclaires Richtung. Ich hob die Katze hoch. Wie immer wurde Medea sofort schlaff und begann zu schnurren.
»Was war es?«, fragte Beauclaire.
»Ich weiß, dass es wie ein Klischee aus einem Horrorfilm klingt«, sagte ich, als ich mit ihr auf dem Arm zurück in die Küche ging. »Aber es war wirklich nur die Katze. Wieso haben Sie sie nicht weiterschlafen lassen, wie alle anderen auch?«
Beauclaire musterte die Katze stirnrunzelnd, aber die Magie in der Luft um ihn herum löste sich langsam auf. Ich setzte mich, und die Katze erlaubte mir huldvoll, sie weiter zu streicheln.
»Katzen sind knifflig«, erklärte er mir. »Wie Sie neigen auch Katzen dazu, Zauber leichter abzuschütteln. Ich hatte nicht damit gerechnet, eine Katze in einem Haus voller Werwölfe zu finden, und improvisierte Magie – vor allem solch grazile Magie bei komplizierten Lebewesen wie Katzen – ist nicht meine Spezialität.« Er sah mich an, und in seiner Stimme schwang eine Drohung mit, als er sagte: »Hurrikans, Flutwellen, überschwemmte Städte – so etwas fällt mir leichter.«
»Fühlen Sie sich deswegen nicht schlecht«, meinte ich versöhnlich. Seine Brauen sanken nach unten, und ich fuhr neutral fort: »Es hat bisher auch noch niemand von einer Katze gehört, die Werwölfe mag.«
Medea – vielleicht, weil gefährliche Männer mit drohenden Stimmen ihrer Erfahrung nach diejenigen waren, die am ehesten dazu neigten, alles stehen und liegen zu lassen, um sie zu knuddeln – entschied, dass Beauclaire Freiwild war. Sie glitt von meinem Schoß auf den Tisch und begann, langsam über den Tisch auf ihn zuzuschleichen.
»Wir sprachen vom Wanderstab?«, sagte er und hob eine Augenbraue. Ich war mir nicht sicher, ob die Augenbraue mir galt oder der Katze – Medea bei ihrem Zeitlupen-Schleichen zuzusehen, konnte einen beunruhigenden Effekt haben.
»Ein Eichendryad hatte den Wanderstab benutzt, um einen Vampir damit zu töten«, erklärte ich ihm. Das war entweder der Beginn einer Geschichte oder eine Ablenkung. Darüber war ich mir selbst noch nicht im Klaren.
Ich hob die Hand und schlang meine Finger um Adams Hundemarke, die, zusammen mit meinem Ehering und einem silbernen Lamm, an einer Kette um meinen Hals hing. Wenn ich Beauclaire davon abhalten wollte, mich und meine gerade viel zu verletzliche Familie in einem Wutanfall zu vernichten, dann musste er verstehen – soweit ich es eben selbst verstanden hatte – was mit dem Wanderstab geschehen war.
Medea hatte es inzwischen über den Tisch geschafft und kauerte sich vor Beauclaire. Sie konzentrierte sich auf ihn und stöhnte. Ein Geräusch, das ich so noch nie von einer Katze gehört hatte.
»Der Eichendryad hat mir hinterher erklärt« – ich hob meine Stimme ein wenig, um Medeas seltsame Rufe zu übertönen – »dass Lugh niemals etwas geschaffen hat, was nicht auch als Waffe eingesetzt werden konnte.« Ich runzelte die Stirn. »Nein, das war nicht genau das, was er gesagt hat. Es war eher etwas in der Richtung von ›Nichts baute er, was nicht im Notfall ein Speer werden könnte‹.«
Medea jaulte lauter, dann verwandelte sie sich in ein Halloween-Kätzchen; jedes Haar an ihrem Körper richtete sich auf, und hätte sie einen Schwanz besessen, hätte sie ihn wohl hoch in die Luft gereckt.
Medea, die täglich mit Werwölfen zu tun hatte, war ziemlich immun gegen Angst. Sie mochte sogar Vampire. Und sie hatte keinerlei Probleme mit Zee oder Tad.
Beauclaire senkte den Kopf, bis seine Augen auf einer Höhe mit denen von Medea schwebten. Dann senkte er seinen Tarnzauber nur ein klein wenig. Als er die Katze anfauchte, erhaschte ich einen Blick auf etwas Wunderschönes, Tödliches – ein Wesen mit grünen Augen und einer lange Zunge. Die Katze flog förmlich vom Tisch, dann verschwand sie um die Ecke und sauste die Treppe nach oben.
Ich fühlte, wie meine Lippen sich instinktiv zu einem Knurren verzogen. »Zu viel des Guten«, erklärte ich ihm.
Er entspannte sich auf seinem Stuhl. »Also ist der Wanderstab jetzt bei diesem Eichendryad?«
Ich schüttelte den Kopf. »Nein. Er kam danach zurück. Aber letzten Sommer … die Sache mit den Otterkin …«
»Ich habe von Ihnen und dem Tod der letzten Otterkin gehört.« Er zuckte mit den Achseln. »Die Otterkin waren immer blutrünstig und dumm. Es ist kein Verlust …« Dann zögerte er, musterte mich nachdenklich und sagte: »Sie haben sie mit dem Wanderstab getötet?«
»Er war eben das, was ich gerade zur Hand hatte.« Ich bemühte mich, nicht allzu defensiv zu wirken. »Und ich habe nur einen von ihnen damit getötet.« Adam hatte sich um den Rest gekümmert, aber das würde ich Beauclaire nicht erzählen. »Irgendetwas stimmte nicht mit dem Wanderstab, als dieser Otterkin starb.« Das Artefakt hatte hungrig gewirkt.
»Etwas stimmte nicht mit dem Stab«, wiederholte Beauclaire nachdenklich. Dann schüttelte er den Kopf. »Nein. Nur die großen Waffen werden getränkt, wenn sie geschaffen werden, gewöhnlich im Blut einer würdigen Person, im Blut von jemandem, dessen Eigenschaften das Schwert gefährlicher machen. Der Wanderstab wurde schon vor langer Zeit vollendet.«
Ich fragte mich, ob ich erwähnen sollte, dass Onkel Mike mich gefragt hatte, ob ich den Wanderstab »getränkt« hatte. Und vielleicht sollte ich ihm erzählen, dass der Otterkin nicht das Einzige gewesen war, was der Wanderstab an diesem Tag getötet hatte. Vielleicht sollte ich ihm außerdem erzählen, dass der Wanderstab diesen Otterkin quasi selbstständig getötet hatte.
Doch bevor ich die Chance bekam, etwas zu sagen, fuhr Beauclaire fort: »Das Schwert, das Sie als Excalibur kennen, wurde geboren, als die Klinge im Tod meines Vaters getränkt wurde.« Er zögerte und zeigte seine Zähne, aber auf eine Weise, die alles andere als ein Lächeln war. »Wie man hört, sind Sie mit dem Schöpfer dieser Klinge gut bekannt.«
Für einen Moment dachte ich nicht mehr an meine Sorgen wegen des Wanderstabes.
Jodelnder Joschafat. O heilige Nacht.
Siebold Adelbertsmiter hatte einst, vor langer Zeit, Klingen erschaffen. Zu dem Zeitpunkt, als ich ihn allerdings kennengelernt hatte, war er nur der Besitzer einer normalen VW-Werkstatt gewesen. Er hatte mich angestellt, um mir dann später die Werkstatt zu verkaufen. Und zwar als die Grauen Lords entschieden hatten, dass die Zeit gekommen war, der Öffentlichkeit seine Fae-Natur zu enthüllen – Jahrzehnte, nachdem das Feenvolk an die Öffentlichkeit getreten war. Ich kannte ihn als grummeligen alten Griesgram mit einem Herz so weich wie ein Marshmallow. Aber früher war Zee eine ganz andere Person gewesen: der dunkle Schmied von Drontheim. Und in den Märchen, in denen er eine Rolle spielte, gehörte er nicht zu den Guten.
Der Teil von mir, der nach wie vor Angst vor Beauclaire hatte, machte sich Sorgen, dass sein Groll auf Zee Auswirkungen auf mich haben könnte. Ein anderer Teil war entsetzt darüber, dass mein Freund Zee Lugh getötet hatte, den Held von Hunderten, wenn nicht Tausenden von Geschichten. Aber der größte Teil von mir staunte darüber, dass Zee, mein grummeliger Mentor Zee, tatsächlich Excalibur geschmiedet hatte.
Erst einen Augenblick später begann ich, die neue Information wirklich zu verarbeiten. In dieser Geschichte lag die Antwort darauf, wieso Beauclaire nicht wusste, was ich mit dem Wanderstab getan hatte.
Wenn Zee Lugh getötet hatte, würde Lughs Sohn kaum freundliche Worte mit ihm wechseln, und auch nicht mit Leuten, die ihm nahestanden. Niemand ist so nachtragend wie das Feenvolk.
»Aber wir sprechen bei diesem Stab nicht von einer der großen Waffen«, sagte Beauclaire, und beruhigte sich, als hätte er seine Gedanken von der uralten Quelle seiner Wut losgerissen. »Also sind diese Geschichten, dass der Wanderstab verwendet wurde, um einen Vampir oder einen Otterkin zu töten, nicht relevant. Der Wanderstab ist ein untergeordnetes Artefakt – selbst wenn Lugh ihn geschaffen hat – und bringt dem Besitzer auch keinen echten Nutzen.«
»Außer man beschließt, Schafe zu züchten«, sagte ich, weil mich seine Geringschätzung des Wanderstabes zu meiner eigenen Überraschung ein wenig verletzte. Der Stab war alt und wunderschön gewesen – und mir gegenüber so loyal wie ein Schäferhund gegenüber seinem Schäfer. Wenn er verdorben worden war, dann war es meine eigene Schuld – weil ich beschlossen hatte, damit Monster zu töten. »Dann würden dank des Stabes all meine Schafe Zwillinge bekommen. Das mag ja für Sie oder das Feenvolk nicht wichtig sein, aber für einen Schäfer hätte das sicherlich einen Unterschied gemacht.«
Beauclaire schenkte mir einen Blick, mit dem mich auch meine Mutter manchmal bedachte. Aber er war nicht meine Mutter, und er war in mein Haus eingedrungen, also zuckte ich nicht einmal zusammen. Stattdessen verengte ich die Augen zu Schlitzen und beendete meine Ausführungen. »Wäre ich ein Schaf-Farmer, hielte ich das für mächtige Magie.«
»Der Stab ist ein Artefakt, das mein Vater geschaffen hat«, sagte Beauclaire, der auch ap Lugh war, also Lughs Sohn. »Ich schätze den Wanderstab, verstehen Sie mich nicht falsch. Aber er ist weder mächtig, noch liegt seine Magie in einem Bereich, der die meisten Menschen oder Fae interessiert. Aus diesem Grund wurde er länger in Ihrem Besitz belassen, als es der Fall hätte sein dürfen.«
»Tatsächlich«, sagte ich und hob einen Finger, »wurde er mir gelassen, weil er stets zu mir zurückgekehrt ist, wann immer ich ihn zurückgegeben habe oder einer aus dem Feenvolk versucht hat, ihn für sich zu beanspruchen.«
Beauclaire lehnte sich vor und sagte: »Wie kommt es dann, dass Sie den Wanderstab jetzt nicht mehr besitzen?«
»Ist es jetzt der Graue Lord oder ap Lugh, der das wissen will?«, fragte ich.
Er lehnte sich zurück. »Spielt das eine Rolle?«
Ich antwortete nicht.
»Der Graue Lord ist zu sehr mit anderen Dingen beschäftigt, um einem Wanderstab hinterherzujagen, der dafür sorgt, das Schafe Zwillingslämmer gebären. Egal, wie alt oder ehrwürdig das Artefakt auch sein mag«, erklärte Beauclaire einen Augenblick später. Er schenkte mir ein kleines Lächeln, das seine Augen nicht erreichte. »Doch hätte ich früher erfahren, wo der Wanderstab sich befindet, wäre ich früher gekommen, um ihn zu holen.«
Was eine Antwort war. Oder nicht?
»Der Graue Lord jedenfalls hätte nur eine kurze Antwort bekommen«, erklärte ich ihm. »Was auch immer sie ihm geholfen hätte.«
Diese beweglichen Augenbrauen schossen mit Spock-artiger Schnelligkeit nach oben.
»Oder mir«, fuhr ich fort. »Denn der Graue Lord wird auf keinen Fall glücklich sein.« Der Sohn von Lugh konnte vielleicht verstehen, warum ich getan hatte, was ich getan hatte – weil er verstehen würde, dass die Notwendigkeit, meine Taten wiedergutzumachen, wichtiger war als die Tatsache, dass der Wanderstab inzwischen im Vergleich zu früher um einiges mächtiger war. Der Graue Lord dagegen würde sich nur für die Macht interessieren.
Beauclaire antwortete nicht, und ich holte tief Luft.
»Der Wanderstab hat einen der Otterkin getötet«, erklärte ich ihm. »Denn zu behaupten, ich hätte einen der Otterkin damit getötet, würde nicht ganz der Wahrheit entsprechen. Ich habe ihn verwendet, um mich zu verteidigen, als der Otterkin mich mit einem Schwert angegriffen hat. Seine Waffe aus magischer Bronze zerbrach beim Aufprall auf den Wanderstab, ob dieser Stab nun ein untergeordnetes Artefakt sein mag oder nicht.« Mein bissiger Tonfall zauberte den Anflug eines Lächelns auf Beauclaires Gesicht. Doch als ich fortfuhr, wurde seine Miene ausdruckslos. »Und dann bildete sich aus dem silbernen Griff des Wanderstabes eine Klinge – eine Speerspitze – und tötete den Otterkin.« Nur für den Fall, dass er es noch nicht verstanden hatte, fügte ich hinzu: »Aus sich selbst heraus. Aber ohne sein Eingreifen hätte ich nicht überlebt.«
Beauclaires lange Finger zeichneten nachdenklich Muster auf den Küchentisch. Ich machte mir Sorgen, dass er damit irgendeine Art von Magie wirken könnte, doch er hatte versprochen, mich nicht zu verletzen, und hätte er Magie eingesetzt, hätte ich sie gespürt.
Schließlich sprach er: »Die Artefakte meines Vaters erwerben eine Art Selbstwahrnehmung, das geschieht bei ihnen mit zunehmendem Alter. Aber auch das verändert ihre Aufgabe nicht so tiefgreifend. Der Wanderstab ist eigentlich ein Artefakt des Lebens, nicht des Todes.«
»Vielleicht ist der Wanderstab das erste Artefakt, das sich auf diese Weise verändert, oder sogar das Einzige. Ich lüge Sie nicht an.« Ich sprach voller Anspannung. Vielleicht hätte ich ihm das alles gar nicht erzählen sollen. Aber er machte mir Angst, dieser Graue Lord, der den Anzug eines Anwalts trug und so ruhig und kühl wirkte. Ich machte mir keine Illusionen über die eigentliche Art des Benehmens, die unter diesem teuren Anzug lauerte – die Fae waren Meister darin, das Raubtier in sich unter der Fassade der Zivilisation zu verbergen. Deshalb musste ich dafür sorgen, dass er wirklich verstand, warum ich den Wanderstab verschenkt hatte, oder es bestand die realistische Chance, dass er mich einfach umbringen würde.
»Vielleicht nicht«, vertraute er mir nach einem langen Moment der Stille an. »Aber es gibt viele Arten von Lügen.«
»Bevor der Otterkin starb, haben wir gegen den Flussteufel gekämpft, eine urwüchsige Kreatur, die gerufen wurde, um die Welt zu zerstören. Den Großteil der Arbeit haben hier andere getan. Es war ein schwerer Kampf, und fast hätten wir ihn verloren. Außer mir sind alle gestorben, die gekämpft haben, um das Wesen zu töten.« Für manche dieser Wesen war der Tod weniger permanent als für andere, aber das bedeutete nicht, dass sie damals nicht wirklich gestorben sind. »Damals hatte ich meine einzige Waffe verloren. Ich war in diesem Moment verzweifelt, und alle anderen waren bereits gestorben oder standen kurz vor dem Tod. Da erschien plötzlich der Wanderstab in meiner Hand, und damit habe ich den Flussteufel getötet.«
Beauclaire antwortete nicht sofort, doch sein Blick war so unverwandt auf mich gerichtet, dass ich seine Aufmerksamkeit wie Elektrizität auf der Haut spürte. »Sie glauben also, er wurde getränkt im Blut dieses ›Flussteufels‹?« Das letzte Wort stieß er voller Verachtung hervor.
»›Flussteufel‹ war der Name, den andere diesem Wesen gegeben haben, also machen Sie nicht mich dafür verantwortlich«, meinte ich. »Aber ja. Denn nachdem der Flussteufel gestorben ist, hat sich der Wanderstab auf einmal verändert. Er hat den Otterkin getötet und … hatte plötzlich ein Bewusstsein.«
Beauclaire beobachtete mich weiterhin nur, und der Blick in seinen Augen erinnerte mich an Medea, wenn sie vor einem Mauseloch kauerte. Abwartend.
»Ich habe ihn damals zerbrochen«, gab ich offen zu. »Und ich wusste nicht, was ich dagegen tun sollte.«
»Sie haben ihn darum Siebold Adelbertsmiter gegeben«, sagte Beauclaire. Seine Stimme war kühl, sein Blick hungrig und sein Körper angespannt und bereit, jemanden in der Luft zu zerreißen.
»Der Wanderstab wollte sich nicht einmal von Zee anfassen lassen, als ich ihn das erste Mal in meinen Besitz bekam«, erklärte ich. »Er wäre nicht mit Zee gegangen, also habe ich es nicht einmal versucht.«
»Onkel Mike?« Das hätte ihn offensichtlich weniger gestört.
»Nein. Auch nicht Onkel Mike. Ich habe Ihnen doch gesagt, dass er nicht bei ihm geblieben ist. Was wissen Sie über die Gastfreundschaftsregeln der amerikanischen Ureinwohner?«
Er musterte mich einen Moment. »Warum erklären Sie sie mir nicht einfach?«
Also erklärte ich, wie es dazu gekommen war, dass ich Lughs Wanderstab Kojote geschenkt hatte.
Lughs Sohn musterte mich ungläubig. »Sie haben ihn Kojote gegeben? Weil er als Ihr Gast den Wanderstab bewundert hat?«
»Genau«, stimmte ich zu.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: