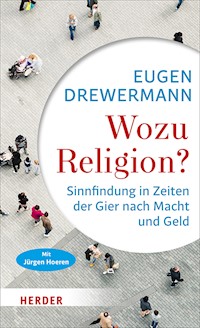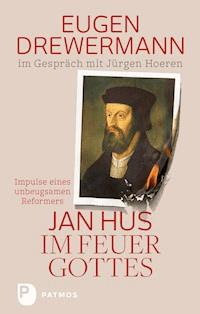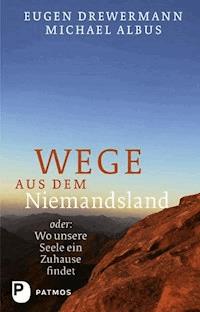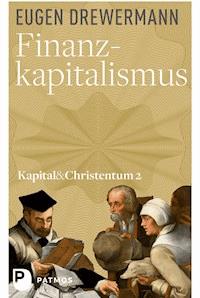
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Patmos Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Kapital & Christentum
- Sprache: Deutsch
Mit der Trilogie "Kapital & Christentum" bietet Eugen Drewermann eine umfassende Analyse der Entstehung und der Wirksamkeit des kapitalistischen Wirtschaftssystems. In Band 2 klärt E. Drewermann die Frage, was Menschen mit Geld machen – und was das Geld mit Menschen macht. Was überhaupt ist das: Geld? Und wie wird es zu Kapital? Was treiben die Banken? Wie wirkt der Zins? Welche Rolle spielen Finanzspekulationen? – Was bringt uns dazu, Gewinnsucht und Geldgier als eine unternehmerische Tugend zu betrachten und Geld und Gelderwerb in den Mittelpunkt unseres Lebens zu rücken? Die von der Realwirtschaft abgekoppelte Finanzwirtschaft bewirkt wachsende Ungerechtigkeit, spaltet zwischen Arm und Reich, erhält sich durch Gewalt. Erst wenn wir verstehen, wie das kapitalistische Wirtschaftssystem funktioniert, zeichnet sich ab, wie wir uns aus dem Tanz ums Goldene Kalb befreien können.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 648
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Eugen Drewermann
Finanzkapitalismus
Kapital und Christentum Band 2
Patmos Verlag
Was find ich hier?
Gold? kostbar flimmernd, rotes Gold? …
…
So viel hiervon macht schwarz weiß, häßlich schön,
Schlecht gut, alt jung, feig tapfer, niedrig edel.
Ihr Götter! warum dies? Warum dies, Götter?
Ha! dies lockt euch den Priester vom Altar,
Reißt Halbgenesenen weg das Schlummerkissen.
Ja, dieser rote Sklave löst und bindet
Geweihte Bande, segnet den Verfluchten.
Er macht den Aussatz lieblich, ehrt den Dieb
Und gibt ihm Rang, gebeugtes Knie und Einfluß
Im Rat der Senatoren; dieser führt
Der überjährgen Witwe Freier zu;
Sie, von Spital und Wunden giftig eiternd,
Mit Ekel fortgeschickt, verjüngt balsamisch
Zu Maienjugend dies. Verdammt Metall,
Gemeine Hure du der Menschen, die
Die Völker tört. Komm, sei das, was du bist.
William Shakespeare:
Timon von Athen, Akt IV, Szene III, S. 580
Rückschau und Vorschau
Noch haben wir in »Geld, Gesellschaft und Gewalt, Band 1« den Kapitalismus kaum erst zur Hälfte, allein in seinem unternehmerisch-ökonomischen Teil, kennengelernt, da zeichnet sich doch schon ein einigermaßen klar konturiertes Umrißbild ab.
Als erstes: es gilt das »Gesetz« des »freien« Marktes, – alle Unternehmer der gleichen Branche stehen in Konkurrenz untereinander; jeder von ihnen kann machen, was er will, doch er darf – bei Strafe des Untergangs – nur tun, was ihm gegenüber seinen Mitbewerbern wirtschaftlichen Vorteil bringt. Daraus ergibt sich zum zweiten, daß als oberstes Ziel all seiner Aktivitäten die Maximierung des Gewinns zu erachten ist; alle persönlichen Motive und Rücksichtnahmen haben dahinter zurückzutreten, – sie sind nur, wenn verträglich mit dieser obersten Zielsetzung, zugelassen. Der Unternehmer ist zum dritten Eigner der Produktionsmittel; als Feudalherr war er einmal Besitzer des Bodens, jetzt, als Industriekapitalist, verfügt er über die nötigen Maschinen, Werkshallen und Vertriebssysteme; freilich, je komplizierter die Unternehmensstruktur und je ehrgeiziger in den Größenordnungen die Planung gerät, desto mehr wächst auch die Abhängigkeit von den Geldmitteln der Kreditgeber: der Banken und der Aktionäre.
Ein Hauptthema dieses zweiten Bandes wird eben deshalb der Frage gewidmet sein: was eigentlich ist Geld und wie wird aus ihm Kapital? Hier schon läßt sich allerdings sagen, daß der Unternehmer, als Konzern- oder als Firmenchef, nicht allein unfrei auf dem »freien« Markt agiert infolge des »Gesetzes« wechselseitiger Vernichtungskonkurrenz, sondern daß er zugleich abhängig ist von seinen Investoren: sie interessieren sich, ganz wie er selber, allein an den Gewinnausschüttungen, am Shareholder Value (am Vermögenswert der Anteilseigner), und dieses ihnen zu verschaffen ist sein Handlungsauftrag, seine Verpflichtung, seine »moralische« »Verantwortung« (alle Begriffe der bürgerlichen Welt müssen bei der Kennzeichnung der Kapitalismus in Anführungsstriche gesetzt werden, – sie meinen nicht mehr, was sie zu bedeuten scheinen, sie sind nur noch die Surrogate einer Umlenkung menschlichen Anstands).
Dafür, zum vierten, herrscht der Glaube (um einen solchen geht es, wie in einer Religion), die »unsichtbare Hand«, jenes »Gesetz« des »freien« Marktes, werde von alleine alles richten: staatliche Eingriffe könnten da nur störend sein; der Markt selber sei »sozial«: indem ein jeder seinem Vorteil nachgehe, wirke sich’s rein rechnerisch zum Vorteil aller aus; wachsende Umsätze, steigender Handel, höhere Rendite vermehrten automatisch den Wohlstand aller Marktteilnehmer, der Produzenten wie der Konsumenten. – Jede »unternehmensbasierte« Wirtschaftstheorie (und Politik) wird dieses Credo propagieren. Und hat sie nicht recht?
Die Dynamik, mit welcher der Industriekapitalismus die Welt verändert hat, ist enorm. Noch um 1800 lebten in Deutschland kaum 10 % der Bevölkerung in Gemeinden mit mehr als 5 000 Einwohnern1; dann ballten sich immer größere Arbeitermassen rund um die Fabriken zusammen. Die Grundversorgung wurde gewährleistet, die Mangelwirtschaft durch Massenproduktion überwunden. Die durchschnittliche Lebenserwartung stieg: 1870 lag sie noch bei etwa 37 Jahren, um 1900 bereits um 10 Jahre höher2; bei einem um 1930 Geborenen lag sie bei 61 Jahren3, bei einem Mädchen, das 2004 zur Welt gekommen ist, hat sie sich auf 82 Jahre erhöht, bei einem Jungen auf 76 Jahre4. Der Feudalismus wurde hinweggefegt; der Unternehmer trat an die Stelle des Feudalherren; die Bauernbefreiung schaffte die Voraussetzungen zur Bildung der Reservearmeen des Industrieproletariats; die Gewerbefreiheit erzwang selbst in Preußen 1834 die Einrichtung des Deutschen Zollvereins zur Erleichterung des Handels und Warentransports in den damals noch 36 verschiedenen Hoheitsgebieten in deutschen Landen. Eisenbahnen verbanden Fabriken, Städte und Häfen; Kohle- und Stahlproduktion wurden zu Trägern des industriellen Fortschritts. Die Entwicklung der Chemie erlaubte die Herstellung verbesserter Medikamente, die Elektrotechnik ermöglichte den Telegraphen, den Elektromotor, die Beleuchtung von Stuben, Städten und Werkshallen: der 24-Stunden-Tag wurde zum Gesetz der Arbeitszeit. Dieselmotoren eroberten die Straßen …
Die Aufzählung der Errungenschaften des kapitalistischen Wirtschaftssystems fällt selbst in solch knappen Andeutungen höchst beeindruckend aus, – das läßt sich nicht leugnen. Doch etwas in diesem System ist monströs falsch: es ist nicht, wie ADAM SMITH glaubte und FRIEDRICH AUGUST von HAYEK dozierte, »sozial«; im Gegenteil: es lebt von der Schaffung permanenten Unrechts und wachsender Ungerechtigkeit; es spaltet, je länger, je mehr, zwischen Arm und Reich; es stützt sich auf Gewalt und erhält sich durch Gewalt. Das Sklavenhaltertum des Feudalismus setzte sich fort in der Lohnsklaverei des Industriearbeiters, der zudem noch zum Sklaven der Maschine wurde, mit einer Arbeitszeit ursprünglich von bis zu 90 Wochenstunden, – noch um 1900 waren es durchschnittlich 58 Stunden5; die hygienischen Bedingungen waren katastrophal, die Kindersterblichkeit hoch. Gleichwohl wuchs auch unter diesen Umständen die Bevölkerung: Lebten auf dem Gebiet des Deutschen Reiches um 1850 nur 35 Mio Menschen, so waren es 1914, bei Ausbruch des Ersten Weltkriegs, 67 Mio.6 Renten- und Krankenversicherungen wurden 1883 unter Bismarck eingeführt. Erkennen läßt sich: »Nicht mehr Kaiser, Könige und Grundherren stehen im Zentrum der gesellschaftlichen Auseinandersetzung, sondern das Besitzbürgertum und die Arbeitermassen.«7 »In Preußen explodiert die Zahl der Maschinen von einigen Hundert in den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts auf fast 30 000 im Jahr 1875. – … Am Vorabend des Ersten Weltkriegs haben allein die Eisenbahnen des Deutschen Reiches Zehntausende Lokomotiven unter Dampf. Sie rollen auf mehr als 60 000 Kilometer Schienen, für die Dämme aufgeschüttet und Tunnel gebohrt werden – erstmals passt der Mensch sich nicht der Natur an, sondern formt sie nach seinen Bedürfnissen.«8
Doch gerade in diesem neu erwachten Stolz liegt, noch unbemerkt in den Anfangstagen der Volkswirtschaftslehre, ein unlösbares Kernproblem der kapitalistischen Ökonomie: Die außerordentliche Dynamik, mit welcher der Kapitalismus alle Marktteilnehmer unter Druck setzt, ist identisch mit der Forderung nach ständigem Wachstum. Wachstum ist das fünfte Kennzeichen dieser Art zu wirtschaften; – nur wenn er wächst, kann sich der Kapitalismus am Leben erhalten, – JOSEPH SCHUMPETERs »kreative Zerstörung« ist sein Wesen. Doch etwas hat sich geändert. Bisher ergab sich der Furor quantitativer Selbstausdehnung und qualitativer Veränderungen aus den Konkurrenzbedingungen der Produktion: nur die Größten, Stärksten und Schnellsten können in diesem sozialdarwinistischen struggle for life überleben; fortan sind das die Reichsten. Wir werden noch sehen, wie vor allem die Abhängigkeit des kapitalistischen Unternehmers von seinen Geldgebern eine ganz eigene Antriebsdynamik entfaltet. Bisher mochte es genügen, in die Produktionskosten den Preis für Rohstoffe und Arbeitslöhne einzurechnen, ab sofort aber werden auch die Zinsen bei der Rückzahlung fälliger Kredite hinzukommen. Eine Wirtschaftsform indes, die ständig expandieren muß, kann nie zur Ruhe kommen; sie ist strukturell außerstande, ein Gleichgewicht von Mensch und Natur herzustellen; vielmehr besteht sie wesentlich in einer immer effizienteren Ausbeutung der Natur. Und mit ihren »Segnungen« wächst immer noch die Menschheit, – am Jahreswechsel 2016/17 steht sie bei fast 7,5 Mrd. Und sie muß wachsen: die Produzenten brauchen ihre Konsumenten; immer mehr Waren – immer mehr Menschen. Jeder weiß: so kann es nicht weitergehen. Die Natur ist nicht unendlich, doch so soll es weitergehen.
Bereits 1946 verordnete in den USA ein eigenes Gesetz, daß die Regierung für »maximale Beschäftigung, Produktion und Kaufkraft« sorgen müsse9. Diese drei Ziele: Vollbeschäftigung, Wirtschaftswachstum und Preisstabilität (Inflationsbekämpfung), lassen sich (als das »magische Dreieck« der Volkswirtschaftslehre) nur um den Ausschluß des jeweils Dritten verwirklichen. – Die DDR zum Beispiel garantierte über viele Jahre hin Vollbeschäftigung und stabile Preise, doch ihr Wirtschaftswachstum lahmte. 1958 demonstrierte der Statistiker ALBAN PHILLIPS, daß ein linearer Zusammenhang besteht zwischen Arbeitslosigkeit und geringer Lohnentwicklung (also niedriger Inflationsrate); umgekehrt läßt sich eine steigende Inflationsrate mit einer sinkenden Zahl von Arbeitslosen verbinden, – Preisstabilität oder Vollbeschäftigung, dazwischen scheint man wählen zu müssen. So erklärt sich der damals heftig kritisierte Satz von Kanzler Helmut Schmidt in den 70er Jahren, ihm seien 5 % Inflation lieber als 5 % Arbeitslosigkeit, – natürlich warf man ihm vor, er werde beides bekommen, wenn er den Wirtschaftsmotor drossele; Inflation sei Diebstahl, eine Sünde gegen das 7. Gebot, wetterte seinerzeit der katholische Episkopat der BRD-West, um die C-Parteien zu unterstützen. Doch auch die EZB hat sich mit ihrer Niedrigst-Zins-Politik europaweit ein gleiches Ziel gesetzt: eine Ankurbelung der Investitionen, einen Abbau der Arbeitslosigkeit und dann auch einen Anstieg der Inflationsrate auf 2 %.
In jedem Falle geht es »alternativlos« um Wachstum. 1967 wurde in der Bonner Republik ein Stabilitäts- und Wachstumsgesetz erlassen, wonach der Staat verpflichtet ist, »eine zu geringe Nachfrage durch Investitionen« auszugleichen, und er ist »nicht nur für Preisstabilität zuständig«, sondern auch für »›angemessenes Wirtschaftswachstum‹.«10 Das »Wohl des Staates zu mehren«, ist also sogar per Gesetz identisch mit der Forderung nach Wirtschaftswachstum, was in der Praxis heißt: eine »Entfesselung der Marktkräfte« durch Steuersenkung auf Unternehmergewinne und »Privatisierung« von Krankheits- und Altersvorsorge zwecks Abbau der »Lohnnebenkosten«, notfalls auch Zinssenkungen und Subventionen. Dahinter steht nicht ohne weiteres schon die neoliberale Ideologie von MILTON FRIEDMAN und seinen Chicago Boys, – in der BRD war in jenen Tagen die ordoliberale Theorie von WALTER EUCKEN (1891–1950) vorherrschend, der für einen »fairen« Wettbewerb eintrat und den Staat in die Pflicht nahm, Kartellbildungen und Machtmißbrauch zu bekämpfen11. An die Kernfrage indessen rührte niemand: Wohin führt ungebremstes Wachstum? Kann es sein, daß die gesamte Basis des Kapitalismus: sein Zwang zur Expansion, daß ein per Gesetz vorgeschriebenes Regierungsziel: eben Wachstum (oder neuerdings: das »Wachstumsbeschleunigungsgesetz« von Dezember 2008), in sich selbst einer unausweichlichen Katastrophe gleichkommt? – Es kann nicht nur sein, es ist so! Je rascher der Kapitalismus den Raum überwindet und die Zeit (als geldbringenden Produktionsfaktor) beschleunigt, desto enger zieht sich die Welt um ihn zusammen, desto sicherer fährt er voll vor die Wand; und da er mittlerweile so gut wie die gesamte global vernetzte Menschheit sich untertan gemacht hat, besteht die Gefahr, daß er sie mit sich in den Abgrund reißt.
Wie es dazu kommt, hat sich uns bereits an dem Prozeß der Preisbildung gezeigt, der in der tradierten Volkswirtschaftslehre so beschrieben wird, als wenn die unglaubliche Ausbeutung der Natur kein weiteres Problem darstelle. Inzwischen wissen wir, was man sich schon am Anfang hätte sagen können: daß ein unbegrenztes Wachstum inmitten einer begrenzten Welt nicht lange ohne Schaden voranschreiten kann. Die Verwüstung der Böden, die Verseuchung der Gewässer, die Überfischung der Meere, die Rodung der tropischen Regenwälder, die Belastung der Luft, die menschengemachte Klimaerwärmung mit all ihren Folgen, die skrupellose Ausbeutung der Tiere in der industrialisierten Landwirtschaft, die wachsende Rate aussterbender Tier- und Pflanzenarten – das alles zusammen zeigt die absolute Unverträglichkeit des kapitalistischen Wirtschaftssystems mit den Grundregeln eines ökologisch »nachhaltigen« Umgangs mit einer Natur, die unendlich viel mehr ist als die »Umwelt« nur der Spezies Mensch. NAOMI KLEIN hat recht: Die »Rettung« des Klimas, die »Rettung der Welt«, wie sie im Dezember 2015 in Paris ebenso vollmundig wie halbherzig in Aussicht gestellt wurde, ist realisierbar nur unter Beseitigung des kapitalistischen Wirtschaftssystems12. Ein einziger Faktor, um das zu bewerkstelligen, würde genügen: Es gälte nach dem Verursacherprinzip, die der Natur im Produktionsprozeß zugefügten Schäden in Form der anfallenden Kosten der Schadensregulierung in die Bildung der Preise der jeweiligen Produkte einzubeziehen. PIGOUs »Externa« veränderten alles.
Erinnern wir uns. – Preise, so sahen wir, bilden sich (der überkommenen Theorie nach) in einem Gleichgewicht aus den Grenzkosten des Herstellers und dem Grenznutzen des Verbrauchers. Auf der Angebotsseite wird ein Unternehmer solange ein Produkt herstellen, wie die Kosten für ihn erschwinglich sind, – er wird den Preis seiner Ware auf der Kostenhöhe festsetzen, die ihm die Erzeugung des letzten Stücks seines Produkts zu stehen kommt. Der Verbraucher richtet sich nach dem Nutzen beim Kauf einer Ware: hat er großen Hunger, wird er für ein Stück Brot sogar einen extrem hohen Preis akzeptieren, doch je mehr Brot er kauft, desto geringer wird für ihn der Nutzen; von einem bestimmten Punkt an hat er genug, – der Grenznutzen, wie LEON WALRAS ihn bezeichnete, liegt für ihn auf der Höhe der letzten Broteinheit. Entsprechend der Vorstellung der neoklassischen Wirtschaftstheoretiker (die im 19. Jh. die klassischen Theorien von ADAM SMITH und DAVID RICARDO weiterführten) tendiert der Marktmechanismus von Angebot und Nachfrage von selbst zu einem Gleichgewichtspunkt, an dem es weder für den Hersteller noch für den Verbraucher sinnvoll ist, weiter Ware gegen Geld zu tauschen13. Im Idealzustand, nach dem Theorem von JEAN BAPTISTE SAY, wird überhaupt alles, was produziert wird, auch konsumiert werden: der Verbraucher kann nur so viel kaufen, wie erzeugt wird, und der Hersteller wird nur so viel produzieren, wie er abzusetzen vermag; die Herstellungskosten realisieren sich in den Verkaufspreisen. Die Preise selbst fungieren auf dem – offenen – Markt als Informationen darüber, wie viel an Kaufbedürfnis besteht und wieviel an Warenangebot existiert. – Vorausgesetzt als Marktteilnehmer ist dabei freilich ein Menschentyp, den es (jedenfalls noch) nicht gibt: ein homo oeconomicus, der über eine hinreichende Menge relevanter Informationen verfügt, um das Marktgeschehen kompetent einschätzen zu können, und der sich entsprechend den Kosten- und Nutzenrechnungen rational (das heißt optimal zugunsten seinen Vorteilsinteressen) verhält. – Soweit in der Theorie, doch welch eine Wirklichkeit wird darin abgebildet?
Kaufanreize (»Bedürfnisse«) können völlig irrational erzeugt werden, – die gesamte Werbebranche basiert auf dieser Möglichkeit; sie können sich zudem aus phantastischen Moden ergeben. – Das tollste (und für alle Spekulationsblasen späterer Zeiten am meisten lehrreiche) Beispiel stellt wohl der niederländische Tulpenwahn und sein Ende im Jahre 1637 dar: Ursprünglich »eine Wildpflanze in den Hochtälern Zentralasiens«, hatte »die Tulpe ihren Weg über Persien und das Osmanische Reich nach Europa« gefunden und war bald »zur Modeblume der Reichen und Schönen« avanciert14. Die kostbaren Zwiebeln, für deren seltenste Sorten schließlich bis zu 10 000 Gulden ausgegeben wurden, nahmen selber die Funktion einer Währung ein: man rechnete in Tulpen, von 1635 an dealte man mit Tulpen-Derivaten, »es gab Anteilsscheine auf Tulpen-Zwiebeln und handelbare Bezugsrechte … Nun wurden ganzjährig Terminkontrakte abgeschlossen und Zwiebeln gehandelt, die noch in der Erde steckten. Schuldscheine und Schilder in den Beeten wiesen die künftigen Besitzer und das Datum des Bezugs aus.«15 Die Blase platzte am ersten Dienstag des Monats Februar im Jahre 1637, als ein Auktionator in einem Schankkollegium in Haarlem den geforderten Preis nicht erzielen konnte und Abschläge akzeptieren mußte. Mit einem Mal fuhren die Investoren Verluste ein. »Der durchschnittliche Tulpen-Anleger verzeichnete binnen Wochen ein Minus im Depot von 95 Prozent, die meisten Derivate waren mit einem Schlag völlig wertlos geworden.«16
In gewisser Weise deutet diese Episode bereits auf die – noch weit größere – Finanzkrise von 2008 hin, doch an dieser Stelle illustriert sie nur erst die blühende Irrationalität im Verhalten sämtlicher Marktteilnehmer: der Produzenten und Händler nicht weniger als der Käufer und Investoren. THORSTEIN VEBLEN ist zuzustimmen: es sind die gesellschaftlichen Launen der Eitelkeit und des Dabei-Sein-Wollens, die – oft genug – den Markt bestimmen; wie sonst wäre der Absatz von Porsche-Autos, Rolex-Uhren, Diamant-Kolliers oder 1000-Euro-Weinen zu erklären? Der »Nutzen« liegt hier einzig in der Demonstration, daß man sich’s leisten kann, – ein Statusemblem, mehr nicht, doch höchst lukrativ. Statt bloße »Mathematik« zu sein, ergeben sich die Markt»gesetze« offenbar aus einer Menge psychologisch zufälliger Konstellationen, mit anderen Worten: sie sind gar keine »Gesetze«.
Dann aber gibt es jenen Aspekt der Preisgestaltung, der im kapitalistischen Wettbewerb des »freien« Marktes in der Tat einem eisernen Zwang unterliegt: Um seine Ware absetzen zu können, muß der Hersteller die Produktionskosten so niedrig wie möglich halten; und das wird ihn im Industriezeitalter dazu führen, so billig als es irgend geht, sich die nötigen Rohstoffe zu sichern: ein schonungsloser Raubbau an der Natur ist notwendigerweise die Folge, verbunden mit der militärischen Ausdehnung kolonialer Herrschaft. Der Staat, selber das Produkt monströser Gewaltausübung, wie wir noch sehen werden, steht dem Treiben des kapitalistischen Unternehmertums keinesfalls hemmend, sondern höchst förderlich gegenüber, ja, er ist damit verschmolzen: Wo im Feudalismus Fürsten, Barone, Bischöfe und Grafen Kriege führten, wenn ihnen das Geld ausging, diktieren nunmehr die Unternehmer und Kapitaleigner den »Regierenden«, wie der allgemeine Wohlstand zu mehren ist. Noch sieht man nicht, daß, je erfolgreicher das kapitalistische Wirtschaftssystem agiert, die Grenzen der Natur sich desto empfindlicher bemerkbar machen müssen, und man will genauso wenig sehen, daß der aufgehäufte Reichtum auf der Nordhalbkugel einhergeht mit der systematischen Verelendung weiter Teile auf der Südhalbkugel. Der Besitz von Böden – dieses alte Privileg von Kirche und Adel im Feudalismus – ist heiß umkämpft in Welteroberungsstrategien kapitalistisch fungierender Konzerne. Vergeblich, daß Wirtschaftswissenschaftler wie LEON WALRAS schon aus Gründen der Gerechtigkeit eine Sozialisierung des Bodens forderten und der Ökonom ALFRED MARSHALL »den Kampf gegen die Armut als wahre Legitimation seiner Wissenschaft« betrachtete17, – sie dachten dabei an Europa, nicht an die verheerenden Praktiken der Franzosen, Briten, Holländer, Spanier und Portugiesen in Nord- und Südamerika, in Afrika, in Indien und Hinterindien, in Südostasien und Fernost.
Doch daraus ist etwas Entscheidendes zu lernen. Wie bei den Böden, so mit dem Wasser, so mit den Wohnungen, so mit allen Grundbedürfnissen des Lebens: sie dürfen nicht in die Hände kapitalistischer Unternehmer geraten, die sie als ihre »Produkte« auf dem Weltmarkt feilbieten! Die Markt-»Gesetze« im Kapitalismus arbeiten allein zu ihrem Gewinn, indem sie den Rest der Menschheit in allen lebenswichtigen Belangen auf Gedeih und Verderb von ihnen abhängig machen; im Kapitalismus ist das kein »Marktversagen«, sondern das erklärte Ziel und das unvermeidbare Ergebnis dieser Art von Wirtschafts»ordnung«.
Will man es noch ein Stück weiter treiben? Et voila! Der Smog in Peking, Singapur und Mailand nötigt im Dezember 2015 zu drastischen Verkehrseinschränkungen; die Luft in den Städten zu atmen, ist zunehmend ungesund. Welch eine Gewinnchance da bei einem Dienstleistungssystem für gesunde Atemluft! Etwa so: Keine Großstadt, die nicht über eine Menge von Pissoirs verfügt, auch damit ist viel Geld zu machen, wenn man sich ein lokales Monopol darauf sichert (und die Stadtverwaltung dahin bringt, es einem zuzuschanzen); läßt sich da nicht eine ähnliche Verteilung von Atemsäulen im ganzen Stadtgebiet organisieren, wo nach Zahlung eines gewissen Betrages in einen Münz- und Kartenautomaten frische Luft in einem angemessenen Zeitäquivalent zum Einatmen zur Verfügung steht? Je schlechter (je »knapper«) das Konsumgut Luft, desto höher der Preis, der dafür gezahlt wird. – Schon ist diese Idee kein Gedankenexperiment mehr, – solche Luftzapfsäulen gibt es wirklich in Tokio; aber die Frage stellt sich um so dringlicher: wann eigentlich merken die Menschen, daß ihnen der Kapitalismus die Luft abdrückt? Er stiehlt ihnen alles, wovon sie leben, indem er es in eine käufliche Ware verwandelt; er stiehlt ihnen, was sie selbst sind: ihre Würde.
O ja, »die Würde des Menschen ist unantastbar«18, so steht es in der Verfassung; nie soll der Mensch betrachtet werden als ein Mittel zum Zweck, stets als ein Zweck an sich selbst, heißt es bei IMMANUEL KANT19. Doch der Kapitalismus besteht in nichts anderem als in der systematischen Ausbeutung des Menschen durch den Menschen. Möglich ist das, weil die Produktionsmittel sich in den Händen des Unternehmers befinden; er ist der Arbeitgeber, der den Arbeitnehmern die Löhne auf einem Niveau diktieren kann, das seine Rendite (den »Mehrwert«) nicht schmälert. Auch auf dem Arbeitsmarkt herrscht laut der tradierten Wirtschaftslehre das »Gesetz« von Angebot und Nachfrage. Da ist der Unternehmer, der je nach Absatzlage seiner Produkte den Umfang der Arbeitsnachfrage feststellt: ist er groß genug, wird er bereit sein, das knapper werdende »Humankapital« teurer zu bezahlen, – die Löhne können steigen. Unter allen Umständen ist er, der Eigner der Produktionsmittel, der wahre Herr auf dem Arbeitsmarkt. Denn die Arbeiter haben nichts anzubieten als sich selbst: die Muskelkraft ihres Körpers und die Geisteskraft ihres Gedächtnisses und ihrer Phantasie. Drängen ihrer, getrieben von Not, zu viele auf den Markt, so stehen sie selber in Konkurrenz untereinander im Wettbewerb um die gleiche Anstellung; sie müssen akzeptieren, daß von ihnen nur die »Tüchtigsten« zu den branchenüblich niedrigsten Tarifen angestellt werden. Die ungelernten Arbeiter, denen jede Art von mechanischer Arbeit zugemutet werden kann, müssen sich mit Löhnen abspeisen lassen, die gerade die Lebenshaltungskosten decken; qualifizierte Arbeiter muß man höher entlohnen, – sie könnten sich sonst bei der Nachbarfirma bewerben.
Wie aber, man verlegt die Arbeit ins Ausland? Outsourcing ist zum Zauberwort des gegenwärtigen Kapitalismus geworden. In den Tagen des Kolonialismus zwang man die einheimische Bevölkerung in den Überseeländern mit drakonischen Mitteln zur Dienstbarkeit gegenüber den Handelsgesellschaften und Produzenten der Herkunftsländer: sie hatten die Produkte anzupflanzen, abzubauen oder zu erstellen, die für Franzosen, Briten, Spanier etc. von Hauptinteresse waren. Jetzt ist es möglich, in den ausgebeuteten Ländern auf neokoloniale Weise tätig zu werden, indem man die verarmte Bevölkerung als Billiglohnkräfte in Dienst stellt. Im Zeitalter digital vernetzter Verwaltungsstrukturen ist es nicht schwer, von der Wall Street oder der City of London aus Geldgeschäfte in Singapur oder Dacca zu tätigen, mit denen sich die Arbeiter in den Zuliefer- und Fertigungsbetrieben von Autos, Computern, Kleidern oder Spielzeug bezahlen lassen, – zu einem ortsüblich niedrigen Lohn, wohlgemerkt, und ohne die immer lästigen Lohnnebenkosten. Die Rede geht von der »Lohnveredelung« im Ausland. 97 % ihrer Produkte lassen deutsche Bekleidungsfirmen heute im Ausland fertigen, mehr »als 1 Mio Jobs sind in der Branche seit 1970 still und leise verschwunden«20, sie wurden verlegt in den 90er Jahren vor allem nach Polen, Tschechien und Rumänien, dann nach Tunesien und Marokko, schließlich nach Hongkong und Korea.
Aber natürlich läßt sich der Spieß auch umdrehen. Statt ausländische Investoren und Unternehmer die einheimische Bevölkerung auspressen zu lassen, kann die Bevölkerung der Entwicklungsländer selber in eigener Regie die Produkte herstellen, die sie benötigt oder auf dem Weltmarkt anzubieten gedenkt. So fand es schon MAHATMA GANDHI im Kampf gegen die britische Kolonialherrschaft absurd, für ein Grundnahrungsmittel wie Salz britische Produzenten bezahlen zu sollen, statt es selber an den wunderbaren Stränden der Koromandelküste aus dem Meer zu schöpfen; die gewaltlosen Märsche zum Strand gerieten zu einem politischen Spektakel ersten Ranges. Oder die Textilherstellung! Warum Baumwolle aus Indien nach England verfrachten und dann als fertiges Tuch teuer einkaufen, statt in Heimindustrie in Millionen Hütten Garne zu spinnen, Tücher zu weben und Kleider zu schneidern? Das Spinnrad geriet zum Zeichen der Freiheit und Unabhängigkeit des neuen Indiens21.
Doch GANDHIs Konzept war ein privatwirtschaftliches. Anders heute China. Als 1989 der Kommunismus kollabierte, ergab sich für das Zentralkomitee in Peking die Chance zu einer einfachen Umkehrung: statt den Staat gegen den westlichen Kapitalismus abzuschotten, erschien es ratsam, die zentral gelenkte Wirtschaft auf den anscheinend überlegenen Kapitalismus umzustellen. Aus dem Staatssozialismus wurde ein Staatskapitalismus. Die Ausbeutung der Arbeiter ging ungehemmt weiter, nur jetzt in eigener Regie. Resigniert stellt Bernd Link, Bielefelder Gewerkschaftssekretär von 1971 bis 2007 und langjähriger Geschäftsführer der Gewerkschaft Textil-Bekleidung (GTB, die 1998 von der IG Metall geschluckt wurde) im Rückblick fest: »Eigentlich war alles umsonst. Jahrzehntelang haben wir für humanere Arbeitsbedingungen gekämpft, für etwas weniger Stress und dafür, dass Frauen nicht so krumm vor den Nähmaschinen hocken mussten. Nun sind die Jobs (sc. der Bielefelder Textilindustrie, d. V.) weg, und die sie heute haben, arbeiten unter mieseren Bedingungen als früher unsere Leute.«22
Und wie in der Textilindustrie, so in allen Bereichen der Wirtschaft. Der Rückgang des deutschen Steinkohlenbergbaus etwa hat – neben den neuerdings geltend gemachten Klimaschutzgründen – eine Hauptursache darin, daß es immer noch billiger ist, Kokskohle aus China, verschifft über drei Weltmeere, zu beziehen, als sie in den heimischen Zechen unter den Auflagen der hohen Grubensicherheits-Standards sowie der Knappschaftsversorgung in Krankheit und Alter abzubauen. Mögen auch jährlich 3000 bis 6000 chinesische Kumpels unter Tage ihr Leben lassen, – das Wirtschaftswachstum im Reich der Mitte, das erst in der zweiten Hälfte von 2015 alarmierend genug zu schwächeln beginnt, stand über lange Zeit hin bei sagenhaften 10 %. Die Produktionsbedingungen erinnern an die Tage der Pionierzeit des Industriekapitalismus in Großbritannien. Als JOHANNA SCHOPENHAUER, die Mutter des Philosophen ARTHUR SCHOPENHAUER, 1803 England und Schottland bereiste, vermerkte sie erschrocken über die Industriestadt Manchester: »Dunkel und vom Kohlendampfe eingeräuchert, sieht sie einer ungeheuren Schmiede oder sonst einer Werkstatt ähnlich. Arbeit, Erwerb, Geldbegier scheinen hier die einzige Idee zu sein, überall hört man das Geklapper der Baumwollspinnereien und der Webstühle, auf allen Gesichtern stehen Zahlen, nichts als Zahlen.«23
Doch gerade in dieser Rücksichtslosigkeit auch gegenüber dem »Humankapital« hat der Industriekapitalismus Fuß und Tritt gefaßt, und er ist weit damit gekommen. Die im Ausland gefertigten Produkte lassen sich mit Gewinn in den Export geben. Besonders die BRD steht an erster Stelle der Exportnationen: »Kein Land auf der Welt verkauft mehr Waren ins Ausland als Deutschland, 2008 für gigantische 995 Milliarden Euro. Nicht nur Großunternehmer wie Siemens oder BMW nutzen die Chancen des globalisierten Marktes, sondern auch Hunderte hochspezialisierter Mittelständler.«24 Auch im Waffenexport rangiert die BRD ganz oben, lange auf Platz 3, erst 2015 ist sie hinter China zurückgefallen auf Platz 4; sie hält ihre Position mit Lieferungen an Saudi Arabien, das gerade den Jemen bombardiert und radikal islamische Gruppen in Syrien unterstützt, an Israel, das von seiner Landraubpolitik in Palästina nicht lassen will und sie sogar durch Anwerbung immer neuer Einwanderungsströme mächtig ausdehnt25, an die Türkei, die gegen die Kurden Krieg führt und ihnen die Idee auch nur eines autonom verwalteten irakisch-türkischen Gebietes mit Gewalt auszutreiben versucht, als ob es ein Selbstbestimmungsrecht der Völker in der UN-Charta nicht gäbe … Geschäft ist Geschäft. Pecunia non olet – Geld ist nie etwas Schmutziges. Auch das ist Kapitalismus.
Und er boomt wie nie zuvor. »Das Volumen des Welthandels verdreifachte sich binnen 20 Jahren, die Wirtschaftskraft der Welt verdoppelte sich in einem Vierteljahrhundert nahezu.«26 Computer und Container erlauben einen immer schneller sich ausdehnenden Welthandel. Allein im Jahre 2005 wurden weltweit 400 Millionen Standard Container (TEU – Twenty-Feet-Equivalent Unit, Größe 20 mal 8 mal 8,5 Fuß bei 4,1 t Leergewicht und 21,5 t maximaler Ladung) umgeschlagen, – im Hamburger Hafen 2008 rund 97 % des gesamten Stückgutaufkommens27. Nutznießer eigener Art sind dabei – wie stets – die USA. Noch im Jahre 2008, just vor der großen Bankenkrise, importierten sie für 677 Mrd Dollar mehr Waren, als sie ins Ausland verkauften28; ihr Außenhandelsdefizit nahm parasitäre Formen an: sie konsumierten schlichtweg auf Pump, vor allem durch den Massenimport chinesischer Waren. Doch diese Verwerfungen schienen hinnehmbar, indem man zum einen die eigenen Unternehmer weiter entlastete und zum anderen den einheimischen Arbeitern vergleichsweise höhere Löhne zahlte.
Ganz im Sinne der neoliberalen Wirtschaftstheorie empfahl bereits unter Ronald Reagan in den 80er Jahren der Ökonom ARTHUR LAFFER, die Unternehmensbesteuerung zu senken, auf daß paradoxerweise die Einnahmen des Staates sich dadurch erhöhten; denn er glaubte, daß ein niedrigerer Steuersatz das Wirtschaftswachstum ankurbele und am Ende dem Staat steigende Einnahmen beschere29. Das ganze war erkennbar falsch, doch es überzeugte den amerikanischen Präsidenten nicht minder als Englands »eiserne Lady« Margaret Thatcher und in gewissem Sinne auch Helmut Kohl sowie insbesondere den SPD-Kanzler Gerhard Schröder und seine CDU-Nachfolgerin Angela Merkel. Gewiß, die Wirtschaft wurde auf diese Weise angekurbelt und in der BRD die Neuverschuldung des Staates auf Null geführt (die Gesamtverschuldung selbst liegt freilich immer noch bei kaum vorstellbaren 2 Billionen Euro); doch dafür gerieten vor allem die südlichen Länder Europas in einen gefährlichen Schuldensumpf: Während die BRD exportierte und exportierte, importierten Spanien, Portugal, Griechenland und Italien weit über ihre Zahlungsfähigkeit; die Finanzkrise 2008 stürzte sie nicht nur ein eine wirtschaftliche Rezession, sondern ließ auch die Arbeitslosenquote in sozial unverträgliche Höhen steigen; – der Umgang mit Schulden und der Handel mit Krediten wird einen wichtigen Platz im ersten Teil des vorliegenden Bandes einnehmen.
Doch so niedrig in den einzelnen Ländern die Lohnstückkosten der Arbeiter auch lagen, sie fielen immer noch weit höher aus als in den ausgelagerten Fertigungsstätten im Ausland. Man glaubte sich das leisten zu können auf Grund des vermeintlichen »Wissensvorsprungs« der westlichen Industrienationen. – An sich schon mutet diese Vorstellung absurd an, daß »Wissen«, ein gemeinsames Kulturgut der Menschheit, basierend auf den universal geltenden Gesetzen der Natur, instrumentalisiert werden könnte zu einem Mittel der »Sicherung des Industriestandortes Deutschland« (oder anderer Nationalökonomien); doch auch rein faktisch erweist sich diese politische Strategie als äußerst kurzsichtig; vor allem die asiatischen Länder holen im globalen Konkurrenzkampf aller gegen alle dramatisch auf. Das RICARDOsche Theorem vom komparativen Handelsvorteil fängt an, sich aus westlicher Sicht gegen sich selbst zu kehren, indem die bisherigen Importländer die eingeführten Güter selber herzustellen lernen. Containerschiffe, Fernseher, Kühlschränke, Hochtechnologieprodukte aller Art tragen heute schon den Aufdruck made in China oder made in India oder made in Indonesia, Malaysia, Thailand oder Brasil.
Ein kleines Beispiel: »Am 31. Dezember 2002 wurde in Shanghai eine 30 Kilometer kurze Trasse eröffnet, auf der seither die deutsche Magnetschwebebahn Transrapid fährt (sc. deren Herstellung und Einsatz in der BRD übrigens als zu teuer empfunden wurde, d. V.). Das sollte endlich der kommerzielle Durchbruch des Hightech-Schlittens sein, den in Europa niemand haben wollte. Doch Anfang 2006 verkündeten die Chinesen frohgemut, sie würden nun eine eigene Magnetschwebebahn bauen … Jahrzehntelang hatten die europäischen Staaten das Airbus-Konsortium mit Milliarden gefördert, auf dass in der Alten Welt Arbeitsplätze in der zukunftssicheren Flugzeugindustrie entstünden. Dann ließen die Chinesen wissen, sie würden nur dann mehr Jets kaufen, wenn Airbus auch ein Werk bei ihnen baue und sie an der Technologie teilhaben lasse.«30 Man will nicht länger mehr Produkte beziehen, sondern die Herstellungsverfahren der Produkte kennenlernen. Nicht wenige der Computerspezialisten, Flugzeug- oder Raketenbauer, Atomwissenschaftler und Biochemiker in China und Indien wurden im Westen ausgebildet und sind in ihre Herkunftsländer erfolgreich zurückgekehrt. Den Wissensvorsprung zu kapitalisieren erweist sich zunehmend als Unding.
Was den globalisierten Handel angeht, so bedürften vor allem die Entwicklungsländer faire Zugangsbedingungen auf dem Weltmarkt, und dazu zählt unbedingt eine weltweite Angleichung der Löhne statt einer immer weiteren Ausbeutung der Lohnunterschiede. »Gleicher Lohn für gleiche Arbeit« – das allerdings wäre der zweite Punkt, an dem der Kapitalismus im Rahmen bereits des bisher Erörterten zentral zu treffen wäre, und gerade das erweist sich als unumgänglich. Noch einmal: Würden die Preise ökologisch so kalkuliert, daß die »externen« Schäden an der Umwelt mit in die Preisbildung Eingang fänden, so würden Autos beispielsweise unerschwinglich teuer: Autobahnen, die wie mit dem Lineal noch intakte Biotope zerschneiden, Asphaltpisten, die zur Todesfalle für Rehe, Hasen und Igel werden, Frontscheiben, die als 2 m2 große Fliegenklatschen durch die Landschaft rasen, ein Schadstoffausstoß, der die Luft verpestet und das Klima aufheizt, Unfallopfer von täglich mehr als 10 Toten und mindestens viermal so vielen Verletzten auf deutschen Straßen – all diese »Nebenkosten« in den Anschaffungspreis eines Autos hineingerechnet, machten des Deutschen Lieblingsluxusgegenstand: das Auto, allenfalls noch für das obere 10 % der Bevölkerung bezahlbar. Und so bei den meisten anderen Produkten: würden die Dinge wirklich kosten, was sie kosten, so stünden sie ab sofort nur noch den Höchstbegüterten zur Verfügung; um sie allen zugänglich zu machen, müssten die Unternehmergewinne sozialisiert und an die Bevölkerung weitergereicht werden.
Doch schamlos ausgebeutet wird ja nicht allein die Natur, ausgebeutet werden die Menschen ebenso, und auch in ihre »Preise«, in ihre Löhne also, müßten die sozialen Externa eingerechnet werden; erst dann kämen die Güter mit ihren Preisen allen zugute. Doch dagegen steht die Grundüberzeugung des Kapitalismus. 1986 noch konnte der amerikanische Management-Berater ALFRED RAPAPORT verkünden: »In einer Marktwirtschaft, die die Rechte des Privateigentums hochhält, besteht die einzige soziale Verantwortung des Wirtschaftens darin, Shareholder-Value zu schaffen.«31 Doch die sozialen Verwerfungen, die eine solche Denkweise nach sich zieht, sind am Ende – ähnlich wie bei den ökologischen Schäden – unbezahlbar teuer.
Bisher bestand das Prinzip kapitalistischen Wirtschaftens darin, alle Gewinne zu privatisieren und alle Schäden und Verluste zu sozialisieren. In der global vernetzten Welt von heute aber ist das nicht mehr möglich. Es gilt das Verursacherprinzip: Wer Schäden anrichtet, muß den Schaden wiedergutmachen. Sozial bedeutet das: Wer Arbeitern »betriebsbedingt« kündigt, um durch »Rationalisierungsmaßnahmen« den Produktionsablauf zu »verschlanken«, der muß für die »freigesetzten« Arbeiter durch erträgliche Lohnfortzahlungen oder entsprechende Steueraufschläge zugunsten der sozialen Einrichtungen zur Kasse gebeten werden. Statt der Theorie des Shareholder-Value sollte es gehen um ein Stakeholder-Value, in dem die Unternehmen selber als öffentliche Einrichtungen zu betrachten sind, in der Pflicht, als solche nicht nur die eigenen Zielsetzungen, sondern die Bedürfnisse und Interessen aller wahrzunehmen und zu berücksichtigen, die von den entsprechenden Entscheidungen und Maßnahmen betroffen sind, also keinesfalls nur die Renditeerwartungen der Aktionäre, sondern ebenso auch die Gesundheitsinteressen der Konsumenten, die Sicherheitsbedürfnisse und Versorgungsengpässe der Arbeiter, die soziale Unterstützung der Arbeitslosen und der Arbeitsunfähigen, sowie insgesamt die ökologischen, ökonomischen und sozialen Belange der Gesellschaft, unter deren bereitgestellten kulturellen und strukturellen Voraussetzungen überhaupt nur ein Unternehmen zu agieren vermag.
Wäre es dann, in letzter Konsequenz, nicht am besten, die alte kommunistische Forderung nach einer Vergesellschaftung der Produktionsmittel zu erneuern? Versuche auf halber Strecke dahin gab es schon im kapitalistischen Unternehmertum. Vor allem in Japan glaubten Firmenleiter, die Arbeitsleistung ihrer Angestellten dadurch erhöhen zu können, daß sie diese zu Teilhabern an den eigenen Unternehmen machten; wer an den Gewinnen der Firma selber beteiligt ist, der sollte auch ein verantwortliches Interesse an möglichen Umsatzsteigerungen an den Tag legen. Das Kalkül ging in etwa auf: die Identifikation mit den Firmeninteressen machte die Arbeiter leistungsbereiter, als es die übliche Lohndrückerei je vermocht hatte. Allerdings wurde damit das Prinzip des Wettbewerbs aller gegen alle nur noch verschärft, es wurde nicht durchbrochen oder gar aufgehoben. Um das zu erreichen, muß man freilich nicht die Produktionsmittel der Unternehmer enteignen, – die Warnungen, daß bei solchen Maßnahmen die private Kreativität und Gestaltungskraft von Unternehmern empfindlich leiden würden, sind nach allen Erfahrungen mit der zentralistischen Wirtschaftslenkung in kommunistischen Staaten nicht von der Hand zu weisen. Gesellschaftlich kontrolliert und reguliert werden müssen hingegen die ökologischen und sozialen Folgen unternehmerischen Verhaltens. Würden die »Externa« der Umwelt in die Preise und würden die »Externa« der Gesellschaft in die Löhne eingerechnet, bliebe auf der Ebene der Motivation bei Unternehmern wie Arbeitern alles beim alten, nur daß beide nicht mehr »verdienen« würden auf Kosten der Mitgeschöpfe und auf Kosten der Mitmenschen. Bereits durch diese zwei Einschränkungen begönne der Kapitalismus sich von einem Wirtschaftssystem der ungehemmten Selbstbereicherung Einzelner zu einem Dienstleistungssystem für die Allgemeinheit zu transformieren. Aus dem Raketenauto ohne Bremse würde ein lenkbarer Omnibus zur Beförderung aller. Aus einer räuberischen Wachstumswirtschaft würde eine gleichgewichtsorientierte Erhaltungswirtschaft.
Was einer solchen Transformation bis heute entscheidend im Wege steht, ist nicht eigentlich der Industriekapitalismus, von dem bisher die Rede war, sondern der Finanzkapitalismus, auf den wir jetzt zu sprechen kommen müssen. All die Zeit schon gab es keinen ökonomisch relevanten Vorgang, der nicht vom Austausch von Geld gegen Waren oder Dienstleistungen begleitet war, nur daß der Stellenwert des Geldes sich mit dem Aufstieg der Industrialisierung entscheidend gewandelt hat. In den Tagen des Feudalismus ließ ein Grundeigentümer seine Leibeigenen arbeiten, und mit den Erträgen ihrer agrarischen Produkte finanzierte er ihre Lebensgrundlage. Der Verkauf einer Ware (W) brachte das Geld (G) ein, um neue Waren (W) zu produzieren. Dieser Kreislauf von W – G – W kehrte sich bereits um, als venezianische Händler ganze Flotten ausrüsten ließen, um Waren zu tauschen. Für sie bedeuteten die Handelswaren nichts weiter als ein Mittel, Geld zu gewinnen; der Gebrauchswert der Handelsgüter selbst konnte ihnen egal sein, der Verkaufswert und die damit verbundene Gewinnspanne interessierte sie. Am Anfang stand also eine gewaltige Summe Geld, die nötig war, um die weitgreifenden Unternehmungen mit Hilfe von Kreditgebern und Aktionären vorfinanzieren zu können; dann erst ging der Warentransport und Warenumschlag vonstatten; und wenn alles gut lief, stand ein Mehr an Geld als Gewinn zu erwarten; der Kreislauf lautete jetzt G – W – G’, und er enthielt von vornherein ein hochspekulatives Element. Man bezahlte als venezianischer Händler nicht mit dem, was man in der Vergangenheit erwirtschaftet hatte, sondern mit dem, was man in der Zukunft zu gewinnen hoffte; mit dem Kredit, den man zog, griff man in der Zeit voraus, mit dem Ergebnis, auf Gedeih und Verderb erfolgreich sein zu müssen. Man war dazu verdammt, ein »Gewinner« zu sein oder unterzugehen. Der unerhörte Zwang zum Erfolg, der die Dynamik des Kapitalismus begründet, wurzelt demnach nicht allein in dem Prinzip der Konkurrenz auf dem »freien« Markt, sondern mindestens genau so, wenn nicht noch viel mehr, in der Abhängigkeit des Unternehmers von seinen Kreditgebern. Er muß zurückzahlen, was er geliehen hat, er muß es zurückzahlen mit Zins und Zinseszins, je länger es dauert, desto mehr.
In einer ähnlichen Lage wie jener handeltreibende venezianische Schiffsausrüster befindet sich gleichermaßen der industrielle Unternehmer spätestens seit dem 18. Jh. Er kann nur in das Marktgeschehen eintreten, wenn er Schulden aufnimmt, um die geliehenen Geldbeträge in seine Vorhaben investieren zu können. Allein die Entwicklung der Dampfmaschine kostete Unsummen an Geld, und bei allem Vertrauen, das Richard Arkwright in seinen Meistertüftler James Watt setzte, – es war niemals sicher, daß die gezogenen Kredite sich irgendwann rentieren würden; und selbst als sie es schließlich taten, nahm der Druck zur Verbesserung und Weiterentwicklung ständig zu.
Auch das ist ein Wesenskennzeichen des Industriekapitalismus: er ist abhängig vom Finanzkapital, und diese Abhängigkeit nötigt ihn zu ständigen Neuerungen und Erweiterungen. Innovation und Expansion begleiten ihn nicht nur, sie bilden seine Voraussetzung. »Die neuen Kapitalisten … setzten Geld ein, um Waren zu produzieren und durch deren Verkauf noch mehr Geld zu bekommen. Sie tauschten Geld gegen Ware gegen mehr Geld. Heute klingt das wie eine betriebswirtschaftliche Binsenweisheit – damals war es spektakulär neu. Zwischen 1850 und 1960 wuchs die Wirtschaft Westeuropas etwa vierzig- bis fünfzigmal schneller als im Durchschnitt der 600 Jahre zuvor.«32
Was aber wollen die Geldverleiher? Auch sie setzen Geld ein, um mehr Geld zu gewinnen, und sie setzen eben deshalb die kapitalabhängigen Unternehmer unter Erfolgszwang. Doch wenn diese scheitern? Wenn das ausgeliehene Kapital nicht zurückfließt? Wenn man auf den Schulden des Kreditnehmers sitzen bleibt? Wenn schon Geld nur noch den Zweck hat, Geld zu verdienen, warum dann überhaupt noch den risikobeladenen Umweg über die Herstellung von Waren und deren Verkauf auf dem Markt nehmen? Zum Kapitalismus gehört auch die Tendenz, daß die Finanzwirtschaft sich zunehmend von der Realwirtschaft abkoppelt. Wo wir heute stehen, zeigt sich daran, daß schätzungsweise 90 % der weltweiten Geldströme mit der Produktion und dem Absatz von Waren gar nichts mehr zu tun haben, sondern reinen Spekulationsgeschäften dienen. »In den globalen Computernetzen der Finanzmärkte wird mit Devisen spekuliert, mit Aktienoptionen, mit Finanzderivaten, mit zu ›Zertifikaten‹ gebündelten Krediten. Allein an der Handelsbörse von Chicago wird während eines Jahres mit Devisen gehandelt, deren Wert das Bruttosozialprodukt der gesamten Welt übersteigt … Das Geld arbeitet nicht mehr für die Menschen, sondern nur noch für sich selbst.«33 Es nützt niemandem mehr, und es läge längst an den Regierenden, die Realwirtschaft wieder aus den Fängen des Kasinokapitalismus herauszulösen zugunsten von mehr Gerechtigkeit, Wohlstand für alle und einem dringend notwendigen Ende der Wachstumswirtschaft. Nicht immer mehr Waren für immer mehr Menschen sind zu produzieren; zu lernen gilt es vielmehr, statt eines quantitativen, ein qualitatives Wachstum in Richtung einer Vereinbarkeit von Kultur und Natur, von Ökonomie und Ökologie, von Mensch und Welt. Was und wieviel brauchen wir wirklich, und wie viele Menschen verträgt diese Erde?
Vorrangig beschäftigen muß uns auf dem Wege dahin die Frage, was Menschen mit Geld machen – und was das Geld mit Menschen macht. Was überhaupt ist das: Geld? Und wie wird es zu Kapital? Was treiben die Banken? Wie wirkt der Zins? Welch eine Rolle spielen Finanzspekulationen? – Erst wenn wir verstehen, wie der Kapitalismus funktioniert und warum wir ihn uns nicht länger leisten können, zeichnen sich auch Lösungen ab für die zweite zentrale Frage unserer Zeit: Warum Krieg? Und wie ihn überwinden? – So viel steht von vornherein fest: Es ist nicht möglich, die aggressivste aller denkbaren Wirtschaftsformen zu unterhalten und dann bei einem ständigen Einsatz von Gewalt gegen Natur und Mensch am Ende Frieden erwarten zu wollen. Wie ist es möglich, die Staaten der Welt abzurüsten, die Militärpolitik und die Militärbündnisse aufzulösen und die Entscheidung über lokal nicht lösbar scheinende Konflikte an eine überparteiliche und nicht von Wirtschaftsinteressen geleitete Schiedsinstanz zu delegieren? – Dann bleibt übrig die wichtigste aller Fragen: Was für Menschen sind wir eigentlich? Wie ist es möglich, daß wir einer Wirtschafts»ordnung« des sacro egoismo »alternativlos« Folge leisten? Was treibt uns dazu, Gewinnsucht und Geldgier als eine unternehmerische Tugend zu betrachten und Geld und Gelderwerb in den Mittelpunkt unseres ganzen Lebens zu rücken? »Im Westen glaubt man nicht an Gott, man glaubt an Geld«, meinte vor mehr als 80 Jahren schon MAHATMA GANDHI34. Weil er in erschreckendem Maße recht hatte und weil es nötig ist, den Menschen unserer Kultur aus dem Tanz ums Goldene Kalb zu befreien, läuft die Beschäftigung mit den kapitalistischen Wirtschaftssystem unweigerlich auf die Frage hinaus: Woran zu glauben lohnt sich wirklich? Weil sich allein daran entscheidet, was wir für Menschen sind.
Geld und Kapital
A) Geld und Schuld
1) Finanzkapitalismus nach 1971 – eine Zeitbestimmung
Solange wir bei der Diskussion um faire Preise und faire Löhne bleiben konnten, mochte der Eindruck entstehen, daß die Bereicherung der Unternehmer und Kapitaleigner wesentlich auf der Ausbeutung von Natur und Mensch basiere. Der Wert einer Ware werde bestimmt durch menschliche Arbeit – dieses Theorem RICARDOs, das auch von MARX in der Theorie vom Mehrwert übernommen wurde, hatte seine (begrenzte) Berechtigung in der Frühzeit und Hochblüte des Industriekapitalismus, als der Raubbau an den »Rohstoffen« (noch) unbedenklich schien und das Auspressen immer größerer Arbeitermassen zur Produktionssteigerung identisch war mit der Vergrößerung der Gewinnspanne des Unternehmers.
Doch der Kapitalismus konnte dabei nicht stehen bleiben. Nicht nur der Umfang der Produktion läßt sich steigern, erfolgreich im Wettbewerb kann auf Dauer nur die Steigerung der Produktivität selber sein. Indes, je »intelligenter« die eingesetzten Maschinen arbeiten, desto weniger Arbeiter zu ihrer Bedienung werden gebraucht, – desto weniger Löhne also müssen für sie gezahlt werden. MARX entwickelte daraus das Gesetz von der fallenden Rate des Mehrwerts35, und er erblickte darin den entscheidenden Selbstwiderspruch des Kapitalismus, an dem dieser in bälde schon scheitern müsse. Doch die Krise erwies sich als seine eigentliche Freisetzung, – der Phönix entstieg der Asche, mit der (gar nicht so neuen) Entdeckung, daß es auf Menschen nicht länger mehr ankommt. Längst schon verhält es sich so: Ein türkisches Hilfsarbeitermädchen mag man, wenn es schön genug aussieht, vielleicht noch stundenlang an der Kasse eines Supermarktes beschäftigen, doch eigentlich könnte eine einfache Mechanik zum Ablesen der Preiscodes der Waren jede menschliche Assistenz erübrigen und damit die Kosten verbilligen.
Spätestens mit dem Siegeszug der Elektronik im letzten Drittel des 20. Jhs. verdienen die Unternehmen vorwiegend nicht mehr an der Ausbeutung, sondern an der »Freisetzung« der Arbeiter. Betriebsbedingte Kündigungen gelten als Erfolgsrezept; automatische Fertigung und Montage in riesigen menschenleeren Hallen, in denen 24 Stunden lang computergesteuerte Maschinen ihren »Dienst« tun, tragen zur Verbilligung der Produkte ebenso bei wie zur Verdrängung menschlicher Arbeit. Nur: wer soll die so erstellten Produkte erstehen, wenn der Masse der »Freigesetzten« die Löhne wegbrechen und breiten Bevölkerungsschichten damit die Kaufkraft entzogen wird? Man kann sie von der Produktion in das Dienstleistungsgewerbe umlagern, doch in dieser Branche liegen die Beschäftigungstarife zumeist niedrig, – man muß froh sein, überhaupt eine Arbeit zu finden. Und dann: das ganz große Geld wird nicht mehr in dem Kreislauf von Geld und Ware gewonnen, sondern dadurch, daß man das Geld selbst zur Ware macht. Erst dadurch eigentlich wird Geld zu »Kapital«; es ist nicht länger mehr »geronnene Arbeit«, wie MARX vermeinte36, es ist das Mittel und das Resultat der Spekulation auf phantastische Gewinne, ähnlich den Tagen der Kapitalisierung von Tulpenzwiebeln in den Niederlanden des 17. Jhs.
Auf den Tag genau läßt sich sagen, wann es begann: es war am 15. August (für Katholiken: am Tag Mariae Himmelfahrt) des Jahres 1971, daß Richard Nixon die Umtauschbarkeit des Dollar in Gold aufhob und damit, wie schon dargestellt (I 320), den Vertrag von Bretton Woods beendete. Die unmittelbare Folge dieser Maßnahme war ein enormer Anstieg der Goldpreise (bis 1980 von 35 auf 600 Dollar pro Feinunze) und ein rapider Wertverfall des Dollar. So kam es als erstes »zu einem massiven Transfer von Wohlstand von den armen Ländern, die kein Gold besaßen, in die reichen Staaten wie die Vereinigten Staaten und Großbritannien, die ihre Goldbestände behielten.«37 Dann kam der Volcker-Schock, der durch eine sagenhafte Erhöhung der Zinsen auf über 20 % zur Inflationsbekämpfung in den USA die Schulden der Entwicklungsländer schlechtweg unbezahlbar machte (I 322f.).
Jeder, der allein schon über diese Tatsache nachdenkt, kann in etwa ermessen, wieviel an Gewalt aufgewandt werden muß, um ein solches System, das mit dem Wohl von Milliarden Menschen Hazard spielt, global aufrechtzuerhalten. Nixon hatte den Wechselkurs des Dollar freigegeben, um die Fortführung des Vietnam-Krieges bezahlen zu können. »Auf seinen Befehl hin wurden allein zwischen 1970 und 1972 über 4 Millionen Tonnen Sprengstoff und Brandbomben auf Städte und Dörfer in Indochina abgeworfen … Die Schuldenkrise war eine direkte Folge der Ausgaben für die Bomben – oder besser: für die gewaltige militärische Infrastruktur, die erforderlich war, um diese Bomben ins Ziel zu bringen.«38 Was rückblickend als ein gigantisches Kriegsverbrechen in einem der letzten großen Kolonialkriege erscheint, stellt allerdings keine Ausnahme dar; die Militarisierung der Außenpolitik bildet vielmehr ein Grundprinzip US-amerikanischer Vorgehensweise, um die immer gewaltigeren Schulden auf die Schultern der Weltbevölkerung abzuwälzen. »Die Staatsschulden der Vereinigten Staaten sind seit 1970 Kriegsschulden. Das Land gibt für sein Militär (sc. mit 600 Mrd Dollar pro Jahr, d. V.) mehr aus als alle anderen Staaten der Welt zusammen, und die Rüstungsausgaben sind nicht nur das Fundament der Industriepolitik, sondern verschlingen auch einen derart großen Anteil des Staatshaushalts, dass die Vereinigten Staaten nach zahlreichen Schätzungen ohne sie ein ausgeglichenes Budget vorzuweisen hätten.«39 Die Graphik 1 zeigt den Zusammenhang von Staatsschulden und Rüstungsausgaben in den USA zwischen 1950 bis 200840.
Graphik 1: Schulden und Rüstung
Wie im Vietnam-Krieg liegt dabei der Schwerpunkt des Militärs auf der Lufthoheit. Um überall auf Erden gezielt bomben und töten (d. h. »intervenieren«) zu können, nutzen die USA rund 800 ausländische Militärstützpunkte, – in der Nixon-Ära standen allein in der BRD-West 300 000 amerikanische Soldaten Gewehr bei Fuß. Und so hängt es zusammen: nach der Freigabe der Wechselkurse hatten die nicht-amerikanischen Zentralbanken nichts Besseres zu tun, als amerikanische Staatsanleihen aufzukaufen und das am getreuesten in den Ländern, in denen das US-Militär am intensivsten vorgibt, die »Freiheit« zu verteidigen, – eben in der BRD, dann aber auch in Japan, Taiwan und Südkorea. Alle (amerikanischen) Staatsanleihen sind Kredite, also Versprechungen auf Rückzahlung, doch diese Versprechen können und werden die USA niemals einhalten. Statt dessen bestehen sie – mit Hilfe des IWF41 und der Weltbank – rigoros auf die Rückzahlung der Auslandsschulden der Entwicklungsländer. Vor allem: weil der Dollar auch nach 1971 immer noch als Leitwährung besteht und die einzige Währung ist, in der (dank des Drucks der amerikanischen Militärkolonien Saudi-Arabien und – seit dem 1. Golfkrieg von 1991 – Kuwait) Erdöl gehandelt wird, brauchen die Auslandsschulden der USA denn auch gar nicht zurückgezahlt zu werden, – sie sind »systemrelevant« für die Weltwirtschaft. Graphik 2 zeigt, in welchem Umfang die US-Staatsschulden im Besitz ausländischer und internationaler Investoren zwischen 1970 bis 2010 in Milliarden Dollar zugenommen haben.
Graphik 2: Staatsschulden der USA in Milliarden Dollar im Besitz internationaler und ausländischer Investoren. Grau hinterlegte Bereiche stehen für Rezessionen42
Während der Dollar entsprechend schwächelte, wurde es nach 1971 daher um so attraktiver, die Unterschiede zwischen den nationalen Währungen sich zu nutze zu machen und auf die steigenden und fallenden Notierungen der Währungskurse zu spekulieren; ungeheuere Geldsummen ließen sich durch blitzschnelle An- und Verkäufe zwischen den einzelnen Währungen hin- und herschieben, mit keinem anderen Ziel, als aus den winzigsten Differenzen durch die schiere Menge des eingesetzten Kapitals enorme Gewinne zu erzielen. Möglich wurde das durch den Einsatz immer schnellerer Computer, die nach vorgegebenen Algorithmen die optimalen Gewinnchancen in Bruchteilen von Sekunden abarbeiteten. Wie von selbst begann das Geld als handelbare Ware sich selber zu vermehren. Reichtum akkumulierte nicht länger durch Ausbeutung menschlicher Arbeitskraft, sondern durch den leistungslosen Einsatz der »richtigen« Software. Mit der Umwandlung von Geld in Ware erwachte der Kapitalismus zu sich selbst, und gerade das Finanzkapital erfand eine Reihe von geradezu grotesk anmutenden Methoden, aus Geld immer noch mehr Geld zu machen – einige dieser Verfahren werden wir noch kennenlernen –; doch schon jetzt läßt das Ergebnis dieser Entwicklung sich voraussehen: die Schere zwischen arm und reich wird immer größer. So erfolgreich wie an den Banken und Börsen begannen die elektronischen Rechengeräte natürlich auch an den Produktionsstätten ihre Arbeit aufzunehmen. Statt die Arbeiter, wie gefordert (I 217f.), an der Produktivitätssteigerung durch entsprechende Lohnerhöhungen teilhaben zu lassen, entwickelten sich, wieder von den Siebzigern an, die Produktivitätssteigerung und die Löhne geradezu dramatisch auseinander, wie in Graphik 3 zu sehen.
Graphik 3: Die unterschiedliche Entwicklung von Produktivität und Löhnen43
Während die Leistungsfähigkeit der computergesteuerten Maschinen im Fertigungsprozeß seit 2000 im Winkel von fast 45 Grad anstieg, stagnierten die Löhne beziehungsweise sie dümpelten mit kleineren Schwankungen auf dem Niveau der 70er Jahre vor sich hin. Die Unternehmergewinne stiegen und stiegen, nicht mehr durch die Ausbeutung menschlicher Arbeitskraft, sondern durch die wachsende Verdrängung menschlicher Arbeitskraft aus dem Produktionsprozeß.
Wohin dieser Trend geht, zeigen ein paar Zahlen aus dem Kernland des Kapitalismus, aus den USA. »Bis Ende der 1970er-Jahre stiegen die Bezüge aller Amerikaner weitgehend parallel. Seither haben sich die Einkommen des einen reichsten Prozent verdreifacht, während die Mittelschicht ein Plus von lediglich 40 Prozent verbuchte. Heute verfügen die wohlhabendsten 0,1 Prozent der Bürger über genauso viel Vermögen wie die ärmsten 90 Prozent, unter den 20 reichsten Menschen der Welt sind 15 Amerikaner. Gesamtvermögen: 650 Milliarden Dollar.«44
Es versteht sich, daß auch in der BRD, als dem am meisten USA-hörigen Land der Welt, inzwischen ganz ähnliche Verhältnisse herrschen: Nach Angaben des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung »gehören 0,1 Prozent der reichsten deutschen Haushalte 14 bis 16 Prozent des gesamten Vermögens.« »In der Rangliste des Manager Magazins wird das Vermögen der 100 wohlhabendsten Bundesbürger auf knapp 428 Milliarden Euro geschätzt.«45 Näherhin besitzen die obersten 10 % der Haushalte 51,9 % des Nettovermögens – die untere Hälfte nur über 1 %. Und man hätte diese Entwicklung kommen sehen können: »1998 hatten die reichsten zehn Prozent nur 45,1 Prozent, die unteren 50 Prozent (sc. noch, d. V.) 2,9 Prozent des Vermögens.« Der Hauptgrund für diese Entwicklung ist »die wachsende Bedeutung der Kapitaleinkünfte im Verhältnis zu den Löhnen. Trotz gestiegener Gehälter stagnierte der Anteil der Löhne am Volkseinkommen zuletzt bei 69 Prozent … Insgesamt gelten 14 Prozent der Menschen in Deutschland als arm (sc. sie beziehen weniger als 60 % des mittleren Einkommens, d. V.). Ältere und Alleinerziehende sind besonders oft von Armut betroffen. Geschätzte 335 000 Menschen in Deutschland leben ohne eigene Wohnung, 40 000 leben auf der Straße.«46 Eine Mitschuld an diesen Zuständen trägt zweifellos die Politik, indem sie Arbeitseinkommen mit 42 %, Kapitalerträge aber mit nur 25 % besteuert.
Und das gilt weltweit. Rechtzeitig zu dem »Wirtschaftstreffen« in Davos veröffentlicht die Hilfsorganisation Oxfam jährlich einen Bericht, der die soziale Ungleichheit rund um den Globus anprangert; danach besaßen 2014 85 % der reichsten Personen der Welt »ein so großes Vermögen wie die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung. 2015 hieß es: Nur 80 Superreichen gehört die Hälfte des weltweiten Vermögens! Und nun: Nur noch 62 Megareiche haben so viel Vermögen wie die ärmste Hälfte. 62 Megareiche versus 3,5 Milliarden Menschen, oben gegen unten.«47 Trotz der Banken- und der Schuldenkrisen seit 2008 ging und geht diese Entwicklung offenbar ungehemmt weiter.
Gefordert wird deshalb seit langem eine Abgabe auf große Vermögen, eine Millionärsteuer, »bei der die erste Million des Vermögens steuerfrei bleibt. Danach wird ein Steuersatz in Höhe von fünf Prozent erhoben. Für ein privates Geld- bzw. Immobilienvermögen von zwei Millionen Euro müssten demnach 50 000 Euro Steuern im Jahr bezahlt werden. Hier geht es keinesfalls um Enteignung, sondern um einen Beitrag zur Rückverteilung, mit dem enorm viel erreicht werden könnte. Im Jahr würden so rund 80 Milliarden Euro zusammenkommen.«48 Auf diese Weise ließen sich die Steuerprivilegien der Reichen abbauen, und es entstünde ein finanzieller Spielraum für eine Erhöhung des Mindestlohns und eine Abschaffung der Niedriglohnbeschäftigungen per Leiharbeit und Werkverträgen.
Desgleichen läßt sich an eine Spekulationssteuer für die Wall Street denken, wie es der Präsidentschaftskandidat der US-Demokraten Bernie Sanders Anfang 2016 im amerikanischen Vor-Wahlkampf forderte: »Wir werden hundert Milliarden Dollar aus den Steueroasen zurückholen und dafür benutzen, unsere Infrastruktur wieder aufzubauen,« versprach er49. – Zusätzlich verlangt der Luxemburger Ökonom GUY KIRSCH eine Erbschaftssteuer von 100 %, mithin eine Aufhebung der Erbschaft im herkömmlichen Sinne. »Die Erlöse sollen in einen speziellen Fonds (›Trust‹) fließen. Dieser soll dazu verwendet werden, Erbschaften auszuzahlen, und zwar für alle Erbberechtigten die gleiche Summe, unabhängig davon, ob die Eltern oder Großeltern eine Milliarde oder gar nichts hinterlassen haben. Um dem Erblasser keinen Ausweg zu lassen, soll es auch eine hohe Schenkungssteuer geben. Auch für Betriebsnachfolger gäbe es keine Ausnahmen.«50
Inzwischen rät sogar das Deutsche Institut für Wirtschaft (DIW) dazu, wohlhabende Haushalte stärker zu besteuern. Eine Vermögensabgabe der reichsten acht % der deutschen Haushalte würde allein schon 10 bis 20 Mrd Euro einbringen, – es war offensichtlich ein Fehler, daß die Vermögenssteuer in der BRD im Jahre 1996 unter Helmut Kohl von der schwarz-gelben Regierung ausgesetzt wurde. Soll es weiterhin als ein Zeichen von »Sozialneid« gelten, oder ist es nicht vielmehr eine längst überfällige Maßnahme zum Abbau der wachsenden sozialen Ungleichheit, wenn das eine reichste Prozent der deutschen Privathaushalte, die rund ein Drittel des Nettovermögens (also Grundvermögen, Finanzvermögen, Betriebsvermögen und Hausrat) in Höhe von 9000 Milliarden Euro auf sich vereinen, mit einem proportionalen Vermögens-Steuersatz von 1 % belastet würde? Betroffen wären davon 150 000 bis maximal 435 000 Steuerpflichtige, und das meiste müßten die reichsten 0,1 % zahlen. Freilich, auch so würde eine wirkliche Angleichung der Vermögen kaum erreicht werden, und durchsetzen ließe eine solche Maßnahme sich sinnvollerweise nur, wenn die zu befürchtende Steuerflucht ins Ausland verhindert würde; doch möglich wäre das – immerhin haben sich mittlerweile die Europäer und die G-20-Staaten auf Maßnahmen gegen den Kapitaltransfer ins Ausland mit einer Zügelung des Bankgeheimnisses geeinigt51. So bleibt die Politik in der Pflicht.
Klar zu erkennen jedenfalls ist die Notwendigkeit, die Vermögensungleichheit abzubauen, denn diese wächst und wächst, wohingegen die Einkommensungleichheit sich als feste Größe inzwischen etabliert hat. So gilt es immer noch als normal, daß der Chef der US-Großbank JP Morgan Chase, Jamie Dimon, 2015 Vergütungen in Höhe von 27 Mio Dollar einstrich, – das waren sogar noch 7 Mio (= 35 %) mehr als 2014; sein Grundgehalt belief sich auf 1,5 Mio Dollar; hinzu kam ein Bonus von 5 Mio in bar52. Ärger noch als das Gehaltsgefälle ist indessen das Auseinandertreten der Vermögen durch leistungsloses »Wachstum« des Kapitalbesitzes in den Händen der Reichen und Superreichen. »Das mittlere Vermögen eines deutschen Haushalts beträgt (sc. lediglich, d. V.) gut 50 000 Euro, wer dauerhaft zur Miete wohnt, kommt gar nur auf 20 000. Das reichste Tausendstel der Haushalte hat dagegen im Schnitt 35 Millionen Euro zur Verfügung – 17 500-mal so viel … So schwer der Gedanke fällt: Die logische Folge aus diesem Trend wäre die Einführung einer Vermögenssteuer«, und zwar nicht als Doppelbesteuerung ein und desselben Einkommens, sondern anstelle (nicht zusätzlich zu) der Einkommenssteuer. »Der Aufschrei wäre sicher gewaltig. Millionen Jobs, so würde es heißen, seien in Gefahr, weil Betriebe wegen der Vermögenssteuer geschlossen werden müssten. Das (sc. aber, d. V.) ist Unsinn. Ein Firmenchef mit einem Betrieb im Wert von acht Millionen und einem Privatvermögen von zwei Millionen Euro müsste 300 000 Euro Steuern zahlen. Das sollte angesichts der wegfallenden anderen Steuern möglich sein. – Wenn nicht, wären auch nach dem Vermögen gestaffelte Steuersätze denkbar, etwa von null bis vier Prozent. Schließlich geht es ja nicht darum, kleine Mittelständler zu belasten, sondern jene gut 400 000 reichsten Haushalte stärker zur Finanzierung des Allgemeinwohls und von Chancengleichheit heranzuziehen, die zusammen ein Drittel des Gesamtvermögens besitzen.«53
Doch selbst solche – dringend erforderlichen – Maßnahmen zum Abbau der sozialen Spannungen im Zeitalter des Finanzkapitalismus könnten höchstens gewisse Symptome jener Krankheit kurieren, die darin besteht, mit Geld so umzugehen, wie wenn es eine Ware wäre. Was ist Geld »eigentlich« und welch eine Dynamik ist ihm eigen, um dahin zu drängen, wo wir heute stehen? Ein Umdenken an dieser Stelle ist der Schlüssel, um die schlimmste Erscheinungsform des Kapitalismus in die Panzerschränke der Tresore einzuschließen. Geld ist nicht einfach »Gier«, – und selbst »die« Banker wollen nicht allein sich selbst bereichern; sie folgen einem paradoxen Ethos von »Verantwortung«; doch längst hat sich gezeigt: das Wachstumscredo selbst ist unverantwortlich und mit ihm auch die zunehmende Kluft von arm und reich54; sie gefährdet den Wohlstand aller, denn sie ist identisch mit ökonomischer Unsicherheit, sinkendem Lebensstandard der Allermeisten und grassierender Armut55.
2) Ursprung und Wesen des Geldes
a) Durch den Kredit, nicht durch den Tausch entstand das Geld
Was Geld ist, weiß scheinbar ein jeder, trägt er’s doch in der eigenen Tasche mit sich, greift danach mehrmals täglich und rechnet nach den Ziffern auf den Münzen oder Scheinen aus, ob er im Laden diese oder jene Ware bar bezahlen kann, sonst nimmt er die Kreditkarte, von der auf seinem Giro-Konto der entsprechende Betrag abgebucht wird. Zu unterscheiden ist also schon einmal Münzgeld, Papiergeld und Giralgeld, und all die verschiedenen Geldformen dienen als Zahlungsmittel beim Tausch von Ware gegen Geld. Die Preise der Waren drücken in Geldform ihren Wert auf dem Markt aus, und so fungiert Geld als ein Maßstab im Wertevergleich aller angebotenen Produkte; eben weil man mit Geld alles mögliche kaufen kann, hält man in seinem Portemonnaie einen gewissen Betrag für alle Fälle bereit.
Geld ist demnach ein »Gegenstand, der als Tauschmedium agiert, einen Wert bewahrt und die Einheit einer Abrechnung darstellt.«56 »Geld ist die Maßeinheit für wirtschaftlichen Wert und dient zugleich als Zahlungsmittel«57. Es ist ein »Tauschmittel«, eine Recheneinheit«, und ein »Wertaufbewahrungsmittel«58.
Diese Auffassung von Geld gilt in der Volkswirtschaftslehre als common sense, und sie hat für sich, daß sie unmittelbar einleuchtet: Eine Ware gegen andere zu tauschen ist nur bei »Bedürfniskoinzidenz« ohne Probleme möglich; – auf dem »Schwarzmarkt« von 1945 zum Beispiel konnte ein Bergmann mit einem Eimer Kohle bei einem Bauern eine Scheibe Speck erkungeln; der Tausch legte sich nahe, weil der eine fror und der andere Hunger hatte; ihre Bedürfnisse »koinzidierten«. Wie aber soll ein Klempner ein Wasserrohr oder ein Autobauer einen Kotflügel gegen Brot und Butter an den Mann bringen? Je spezieller die Produkte, desto schwieriger wird es, sie gegeneinander zu tauschen. Daraus geht wie von selbst hervor, daß die Einführung von Geld den Handel (das Eintauschen von Waren) entscheidend vereinfacht. »Gesellschaften, in denen ein reger Handel stattfand, konnten auf Dauer mit den enormen Nachteilen des Tauschhandels nicht zurechtkommen. Die Verwendung eines allgemein anerkannten Tauschmittels, wie es Geld darstellt, ermöglicht dem Bauern den Kauf einer neuen Hose vom Schneider, der seinerseits vom Schuster kauft, welcher mit dem verdienten Geld wiederum Leder vom Bauern kauft.«59