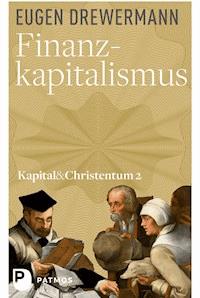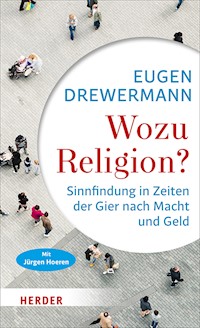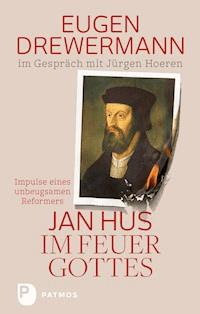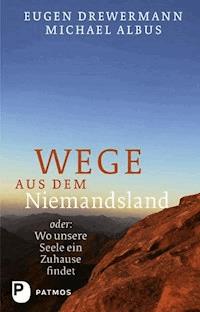Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Patmos Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Eugen Drewermann hat sich viele Jahre lang intensiv mit der Weisheit der Märchen beschäftigt, insbesondere mit den Hausmärchen der Gebrüder Grimm. Folgende Märchen interpretiert er in dieser Erstveröffentlichung: "Von einem, der auszog, das Fürchten zu lernen", "Das tapfere Schneiderlein" und "Die Eule". "Am tiefsten geht die Angst, die uns befällt, wenn wir bemerken, was es heißt, ein Mensch zu sein, – die Angst, geistig zu existieren: als Einzelner, in Freiheit, hinwandernd zwischen Zeit und Ewigkeit. [...] Im Grunde läßt sie sich nur lösen in Vertrauen, doch dazu brauchte es eines gewissermaßen religiösen Haltepunkts. Ein solcher Halt im Absoluten läßt sich nicht verordnen noch verfügen; es läßt sich freilich zeigen, was passiert, wenn er uns fehlt. Wir werden dann die Angst verdrängen oder anderen Angst machen oder die vermeintlichen Angstquellen auszuschalten suchen. In jedem Falle finden wir niemals uns selbst, gelangen wir nie wirklich zu den anderen und werden niemals Ruhe haben."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 577
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Eugen Drewermann
Wenn mir’s nur gruselte!
Von Angst und ihrer Bewältigung
Grimms Märchen tiefenpsychologisch gedeutet
- Von einem, der auszog, das Fürchten zu lernen
- Das tapfere Schneiderlein
- Die Eule
Patmos Verlag
Inhalt
Vorwort
Märchen von einem, der auszog, das Fürchten zu lernen(KHM 4) oder:Angstfreiheit durch Angstverdrängung
Der Begriff Angst
Mangelnder Geist als Angstfreiheit an der Stätte des Todes
Der Spuk im Turm
Die Unschuld des Gefühllosen
Die Nacht unter dem Galgen
Der Fuhrmann und das Wirtshaus
Drei Nächte im Schloß
Eine unglückliche Ehe und ein schlechter Scherz
Angst entsteht und vergeht im Gegenüber des Unendlichen
Das tapfere Schneiderlein (KHM 20) oder:Angstlösung durch Angstverbreitung
Das »Schneiderlein« als Typ
»Kleider machen Leute« und »Leute machen Kleider«
Die Aktualität einer narzißtischen Persönlichkeit
Narzißmus als Merkmal der Selfie-Generation
Wer ist man selber?
Narzißmus aus Angst als ärgerliche Irreführung anderer
Zwischen Minderwertigkeitsgefühl und Selbstaufblähung
Nahrungsaufnahme und kindliche Magie
Ein aggressiver Triebdurchbruch als Wandlung der Person
Die Auseinandersetzung mit dem Riesen
Die drei Proben
Es gibt keine Kameradschaft in Konkurrenz
Ein rettender Rest von Realitätssinn
Das Logo eines großen Kriegsmannes
Der Eine und die Einzige
Im Kampf der Unaufrichtigkeit
Die Preisjungfrau
Zwei Riesenansprüche neutralisieren sich
Von Mißtrauen und alter Angst
Zwei neue Aufgaben der Brautwerbung
Angst, Zwang und Trug – eine höfische Ehe
Läßt sich Narzißmus heilen?
Die Eule (KHM 174) oder: Angstverarbeitung durch Aggression
Wo eigentlich ist Schilda?
Die Eule als Tier und als Untier
Der Schrecken des Ungewöhnlichen
Angst verformt die Wahrnehmung
Realitätsverlust
Massenpanik
Der Ruf nach dem Retter
Angst macht Angst
Die finale »Lösung«: Niederbrennen
Bibliographie
Über den Autor
Über das Buch
Impressum
Hinweise des Verlags
Bildtafeln
Anmerkungen
Vorwort
Kein Gefühl ist so elementar wie das Gefühl der Angst. Um Sein oder Nichtsein geht es, wo immer es auftaucht. »Dein Leben ist in Gefahr«, signalisiert es. Diese Gefahr kann real sein – eine Feuersbrunst, ein Erdbeben, eine Überschwemmung, ein Sturm: Die ganze Welt enthält Bedrohungen, die überall und jederzeit auf ihre Beute lauern.
Doch viele Angstinhalte haben ihren Grund nicht in der Wirklichkeit; sie sind phantastischer Natur, »real« nur psychisch, in der Vorstellung. – Die meisten Menschen werden zögern, sich des Nachts auf einen Friedhof zu begeben; sie glauben nicht an Geister und Gespenster, und doch wird’s ihnen unheimlich. Warum? Oder noch eigenartiger: Was spielt sich ab, wenn jemand schon beim Summen einer Fliege oder beim Anblick einer Spinne in Panik gerät? Vielleicht spukt ihm die Warnung im Kopf, Insekten seien Krankheitsüberträger, er fürchtet sich vor Schlafkrankheit oder Malaria; jedoch lebt er in Westeuropa, nicht in Afrika. Real ist seine Angst so gut wie unbegründet; sie ist symbolischer Natur und kommt aus seinem Inneren; die Wirklichkeit – in diesem Fall – ist harmlos, nicht aber die Bedeutung, die sie, als Bild gelesen, annimmt.
Die Psychoanalytiker erklären, daß wir »die Welt« erleben, geprägt in der Vermittlung unserer Eltern; ihr Ärger, ihre Ablehnung sind für ein Kind bedrohlicher als alle äußeren Gefahren, die es noch gar nicht einzuschätzen weiß. Und diese Ängste gehen mit; es ist sehr schwer, sie sich bewußt zu machen und nach und nach sich daraus zu lösen. Rein assoziativ können sie anfallartig wiederkehren, und in unbewußten Wiederholungsschleifen stellen sie immer wieder ein Verhalten nach, wie es in Kindertagen eingeschliffen wurde.
Am tiefsten geht die Angst, die uns befällt, wenn wir bemerken, was es heißt, ein Mensch zu sein, – die Angst, geistig zu existieren: als Einzelner, in Freiheit, hinwandernd zwischen Zeit und Ewigkeit. Sie ist in eigentlichem Sinne »Angst«, wie SÖREN KIERKEGAARD sie definierte. Sie steht im Hintergrund all der Befürchtungen inmitten einer Welt, die niemals unsere Heimat wird; sie nötigt uns die Frage auf, wie wir mit ihr verfahren. Im Grunde läßt sie sich nur lösen in Vertrauen, doch dazu brauchte es eines gewissermaßen religiösen Haltepunkts. Ein solcher Halt im Absoluten läßt sich nicht verordnen noch verfügen; es läßt sich freilich zeigen, was passiert, wenn er uns fehlt. Wir werden dann die Angst verdrängen oder anderen Angst machen oder die vermeintlichen Angstquellen auszuschalten suchen. In jedem Falle finden wir niemals uns selbst, gelangen wir nie wirklich zu den anderen und werden niemals Ruhe haben.
Auch diese Wahrheit können wir verleugnen, jedoch – sie holt uns ein in den Zerstörungen, die wir uns selbst bereiten. Gefühlsfremdheit, Empfindungslosigkeit und eine Kälte, die uns selber unbegreiflich scheint, sind Zeichen solcher Angstverdrängung; Narzißmus, Ichaufblähung und der Größenwahn von Zwergriesen sind mögliche Symptome des Alleingelassenseins in Angst; vor allem eine ständige Gewaltbereitschaft im eigenen wie öffentlichen Leben kennzeichnet das Unvermögen, sich seiner Angst zu stellen und sie in ein größeres Vertrauen aufzulösen. Persönlich, zwischenmenschlich und politisch deformiert die Angst, wenn sie im Endlichen sich selbst unendlich setzt, das Beste, was wir haben: unser Verlangen nach der Wahrheit unseres Daseins, unsere Sehnsucht nach der Liebe und der Anerkennung anderer und unsere Fähigkeit, in Frieden, unbedroht, jenseits der Paranoia einer permanenten Gefahrenvigilanz, durch diese Welt zu gehen.
Märchen sind nicht in sich Psychologie, Philosophie, Theologie; sie schildern zwischen Spaß und Ernst, in sinnbildhaften Szenen, gewisse komische und tragische Facetten unseres Lebens. Aber die drei in diesem Band vereinten Erzählungen der Brüder GRIMM werfen aspekthaft Licht auf die genannten Möglichkeiten unserer Existenz im Schattendunkel unbewußter Angst. Das »Märchen von einem, der auszog, das Fürchten zu lernen« (KHM 4) beschreibt ein Dasein, das auch im Angesicht des Todes scheinbar völlig angstfrei bleibt, im richtigen Gespür jedoch, daß da im ganzen Lebensaufbau, trotz aller äußeren Erfolge, etwas Entscheidendes noch fehlt. – »Das tapfere Schneiderlein« (KHM 20) parodiert diese Chance und die Gefahr eines »kompensatorischen« Weges der Angstüberwindung: Nur als ein Held und rechter Schlagetot braucht man sich vor niemandem mehr zu fürchten, indem man einem jeden Angst vor sich selber einflößt. Auch so kann man auf der Karriereleiter sehr hoch kommen, man kommt nur niemals bei sich selber an; und man ist ständig auf der Flucht vor einer Lebenslüge, die noch im Traum sich mitteilt. – Oder man steckt aus lauter Angst buchstäblich die eigene Scheune in Brand, um daraus die »Eule« zu vertreiben, wie es die GRIMMs berichten: in der Stadt Peine soll es sich mal zugetragen haben, erzählte ihnen eine alte Überlieferung; es kann und wird sich überall ereignen, besagt ihr Märchen (KHM 174) warnend, wenn wir zu Sklaven unserer Angstwahrnehmung werden.
Wie also leben mit der Angst? Das ist die Frage, deren Antwort dreifach darüber entscheidet, was wir für Menschen sind. Psychologie und Philosophie können zu dem Punkt hinführen, da die Entscheidung fällt. Sie tasten die Wände totalisierter Angst im Kerker einer in sich geschlossenen Endlichkeit ab; die Öffnung der Türe aber, die Überwindung der Angst, ist möglich allein im Vertrauen in eine andere Sphäre der Wirklichkeit, wie nur die Religion sie verheißt.
Wie Angst sich darstellt, hat ALFRED KUBIN in der Graphik »Das Grausen« im Jahre 1903 ins Bild gesetzt1 (Abb. 1): Da steuert eine Art Drachenschiff als das Gefährt der vermeintlich furchtlosen Wikinger mit geborstenem Masten auf ein Ungeheuer zu, das wie das Fabelwesen von Loch Ness sein Haupt aus einer riesigen, alles verschlingenden Monsterwelle erhebt – auf seinem Schlangenhals einen Totenschädel mit offenem Gebiß und einem erblindeten sowie einem künstlichen gläsernen Auge, das kalt und unerbittlich kein Entrinnen erlaubt. Jenseits der Welle liegt die See in schwarzer Stille da, doch das sehen nicht die zwei sturmumpeitschten Gestalten, die sich an die viel zu niedrige Reling des Schiffes pressen, – sie haben keine Chance, nicht von Bord gespült zu werden. Der Schrecken, den sie vor sich sehen, ist eng umschrieben, lokal begrenzt, doch total für sie als Betroffene. – Eine mögliche Gegendarstellung bildet allein die neutestamentliche Geschichte vom Seewandel Petri in Mt 14,22–33: Unser Leben ist eine Fahrt in den Untergang, und der Tod wird irgendwann, jäh und frech, vor uns auftauchen. So betrachtet durchqueren wir in unserem ganzen Leben ein Meer der Angst, dazu bestimmt, verschlungen zu werden. Oder: Wir sehen inmitten des Schreckens die Gestalt dessen, der in der Überwindung des Todes vom anderen Ufer her auf uns zukommt und seine Hand zu uns Versinkenden ausstreckt mit der Anrede: »Du so wenig Vertrauender«. Nur dann verschwindet die Fratze des Todes, und es tritt »eine große Stille« ein (Mk 6,51), im Gegenüber der Gestalt, die da kommt, uns am anderen Ufer eine Wohnung zu bereiten (Joh 14,1–3). Zwischen Angst und Vertrauen verläuft unser Leben. Wir müssen uns entscheiden.
Abbildung 1: Alfred Kubin, »Das Grausen«, um 1902, © Leopold Museum, Wien © Eberhard Spangenberg, München/VG Bild-Kunst, Bonn 2017
Märchen von einem, der auszog, das Fürchten zu lernen(KHM 4) oder:Angstfreiheit durch Angstverdrängung
Ein Vater hatte zwei Söhne, davon war der älteste klug und gescheit und wußte sich in alles wohl zu schicken, der jüngste aber war dumm, konnte nichts begreifen und lernen: und wenn ihn die Leute sahen, sprachen sie: »Mit dem wird der Vater noch seine Last haben!« Wenn nun etwas zu tun war, so mußte es der älteste allzeit ausrichten: hieß ihn aber der Vater noch spät oder gar in der Nacht etwas holen und der Weg ging dabei über den Kirchhof oder sonst einen schaurigen Ort, so antwortete er wohl: »Ach nein, Vater, ich gehe nicht dahin, es gruselt mir!«, denn er fürchtete sich. Oder wenn abends beim Feuer Geschichten erzählt wurden, wobei einem die Haut schaudert, so sprachen die Zuhörer manchmal: »Ach, es gruselt mir!« Der jüngste saß in einer Ecke und hörte das mit an und konnte nicht begreifen, was es heißen sollte. »Immer sagen sie: Es gruselt mir! Es gruselt mir! Mir gruselt’s nicht. Das wird wohl eine Kunst sein, von der ich auch nichts verstehe.«
Nun geschah es, daß der Vater einmal zu ihm sprach: »Hör, du, in der Ecke dort, du wirst groß und stark, du mußt auch etwas lernen, womit du dein Brot verdienst. Siehst du, wie dein Bruder sich Mühe gibt, aber an dir ist Hopfen und Malz verloren.« – »Ei, Vater,« antwortete er, »ich will gerne was lernen; ja, wenn’s anginge, so möchte ich lernen, daß mir’s gruselte; davon verstehe ich noch gar nichts.« Der älteste lachte, als er das hörte und dachte bei sich: »Du lieber Gott, was ist mein Bruder ein Dummbart, aus dem wird sein Lebtag nichts: was ein Häkchen werden will, muß sich beizeiten krümmen.« Der Vater seufzte und antwortete ihm: »Das Gruseln, das sollst du schon lernen, aber dein Brot wirst du damit nicht verdienen.«
Bald danach kam der Küster zu Besuch ins Haus. Da klagte ihm der Vater seine Not und erzählte, wie sein jüngster Sohn in allen Dingen so schlecht beschlagen wäre, er wüßte nichts und lernte nichts. »Denkt Euch, als ich ihn fragte, womit er sein Brot verdienen wollte, hat er gar verlangt, das Gruseln zu lernen.« – »Wenn’s weiter nichts ist,« antwortete der Küster, »das kann er bei mir lernen; tut ihn nur zu mir, ich will ihn schon abhobeln.« Der Vater war es zufrieden, weil er dachte: »Der Junge wird doch ein wenig zugestutzt.« Der Küster nahm ihn also ins Haus, und er mußte die Glocken läuten. Nach ein paar Tagen weckte er ihn um Mitternacht, hieß ihn aufstehen, in den Kirchturm steigen und läuten. »Du sollst schon lernen, was Gruseln ist«, dachte er, ging heimlich voraus, und als der Junge oben war und sich umdrehte und das Glockenseil fassen wollte, so sah er auf der Treppe, dem Schalloch gegenüber, eine weiße Gestalt stehen. »Wer da?« rief er, aber die Gestalt gab keine Antwort, regte und bewegte sich nicht. »Gib Antwort,« rief der Junge, »oder mache, daß du fortkommst, du hast hier in der Nacht nichts zu schaffen!« Der Küster aber blieb unbeweglich stehen, damit der Junge glauben sollte, es wäre ein Gespenst. Der Junge rief zum zweiten Mal: »Was willst du hier? Sprich, wenn du ein ehrlicher Kerl bist, oder ich werfe dich die Treppe hinab.« Der Küster dachte: »Das wird so schlimm nicht gemeint sein«, gab keinen Laut von sich und stand, als wenn er von Stein wäre. Da rief ihn der Junge zum dritten Mal an, und als das auch vergeblich war, nahm er einen Anlauf und stieß das Gespenst die Treppe hinab, daß es zehn Stufen hinabfiel und in einer Ecke liegenblieb. Darauf läutete er die Glocke, ging heim, legte sich, ohne ein Wort zu sagen, ins Bett und schlief fort. Die Küsterfrau wartete lange Zeit auf ihren Mann, aber er wollte nicht wiederkommen. Da ward ihr endlich angst, sie weckte den Jungen und fragte: »Weißt du nicht, wo mein Mann geblieben ist? Er ist vor dir auf den Turm gestiegen.« – »Nein«, antwortete der Junge, »aber da hat einer dem Schalloch gegenüber auf der Treppe gestanden, und weil er keine Antwort geben und auch nicht weggehen wollte, so habe ich ihn für einen Spitzbuben gehalten und hinuntergestoßen. Geht nur hin, so werdet Ihr sehen, ob er’s gewesen ist, es sollte mir leid tun.« Die Frau sprang fort und fand ihren Mann, der in einer Ecke lag und jammerte und ein Bein gebrochen hatte.
Sie trug ihn herab und eilte mit lautem Geschrei zu dem Vater des Jungen. »Euer Junge«, rief sie, »hat ein großes Unglück angerichtet, meinen Mann hat er die Treppe hinabgeworfen, daß er ein Bein gebrochen hat: schafft den Taugenichts aus unserm Hause!« Der Vater erschrak, kam herbeigelaufen und schalt den Jungen aus. »Was sind das für gottlose Streiche, die muß dir der Böse eingegeben haben.« – »Vater«, antwortete er, »hört nur an, ich bin ganz unschuldig: er stand da in der Nacht, wie einer, der Böses im Sinne hat. Ich wußte nicht, wer’s war, und habe ihn dreimal ermahnt, zu reden oder wegzugehen.« – »Ach«, sprach der Vater, »mit dir erleb ich nur Unglück, geh mir aus den Augen, ich will dich nicht mehr ansehen.« – »Ja, Vater, recht gerne, wartet nur bis Tag ist, da will ich ausgehen und das Gruseln lernen, so versteh ich doch eine Kunst, die mich ernähren kann.« – »Lerne, was du willst«, sprach der Vater, »mir ist alles einerlei. Da hast du fünfzig Taler, damit geh in die weite Welt und sage keinem Menschen, wo du her bist und wer dein Vater ist, denn ich muß mich deiner schämen.« – »Ja, Vater, wie Ihr’s haben wollt, wenn Ihr nicht mehr verlangt, das kann ich leicht in Acht behalten.«
Als nun der Tag anbrach, steckte der Junge seine fünfzig Taler in die Tasche, ging hinaus auf die große Landstraße und sprach immer vor sich hin: »Wenn mir’s nur gruselte! Wenn mir’s nur gruselte!« Da kam ein Mann heran, der hörte das Gespräch, das der Junge mit sich selber führte, und als sie ein Stück weiter waren, daß man den Galgen sehen konnte, sagte der Mann zu ihm: »Siehst du, dort ist der Baum, wo siebene mit des Seilers Tochter Hochzeit gehalten haben und jetzt das Fliegen lernen: setz dich darunter und warte, bis die Nacht kommt, so wirst du schon noch das Gruseln lernen.« – »Wenn weiter nichts dazu gehört,« antwortete der Junge, »das ist leicht getan; lerne ich aber so geschwind das Gruseln, so sollst du meine fünfzig Taler haben; komm nur morgen früh wieder zu mir.« Da ging der Junge zu dem Galgen, setzte sich darunter und wartete, bis der Abend kam. Und weil ihn fror, machte er sich ein Feuer an: aber um Mitternacht ging der Wind so kalt, daß er trotz des Feuers nicht warm werden wollte. Und als der Wind die Gehenkten gegeneinander stieß, daß sie sich hin und her bewegten, so dachte er: »Du frierst unten bei dem Feuer, was mögen die da oben erst frieren und zappeln.« Und weil er mitleidig war, legte er die Leiter an, stieg hinauf, knüpfte einen nach dem andern los und holte sie alle siebene herab. Darauf schürte er das Feuer, blies es an und setzte sie ringsherum, daß sie sich wärmen sollten. Aber sie saßen da und regten sich nicht, und das Feuer ergriff ihre Kleider. Da sprach er: »Nehmt euch in acht, sonst häng ich euch wieder hinauf.« Die Toten aber hörten nicht, schwiegen und ließen ihre Lumpen fortbrennen. Da ward er bös und sprach: »Wenn ihr nicht achtgeben wollt, so kann ich euch nicht helfen, ich will nicht mit euch verbrennen«, und hing sie nach der Reihe wieder hinauf. Nun setzte er sich zu seinem Feuer und schlief ein, und am andern Morgen, da kam der Mann zu ihm, wollte die fünfzig Taler haben und sprach: »Nun, weißt du, was Gruseln ist?« – »Nein«, antwortete er, »woher sollte ich’s wissen? Die da droben haben das Maul nicht aufgetan und waren so dumm, daß sie die paar alten Lappen, die sie am Leibe haben, brennen ließen.« Da sah der Mann, daß er die fünfzig Taler heute nicht davontragen würde, ging fort und sprach: »So einer ist mir noch nicht vorgekommen.«
Der Junge ging auch seines Wegs und fing wieder an, vor sich hin zu reden: »Ach, wenn mir’s nur gruselte! Ach, wenn mir’s nur gruselte!« Das hörte ein Fuhrmann, der hinter ihm her schritt, und fragte: »Wer bist du?« – »Ich weiß nicht«, antwortete der Junge. Der Fuhrmann fragte weiter: »Wo bist du her?« – »Ich weiß nicht.« – »Wer ist dein Vater?« – »Das darf ich nicht sagen.« – »Was brummst du beständig in den Bart hinein?« – »Ei«, antwortete der Junge, »ich wollte, daß mir’s gruselte, aber niemand kann mir’s lehren.« – »Laß dein dummes Geschwätz«, sprach der Fuhrmann, »komm, geh mit mir, ich will sehen, daß ich dich unterbringe.« Der Junge ging mit dem Fuhrmann, und abends gelangten sie zu einem Wirtshaus, wo sie übernachten wollten. Da sprach er beim Eintritt in die Stube wieder ganz laut: »Wenn mir’s nur gruselte! Wenn mir’s nur gruselte!« Der Wirt, der das hörte, lachte und sprach: »Wenn dich danach lüstet, dazu sollte hier wohl Gelegenheit sein.« – »Ach, schweig stille«, sprach die Wirtsfrau, »so mancher Vorwitzige hat schon sein Leben eingebüßt, es wäre Jammer und Schade um die schönen Augen, wenn die das Tageslicht nicht wieder sehen sollten.« Der Junge aber sagte: »Wenn’s noch so schwer wäre, ich will’s einmal lernen, deshalb bin ich ja ausgezogen.« Er ließ dem Wirt auch keine Ruhe, bis dieser erzählte, nicht weit davon stände ein verwünschtes Schloß, wo einer wohl lernen könnte, was Gruseln wäre, wenn er nur drei Nächte darin wachen wollte. Der König hätte dem, der’s wagen wollte, seine Tochter zur Frau versprochen, und die wäre die schönste Jungfrau, welche die Sonne beschien; in dem Schlosse steckten auch große Schätze, von bösen Geistern bewacht, die würden dann frei und könnten einen Armen reich genug machen. Schon viele wären wohl hinein-, aber noch keiner wieder herausgekommen. Da ging der Junge am andern Morgen vor den König und sprach: »Wenn’s erlaubt wäre, so wollte ich wohl drei Nächte in dem verwünschten Schlosse wachen.« Der König sah ihn an, und weil er ihm gefiel, sprach er: »Du darfst dir noch dreierlei ausbitten, aber es müssen leblose Dinge sein, und das darfst du mit ins Schloß nehmen.« Da antwortete er: »So bitt ich um ein Feuer, eine Drehbank und eine Schnitzbank mit dem Messer.«
Der König ließ ihm das alles bei Tage in das Schloß tragen. Als es Nacht werden wollte, ging der Junge hinauf, machte sich in einer Kammer ein helles Feuer an, stellte die Schnitzbank mit dem Messer daneben und setzte sich auf die Drehbank. »Ach, wenn mir’s nur gruselte«, sprach er, »aber hier werde ich’s auch nicht lernen.« Gegen Mitternacht wollte er sich sein Feuer einmal aufschüren, wie er so hineinblies, da schrie’s plötzlich aus einer Ecke: »Au, miau! Was uns friert!« – »Ihr Narren«, rief er, »was schreit ihr? Wenn euch friert, kommt, setzt euch ans Feuer und wärmt euch.« Und wie er das gesagt hatte, kamen zwei große schwarze Katzen in einem gewaltigen Sprunge herbei, setzten sich ihm zu beiden Seiten und sahen ihn mit ihren feurigen Augen ganz wild an. Über ein Weilchen, als sie sich gewärmt hatten, sprachen sie: »Kamerad, wollen wir eins in der Karte spielen?« – »Warum nicht?« antwortete er. »Aber zeigt einmal eure Pfoten her.« Da streckten sie die Krallen aus. »Ei«, sagte er, »was habt ihr lange Nägel! Wartet, die muß ich euch erst abschneiden.« Damit packte er sie beim Kragen, hob sie auf die Schnitzbank und schraubte ihnen die Pfoten fest. »Euch habe ich auf die Finger gesehen«, sprach er, »da vergeht mir die Lust zum Kartenspiel«, schlug sie tot und warf sie hinaus ins Wasser. Als er aber die zwei zur Ruhe gebracht hatte und sich wieder zu seinem Feuer setzen wollte, da kamen aus allen Ecken und Enden schwarze Katzen und schwarze Hunde an glühenden Ketten, immer mehr und mehr, daß er sich nicht mehr bergen konnte; die schrien greulich, traten ihm auf sein Feuer, zerrten es auseinander und wollten es ausmachen. Das sah er ein Weilchen ruhig mit an, als es ihm aber zu arg ward, faßte er sein Schnitzmesser und rief: »Fort mit dir, du Gesindel«, und haute auf sie los. Ein Teil sprang weg, die andern schlug er tot und warf sie hinaus in den Teich. Als er wiedergekommen war, blies er aus den Funken sein Feuer frisch an und wärmte sich. Und als er so saß, wollten ihm die Augen nicht länger offen bleiben und er bekam Lust zu schlafen. Da blickte er um sich und sah in der Ecke ein großes Bett. »Das ist mir eben recht«, sprach er, und legte sich hinein. Als er aber die Augen zutun wollte, so fing das Bett von selbst an zu fahren und fuhr im ganzen Schloß herum. »Recht so«, sprach er, »nur besser zu.« Da rollte das Bett fort, als wären sechs Pferde vorgespannt, über Schwellen und Treppen auf und ab: auf einmal, hopp hopp! warf es um, das unterste zuoberst, daß es wie ein Berg auf ihm lag. Aber er schleuderte Decken und Kissen in die Höhe, stieg heraus und sagte: »Nun mag fahren, wer Lust hat«, legte sich an sein Feuer und schlief, bis es Tag war. Am Morgen kam der König, und als er ihn da auf der Erde liegen sah, meinte er, die Gespenster hätten ihn umgebracht und er wäre tot. Da sprach er: »Es ist doch schade um den schönen Menschen.« Das hörte der Junge, richtete sich auf und sprach: »So weit ist’s noch nicht!« Da verwunderte sich der König, freute sich aber, und fragte, wie es ihm gegangen wäre. »Recht gut«, antwortete er, »eine Nacht wäre herum, die zwei andern werden auch herumgehen.« Als er zum Wirt kam, da machte der große Augen. »Ich dachte nicht«, sprach er, »daß ich dich wieder lebendig sehen würde; hast du nun gelernt, was Gruseln ist?« – »Nein«, sagte er, »es ist alles vergeblich: wenn mir’s nur einer sagen könnte!«
Die zweite Nacht ging er abermals hinauf ins alte Schloß, setzte sich zum Feuer und fing sein altes Lied wieder an: »Wenn mir’s nur gruselte!« Wie Mitternacht herankam, ließ sich ein Lärm und Gepolter hören; erst sachte, dann immer stärker, dann war’s ein bißchen still, endlich kam mit lautem Geschrei ein halber Mensch den Schornstein herab und fiel vor ihn hin. »Heda!« rief er, »noch ein halber gehört dazu, das ist zu wenig.« Da ging der Lärm von frischem an, es tobte und heulte und fiel die andere Hälfte auch herab. »Wart«, sprach er, »ich will dir erst das Feuer ein wenig anblasen.« Wie er das getan hatte und sich wieder umsah, da waren die beiden Stücke zusammengefahren und saß da ein greulicher Mann auf seinem Platz. »So haben wir nicht gewettet«, sprach der Junge, »die Bank ist mein.« Der Mann wollte ihn wegdrängen, aber der Junge ließ sich’s nicht gefallen, schob ihn mit Gewalt weg und setzte sich wieder auf seinen Platz. Da fielen noch mehr Männer herab, einer nach dem andern, die holten neun Totenbeine und zwei Totenköpfe, setzten auf und spielten Kegel. Der Junge bekam auch Lust und fragte: »Hört ihr, kann ich mit sein?« – »Ja, wenn du Geld hast.« – »Geld genug«, antwortete er, »aber eure Kugeln sind nicht recht rund.« Da nahm er die Totenköpfe, setzte sie in die Drehbank und drehte sie rund. »So, jetzt werden sie besser schüppeln«, sprach er, »heida! nun geht’s lustig!« Er spielte mit und verlor etwas von seinem Geld, als es aber zwölf schlug, war alles vor seinen Augen verschwunden. Er legte sich nieder und schlief ruhig ein. Am andern Morgen kam der König und wollte sich erkundigen. »Wie ist dir’s diesmal gegangen?« fragte er. »Ich habe gekegelt«, antwortete er, »und ein paar Heller verloren.« – »Hat dir denn nicht gegruselt?« – »Ei was«, sprach er, »lustig hab ich mich gemacht. Wenn ich nur wüßte, was Gruseln wäre!«
In der dritten Nacht setzte er sich wieder auf seine Bank und sprach ganz verdrießlich: »Wenn es mir nur gruselte!« Als es spät ward, kamen sechs große Männer und brachten eine Totenlade hereingetragen. Da sprach er: »Haha, das ist gewiß mein Vetterchen, das erst vor ein paar Tagen gestorben ist«, winkte mit dem Finger und rief: »Komm, Vetterchen, komm!« Sie stellten den Sarg auf die Erde, er aber ging hinzu und nahm den Deckel ab: da lag ein toter Mann darin. Er fühlte ihm ans Gesicht, aber es war kalt wie Eis. »Wart«, sprach er, »ich will dich ein bißchen wärmen«, ging ans Feuer, wärmte seine Hand und legte sie ihm aufs Gesicht, aber der Tote blieb kalt. Nun nahm er ihn heraus, setzte sich ans Feuer, legte ihn auf seinen Schoß und rieb ihm die Arme, damit das Blut wieder in Bewegung kommen sollte. Als auch das nichts helfen wollte, fiel ihm ein: Wenn zwei zusammen im Bett liegen, so wärmen sie sich, brachte ihn ins Bett, deckte ihn zu und legte sich neben ihn. Über ein Weilchen ward der Tote warm und fing an, sich zu regen. Da sprach der Junge: »Siehst du, Vetterchen, hätt ich dich nicht gewärmt!« Der Tote aber hub an und rief: »Jetzt will ich dich erwürgen.« – »Was«, sagte er, »ist das mein Dank? Gleich sollst du wieder in deinen Sarg«, hub ihn auf, warf ihn hinein und machte den Deckel zu; da kamen die sechs Männer und trugen ihn wieder fort. »Es will mir nicht gruseln«, sagte er, »hier lerne ich’s mein Lebtag nicht.«
Da trat ein Mann herein, der war größer als alle anderen, und sah fürchterlich aus; er war aber alt und hatte einen langen weißen Bart. »O du Wicht«, rief er, »nun sollst du bald lernen, was Gruseln ist, denn du sollst sterben.« – »Nicht so schnell«, antwortete der Junge, »soll ich sterben, so muß ich auch dabei sein.« – »Dich will ich schon packen«, sprach der Unhold. »Sachte, sachte, mach dich nicht so breit; so stark wie du bin ich auch, und wohl noch stärker.« – »Das wollen wir sehn«, sprach der Alte, »bist du stärker als ich, so will ich dich gehn lassen; komm, wir wollen’s versuchen.« Da führte er ihn durch dunkle Gänge zu einem Schmiedefeuer, nahm eine Axt und schlug den einen Amboß mit einem Schlag in die Erde. »Das kann ich noch besser«, sprach der Junge, und ging zu dem andern Amboß; der Alte stellte sich nebenhin und wollte zusehen, und sein weißer Bart hing herab. Da faßte der Junge die Axt, spaltete den Amboß auf einen Hieb und klemmte den Bart des Alten mit hinein. »Nun hab ich dich«, sprach der Junge, »jetzt ist das Sterben an dir.« Dann faßte er eine Eisenstange und schlug auf den Alten los, bis er wimmerte und bat, er möchte aufhören, er wollte ihm große Reichtümer geben. Der Junge zog die Axt raus und ließ ihn los. Der Alte führte ihn wieder ins Schloß zurück und zeigte ihm in einem Keller drei Kasten voll Gold. »Davon«, sprach er, »ist ein Teil den Armen, der andere dem König, der dritte dein.« Indem schlug es zwölfe, und der Geist verschwand, also daß der Junge im Finstern stand. »Ich werde mir doch heraushelfen können«, sprach er, tappte herum, fand den Weg in die Kammer und schlief dort bei seinem Feuer ein. Am andern Morgen kam der König und sagte: »Nun wirst du gelernt haben, was Gruseln ist?« – »Nein«, antwortete er, »was ist’s nur? Mein toter Vetter war da, und ein bärtiger Mann ist gekommen, der hat mir da unten viel Geld gezeigt, aber was Gruseln ist, hat mir keiner gesagt.« Da sprach der König: »Du hast das Schloß erlöst und sollst meine Tochter heiraten.« – »Das ist alles recht gut«, antwortete er, »aber ich weiß noch immer nicht, was Gruseln ist.«
Da ward das Gold heraufgebracht und die Hochzeit gefeiert, aber der junge König, so lieb er seine Gemahlin hatte und so vergnügt er war, sagte doch immer: »Wenn mir nur gruselte, wenn mir nur gruselte!« Das verdroß sie endlich. Ihr Kammermädchen sprach: »Ich will Hilfe schaffen, das Gruseln soll er schon lernen.« Sie ging hinaus zum Bach, der durch den Garten floß, und ließ sich einen ganzen Eimer voll Gründlinge holen. Nachts, als der junge König schlief, mußte seine Gemahlin ihm die Decke wegziehen und den Eimer voll kalt Wasser mit den Gründlingen über ihn herschütten, daß die kleinen Fische um ihn herumzappelten. Da wachte er auf und rief: »Ach was gruselt mir, was gruselt mir, liebe Frau! Ja, nun weiß ich, was Gruseln ist.«
Der Begriff Angst
»In Grimms Märchen«, schrieb 1844 der dänische Religionsphilosoph SÖREN KIERKEGAARD, »gibt es eine Erzählung von einem jungen Burschen, der auf Abenteuer ausging, um das Gruseln zu lernen. Wir wollen jenen Abenteurer seinen Weg gehen lassen, ohne uns darum zu bekümmern, ob er auf seinem Weg das Entsetzliche traf. Dagegen will ich sagen, daß dies ein Abenteuer ist, das jeder Mensch zu bestehen hat: Sich ängstigen lernen, damit man nicht verloren ist, entweder weil man sich niemals geängstet hat, oder weil man in der Angst versunken ist; wer aber sich recht ängstigen lernte, der hat das Höchste gelernt.«2
Recht hat der »Vater der Existenzphilosophie«, wie man KIERKEGAARD gern nennt, wenn er das Thema des GRIMMschen Märchens aus der Zufälligkeit einer individuellen Laune heraushebt und als Darstellung von etwas Wesentlichem im menschlichen Dasein begreift. »Wäre der Mensch ein Tier oder ein Engel«, fährt er zur Begründung fort, »würde er sich nicht ängstigen können. Da er eine Synthese (sc. von Zeit und Ewigkeit, Sinnlichkeit und Geistigkeit, Notwendigkeit und Möglichkeit, d. V.) ist, kann er sich ängstigen, und je tiefer er sich ängstigt, umso größer ist er als Mensch, doch nicht in dem Sinne, in dem die Menschen die Angst gewöhnlich verstehen, nämlich als Angst vor etwas Äußerlichem, vor dem, was außerhalb des Menschen liegt, sondern so, daß er selbst die Angst hervorbringt.«3
Gilt dies, so ist bereits ein fester Maßstab an die Hand gegeben, um in dem GRIMMschen Märchen nachzusehen, ob jener Sohn bei dem Versuch, das Fürchten zu erlernen, an sein Ziel gelangt oder, im Glauben es erreicht zu haben, endgültig es verfehlt. Das Märchen, so betrachtet, wandelt sich von einem Schwank als bloßer Unterhaltung4 zu einem Lehrbeispiel für ein Kaleidoskop von Themen, die dazu gehören, daß wir Menschen sind; es wird damit zu einer Parabel auf unsere Existenz, ob sie, im Erlernen der Angst, gelingt oder mißlingt; es schlüpft aus der komödiantenhaften Kostümierung seines Auftritts hinein ins Maskenspiel einer Tragödie, in der allein wir unseres eigenen Daseins ansichtig zu werden vermögen. »Angst«, schrieb KIERKEGAARD, »kann man vergleichen mit Schwindligsein. Demjenigen, dessen Auge plötzlich in eine gähnende Tiefe hinunterschaut, wird schwindlig. Aber was ist der Grund dafür? Es ist ebenso sehr sein Auge wie der Abgrund; denn was, wenn er nicht hinabgestarrt hätte! So ist Angst der Schwindel der Freiheit, der entsteht, indem der Geist die Synthese setzen will und die Freiheit nun hinabschaut in ihre eigene Möglichkeit und da die Endlichkeit ergreift, um sich daran zu halten.«5 Mit anderen Worten: Angst ist der subjektive Reflex der Freiheit, die entsteht, wenn jemand seiner geistigen Bestimmung inne wird, und so versteht man, wie es möglich ist, dem Lastgewicht des Daseins: in Angst als Geist bestimmt zu sein, auf die einfachste Weise zu entkommen: indem man hineinflieht in die »Glückseligkeit der Geistlosigkeit.«6 »In der Geistlosigkeit gibt es keine Angst, dazu ist sie zu glücklich und zufrieden und zu geistlos. Aber … Gerade darin liegt ihre Verlorenheit, aber auch ihre Sicherheit, daß sie nichts geistig versteht, nichts als Aufgabe erfaßt, wenngleich sie es vermag, alles mit ihrer gematteten Lauheit zu umtasten. Wird sie nur ein einziges Mal vom Geiste berührt und beginnt einen Augenblick zu zappeln wie ein galvanisierter Frosch, so tritt ein Phänomen ein, das vollkommen dem heidnischen Fetischismus entspricht. Für die Geistlosigkeit gibt es keine Autorität, denn sie weiß ja, daß es für den Geist keine Autorität gibt, da sie aber selbst unglücklicherweise nicht Geist ist, so treibt sie trotz ihrem Wissen vollkommene Götzenanbetung. Sie betet einen Dummkopf und einen Helden mit derselben Ehrfurcht an, aber vor allem ist doch ein Scharlatan ihr eigentlicher Fetisch.«7 Man kann auch sagen: Um nicht in Angst dem Geist zu begegnen, flüchtet man sich in die angstfreie Ungeistigkeit des Geistersehens und Gespensterglaubens; aus Religion wird Götzendienst. Von daher mag es viele geben, die »sich … rühmen, niemals Angst zu haben,« erläutert KIERKEGAARD, um zu »antworten, daß man gewiß nicht Angst haben soll vor Menschen, vor Endlichkeiten, aber erst der, welcher die Angst der Möglichkeit (sc. der Freiheit des Geistes, d. V.) durchgemacht hat, erst der ist dazu gebildet, sich nicht zu ängstigen, nicht weil er den Schrecknissen des Lebens entginge, sondern weil diese immer schwach bleiben im Vergleich zu den Schrecken der Möglichkeit. Sollte dagegen der Redende meinen, daß es das Große an ihm ist, sich niemals geängstigt zu haben, dann will ich ihm mit Freuden in meine Erklärung einweihen, dies komme daher, daß er äußerst geistlos ist.«8
Freilich, auch in der Weigerung, Geist zu sein, entkommt man der Angst nicht. Denn: »Wenn nun auch in der Geistlosigkeit keine Angst da ist, weil diese ausgeschlossen ist, wie der Geist es ist, so ist die Angst doch da, nur wartet sie. Es läßt sich denken, daß ein Schuldner Glück haben kann, von seinem Gläubiger sich wegzudrücken und ihn hinzuhalten mit Geschwätz, aber es gibt einen Gläubiger, der niemals zu kurz kommt, und das ist der Geist. Vom Standpunkt des Geistes gesehen ist deshalb die Angst auch zugegen in der Geistlosigkeit, aber verborgen und vermummt. Selbst der Betrachtung graut es beim Anblick dessen; denn wenn die Gestalt der Angst, wenn man die Phantasie eine solche bilden läßt, entsetzlich anzusehen ist, so würde ihre Gestalt doch noch mehr entsetzen, wenn sie es notwendig findet, sich zu verkleiden, um nicht als das aufzutreten, was sie ist, trotzdem sie es voll und ganz ist. Wenn der Tod sich in seiner wahren Gestalt zeigt als der magere, freudlose Schnitter, dann betrachtet man ihn nicht ohne Erschrecken. Wenn er aber, um der Menschen zu spotten, die sich einbilden, seiner spotten zu können, verkleidet auftritt, wenn allein der Betrachter sieht, daß der Unbekannte, der alle fesselt durch seine Höflichkeit und alle in die wilde Ausgelassenheit der Lust hineinpeitscht, der Tod ist, dann ergreift ihn ein tiefes Entsetzen.«9
Eine Vorstellung gerade eines solchen Entsetzens hat EDGAR ALLAN POE in seiner »Arabeske« »Die Maske des Roten Todes« aus dem Jahre 1842 zu vermitteln versucht: Während der »Rote Tod« das Land verheert, hat Fürst Prospero sich mit seinen Freundinnen und Freunden in eine seiner befestigten Abteien zurückgezogen, um »ein zügellos wollüstliches Schauspiel«, ein »Maskenfest«10, dort zu begehen. Mitten in das lustige und prächtige Gelage tritt plötzlich eine verhüllte Erscheinung, die erst »ein Summen und Gemurr der Mißgehaltenheit und Überraschung – dann, endlich, gar des Schreckens, Grausens, Ekels«11 verbreitet. »Selbst für den, der auf immer verloren, dem Leben und Tod gleicherweise für Scherz gelten, gibt es Dinge, mit denen kein Scherz mehr sich treiben läßt«, und das ist hier der Fall. Denn »der Vermummte war so weit gegangen, die Urgestalt des Roten Todes anzunehmen.«12 Voller Zorn stürzt Fürst Prospero dem Verderber aller Freude mit gezücktem Dolch entgegen, und »ein Hauf der Festesgäste« packt »mit dem tollen Mute der Verzweiflung« den Vermummten; aber »dessen hohe Gestalt« stand »aufrecht und reglos … im Schatten der Uhr von Ebenholz«, und »ein unaussprechlich’ Grauen« befiel die Menge, da sie die Grabeslaken und die leichengleiche Maske, die sie so rüde ungestüm anfaßten, unbewohnt fanden von jeglicher greifbaren Gestalt. Nun ward die Gegenwart des Roten Todes erkannt. Wie in der Nacht ein Dieb war er gekommen. Und einer nach dem andern sanken die Gäste nieder, hin in blutbetauten Hallen ihres Schwelggelags, und starb ein jeglicher in seines Falls Verzweiflungshaltung … Und Finsternis und Verfall kam, und der Rote Tod hielt grenzenlose Herrschaft über allem.«13
Was in dem Maskenball des Lebens dem Tod zum Spott sich arrangiert, wird durch den Ernst des Todes selbst zu einem Hohn dem Leben gegenüber; die ihren Mummenschanz mit ihm zu treiben trachten, treffen in dem Vermummten selbst auf eine Realität, die als das Nichts, das sie in Wahrheit sind, sich ebenso maskiert wie all diejenigen, die in ihren Maskeraden dem Tod ein Schnippchen schlagen wollen. – Ein verwegenes »Spiel« zwischen Sein und Nichtsein, zwischen Realität und Imagination, zwischen Wirklichkeit und Vorstellung kommt so zustande, das der erkennende Geist in sich selbst aufführt, indem er die Angst aus sich hervortreibt. Sobald jemand inmitten der Welt seiner bewußt wird, offenbart die Wirklichkeit sich ihm als eine maskierte Unwirklichkeit: Wirklich ist der Tod, indem er alles, was ist, in sein Nichtsein zurückstößt. Gelagert über dem Abgrund des Nichts, bedeutet bewußt zu leben daher, in steter Angst zu existieren. Je entwickelter der Geist, desto entwickelter die Angst; – diese Gleichung KIERKEGAARDs ist unerbittlich. Doch wie damit leben? Alle Schriften des großen Dänen, dessen Gedanken erst 70 Jahre später, nach den Erschütterungen des Ersten Weltkriegs, die ihnen gebührende Beachtung fanden, verfolgten das Ziel, den Leser angesichts der Unerträglichkeit eines in Zeit und Endlichkeit versperrten Daseins dahin zu treiben, sich in der Ewigkeit und Unendlichkeit des Glaubens festzumachen. Angst oder Vertrauen, Verzweiflung oder Identität mit sich selbst, – das bildete für KIERKEGAARD das alles entscheidende Vorzeichen um die Klammer des menschlichen Daseins. Man braucht schon ein Märchen als Schwank, um die Posse auf sich selbst zu begreifen, die darin besteht, Geist auf ungeistige Weise haben zu wollen beziehungsweise, religiös gesprochen, den Glauben ins Unglaubliche zu setzen, indem alle Begriffe ins Auflösbare, Verwechselbare und Umkehrbare verflüssigt werden. Das »Märchen von einem, der auszog, das Fürchten zu lernen« ist alles andere als ein Kommentar auf die Philosophie von G. W. HEGEL, doch gelesen mit KIERKEGAARDs Augen läßt sich an ihr seht gut verdeutlichen, was für ein Bewußtseinszustand sich bildet, wenn, wie in jener, Innen und Außen, Endlich und Unendlich, Geist und Stoff, Leben und Tod zwar nicht »logisch vermittelt«, wohl aber psychologisch auf der Ebene der Vorstellung ineinander verschränkt und gegeneinander vertauscht werden.
Mangelnder Geist als Angstfreiheit an der Stätte des Todes
Alles beginnt in der GRIMMschen Erzählung mit einer überaus richtigen Einsicht gepaart mit einer grundverkehrten Absicht. Ganz und gar zutreffend ist die philosophische Feststellung, daß ein gerüttelt Maß an Dummheit dazugehört, wenn jemand nicht begreift, was »Gruseln« ist; unsinnig aber ist es, eine Quadratur der Dummheit sozusagen, wenn jemand diesen Zustand überwinden will, indem er »Angst« erleben möchte, nur um von anderen für »geistvoll« und intelligent gehalten zu werden; lernen freilich läßt sich gleich zu Anfang der Geschichte, daß ein verfehlter Lebensaufbau meist schon in der frühen Kindheit im Schoße der Familie beginnt. Das dafür verantwortliche Motiv ist menschheitlich so alt wie die biblische Geschichte von Kain und Abel (Gen 4,1–12): Da ist ein Brüderpaar, bei dem der ältere als »klug und gescheit« gilt, weil er »sich in alles wohl zu schicken« weiß, während der jüngere als »dumm« betrachtet wird, weil er »nichts begreifen und lernen« kann, so daß alle bereits kommen sehen, welch eine »Last« er noch für seinen Vater werden wird. Bemerkenswert ist der Umstand, daß einzig und allein die Beziehung der beiden Jungen zu ihrem »Vater« erwähnt wird: »Ein Vater hatte zwei Söhne«, – das sind die ersten Worte der Erzählung; paternalistischer oder auch patriarchalischer geht es nicht. Die Mutter scheint bereits verstorben, jedenfalls spielt sie in der Erziehung ihrer Kinder keine Rolle. Liegt es daran, daß der jüngere sich zentral nach den Vorgaben seines älteren Bruders mißt? Es genügt, daß der Vater – typisch leistungsbetont, wie man es Männern nachzusagen pflegt – immer wieder seine Söhne nach dem Maßstab der Intelligenz miteinander vergleicht, und es wird ganz von allein ein Gefälle von Überlegenheit und Unterlegenheit sich bilden, in dem der eine bevorzugt gegenüber dem anderen dasteht. Die Differenzen mögen an sich, je nachdem, geringfügig ausfallen, tatsächlich sind sie nach der Wertung ihres Vaters ausschlaggebend für das Grundgefühl von Wert und Unwert, Anerkennung oder Ablehnung, Genügen oder Ungenügen. »Mein Vater mißachtet mich, weil ich für ihn nicht klug genug bin«, muß der jüngere denken, und er hat recht: Sein Vater denkt wirklich so, auch die Leute denken so, es ist die Meinung aller, die ihm seine Minderwertigkeit bestätigt. Und diese Ansicht der entscheidenden Kontaktperson im Verein mit dem Urteil der gesamten Umgebung gräbt sich bald schon als ein nicht nur gültiges, sondern in gewissem Sinne bereits endgültiges Selbstbildnis in das Bewußtsein ein. »Ich bin halt ein Trottel, es geschieht mir schon recht, wenn die anderen auf mich herabsehen, ich tauge zu nichts.« Dieses Urteil über sich selbst verinnerlicht und verfestigt sich, so daß es schwer fällt, sich vorzustellen, es könnte sich daran noch etwas ändern oder es könnte sogar insgesamt falsch sein. Es sind die ganz alltäglichen Aufgabenverteilungen, die unter der Regie des Vaters zu diesem Eindruck beitragen. Wann immer »etwas zu tun« ist, muß »es der älteste allzeit verrichten.« Und Mal für Mal liegt für den jüngeren die Botschaft darin, daß, egal worum es sich handelt, auf ihn nicht zu zählen ist. Er ist unbrauchbar, er ist ein Nichtsnutz, ein Eckensteher, – ein Dummerjan halt.
Ist dies das Bild von sich selbst, scheitert jede noch denkbare Eigeninitiative an diesem Verdikt: Es hat doch keinen Zweck, es kommt wieder mal nichts dabei raus, laß es sein … Die Verneinung jedweder Befähigung führt zu einer negativen Erwartung bei jeglichem Tun mit dem Ergebnis einer tiefen Resignation. Am besten ist es unter solchen Umständen, gar nichts mehr zu machen und besser die anderen, die Besserkönner, für sich arbeiten zu lassen. Nach außen mag eine solche Haltung als Faulheit in Erscheinung treten, doch geht sie einher mit dem verborgenen Wunsch, einmal auch so sein zu können wie der beneidete Bruder. Nur wie?
Da ist ein Punkt, an dem sich zeigt, wie auch und gerade die vermeintliche Klugheit der Vernünftigkeit des älteren an ihre Grenzen stößt; sie scheitert an der rätselhaften Unvernunft der Wirklichkeit. Alles Planbare findet sein Ende an der Endlichkeit des Daseins selbst, – nur bis zur Friedhofsmauer reicht all unser Berechnen und Überlegen; dahinter beginnt das Unheimliche, dahinter lauert das gegenständlich nicht Faßbare, das Ängstigende einer rein geistigen Welt.
Wollte man ein Experiment über die seelische Verfaßtheit des heutigen Normalbürgers diesbezüglich durchführen, müßte man nur etwa hundert Passanten einer Einkaufspassage, repräsentativ ausgewählt nach Alter, Geschlecht und Bildungsgrad, auffordern, sich einzeln um Mitternacht auf den örtlichen Friedhof zu begeben und hernach von ihren Gefühlen zu berichten; viele würden wohl mit irgendeiner Ausrede (sie müssen arbeitsbedingt früh schlafen gehen, sie leiden an Nachtblindheit, sie können ihre Kinder nicht allein lassen oder ähnlich) ein solches Ansinnen ablehnen, andere würden verlegen lächelnd, doch ehrlich sagen, daß sie zu viel Angst davor hätten, und selbst unter denen, die, schon um »Spaß« zu haben, sich auf das Abenteuer einließen, würden nicht wenige sich befinden, die hernach von einem Gänsehautgefühl der Beklommenheit zu erzählen wüßten.
In unserer Kultur, wohlgemerkt, glaubt man im Allgemeinen nicht mehr an Geister oder Gespenster, und doch ist die Angst vor den Toten im Unbewußten immer noch tief verankert; sie war in der Steinzeit so groß, daß man Kopf und Rumpf der Verstorbenen getrennt beisetzte oder ihnen die Beine zerschlug, um sie daran zu hindern, die Dörfer der Lebenden heimzusuchen. Daß zu bestimmten Zeiten, nach sechs Wochen etwa oder am 1. November, ihre Seelen zurückkehrten, um an ihren Grabstätten zu weilen, stand ohnehin fest.14 Die Beharrlichkeit solcher religionsgeschichtlicher Ideen erklärt sich daraus, daß der Tod selber ein unauflösbares Rätsel vor allem im Raum der sinnlichen Wahrnehmung darstellt: Da war jemand eben noch lebendig – er hörte zu, er verstand, er antwortete, er bewegte seine Lippen, seine Hand, er äußerte einen Wunsch, er gehörte, wenn auch noch so abschiedlich, der uns bekannten Welt an, er blieb uns vertraut; doch dann, von einem Moment zum anderen, mit dem letzten Atemzug, ist er dahingegangen, man weiß nicht, wohin; nur sein entseelter Körper liegt noch da, und kein Lebenszeichen mehr ist ihm zu entlocken; unaufhaltsam und unbarmherzig wird er zerfallen. Viele Kulturen wehrten sich entsetzt gegen diesen Prozess des biochemischen Abbaus mit Hilfe aufwendiger Mumifizierungstechniken, – zumindest den Anschein des Äußeren suchten sie zu erhalten und verewigten es in Statuen aus Stein oder Edelmetall.15 Doch so fürsorglich solche Bestattungsriten auch ausfielen, sie milderten nur um ein weniges die bebende Angst vor der Unheimlichkeit des Todes. Unverändert beschäftigt sie das Denken, ohne daß doch mit den Mitteln des Denkens eine Antwort auf die Frage des Sterbens gefunden werden könnte; im Angesicht des Todes tritt der Geist selber aus der sinnlich erfahrbaren Wirklichkeit des Endlichen heraus und ist geneigt, sich selbst in den Bereich des nicht mehr sinnlich Erfahrbaren mitzunehmen, als befände er sich immer noch in der Sphäre des Endlichen, enthoben nur ihrer bisherigen Begrenzungen. Alles erscheint jetzt als denkbar und möglich, und je stärker die Fähigkeit zu Imagination und Phantasie, desto beunruhigender wird diese Entgrenzung des Endlichen beziehungsweise dieser Einbruch einer verunendlichten Endlichkeit anmuten. Was ist da Wunsch, was Wahrnehmung, was Wahrheit, was Wahn? Die Maßstäbe, es zu beurteilen, fallen dahin. Die Ungewißheit ebenso wie das Unwissen ist beunruhigend, furchterregend und unheimlich.
In dieser Lage ist es ein Zeichen von Geist, die Erschütterung des Todes mit angemessener Angst zu erleben und die Stätte der Toten im Dunkel der Nacht tunlichst zu meiden. Die Angst vor dem Dunklen an sich ist sogar schon wieder ein eigenes Thema16, das sich freilich wie von selbst mit dem Tode verbindet: Die Umnachtung der Augen des Körpers wie der Seele kann in symbolischem Austausch beides bezeichnen, und von alters her wird, wie zum Trost, der Schlaf als ein Bruder des Todes betrachtet. Sterbend die Augen zu schließen läßt sich demnach verstehen als ein Einschlaf zu ewiger Ruhe. Darüber ist nicht zu vergessen, daß Jahrhunderttausendelang der Anbruch der Nacht in der offenen Landschaft Gefahren aller Art mit sich brachte, – Menschen sind keine Nachtjäger wie zahlreiche Feliden oder Caniden. Das Dunkel macht hilflos, und die Angst als Warnsignal möglicher Bedrohung schärft zugleich die Sinne, lenkt die Aufmerksamkeit und erregt die Vorstellungskraft. Wer es kann, sollte solche Szenarien meiden. Der ältere Bruder jedenfalls verhält sich vernünftigerweise so.
Eben dieses Gebaren aber gerät dem jüngeren zu einem quälenden Rätsel: Was ist es mit der Dunkel- und Friedhofsangst des älteren? Sie gilt als geistvoll, und daß er selbst eine vergleichbare Angst nicht verspürt, liegt demnach an seiner Geistlosigkeit, – wir wissen inzwischen, wie viel an Berechtigung diese Bemerkung philosophisch tatsächlich besitzt. Aber auch psychologisch scheint dem jungen Mann etwas Wichtiges zu ermangeln. Wer keinerlei Angst kennt, die ihn vor drohenden Gefahren zu warnen vermöchte, lebt subjektiv womöglich leichter, doch objektiv sicher gefährlicher. Daß es zu einem solchen Angstverlust kommt, kann zweierlei Gründe haben. Zum einen: Es ist möglich, Angstsituationen in der Erinnerung wie in der Wahrnehmung zu verdrängen; wenn das Ich sich zu schwach fühlt, um einer bestimmten Gefahrenlage standzuhalten, mag es entlastend wirken, einfach wegzuschauen. »Augen zu und durch«, heißt dann die Parole. Aus lauter Angst hat man dann keine Angst mehr, oder anders gesagt: das Alarmsignal der Angst wird als so unerträglich schrill empfunden, daß man die gesamte Warnanlage abschaltet. Man sieht nichts mehr, man hört nichts mehr, man denkt nichts mehr, was irgendwie Gefahr signalisieren könnte; man geht wie beruhigt durch den Tag und wundert sich nur über die ständige Unruhe und Besorgnis der anderen. Beneidenswert freilich ist dieser Zustand nicht, basiert er doch auf ausgedehnten Denkeinschränkungen, Wahrnehmungsstörungen und Wirklichkeitsverleugnungen. Er repräsentiert in der Tat einen Geisteszustand weit unterhalb seiner Möglichkeiten – eine eingefrorene Angst vor der Angst.
Es kann – zum anderen – aber auch sein, daß die gesamte Gefühlswelt unterkühlt ist. Um Angst zu empfinden, brauchte man ein Ich, das sich bedroht fühlen könnte; um Gefühle zu haben, müßte man selber in der entscheidenden Phase der psychischen Entwicklung Gefühle kennengelernt haben. Psychoanalytisch gelten die ersten Lebensmonate als die Zeit, in welcher – noch in der »Dualunion« von Mutter und Kind und dann in den ersten Prozessen der Ablösung – das Gefühl für sich selbst, für die Umgebung, für die Bewertung zentraler Erfahrungen wie Nahrungsaufnahme, Geborgenheit, Wärme und Zuwendung nachhaltig »geprägt« wird. Man nennt diesen Zeitraum der frühkindlichen Entwicklung bezeichnenderweise die »schizoide« Phase17, denn wofern gerade dieser erste Lebensabschnitt von emotionaler Kälte gekennzeichnet war, wird der gesamte Charakteraufbau der Persönlichkeit später »schizoid« geartet sein. Schizoid, von griechisch »schízein« – spalten – meint vor allem, daß im Erleben eines solchen Charaktertyps die Inhalte vom Empfinden völlig getrennt sind. Ein Schizoider registriert wohl intellektuell, was bestimmte Begebenheiten bedeuten, doch sie erreichen nicht sein Gefühl; er bleibt »cool«, er hat scheinbar »Nerven wie Drahtseile«, ihm macht »alles nichts aus«, er steht mit nichts und niemandem wirklich in Verbindung; was aus anderen Menschen wird, was aus ihm selber wird, ist ihm auf merkwürdige Weise »egal«; es geht ihn nicht an, es »betrifft« ihn nicht. Eine solche schizoide Mentalität ist nicht ohne weiteres unintelligent, ganz im Gegenteil: Rein rational kann sie, zum Beispiel in Mathematik oder Physik, Hervorragendes leisten; ja, es scheint, als wolle unser derzeitiges Ausbildungssystem gerade einen solchen Schülertyp nachdrücklich fördern: nicht Gefühle, sondern Kenntnisse, nicht Empathie, sondern Effizienz, nicht Kreativität, sondern Kalkulierbarkeit sind da erwünscht; geschult werden die MINT-Fächer (Mathematik, Informatik und Technik), um im globalen Leistungsvergleich volkswirtschaftlich »fit« zu sein, wohingegen Unterrichtsfächer wie Altgriechisch etwa oder die Beschäftigung mit antiker Geschichte oder die Aneignung des riesigen Angebotes der Weltliteratur als überflüssige Zeitvergeudung aus den Lehrplänen gestrichen wird. Nicht was es mit Menschen macht, ist die Frage dieser Pädagogik, sondern wie man Menschen züchtet, die alles machen können, was von ihnen erwartet und gefordert wird, ist die Frage. Nicht nur durch frühkindliche Einflüsse können Gefühle unterentwickelt bleiben, sie können, wie später bei militärischem Drill, auch einfach wegerzogen und wegtrainiert werden. Das Ergebnis ist »Tumbheit« in wörtlichem Sinne: eine Stumpfheit und ein Verstümmeltsein im gesamten emotionalen Bereich. Was man in solchen Persönlichkeiten vor sich hat, ist niemals eine Glocke, die klingt und schwingt in eigener Resonanz, allenfalls ein Spiegel, der einen jeden Eindruck ungerührt und unberührt an seiner Oberfläche zurückwirft. In der Politik rühmt man manchmal eine solche Teflon-Mentalität, in der Forschung wünscht man sich Leute, die etwa über neue Waffensysteme nachgrübeln können, ohne auch nur einen Gedanken an die möglichen Folgen ihrer »Erfindungen« zu verschwenden, in den Kanzeln von Kampfflugzeugen sitzen nur vollausgebildete Piloten, die Napalmbomben über bewohnte Gebiete so seelenruhig abzuwerfen vermögen, wie wenn sie den Schalter am Trafo ihres Spielzeughubschraubers bewegten.
Doch die Situation des jüngeren Bruders im Märchen ist nicht die einer emotionslosen, schizoiden, handlungsorientierten Intelligenz. Selbst eine solche könnte wenigstens noch Angst empfinden im Leistungsbereich: Sie verfügt über geistige Interessen, und sie kann sich sorgen um deren Gelingen oder Mißlingen. Zu der dumpfen Unfähigkeit des jüngeren Bruders, zu begreifen, was Angst ist, gehört eine Ungeistigkeit, die selbst die Annahme einer reduzierten Rationalität ausschließt. »Hör du, in der Ecke dort«, spricht der Vater zu ihm, »du wirst groß und stark, du mußt auch etwas lernen, womit du dein Brot verdienst. Siehst du, wie dein Bruder sich Mühe gibt, aber an dir ist Hopfen und Malz verloren.« Solche Worte machen nur Sinn bei einem Jungen, der als verachteter »Eckensteher« und »Drückeberger« sich uninteressiert auch daran gibt, irgendetwas von sich her sich geistig anzueignen. Er ist ausgesprochen träge und faul, und in seiner Lage darf diese Haltung als Kehrseite seiner emotionalen Ausfälle gelten: Wofür auch sollte sich jemand wohl interessieren, wenn ihm die ganze Welt als abgeblaßt und farblos erscheint und so gut wie keinerlei Aufforderungscharakter für ihn besitzt? Er kann nur wie gelangweilt herumsitzen, außerstande, sich für irgendetwas zu engagieren oder sich mit irgendetwas so zu beschäftigen, daß es einer erfolgreichen Arbeit ähnlich sähe. Das einzige, was er »lernen« möchte, besteht darin, sich zu gruseln, denn das gilt ihm für »eine Kunst …, von der ich auch nichts verstehe.« Beobachtete er diese »Kunst« nicht bei seinem beneideten Bruder, so käme er kaum auf eine solche Idee; nicht von innen her, weil er sich eines Mangels bewußt wäre, sondern nur im Vergleich mit seinem Bruder begehrt er, »das Fürchten zu lernen«, wie schon der Titel des Märchens verheißt.
Deutlich tritt dabei die außerordentliche Realitätsferne dieses Mannes zutage. Was sein Vater sich bei dem Wort »lernen« vorstellt, ist die Einarbeitung in einen Beruf, mit dem sich ein eigener Lebensunterhalt verdienen ließe; er aber, der so Angeredete, denkt nicht verantwortlich-praktisch, er denkt als erstes und einziges an sich selbst und bestätigt damit die frustrierte Einstellung seines Vaters: Wenn er nur erst sich richtig zu fürchten vermöchte, so hätte er doch irgendwie zu seinem größeren Bruder aufgeschlossen, so verdiente auch er die Achtung eines geistvollen Menschen, dann wäre er nicht länger nur der tragikomische Dorfdepp und Hauslümmel. Zu Recht spricht lachend der ältere, als er das hört, zu sich selbst: »Du lieber Gott, was ist mein Bruder ein Dummbart, aus dem wird sein Lebtag nichts«, und der Vater bemerkt, doppelbödig genug, er werde das »Gruseln … schon lernen, aber dein Brot wirst du damit nicht verdienen.«
Angst, wie gesagt, entstammt dem Geist; der jüngere aber nimmt die Angst für den Geist selbst, er verwechselt Ursache und Wirkung, er will die Wirkung des Geistes ohne Vergeistigung, er macht das Innere zum Äußeren und umgekehrt; alles, was er so betreibt, wird ganz sicher eine »brotlose Kunst« bleiben. Und der Beweis zeigt sich sogleich: Es gibt nicht die geringste eigene Aktivität, mit welcher der junge Mann seinem Ziel näherzukommen versuchte. Er müßte nur mal eines Nachts tun, was sein Bruder zu tun vermeidet: auf den Friedhof gehen und sehen, wie es sich anfühlt. Doch eben davon ist keine Rede. Dieser Mann geht nicht zu dem Ort, an dem Geister spuken könnten, die »Geister« müssen als Spuk schon zu ihm kommen, wenn er je so etwas wie Angst verspüren will. Gerade das aber wird jetzt zum Kalkül des Vaters: Vielleicht, lernt der Sohn erst das Gruseln, wird er doch noch – mit verbessertem Selbstwertgefühl – an irgendetwas Gefallen finden. Doch es kommt, trotz aller väterlichen Fürsorge, anders.
Der Spuk im Turm
Es geschieht »bald danach«, daß »der Küster zum Besuch ins Haus« kommt und »ihm der Vater seine Not« klagt: »sein jüngster Sohn« weiß nichts und lernt nichts, und statt sich so sorgen, wie er »sein Brot verdienen« könnte, verlangt er danach, »das Gruseln zu lernen«. Doch sonderbar: Der Küster verspricht Hilfe, ja, es dünkt ihn ein leichtes, den Jungen das Gruseln zu lehren; wenn er nur erst bei ihm in Dienst stehe, werde er »ihn schon abhobeln«. Und gleich stimmt der Vater zu, – er wäre ganz »zufrieden«, würde sein Sohn »ein wenig zugestutzt«. Beiden ist daran gelegen, dem Jungen, wie man zu sagen pflegt, Beine zu machen; wenn sie ihm, wie gewünscht, einen ordentlichen Schrecken einjagen, wird er sich vielleicht doch besinnen und die Starthilfe nutzen, um endlich aus seiner Lethargie zu erwachen. Das Erleben der Angst soll ihn seinem Phlegma entreißen, doch deckt diese Absicht sich kaum mit den Vorstellungen des Jungen. Der möchte nicht etwas Brauchbares lernen, sondern er möchte sich selbst kennenlernen als jemanden, der, wenn er sich zu ängstigen vermöchte wie sein älterer Bruder, denn doch nicht für gänzlich dumm gelten darf; nicht seine Tüchtigkeit möchte er verbessern, sondern seine Selbstachtung vor den Augen der anderen. Was er will, ließe sich nur mit geistigen Mitteln ermöglichen; was jene sich vorstellen, kann nur auf ein Arrangement im Ungeistigen hinauslaufen. Man ahnt schon hier: Die Sache wird nicht gut ausgehen.
Dabei läßt sich alles ganz rechtschaffen an. Der Küster nimmt den Jungen bei sich auf, läßt ihn bei sich wohnen und nimmt ihn zum Glockenläuten in Dienst. Vermutlich bekommt der Junge dafür keinen Lohn, wohl aber erhält er Wohnung und Beköstigung frei; für seinen Vater bedeutet das eine kleine Entlastung und für den Küster eine erfreuliche Erleichterung: Er ist wohl schon fortgeschrittenen Alters, so daß ihm das Emporklettern der Treppen hinauf in den Turm zunehmend schwerfällt und er auch das Ziehen am Glockenstrang nur mit Mühe noch bewerkstelligen kann. Doch darum geht es nicht. Der Junge soll nicht in die Dienste und Verrichtungen eines Küsters eingeführt werden, um irgendwann durch eigene Arbeit anderen hilfreich zu sein und sich auf eigene Beine zu stellen, er soll sich lediglich an den Küsterhaushalt und insbesondere an den Glockenturm gewöhnen, auf daß ein plötzlich eintretendes ungewohntes Ereignis ihn desto unvorbereiteter, schreckhafter trifft. Er soll lernen, was er sich so sehnlichst wünscht: das Gruseln.
So währt es denn auch nur »ein paar Tage«, daß der Küster seinen Horror-Coup auszuhecken gesonnen ist. Mitternacht ist’s, um die Geisterstunde, als er dem Jungen gebietet, »in den Kirchturm (zu) steigen« und die Glocke zu läuten. Normal wäre es, wenn der Junge fragen würde, was den Küster anficht, grundlos die Leute des Dorfes mit dem Bimbam vom Turm aus dem Schlafe zu reißen, als gelte es, vor einer Feuersbrunst oder vor dem Aufmarsch einer feindlichen Soldateska zu warnen; doch der junge Mann stellt, wohl aus geistiger Trägheit, nicht solche Fragen. Wenn’s ihm geheißen wird, tut er’s, – warum und wozu wird der Küster schon wissen. Dieser freilich weiß nur allzu gut, was er im Schilde führt, nur sein neuer Angestellter darf es natürlich nicht wissen. Unbemerkt nämlich ist er selber vor diesem in den Turm gestiegen, um ihn als Nachtgespenst in jähen Schrecken zu versetzen. Die Frage ist nur: Wie sieht’s aus und woran erkennt man ein Nachtgespenst?
Die konventionelle Antwort ist eindeutig: Um Mitternacht, in der Stunde, da das tiefste Dunkel sich wendet zum Licht, ist es möglich, daß die Gräber sich auftun und die Toten umhergehen, wie damals, als Jesus am Kreuze verstarb und die Erde bebte »und viele Leiber der entschlafenen Heiligen aufstanden und … in die heilige Stadt kamen«, wie das Matthäus-Evangelium erzählt (Mt 27,52–53). Die weißen Grabtücher, in die man sie zur Beisetzung wie in Bettlaken zur ewigen Ruhe gehüllt hat, tragen sie mit sich; ihre Bewegungen sind bekanntermaßen wie schwebend, wenn sie nicht überhaupt stillstehen; besonders unheimlich wirkt auch ihr Verstummen, – würden sie Laute von sich geben, so wären sie wohl zu vernehmen wie der langgedehnte Seufzer beim Vorgang des Sterbens. All das gilt im Volksglauben als charakteristisch für eine Gespenstererscheinung, und exakt an dieses Vorstellungsschema hält sich auch der Küster. Er hat guten Grund, darauf zu vertrauen, daß, wer irgend an Geistererscheinungen glaubt, tief beeindruckt sein wird, wenn er eines solchen Aufzugs ansichtig wird; doch womit er nicht rechnet, ist der »Realitätssinn« des Jungen, der freilich nicht auf einer tieferen Einsicht in das Wesen einer geistigen Existenz, sondern auf seiner vorstellungsarmen Oberflächlichkeit beruht. Und so entbehrt die folgende Szene nicht einer unfreiwilligen Komik.
Der Küster möchte seinem Bekannten helfen, indem er sich als Gespenst verkleidet, um dessen Sohn in Schrecken zu versetzen; er spielt ein Gespenst, um den jungen Mann mit dem Glauben an die reale Begegnung mit dem Geist eines Verstorbenen das Gruseln zu lehren, damit dieser sich für eine geistvolle Person erachten kann. Etwas Irreales, das sich als real gibt, trifft mithin auf einen Realismus, der sich etwas Irreales kaum vorzustellen vermag und der fassungslos davor steht, daß es möglich ist, über die Brüchigkeit eben dieser Realität zutiefst zu erschrecken. Der Kontrast könnte grotesker kaum sein: Der junge Mann redet das »Gespenst«, das im Kirchturm gegenüber dem Schallloch in weißem Umhang vor ihm steht, ganz so an, als handelte es sich um einen gewöhnlichen Menschen, der sich anscheinend rein zufällig um Mitternacht im Kirchturm verlaufen hat. So selbstverständlich er den Auftrag zum Glockenläuten um diese ungewöhnliche Uhrzeit hinnimmt, so normal kommt es ihm offenbar vor, daß jemand zu dieser Stunde sich oben im Glockenturm aufhält, und so fragt er ihn, wie ein Wachsoldat auf Posten: »Wer da?«