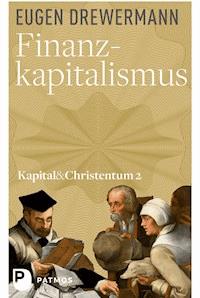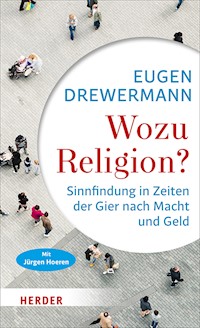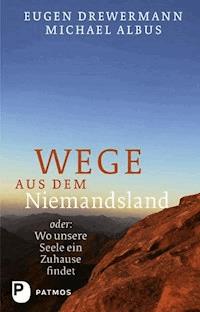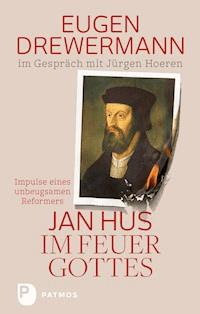
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Patmos Verlag
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Jan Hus kritisiert das Machtstreben und die Habgier der Kirche seiner Zeit; er stellt Christus über das Papsttum. Beim Konzil von Konstanz wird seine Lehre verurteilt, 1415 wird er als Ketzer verbrannt. Im Gespräch zwischen Jürgen Hoeren und Eugen Drewermann zeigt sich, wie überraschend aktuell der Wegbereiter Martin Luthers denkt. Er fordert eine Kirche auf Seiten der Armen, setzt auf Vernunft gegen den Aberglauben, gegenüber bloßem Gehorsam betont er den Wert der Gewissensentscheidung. So wird Geschichte bedeutsam für heute.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 369
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
NAVIGATION
Buch lesen
Cover
Haupttitel
Inhalt
Über die Autoren
Über das Buch
Impressum
Hinweise des Verlags
Eugen Drewermann im Gespräch mit Jürgen Hoeren
Jan Hus im Feuer Gottes
Impulse eines unbeugsamen Reformators
Patmos Verlag
Inhalt
Vorwort
Jan Hus und sein prophetisches Charisma
Bischöfe als Aufseher
Warum Dogmen?
Ins eigene Herz schauen
Wollte Jesus Sakramente?
Streitpunkt Abendmahlslehre
Die Katharer
Christus ist das Haupt der Kirche
Prag, Jan Hus und das Konzil
Vernunft und Glaube
Freiheit und Gewissen
Wollte Hus das Martyrium?
Todsünde und Aberglaube
Jan Hus und seine Glaubensstärke
Suche nach gelebter Armut
Der Verrat am Konziliarismus
Jan Hus – ein Nationalist?
Jan Hus – Vorläufer des Existenzialismus
Jan Hus als Prediger
In Liebe gegen Hass
Die Durcharbeitung der Angst
Anhang
John Wyclif und Jan Hus in eigener Sache
John Wyclif: 45 Thesen
Jan Hus: Was ist Glauben?
Briefe
Tabellen
Luxemburger (und Habsburger)
Zeitgeschichte
Jan Hus
Das Konstanzer Konzil bis zum 6. Juli 1415
Literatur
BILD- UND TEXTNACHWEIS
Vorwort
»Wir wissen, dass es an diesem Heiligen Stuhl schon seit einigen Jahren viele gräuliche Missbräuche in geistlichen Dingen und Exzesse gegen die göttlichen Gebote gegeben hat, ja, dass eigentlich alles pervertiert worden ist. So ist es kein Wunder, wenn sich die Krankheit vom Haupt auf die Glieder, das heißt von den Päpsten auf die unteren Kirchenführer ausgebreitet hat. Wir alle – hohe Prälaten und einfache Kleriker – sind abgewichen, ein jeder sah nur auf seinen eigenen Weg, und da ist schon lange keiner mehr, der Gutes tut, auch nicht einer.« Diese schonungslose Analyse stammt nicht von dem unbequemen böhmischen Geist Jan Hus, der am 6. Juli 1415 in Konstanz als Ketzer verbrannt wurde, sondern etwa hundert Jahre später von Papst Hadrian VI. (1522–1523). Papst Hadrian beschreibt den Zustand der Kirche, vor allem der römischen Kurie, wie sie Jan Hus hundert Jahre zuvor unmissverständlich und unermüdlich vorgetragen hatte. Jan Hus erregte mit seiner Kritik und der radikalen Infragestellung der hierarchischen Strukturen den Unwillen von Papst, Kardinälen, Theologen, Fürsten und letztlich von König Sigismund, der ihm Freies Geleit zum Konzil in Konstanz zugesagt hatte – aber letztendlich sein Verssprechen brach.
In dem vorliegenden Buch erläutert der bekannte Paderborner Theologe Eugen Drewermann im Gespräch mit dem Journalisten Jürgen Hoeren, in welchem politischen, kirchengeschichtlichen und theologischen Kontext Jan Hus zu beurteilen ist. Beeinflusst von dem kritischen reformatorischen Vordenker John Wyclif entwickelt der begnadete Prediger Jan Hus eine Glaubenshaltung und ein Kirchenbild, die reformatorisch, ja revolutionär sind. Im Zentrum steht die Gestalt Jesu Christi – er und sein Wort, die Bibel, sind die einzige und entscheidende Richtschnur für das Leben. In der Epoche, in der drei Päpste gegeneinander streiten und die Christenheit spalten und verwirren, bricht für Jan Hus das künstliche und gänzlich veräußerlichte Konstrukt Kirche als unbiblisch, ungläubig und machtbesessen zusammen. Die Päpste haben aufgehört, unfehlbar und allwissend zu sein. Hus zieht die klare persönliche Konsequenz: Das einzige Oberhaupt der Kirche ist Christus. Und muss Christus sich wirklich stellvertreten lassen? Und wenn ja, durch wen?
Für Eugen Drewermann gewinnt Jan Hus im Laufe der Auseinandersetzung mit den Prager und den römischen Kirchenbehörden und dann schließlich mit der Konstanzer Konzilsversammlung ein prophetisches Format. »Die sichtbare Kirche ist so lange gut, wie sie durchsichtig bleibt, und absolut falsch, als sie sich einschließt und das Sonnenlicht Gottes nicht mehr in die Innenräume lässt. Dann hilft sie nicht mehr zum Sehen, sondern verdunkelt«, so der Paderborner Theologe. Die umstrittene Sündenlehre von Jan Hus und seine entschiedene Kritik an der Ablasspraxis stellt Drewermann in den Kontext der Dogmen- und Kirchengeschichte. Dabei greift er auch Aspekte auf, die in den Predigten und Schriften des Jan Hus kritisch zu beurteilen sind, z. B. seine Abwehr von Schönheit, die Angst vor den Frauen und seinen Hang zu Askese und moralischer Strenge.
John Wyclif und Jan Hus sind wichtige Wegbereiter für Martin Luther. Allen dreien ging es letztlich darum, den Menschen endlich Glaubensinhalte so zu vermitteln, dass sie damit sinnvoll und befreit leben können. Sie wollten im Sinne der Seelsorge die Sache Jesu so vermitteln, dass es die Glaubenden aufrichtet statt niederdrückt. Es war im Grunde ein Plädoyer für die Mündigkeit der Laien. Aus der Sicht des Psychotherapeuten ist gerade bei Jan Hus die lange persönliche Durcharbeitung der Angst zu beobachten. Er hat die Angst vor der Kirche, vor Institutionen überwunden und steht auf einem eigenständigen Fundament. Darin bündelt sich die Antwort auf die Frage: Was können wir von Jan Hus lernen? »Was wir lernen müssen, ist im Grunde, dass alles wegfallen mag, worin man sonst Vertrauen setzt – Geld, Eigentum, Macht, Karriere, das Zeugnis anderer Menschen. Übrig bleibt, sich in Christus zu verwurzeln.«
Jan Hus ist in seiner Eindeutigkeit, in seinem klaren Bekenntnis zur Wahrheit für viele Menschen auch heute noch ein Vorbild – und, so paradox es klingen mag, in seiner Kirchenkritik und Kirchenanalyse lag Jan Hus zu keiner Zeit falsch. Wenn Papst Franziskus am 22. Dezember 2014 klagt, die Kurie sei »Krankheiten, Funktionsstörungen und Gebrechen ausgesetzt …, leidet an mangelnder Selbstkritik, kaltem Bürokratismus, Scheinheiligkeit bis hin zu Gier nach weltlicher Macht und weltlichem Besitz«, dann vermag man zu erkennen, wie aktuell Jan Hus heute ist. Es lohnt sich, sich mit ihm zu beschäftigen.
Jan Hus und sein prophetisches Charisma
Jürgen Hoeren: Herr Drewermann, am 6. Juli 2015 gedenken wir des Todes von Jan Hus. Die Verbrennung in Konstanz liegt 600 Jahre zurück. Ist Jan Hus ein besonderer Ketzer oder ein Ketzer unter den vielen Ketzern?
Eugen Drewermann:Jan Hus ist absolut etwas Besonderes. Als er starb, meinte man, er sei ein vir egregius praeter fidem, ein ausgezeichneter Mann, mal abgesehen von seinem Glauben. Selbst wo man ihn gelobt hat, hat man ihn missverstanden. Jan Hus war groß durch seinen Glauben, nicht praeter fidem, sondern propter fidem. Und die ganze Perfidie lag darin, dass man ihm den Glauben abgesprochen hat. Er ist das herausragende Beispiel für ein Leben, das durch und durch prophetisch sich den Prälaten und den Priestern verweigert, sofern sie nichts wollen als Unterwerfung und Macht. Er knüpft an die Bibel an und tut das so intensiv und innig, wie er es zu tun vermag. Er ist nicht im modernen Sinn ein wissenschaftlich ausgerichteter Exeget, er ist kein großer Philosoph, aber er begreift die Bibel als ein Gotteswort an seine eigene Person. Und das möchte er als Seelsorger vermitteln. Konfrontiert ist er mit Bischöfen, die Fürsten sind, aber ganz sicher keine Seelsorger; mit Theologen, die zutiefst zerspalten sind; ausgesetzt einem Papsttum, das bis zur Karikatur selbst in Widersprüchen gefangen ist. Er ist auf der Suche nach einer Einheit, die im letzten nur im Herzen des Glaubens und des Glaubenden gefunden werden könnte. Insofern weist Jan Hus bei weitem über seine Zeit hinaus. Manche Züge lassen sich mit ihm verbinden, die von der Mündigkeit des Menschen in den Tagen der Aufklärung Ahnung schaffen. Er wird manchmal als »Theologe der Böhmen« vereinnahmt. Er ist aber nicht identisch mit der Nationenfrage. Ganz im Gegenteil. Er begreift die Botschaft Gottes als ein Anliegen für die Menschheit, für die Christenheit zumindest. Er ist eine Person, die sich in allen Anfeindungen, Verleumdungen, Kampagnen der Lüge gegen ihn, des persönlichen Verrats eine Standfestigkeit des Friedens und der Güte bewahrt hat, die immer mehr, je stärker man ihn in die Enge treibt und je dichter man ihn in Konstanz an den Scheiterhaufen bringt, in Ähnlichkeit gerät zu der Art, wie Jesus im Neuen Testament stirbt. Das ist schließlich sein Trost, seine Selbstvergewisserung, sein Vermächtnis. Die Kostbarkeit der ganzen hussitischen Bewegung ist am Ende in meinen Augen die Unitas fratrum, die Brüdergemeinde unter Peter Chelčický. Der hat als erster sich abgewendet von den Taboriten und nichts weiter mehr gewollt als die Ernstnahme der Liebe und Gewaltfreiheit.
Jürgen Hoeren: Herr Drewermann, Sie sagen, Jan Hus hatte ein prophetisches Charisma. Ist diese Prophetie, dieser prophetische Charakterzug ein Merkmal all jener unbequemen Denker der Christenheit, die man mit den Begriffen Häretiker und Ketzer be- legt?
Eugen Drewermann: In gewissem Sinne: Ja. Der Ausdruck Prophet wäre falsch verstanden, wenn man ihn identifizierte mit der Fähigkeit, Zukunft vorhersagen zu können. Wörtlich kann man das Wort Prophet zwar so übersetzen. Aber die gesamte Gestalt, mit der Propheten im Alten Testament aufstehen, verdankt sich dem Mut, das Gotteswort in der eigenen Existenz so zu leben, dass es zeichenhaft im Raum der Verkündigung verbindlich wird gegenüber den Herrschern und gegenüber dem Volk. Propheten sind nicht Volkstribune im römischen Sinne. Sie sind nicht Sozialreformer, die sich an die Spitze bestimmter gesellschaftlicher Bedürfnisse stellen. Sie haben nichts weiter im Sinn, als das menschliche Leben nach dem zu formen, was sie als den Willen Gottes begreifen. Und das absolut und unbedingt und ohne Zögern – jetzt. Wenn Zukunftswissen in den Worten von Propheten liegt, dann allenfalls darin, dass es eine Katastrophe wäre, es jetzt nicht zu begreifen. Es wäre dann zu spät. Immer brennt es deswegen den Propheten auf den Nägeln. Immer sehen sie die Welt dicht vor dem Einsturz, wenn nicht gerade im letzten Moment noch Umkehr wäre. Und je mehr sie über den bestehenden Zustand nachdenken, desto radikaler werden auch in der eigenen Verkündigung ihre Worte. Man hört in aller Regel nicht auf sie, man schikaniert sie, so gut man kann, man macht sie lächerlich, sperrt sie weg, bringt sie um. Je ärger die Zeitläufte werden, desto klarer wird, dass es nicht mit einer Reform an dieser oder jener Stelle getan ist. – Es ist so ähnlich, wie wenn wir heute über den Kapitalismus reden; da nützt es nichts zu sagen: Wir müssen aber die Renten ein bisschen aufstocken oder Mindestlohn zahlen oder die Banken etwas kontrollieren. Es geht zu wie bei Adorno: Man kann im Falschen nichts richtig machen. Das sehen die Propheten. Und letztlich geht es um die Änderung der ganzen Welt. Alles steht auf dem Spiel, das ganze Leben. Und dementsprechend gefährlich sind Propheten den Verwaltern des Bestehenden in allen Zeiten. Nur mit diesem Anspruch ist im christlichen Sinne der Prophet aus Nazaret zu verstehen.
Jürgen Hoeren: Nun beruft sich Hus vor allem auf den Propheten Ezechiel, der gegen die Verschmutzung und die Verunreinigung des Tempels gewettert hat. Warum wählt Jan Hus gerade diese Vorbildgestalt des Alten Testaments?
Eugen Drewermann:Ezechiel ist deswegen eine spannende Gestalt, weil er eigentlich Priester war und, verschleppt nach Babylon, dies nicht mehr sein durfte. Er hat davon geträumt, dass der Tempel wieder aufgebaut würde. Das ist seine große Vision, die den Tempel, den neu geschaffenen, fast in eins setzt mit dem wiedererstandenen Paradies. Da sind vier Ströme, die die Erde durchtränken, die die Wüste wiederbeleben (Ez 47,1–12). Und das alles soll geschehen im Namen Gottes. Daraus jedoch ist gerade in den Texten des Propheten Ezechiel eine Art Possenstück geworden. Die Priester sind darüber hergegangen und haben sich vorgestellt, wie Gott in den neuen Tempel Einzug hält von der Ostseite her mit dem Sonnenaufgang. Dann, wenn Gott im Tempel ist, wird man die Ostseite verschließen, und nun ist Gott im Tempel eingesperrt (Ez 44,2). Er ist gewissermaßen der Gefangene der Priesterschaft. Jan Hus hat diese Travestie des Ezechiel nicht aus den Texten herausgelesen. Dazu muss man die Lupe nehmen und die Brüche in der Darstellung der Tempelvision des Ezechiel herausarbeiten. Aber richtig begriffen hat er, dass man Prophet sein muss, selbst wenn man daran gehindert ist, Priester zu sein. Jan Hus war Priester, aber immer wieder unter dem Verbot, als Priester handeln zu dürfen. Worauf er unbedingt bestanden hat, ist die Freiheit der Rede, Prediger zu sein und in dem Sinne Prophet zu sein, sogar gegen den Einspruch der Kirche. Das wird ihm immer wieder – auch in Konstanz – vorgeworfen. Denn schließlich: Er hat sich um das Verbot, das Interdikt, nicht gekümmert, er hat einfach weiter geredet. Das war seine Art der Treue Gottes: Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen, so steht es im 5. Kapitel der Apostelgeschichte.
Jürgen Hoeren: Und Augustinus …
Eugen Drewermann: Im Hintergrund steht Augustinus. Aber das ist eine eigene Geschichte, die schon die Brüche der gesamten abendländischen Kirchengeschichte vorwegnimmt. Auch Hieronymus ist eine große Gestalt für ihn, ebenso Chrysostomus, der Prediger der Armut; und zudem die Betonung der Innerlichkeit, die er ganz sicher bei Augustinus findet, die Worte von der Gnade, durch welche die Theologie des Augustinus geprägt ist. Aber da ist auch manches schillernd. Wir werden gleich noch unbedingt über das Erbe des Augustinus als Manichäer zu sprechen kommen.
Jürgen Hoeren: Aber Hus und seine Vorgänger, wie Wyclif, Abaelard und andere, stehen ja in einer Tradition. Es gab ja schon im dritten Jahrhundert eine prophetische Bewegung, die Montanisten. Und es waren ja auch Laien, die im Grunde das forderten und praktizierten, was Hus zwölfhundert Jahre später forderte.
Eugen Drewermann: Sie haben völlig recht. Hus ist im Grunde der unglückliche Erbe einer Vielzahl nicht gelöster, unterdrückter und mit Gewalt verdrängter Probleme der Kirchengeschichte. Eine Frage lautet: Was ist Glaube? Schauen wir auf die Person Jesu, so hat er keine neue Religion gegründet, keine neuen Dogmen eingerichtet, keine kirchliche Institution gewollt, er hat nicht eine Beamtenschaft gegen die Sadduzäer seiner Zeit einrichten wollen. Er wollte die Erneuerung des Volks der Erwählung von innen her, sodass niemand mehr ausgeschlossen würde, auch nicht die sogenannten Sünder, die Verlorenen, die Verlaufenen. Denen nachzugehen, sie alle zu integrieren unter den Händen Gottes, das war das Bemühen Jesu. Damit geriet er – wie man weiß – sehr bald über Kreuz mit den Schriftgelehrten, die ihre Tora-Treue in Gefahr sahen, mit der Priesterschaft, die ihre Pfründe bedroht sah, auch damals schon. Wenn ein Vertrauen ist zu Gott, das bedingungslos sich geschenkt fühlt als Geschöpf aus den Händen Gottes, braucht es keine Priester mehr, die mittels bestimmter Opferpraktiken und Ritualkenntnisse die Menschen mit dem Allerhöchsten vermitteln müssten, damit Sündenvergebung sei. Es ist nicht möglich, gleichzeitig im Sinne Jesu das Vaterunser zu beten wie ein Kind: »Alles musst du uns vergeben, weil wir sonst nicht leben könnten« – frei übersetzt – und dann in den Tempel zu gehen und alle möglichen Tiere schlachten zu lassen, damit im Blut- und Fettdampf Gott zu den Menschen gnädig würde. Opfer setzen Angst voraus, sie fördern die Ambivalenz des Gottesbildes. All das erübrigt Jesus in einer persönlichen Haltung des Vertrauens. Aus dem, was Jesus in dieser Weise lebt und was ihn schon gefährlich in Widerspruch bringt zu den Schriftgelehrten und dem sadduzäischen Priestertum, wird in gewisser Weise Jesus wieder weggenommen, indem man das hebräische Glauben als Vertrauen im griechischen Sinne übersetzt mit Fürwahrhalten bestimmter Inhalte. Jesus mochte, dass wir Gott glauben, im Akkusativ wie im Dativ, an seine Existenz und all dem, was er sagt. Daraus wird in der kirchlichen Doktrin ein Glauben bezogen auf bestimmte Lehrinhalte, die man theologisch ausformuliert. Man macht Jesus zum Gegenstand einer immer komplexer werdenden Lehre. Damit hat man nun einen Glauben, der in der Korrektheit des Nachsprechens der dogmatisch vorgegebenen Lehrinhalte liegt. Ein solcher Glaube rückt immer weiter weg von der persönlich gelebten Existenzform. Es spalten sich geradezu das Leben des Einzelnen und das kollektiv verordnete Bekenntnis der Kirche.
Bischöfe als Aufseher
Jürgen Hoeren: Herr Drewermann, haben denn die Jünger Jesu das Anliegen Jesu begriffen, wie sie es geschildert haben: nämlich den Gottesglauben und nur den allein – ohne Mittler, ohne Vermittler, ohne Hierarchie, ohne Ämter?
Eugen Drewermann: Wir haben es bei den Jüngern Jesu mit Juden zu tun, das dürfen wir nie übersehen. Natürlich haben sie begriffen, dass Glaube – hebräisch emuna – nichts anderes sein kann als Vertrauen. Erst unter dem Einfluss griechisch sprechender hellenistischer Christen ist allerdings sehr bald aus der Person Jesu eine Kultgottheit geworden mit einer sehr komplizierten Lehrvorstellung, die ihn beschreibt als den Gottessohn. Auf diese Probleme der Christologie müssen wir unbedingt noch eingehen. Aber es liegt in der ganzen Entwicklung noch ein zweiter Schritt: Wenn die Orthodoxie sich abspaltet von der Existenzform, braucht es Kontrolleure der richtigen Lehre. In Glaubensfragen kann man so gut wie niemals derart strikt argumentieren, dass aus der Logik der Beweisführung das Ergebnis ein für alle Mal abzuleiten wäre. Es liegt in jedem Dogma eine Form von Gewalt, mit dem Versuch, alle anderen Denkmöglichkeiten unter Verbot zu stellen. Diese Kontrolleure des richtigen Glaubens stehen bestimmten Ämtern vor, sie fühlen sich in der Pflicht der Verantwortung, die Richtigkeit der Lehrtradition zu kontrollieren. Und da nun haben wir das Eigentümliche, dass speziell die Bischöfe, die Episkopoi, die Aufseher wörtlich übersetzt, ein Amt bekleiden, dem sie solche göttliche Unfehlbarkeit und den Besitz der Wahrheit zusprechen. Wie sie selbst leben, ist schon nicht mehr gar so wichtig, verglichen mit der Frage, welch ein Amt sie bekleiden. Das Göttliche, das Gnadenhafte, das Wahre liegt fortan im Amt, unabhängig von der Person. Nun haben wir schon im zweiten Jahrhundert den Konflikt der Montanisten in Kleinasien. Montanus will nicht länger diese Aufspaltung zwischen Funktion und Person. Es bildet sich eine große Bewegung, die darauf pocht: Es darf jemand im Raum der christlichen Kirche Sakramente nur spenden, Verkündigung nur tätigen, wenn er mit seiner Person in Wahrhaftigkeit, nicht in formaler Lehrwahrheit, sondern in persönlicher Identität dahinter steht, so wie die Propheten einmal. Auch die besaßen eigentlich nur die Resonanzbühne ihres eigenen Herzens und ihres persönlichen Lebens. Und genau das erwartet man jetzt auch von dem, was man einen Priester nennt. Unterhalb davon wird es, meint man, schizophren. Der Streit geht noch ein Jahrhundert, vor allem in Nordafrika, weiter. Man will in Karthago einen Bischof einsetzen, Cäcilian, der auf eine Weise lebt, dass es skandalös ist. Man lehnt ihn als Bischof ab und setzt stattdessen Donatus als Bischof ein. Daraus entsteht eine eigene Gruppierung, die Donatisten. Es sind die allerletzten, die noch einmal betonen, dass man Leben und Glauben voneinander nicht trennen darf. Es ist bedauerlicherweise Augustinus, der die Donatisten in einen heftigen Streit verwickelt und kirchenpolitisch ausschaltet. Auch das ist ein Erbe des Bischofs von Hippo in der Kirchengeschichte. Er, der der Vater existenzieller Lyrik in der christlichen Literatur genannt zu werden verdient, wendet sich paradoxerweise im Interesse der Kirchenzucht gegen diesen in seinen Augen übertriebenen Subjektivismus der Donatisten und davor der Montanisten. Tertulian – um 200 – gilt als Montanist und hat in entsprechender Radikalität geschrieben, zum Beispiel über die Unmöglichkeit, dass Christen Militärdienst leisten. Da sind die Dinge scheinbar noch klar. In den Tagen des Augustinus aber ist das alles andere als klar. Da ist inzwischen die konstantinische Wende eingetreten, und die großen Theologen müssen versuchen, mit den dadurch entstandenen Widersprüchen klarzukommen.
Jürgen Hoeren: Herr Drewermann, bleiben wir noch bei den Montanisten; sie hatten aber doch auch einen sehr schwärmerischen Zug. Sie glaubten ja, dass das neue Jerusalem bald kommen würde. Sie ließen sich in der heutigen Türkei nieder, in einer kargen Ebene. Sie rechneten damit, das neue Jerusalem komme bald. Und sie kannten auch Prophetinnen mit besonderer Gabe, die sehr engagiert – um es einfach zu sagen – predigten. Waren das Ansätze, die Sie als »richtigen Weg« bezeichnen würden?
Eugen Drewermann: So sind Propheten, so sind Mystiker, so sind religiös glühende Existenzen. Das Gottesreich kommt nicht irgendwo, sondern es kommt in Phrygien, da wo die Montanisten leben. Immer da, wo sie sie selbst sind, geschieht das Eigentliche. Und sie sind ungeduldig. Es ist unter dem Druck des Leids an einer verkehrten Welt nicht anders möglich, als das Anliegen Christi auf den Nägeln brennen zu spüren. Alles mussjetzt kommen, es duldet keinen Aufschub. Das gehört mit zu der prophetischen Existenz, so wie Jesus selbst sie verkörpert. Zugegeben: Dieses Schwärmertum ist ohne Zweifel auch das Bedenkliche, denn wenn es mit zu viel Angst sich selbst durchsetzt, kann es die Züge des Fanatischen annehmen und mehr Schaden als Nutzen stiften. Deshalb ist ein Gegengewicht des normativ Zügelnden schon erforderlich, aber dieses Gegengewicht müsste eines der Güte sein, der Toleranz, des menschlichen Umgangs. Man müsste die Punkte, an denen die Visionäre leiden, aufgreifen und sie mit ihnen gemeinsam durchgehen. Dann würde sich der Furor temperieren lassen.
Jürgen Hoeren: Aber diese Leute setzen sich als verbindlich, indem sie sehr asketisch leben, auf Sexualität verzichten, das Armutsideal geradezu übersteigern, geradezu fanatisch leben …
Eugen Drewermann: Damit greifen sie das, was Jan Hus 1200 Jahre später will, bereits auf; das geht in gerader Linie weiter. Aber sie greifen vor allen Dingen 200 Jahre zurück. Denn die Person Jesu wollte ohne Zweifel genau dies: ein Visionär sein, der in Armut unter radikalem Machtverzicht lebt. Wenn wir den Mann aus Nazaret als Erlöser begreifen, dann müssten wir die bürgerlichen Begriffe von Grund auf umprägen. Beginnen wir nur mit dem Zentralbegriff der Verehrung Jesu: Er ist der Sohn Gottes, sagt das Dogma. In den Weihnachtstagen wird das Ereignis seiner Ankunft begangen, wie über dem Feld der Hirten die Engel davon sprechen, Gott habe Herrlichkeit im Himmel nur, wenn auf Erden Friede sei bei den Menschen – ich übersetze die Stelle ein bisschen frei –, die an Gnade glauben können und auf Gewalt verzichten. Wenn das so ist, ist die gesamte Weihnachtsbotschaft das Gegenprogramm zur sogenannten Friedenspolitik des Kaisers Augustus. Es geht bis in die mythologische Sprache hinein. Der Gründer Roms, Romulus, wurde geboren von Rhea Silvia, einer Vestalin, die keinen Mann berühren durfte, und vom Gott Mars, vom Kriegsgott. So kam Romulus zur Welt, ein Gotteskind. Und auch das Julisch-Claudische Kaiserhaus trat durch die Göttin Aphrodite, die von Anchises den Äneas gebar, in die Geschichte ein. Gotteskinder sind also die Gründer Roms und die Herrscher Roms. Und sogar deren Ende ist danach: Romulus stirbt, indem er auf dem Marsfeld eine Militärparade abnimmt und dann unter Donner zum Himmel auffährt. Lukas steht nicht an, die Geschichte Jesu in genau diesen beiden Spannungen zu erzählen: die Geburt Jesu in Betlehem bereits als Kontrastprogramm zu Romulus, und das Ende des Jesus genauso als Kontrast zu Romulus. Jesus fährt im ersten Kapitel der Apostelgeschichte zum Himmel auf. Und das stellt jeden, der Jesus anschaut, vor die Frage, wen er für den wahren Gottessohn hält. Das Mysterium ist nicht, dass es Gottessöhne gibt – das Mysteriöse macht erst das Kirchendogma aus dem Mythischen in fast gespenstischer Weise mit metaphysischen Begrifflichkeiten, die alle erst einmal zurechtgebogen werden müssen, um begreifbar zu werden. Für die antike Welt sind Gottessöhne etwas ganz Normales. Die Frage ist also: Wen halten wir für einen Gottessohn und mit welchen Konsequenzen? Glauben wir daran, dass Cäsar oder Augustus Götter sind, Gottessöhne? Die waren groß – ohne Frage. Cäsar immerhin hat eineinhalb Millionen Gallier ermordet, nur um die Macht in Rom zu erlangen. Groß! Er hat alle Schlachten gewonnen, gegen Pompejus später sogar den Bürgerkrieg – ganz groß. Aber lesen wir Lukas, müssten wir sagen: Er ist winzig klein. Er ist gemein. Darauf hinaus läuft sogar das Ende aller Reden, die Jesus im Lukasevangelium hält, im Abendmahlssaal – auch das ein Thema, das dann für Jan Hus sehr wichtig wird: Wie feiert man das Abendmahl? – Da diskutieren die Jünger über genau diesen Punkt: Was halten wir für groß? (Lk 22,24) Und Jesus antwortet: Die da auf den Thronen sitzen, willküren herab auf ihre Untertanen und nennen sich dafür Wohltäter. Bei euch nicht so (Mk 10,42–43). Man müsste das Gemeinte jetzt frei wiedergeben und sagen: Wenn ihr euch niederbeugt zu den Kleinsten und euch fragt, wie ihr denen aufhelft, dann seid ihr wirklich groß. Mit anderen Worten: Wir haben einen Begriff aus der Antike, einen Begriff aus der altorientalischen Königstheologie oder Mythologie übernommen, indem wir Jesus den Gottessohn nennen. Das erklärt, warum er als König, als Messias, als Christus definiert wird in theologischer Überlieferung. Aber was wir in Wahrheit vor uns haben, ist ja nicht nur die Entwicklung der Mythologie ins christliche Dogma. Viel wichtiger ist die Umprägung all der mythologisch tradierten Begriffe durch die Person Jesu und sein Vorbild. Dann können wir sagen: Wir glauben Jesus als den König, wenn wir anfangen, so zu leben, wie er es wollte. Und das heißt: Wir brauchen keine Macht mehr, wir brauchen dazu nicht mehr viel Geld, wir fragen nicht länger nach äußerem Erfolg, wir fragen simpel: Welche Dinge stimmen vor Gott? Was hilft zum Leben? Wo setzen wir Vertrauen gegen Angst? Wie gehen wir mit Kranken so um, dass sie sich wieder auf die eigenen Füße gestellt fühlen? Das sind die Wunder Jesu, und daran anknüpfen möchte man bei all denen, die ihn ernst nehmen.
Warum Dogmen?
Jürgen Hoeren: Aber damit sind wir bei der zentralen Frage: Gottes Sohn? Jesus verlässt die Welt, verspricht, er kommt wieder, errichtet eine neue Gottesherrschaft, und wenn er wiederkommt, dann gibt es – wie Sie gesagt haben – den Friedensfürsten, das Reich des Friedens, der Messias kommt. Und diese Situation – die Jünger nahmen das Versprechen, diese Vision als Realität, als reales Versprechen – tritt nicht ein. Und dann steht man vor der großen Frage: Was war er denn nun? War er Menschensohn? War er wirklich Gottessohn? Oder ist er nur Gott ähnlich oder nur ein Prophet? Ist Maria, seine Mutter, eine Frau, eine besondere Frau oder wirklich eine Gottesgebärerin?
Eugen Drewermann: Das sind sehr bald die Fragen des Dogmas. Und man muss alle diese Begriffe, die uns in der christlichen Lehre wie vertraut scheinen, noch einmal zurückführen auf ihren Ursprung. Wenn wir Jesus als den König bezeichnen, liegt das daran, dass mit ihm die Hoffnung verbunden wurde, er werde das davidische Königreich aufrichten. Das waren nationaltheologische Großmachtträume, die in Israel seit den Tagen der Makkabäer im Schwange waren, also seit 163 vor Christus. Und man erwartete, wenn jemand messianische Züge gewinnt in der Betrachtung des Volkes, dass er diese Hoffnung einlöse. Jesus aber machte daraus die vollkommene Travestie. Als er in Jerusalem einzieht, wie wenn er von der heiligen Stadt selbst für Gott in Königsmacht Besitz ergreifen wollte, stellt er nicht die Aufrichtung des davidischen Großreichs dar, sondern – wenn überhaupt – aktualisiert er eine Stelle aus dem neunten Kapitel des Propheten Sacharja: Wenn denn der Messias kommt, – so die allerdings im ganzen Alten Testament singuläre Vision –, wird er als allererstes die Kriegswagen verbrennen und die Bogen zerbrechen. Das erste also ist eine absolute Friedensmaßnahme einseitiger Abrüstung. Jedem, der heute die Zeitung liest, werden die Ohren klingeln unter dem Diktat, dass wir den Frieden nur als die Mächtigen den restlichen Bösewichtern diktieren könnten; denn wir sind die Guten, und zu denen müssen wir jene erst einmal machen, und da sie das freiwillig nicht wollen, müssen sie es lernen, indem wir sie militärisch niederringen. So ist das übliche Denken bis heute. Aber: Für Jesus kommt der Friede nicht aus dem Diktat der Gewalt. Deshalb ist ihm Sacharja an dieser Stelle entscheidend: Die Schockwelle einer einseitigen Abrüstung wird sein, dass die umliegenden Staaten ebenfalls abrüsten – keiner mehr bedroht den anderen. – Das ist eine Situation, wie wir sie zeitgeschichtlich allen Ernstes 1989 hätten haben können: Beim Zusammenbruch des Warschauer Paktes gab es das Angebot einer entmilitarisierten Zone vom Ural bis zum Atlantik. Aber wir wollten weiter unsere Großmachtträume pflegen, und auch die Kirchen hatten dagegen offensichtlich keinen Einspruch. Wieder sehen wir, dass, wenn man von Jesus als dem König redet, man die Person Jesu benutzen muss, um den Inhalt dieses Königtums gegen die übliche Vorstellung von Königsmacht zu setzen. Jesus enttäuscht in gewissem Sinne die Frommen, die ihn auf ihre Weise als König betrachten.
Nun gehört zum Königsbegriff die Vorstellung der Alten Ägypter von der Gottessohnschaft. Wer das genauer studieren will, der muss nur einmal nach München reisen; in der neuen ägyptologischen Museumsausstellung findet er dort um 2400 vor Christus eine Doppelstatue des Ni-user-Ra (Ihm gehört die Macht der Sonne, könnte man das übersetzen). Da sieht man in seiner Person einmal die menschliche Gestalt des Pharao: älter geworden, schwächer, und daneben die ewige Gestalt: zeitenthoben, in unkorrumpierbarer Jugendlichkeit. Und beide Gestalten, die menschliche und die göttliche, die zeitliche und die ewige, vereinigen sich in der Person des Pharao, wohlgemerkt nicht, weil er metaphysisch Gott wäre, sondern weil er durch sein Amt am Tage der Thronbesteigung zum Repräsentanten der Sonne am Himmel wird. Und das projiziert man zurück in den Anfang: Fortan kann man ihn nicht länger mehr erklären als Sohn irdischer Eltern, sondern nur noch dadurch, dass der Gott Amun-Re zur Königsmutter kam und mit ihr diesen seinen Sohn zeugte. So steht es denn auch im Psalm 110: »Heute habe ich dich gezeugt«. Das sind die Worte, die aus dem alten Ägypten auf die Psalmengebete Einfluss nehmen und sich dann auf David beziehen und auf seine Nachfolger. Im Judentum freilich glaubte man diese Worte allenfalls metaphorisch; solche Vorstellungen waren gerade noch am Rande dessen geduldet, was der Herrscherkult im alten Orient auf biblischem Niveau zuließ.
Man darf solche Aussagen aber um Himmels willen nicht metaphysisch nehmen. Doch genau das geschieht in der jüdischen Diaspora, in Ägypten. Und das einfachste Beispiel dafür ist die Übersetzung von Jesaja 6 und 7. Da verheißt der Prophet, es werde ein junges Mädchen gebären, und das Kind, das sie zur Welt bringe, werde das Ende des Hauses Achas sein. Die ganze Dynastie werde von Gott zerschmettert werden durch einen Neuanfang. Eben dies wird verheißen vom Propheten. Daraus aber wird in der griechischen Übersetzung, in der Septuaginta, die Formulierung »die Jungfrau wird gebären«. Das ist eine Heilsweissagung, nicht mehr eine Strafdrohung des Propheten, und daraus wird eine christologisch interpretierte Aussage, wie die »Jungfrau« den Gottessohn gebären wird. Im alten Ägypten hat man sich nie darum gekümmert, in welchem Zustand die Königsmutter befindlich war; die jungfräuliche Geburt war nie das Thema der Ägypter. Es ging darum, das Wesen des Pharaos als des Herrschers über die beiden Länder von Unter- und Oberägypten zu beschreiben. Natürlich fährt der Pharao im Tode auch zum Himmel auf. Das alles ist viel, viel älter, als es den Römern dann in der Romulus-Legende zu Papier kam.
Mit anderen Worten: Wir müssten die Bilder, mit denen man Jesus im Neuen Testament als Gottessohn zu beschreiben sucht, in ihrer historischen Bedingtheit relativieren. Das Absolute des Christlichen liegt nicht in den Begriffen. Die sind uralt, weit länger vor Christus als wir heute danach sind. Wie sie durch die Person Jesu neu interpretiert werden, ist das Neue, das wirklich Revolutionäre, das dem Frieden und der Menschlichkeit Dienende. Stattdessen flüchten wir uns dogmatisch in die Begriffe, metaphysizieren sie und nehmen deren Rezitation schon als Beweis des Glaubens; und dann können wir eigentlich leben, wie wir wollen.
Jürgen Hoeren: Dann war das Konzil von Nicäa 325 eine Versammlung von Menschen, die die kulturgeschichtlichen Wurzeln dessen, was sie dort diskutierten, nämlich Gottessohn – Menschensohn, nicht mehr begriffen hatten, nicht mehr präsent hatten?
Eugen Drewermann: Ärger noch: die es gar nicht mehr wissen wollten.
Jürgen Hoeren: Oder nicht mehr wissen konnten?
Eugen Drewermann: Nicht mehr wissen durften. Man sah natürlich, dass vieles von dem, was man inzwischen von Christus sagte, sehr ähnlich ist dem, was auch die sogenannten Heiden sich erzählten. Aber der Unterschied sollte jetzt darin gelegen sein, dass die Heiden Mythen überliefern, die der Teufel schon vorweg erfunden habe, damit es möglichst schwierig werde, Jesus in seiner Einzigartigkeit zu erkennen, und einzigartig wahr sollte die Gestalt Jesu sein, weil er geschichtlich war. Man setzte die Wahrheit des Christlichen in die Historie und setzte diese in den Gegensatz zum Mythischen. Nach allem, was wir bisher gesagt haben, läge die Wahrheit eigentlich darin, dass man die Uminterpretation der Bilder, mit denen man Jesus deutete, für die wahre Form des Lebens nähme. Stattdessen aber wurde jetzt ein historisches Faktum zum Glauben erhoben, und zwar in der Art vorgeschrieben, dass Jesus wirklich das Kind einer Jungfrau sei und dass er wirklich physisch und metaphysisch Gott sei.
Dieser Deutungsansatz entfernt sich vollkommen von der Art, wie man Mythen interpretieren müsste. Man hat jetzt nicht mehr Bilder vor sich, man hat Begriffe, die sogar unter sich in Konkurrenz gehen; die Interpretation dieser Begriffe, in die man die mythischen Bilder zur Deutung der Person Jesu verwandelt hat, kann niemals ohne Widersprüche sein.
Der Begriff »Menschensohn« zum Beispiel, den Sie eben kurz erwähnten, stammt aus der Apokalyptik. Er ist vermutlich von Jesus selbst gebraucht worden und meint die Gestalt des Menschen am Throne Gottes in den Tagen der Endzeit. Sagen wir weniger mythologisch: Er ist die Gestalt, auf die wir schauen sollten, wenn wir uns fragen, wie wir ein für alle Mal richtig leben. So etwas wollte uns Jesus im Vorgriff zeigen, und so hat er dann auch geglaubt, dass in seinen Tagen, im Raum seiner Verkündigung, sich diese Entscheidung für das, was gilt vor Gott, zutragen würde. Wie lang die Welt existiert, war im Grunde nicht das Problem Jesu, aber er dachte wie selbstverständlich in der apokalyptischen Tradition: Lange kann dieser Weltenzustand, ohne dass er kollabiert, sich selbst nicht ertragen. Der Mann aus Nazaret hat ganz sicher nicht den Planeten Erde mit astronomischen Zeitmaßen betrachtet. Man sollte das Ausbleiben der Naherwartung deshalb nicht so dramatisch nehmen, wie es gern geschieht. Der französische Exeget und Religionswissenschaftler Alfred Loisy (1857–1940) hat um 1900 einmal simpel gesagt: »Jesus verkündete das Reich Gottes, und gekommen ist die Kirche.« Das ist goldrichtig. Aber würde man bei dem bleiben, was Jesus wollte, und damit Kirche identifizieren, hätte es eine gerade Entwicklung geben können statt des unglaublichen Bruchs, den wir mit der Machtergreifung Konstantins verbinden. Wir müssen nur einmal sehen, wie um 312 in der Schlacht an der Milvischen Brücke Konstantin gegen seinen Widersacher Maxentius zu Felde geht. Er stand vor der Entscheidung: Regiert man mit den sogenannten Heiden oder mit den immer stärker werdenden Gruppierungen der Christen? Konstantin entschied sich für die Christen und ließ seine Soldateska mit dem Emblem des Kreuzes aufmarschieren – wenn denn das so war und ihm nicht nur zugeschrieben wird. Glauben sollen wir, dass er selbst die Vision hatte, im Zeichen des ☧ Chi-Rho, des Christus, werde man siegen. Konstantinhat gesiegt, aber es ist das erste Mal, dass man aus Christus einen Schlachtenlenkergott gemacht hat, ungefähr so, wie wenn er Zeus oder Wotan wäre. Zweifellos ist das das absolute Gegenstück zu dem, was Jesus wollte. Und weil Konstantin das Reich eint zwischen Byzanz und Rom, weil er der mächtigste Mann der Welt ist und weil er vorbereitet, dass sein Nachfolger das Christentum zur Staatsreligion erhebt, findet er begeisterte Theologen, die diesen dramatischen Wandel – ich stehe nicht an zu sagen: diese unglaubliche Perversion – aus vollem Herzen rechtfertigen, begrüßen und dem Volke vorschreiben. Im Zuge dessen entsteht 325 das von Ihnen erwähnte Nicänische Konzil – einberufen vom Kaiser, die Bischöfe gewissermaßen als seine Staatsbeamten – mit dem Ziel, nicht Theologie zu verfeinern, sondern eine ideologische, homogene Basis zur Herrschaft zu gewinnen. – Denn die Christen waren zersplittert. Wenn sie von Christus reden als Sohn Gottes, wie soll man das verstehen? Ist er zum Sohn Gottes geworden wie der Pharao durch Thronbesteigung, und wann hätte sie stattgefunden? Paulus kann noch sagen: Durch seinen Tod und seine Auferstehung ist Jesus zum Messias, zum König gemacht worden (Röm 1,4). Gilt diese Vorstellung, so wäre Jesus überhaupt erst in dem Bild seiner Himmelfahrt zum Gottessohn geworden, er wäre nicht von Anfang an als Gott zur Welt gekommen. Über derlei Dinge kann man diskutieren. Oder war er ein Geschöpft Gottes, das womöglich in allerhöchster Ähnlichkeit zu Gott war, vielleicht das größte aller Geschöpfe? Doch wie wäre das zu verstehen? Ist der Sohn Gottes erst geworden in der Person des historischen Jesus oder war er es immer, von Ewigkeit her in der Gottheit selbst schon? Es wird immer komplizierter. Und um diese ganzen Streitereien in eine Einheit zu bringen, damit das Christentum als Hilfsmittel zur Regierung taugt und überhaupt selbst regierbar wird, braucht man eine Klarstellung.
Jürgen Hoeren: Und die Klarstellung traf der Kaiser, der noch nicht einmal getauft war, noch nicht einmal ein Katechumenat gemacht hatte?
Eugen Drewermann: Und der keine Ahnung hatte von den Fragen, um die es ging. Er hatte ursprünglich verstanden, dass die Arianer Recht haben sollten, und schon ließ er verkünden, dass sie recht hätten: Christus ist ein Geschöpf Gottes, wie Arius es lehrte. Dann aber stürmten die Konzilsväter der Gegenpartei den Palast und sagten: Nein, genau umgekehrt. Also war es genau umgekehrt. Und so ist es denn geblieben. Konstantin war es im Grunde genommen egal, woran die Christen glaubten, wenn sie nur einheitlich an etwas glaubten. Wir haben also jetzt um 325 eine Kirche, die zunehmend ihre eigenen Leiter, die gesamte Hierarchie, als Staatsbeamte definiert. – Das ist ein Zustand, den wir im übrigen vor allem in Deutschland bis heute beibehalten haben: Ein Bischof muss als erstes, damit er seinen Amtsantritt vollziehen kann, auf die Verfassung schwören. Er wird bezahlt vom Staat, und er ist gebunden daran, nichts im Staat infrage zu stellen, jedenfalls nicht grundsätzlich. Kann er die Bundeswehr in ihrer Legitimation anzweifeln? Sie ist ein Verfassungsorgan – also kann er nicht! Er hat auf die Verfassung geschworen. Unmöglich also, dass er da noch Skrupel hätte! Das alles ist bis heute eigentlich ohne große Änderung seit dem vierten Jahrhundert so geblieben, außer, dass es von der Öffentlichkeit nicht mehr so krass gesehen wird, wie es funktioniert. Doch nehmen wir dafür nur den historischen Hintergrund: Spätestens seit 1648 haben wir uns im Westfälischen Frieden darauf geeinigt, dass die Fürsten bestimmen, welche Theologen an ihren Universitäten lehren – katholisch oder protestantisch – und dass in ihrem Regierungsbezirk die Gläubigen das glauben, was der Fürst verordnet: cuius regio, eius et religio. Der Fürst entscheidet, und zwar in Macht, was der Glaube Gottes zu sein hat. Das ist ein christliches Possenstück ohne Ende. Aber es beginnt bereits im Jahre 312 und setzt sich so fort im Jahre 325 mit dem ersten ökumenischen Dogma über das Wesen Gottes und das Wesen Christi.
Ins eigene Herz schauen
Jürgen Hoeren: 312 beginnt es, und wir haben Jan Hus für uns ins Zentrum der daraus folgenden Entwicklung gestellt. Warum wurde dann für die nachfolgende Bewegung der sogenannten Ketzer und Häretiker, wie Waldes oder Abaelard oder eben auch Wyclif und Jan Hus, warum wurde es für diese Menschen dann so wichtig, das Evangelium, das Alte und Neue Testament, in ihrer Landessprache zu lesen, zu publizieren und zu verkünden?
Eugen Drewermann: Dies ist tatsächlich erstaunlich. Es hat immer wieder den Versuch gegeben, Christus nachzufolgen. Da darf man die Ordensbewegungen nicht ausschließen. Sie haben versucht, vor allem in Ägypten im vierten Jahrhundert, eine Alternative zur verfassten Ordnung zu bieten.
Jürgen Hoeren: Die Wüstenväter …
Eugen Drewermann: Es war ein wirklicher Exodus … die Wüstenväter, ja … Da, wo nach altägyptischer Vorstellung der Tod ist, da ziehen sie hin, um das Nichtleben der sogenannten verwalteten Kultur gegenzubesetzen.
Jürgen Hoeren: Asketen …
Eugen Drewermann: Asketen im Bestreben, die Ewigkeit zu atmen anstatt der ewigen Vergänglichkeit. Das sind außerordentliche Bewegungen, denen das Christentum zweifelsohne viel verdankt; oder nehmen Sie Benedikt von Nursia. Gleichwohl gilt: Alle asketischen Mönchsbewegungen haben in gewissem Sinne die Person Jesu gegen sich. Fest steht: Jesus wollte keine Orden. Jesus wollte, dass man im ganz normalen Leben Gott nahe ist und sich eine Lebensform bewahrt, die den Herausforderungen des Alltags standhält. Keine Ausnahme also, sondern die Durchdringung der Welt als der Sauerteig, der den Brotteig zum Gären bringt und zum Backen vorbereitet. Oder als das Salz der Erde: Das waren die Bilder Jesu. Also nicht Rückzug von der Welt, sondern Verwandlung, Erlösung der Welt. So hatte Jesus die Botschaft vom Reich Gottes verstanden. Sie ist nichts Abgespaltenes, nichts, das in ferner Zukunft kommt – sei es als Sintflut oder als Durchbruch von etwas, das wir selbst gar nicht zu tun vermögen –, sondern als eine Wirklichkeit, zu der wir jederzeit imstande sind, wenn wir die Grundlagen unserer Existenz begreifen.
Von dieser Art der Erschütterung kann man in der ersten großen Kontrastbewegung im 12. Jahrhundert in Gestalt der Katharer und der Waldenser in der Tat reden. Wir haben im Hintergrund einen Papst wie Gregor VII. Der verkörpert im elften Jahrhundert jenen Machtanspruch, den die Kirche stellt gegenüber dem Kaisertum, das sich fest etabliert hat. Die Frage ist: Wer hat Macht auf Erden zu vergeben, der Kaiser dem Papst oder der Papst dem Kaiser? Gregor VII. definiert die Struktur von Katholizismus, die wir bis heute mehr oder minder dogmatisch beibehalten haben.
Jürgen Hoeren: Und die Struktur vom Papstamt, der dictatus papae …
Eugen Drewermann: Unbedingt. Der Anspruch auf päpstliche Unfehlbarkeit beginnt nicht erst im Jahre 1870, sondern im Grunde bereits im elften Jahrhundert.
Jürgen Hoeren: Den Papst darf niemand richten.
Eugen Drewermann: So ist es. Ganz im Gegenteil. Bonifaz VIII. wird später sagen »Clericis laicos« – den Klerikern gehören die Laien und sind ihnen untertan. In diesem Durcheinander machtpolitischer ideologischer Auseinandersetzungen erlebt nun ein einfacher Kaufmann in Lyon – 1176 Petrus Waldes – eine innere Bekehrung. Er verkauft, was er hat. Er hat die Bibel so verstanden, wie er es konnte, und er versucht sie zu leben, wörtlich. In der Bibel steht etwa: »Du sollst nicht schwören« (Mt 5,33–37). Was also gibt es dann für eine Berechtigung, dass in Staat und Kirche immer wieder Menschen schwören müssen auf Dinge hin, von denen sie gar nicht wissen, ob sie sie halten können? Da sind unter Eid Versprechungen fürs ganze Leben abzuleisten. Aber wer weiß, wie das eigene Leben beschaffen sein wird? Das alles ist ein klarer Verstoß gegen das ausdrückliche Wort Jesu: »Eure Rede sei das Ja ein Ja, das Nein ein Nein, alles Weitere ist vom Teufel.« Aber was macht daraus die Kirche? Und wer ist sie, wenn sie so macht? Oder die Forderung der Armut – ganz selbstverständlich hat Jesus gesagt: »Gebt alles, was ihr habt, den Armen« (Mk 10,21). Petrus Waldes tut es und versucht es. Oder: Es steht bei Matthäus: »Wer zum Schwerte greift, wird durch das Schwert umkommen« (Mt 26,52). Also kann die Institution der Todesstrafe nicht im Christentum geduldet werden. Was aber machen dann die Herrscher? Wem stimmt die Kirche zu, wenn sie Macht delegiert zur Hinrichtung von Menschen? Das alles ist nicht zu ertragen. Ferner: Was ist mit dem Kriegsdienst? Es sind all die alten Punkte in der Botschaft Jesu, die Konstantin hier vom Tablett gewischt hat, weil er als Herrscher natürlich das Recht haben musste zu töten. Nur, das ist wirklich »heidnisch« gedacht: Wie wäre ein Kaiser Gottes Repräsentant auf Erden, wenn er nicht Herr über Leben und Tod sein dürfte? Und heidnisch ist auch ein Papsttum, das denkt, was wäre das für eine Kirche, die ihm dafür nicht die Ideologie lieferte? Petrus Waldes hingegen, als einfacher Mann, als Gründer einer wirklichen Armutsbewegung, die da mit ihm entsteht, denkt ganz simpel, fast naiv, ohne jede Auslegungskunst, und spricht sich das Recht zu, sagen zu können, was er als Wahrheit im Wort Gottes entdeckt hat. Das Recht auf Predigen durch die Laien ist für Petrus Waldes selbstverständlich. Zwei Jahre später wird er zu Papst Alexander III. gehen, doch der lacht ihn simpel aus. Man nimmt ihn nicht ernst. Alexander III. ist dabei ein gar nicht so schlechter Papst gewesen. Er konnte immerhin sagen: »Besser einen Schuldigen freisprechen als einen Unschuldigen verurteilen.« Das hätte ein warnendes Wort sein können, gemessen an dem, was hundert Jahre später in Gestalt der Inquisition das Abendland heimsuchen wird. Petrus Waldes wird in diesem Sinne noch nicht verfolgt. Er wird nur ausgegrenzt, er wird lächerlich gemacht; doch er hat auf seine Weise eine große Bewegung angestoßen, die vor allem dann im 14., 15. Jahrhundert auch in Böhmen größte Auswirkungen haben wird und die in Norditalien Restgemeinden besitzt, die bis heute noch bestehen. Und man wird mitunter, wenn man Hus nicht gleich als Wyclifiten bezeichnet, ihn zumindest als Waldenser anklagen. Und das nicht ganz zu Unrecht. In der Art von Petrus Waldes denkt später auch Jan Hus.
Jürgen Hoeren: Warum ist denn die Laienpredigt so gefährlich?
Eugen Drewermann: Das ist eine gute Frage. Die Antwort lautet simpel: Weil nach allem, was wir sagten, die Verkündigung im Raum der Religion sich an den Dogmen, die die Kirche erlassen hat, orientieren muss. Dazu braucht es als erstes Bildung, Ausbildung, unbedingt die Kenntnis von Latein, der Kirchensprache, am besten auch von Griechisch, der Sprache des Neuen Testamentes. Hebräisch ist so wichtig nicht, aber es wird in den Tagen der Reformation durch Philipp Melanchthon